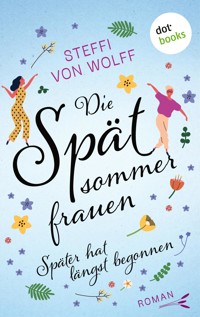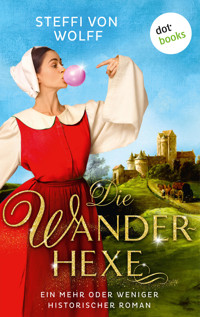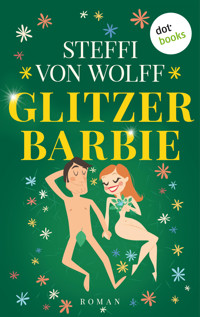4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein bisschen Rache wird ja wohl erlaubt sein! Das Comedy-Feuerwerk »Gruppen-Ex« von Bestsellerautorin Steffi von Wolff jetzt als eBook bei dotbooks. Verlieb dich nie in einen Schwindler … Als Sanni von ihrem Didgeridoo-Kurs in Australien nach Hamburg zurückkehrt, freut sie sich so sehr auf ihren Mann – doch Mark hat sie in der Zwischenzeit ohne jede Vorwarnung verlassen und noch dazu komplett ausgeraubt! Plötzlich steht Sanni mit gerade mal 8 Euro vor dem Nichts. Aber zum Glück braucht man kein Vermögen, um nach dem ersten Herzschmerz herrlichste Rachepläne zu schmieden ... zumal Sanni auch die anderen Ex-Frauen von Mark ausfindig macht. Und gemeinsam sind die Rachegöttinnen nicht zu stoppen! Keine Chance für schlechte Laune: »Wer Steffi von Wolff nicht erlebt hat, hat ganz klar was verpasst.« WAZ Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die turbulente Komödie »Gruppen-Ex« von Bestseller-Autorin Steffi von Wolff. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch:
Verlieb dich nie in einen Schwindler … Als Sanni von ihrem Didgeridoo-Kurs in Australien nach Hamburg zurückkehrt, freut sie sich so sehr auf ihren Mann – doch Mark hat sie in der Zwischenzeit ohne jede Vorwarnung verlassen und noch dazu komplett ausgeraubt! Plötzlich steht Sanni mit gerade mal 8 Euro vor dem Nichts. Aber zum Glück braucht man kein Vermögen, um nach dem ersten Herzschmerz herrlichste Rachepläne zu schmieden ... zumal Sanni auch die anderen Ex-Frauen von Mark ausfindig macht. Und gemeinsam sind die Rachegöttinnen nicht zu stoppen!
Keine Chance für schlechte Laune: »Wer Steffi von Wolff nicht erlebt hat, hat ganz klar was verpasst.« WAZ
Über die Autorin:
Steffi von Wolff, geboren 1966 in Hessen, war Reporterin, Redakteurin und Moderatorin bei verschiedenen Radiosendern. Heute arbeitet sie freiberuflich für Zeitungen und Magazine wie »Bild am Sonntag« und »Brigitte«, ist als Roman- und Sachbuch-Autorin erfolgreich und wird von vielen Fans als »Comedyqueen« gefeiert. Steffi von Wolff lebt mit ihrem Mann in Hamburg.
Die Autorin im Internet: www.facebook.com/steffivonwolff.autorin und www.steffivonwolff.de
Steffi von Wolff veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre Bestseller »Glitzerbarbie«, »ReeperWahn« und »Rostfrei«, »Fräulein Cosima erlebt ein Wunder«, »Das kleine Segelboot des Glücks«, »Der kleine Buchclub der Träume«, »Das kleine Hotel an der Nordsee«, »Das kleine Haus am Ende der Welt« und »Das kleine Appartement des Glücks« sowie die Kurzgeschichten-Sammelbände »Das kleine Liebeschaos für Glückssucher« und »Das kleine Glück im Weihnachtstrubel«. Eine andere Seite ihres Könnens zeigt Steffi von Wolff unter ihrem Pseudonym Rebecca Stephan im ebenso einfühlsamen wie bewegenden Roman »Zwei halbe Leben«.
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2021
Copyright © der Originalausgabe 2009 S. Fischer Verlag GmbH: Veröffentlicht im Fischer Taschenbuch Verlag, einem Unternehmen der S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, Memmingen, unter Verwendung eines Bildmotivs von shutterstock/small shrimp
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-906-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: info@dotbooks.de. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Gruppen-Ex« an: lesetipp@dotbooks.de (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Steffi von Wolff
Gruppen-Ex
Roman
dotbooks.
Für meine Freundin Gabriella. So halt.
Kapitel 1
»Die Vorstellung beginnt!«
Albert Camus: Caligula
Dritter Akt, erster Auftritt (Seite 47, ziemlich weit unten)
Warum geben manche Leute ihren Kindern eigentlich so komische Namen? Ich werde das nie begreifen, zumal die Neugeborenen in ihren Taufkleidchen sich ja gar nicht dagegen wehren können. Wie kommt jemand darauf, seinen Nachwuchs Titus zu nennen? Bei Titus denke ich automatisch an diesen römischen Kaiser. Ich stelle mir eine Szene vor, in der er es nicht schafft, während einer ausschweifenden Orgie Trauben so zu essen, dass ihm der Saft nicht am Kinn runterläuft – was mit daran liegt, dass er auf einer Ottomane hängt und sowieso schon viel zu viel gefressen hat, weswegen er quasi bewegungsunfähig ist. Glupschaugen und ein Völlegefühl muss ich mir beim Namen Titus ebenfalls vorstellen und eine aufgeblähte Wampe, weil der Magensaft mit dem Traubenkonsum überfordert ist und langsam zu rebellieren beginnt. Auf Blähungen und ihre Konsequenzen möchte ich gar nicht weiter eingehen.
Jedenfalls sieht ein Titus nicht aus wie dieses unsägliche, kleine Geschöpf in Menschengestalt, das eigentlich während des Fluges auf seinem Sitz bleiben sollte, es aber nicht tut. Es ist blond gelockt, schätzungsweise fünf Jahre alt und schreit seit sechs Stunden nach Bionade Ingwer-Orange und, jetzt kommt’s: nach gedünstetem Fenchelgemüse. Ist denn das zu fassen? Hätte ich das vorher gewusst, ich wäre Economy geflogen. Aber wie konnte ich ahnen, dass die Ausgeburt des Teufels mit mir in einem Flugzeug sitzt?
Die Mutter, eine relativ gelassene Frau Anfang dreißig, nimmt das alles nicht so tragisch. »Der Titus mag natürlich überhaupt kein Fenchelgemüse«, erklärt sie mir nun zum sechsten Mal. »Der Titus möchte gar nichts Gedünstetes. Er hasst gedünstete Speisen. Der Titus ist schlau. Er informiert sich vorher, was es gibt und was nicht, und dann will der Titus das haben, was es nicht gibt. Und dann macht der Titus Theater. Schau doch mal, Titus, ich hab den Laptop angemacht. Willst du nicht eine DVD gucken? Hügel der blutigen Augen vielleicht? Oder The Texas Chainsaw Massacre? Hm?«
Habe ich da richtig gehört? Sie erlaubt ihrem Sohn, der noch nicht mal in die erste Klasse geht, Filme zu schauen, die in Deutschland auf dem Index stehen? Na ja, das ist nicht meine Sache. Natürlich wäre ich eigentlich dazu verpflichtet, das Jugendamt zu informieren, aber dann würde die Mutter bestimmt behaupten, ich hätte mich verhört, und letztendlich wäre ich die Gelackmeierte. Davon mal abgesehen, will der Titus auch gar nicht DVD schauen. Er kann froh sein, dass ich von Natur aus so freundlich und zuvorkommend bin, ihn nicht einen Kopf kürzer zu machen, so wie die in den Filmen das ja gern mal tun. Dann wäre der Titus nämlich still. Jetzt reißt der Titus seiner Mutter zum x-ten Mal die Brille von der Nase, und sie bückt sich nicht etwa, nein, hilfesuchend dreht sie sich wieder halb zu mir um. Ich suche zum x-ten Mal diese verdammte Brille, die natürlich unter dem Sitz liegt, und drücke sie der Mutter in die Hand. Natürlich müsste ich das nicht tun. Aber ich bin von Natur aus ein höflicher Mensch. Zuvorkommend. Ja, auch brav. Widerworte gebe ich selten, und meistens füge ich mich meinem Schicksal. Ich weiß nicht, ob man das gut erzogen oder einfach schüchtern oder nicht selbstbewusst nennt. Aber ist das nicht auch völlig egal?
Noch eine halbe Stunde. Dann bin ich zu Hause. Bei meinem Mann. Bei Mark. Mark … ich hebe meine rechte Hand und schaue den schönen Ring an. Er ist schlicht, mein Ehering, aus Platin, aber Mark hat es sich nicht nehmen lassen, mich zusätzlich noch mit einem Beisteckring zu überraschen. Viele kleine baguetteförmige Brillanten nebeneinander. Perfekt. So perfekt wie unsere Liebe.
Während Titus dem Sitznachbarn zur Rechten das hohe C ins Ohr kreischt, weil es kein gedünstetes Fenchelgemüse gibt, schalte ich auf Durchzug und schaue aus dem Fenster. Noch fünfundzwanzig Minuten. Wir haben schon an Höhe verloren. Gleich werden wir in Hamburg landen.
Ich hieß mal Sanni Hohenfeldt, und seit genau einhundertachtzehn Tagen heiße ich Sanni Prinz. Nicht dass mir mein Nachname nicht gefallen hätte, doch, doch, aber Mark heißt nun mal Prinz, und weil ich Mark ohne Ende liebe, habe ich auf meinen Nachnamen verzichtet und den Namen Prinz angenommen, womit ich mich sehr wohlfühle.
Wenn ich die Beziehung zwischen Mark und mir mit einer Krankheit vergleichen müsste, ich würde eine heftige Sommergrippe mit Fieber und Schüttelfrost wählen, die sich irgendwann als Allergie entpuppt. Sie kommt ganz plötzlich, setzt sich fest und birgt lauter Überraschungen in sich. Man weiß nie, ob es schlimmer wird oder besser, aber eins ist sicher: Die Allergie bleibt. Ach, herrlich. Wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich niemals geglaubt, dass es mich so dermaßen heftig erwischen würde. Natürlich hatte ich Beziehungen, immerhin bin ich schon über dreißig, aber nie war es so, dass ich auch nur ansatzweise daran dachte zu heiraten. Den ersten Mann in meinem Leben hätte ich sowieso nicht heiraten können, er hieß Bubeli und war mein grüner Sittich. Als ich fünfzehn war, folgte Udo, das war zwar ein Mensch, aber die Beziehung zu ihm hielt nur knappe drei Monate. Ich bitte Sie, was ist das für ein Mann, der es emotional nicht verkraftet, alle drei Teile des Weißen Hais am Stück zu schauen und dabei Schillerlocke auf Butterbrot zu essen? Eben. Ich liebe gruselige Filme. Schon immer. Weil man den Fernseher ausschalten kann, wenns zu schlimm wird. (Nicht geeignet halte ich solche Filme allerdings für kleine Kinder, aber das ist ja, wie gesagt, nicht meine Sache.)
Die erste längere Liaison hatte ich mit Bernhard Brummer, er hieß wirklich so. Bernhard war angehender Rechtsanwalt und musste in Stresssituationen, also meistens vor Prüfungen, grundsätzlich Ausdruckstango mit weißen Klappstühlen tanzen; ich konnte dem nicht ganz folgen und gab der Beziehung deshalb keine Chance.
Ach, und den Rest der Männer kann man einfach vergessen.
Bis Mark kam.
Meine Sommergrippe. Meine lebenslange Allergie.
Ich schließe die Augen und spule den Film zum tausendsten Mal ab.
»Lass uns doch mal zum Ulmenhof radeln«, hatte Beate mir damals vorgeschlagen. Das war an einem Sonntag. Also hatten wir die Räder rausgeholt und waren losgefahren. Es war ein superschöner Frühlingstag, nicht zu heiß und nicht zu kalt. Genau richtig für eine ausgedehnte Tour mit anschließendem Einkehren in ein Gartenlokal. Auf dem Rückweg – wir waren leicht angeschickert, weil wir ein paar Gläser Weißwein getrunken hatten – gackerten wir herum und schubsten uns gegenseitig während des Fahrens. Und so trug es sich zu, dass ich ein wenig strauchelte, vom Weg abkam und mit dem Vorderrad gegen eine Wurzel knallte. Das wiederum hatte zur Folge, dass ich stürzte, und zwar aufs Steißbein. Beate, die immer noch vor sich hin kicherte, bekam von alldem nichts mit und fuhr weiter. Wer nicht weiterfuhr, war ein Mann in meinem Alter, der offenbar alleine unterwegs war, jedenfalls war niemand bei ihm.
»Hey«, war das Erste, was Mark zu mir sagte.
Ich lag da, auf dem Rücken wie ein von böser Knabenhand umgedrehter Käfer, und sagte gar nichts. Ich strampelte auch nicht mit den Beinen, sondern schwieg eine halbe Minute und brüllte dann los, weil mich eine Wespe gestochen hatte. Mark deutete das als Schockreaktion und brachte mich in die stabile Seitenlage, was aber ein Fehler war, weil ich so direkt auf dem permanent anschwellenden Stich lag.
Aber das spielte alles überhaupt keine Rolle.
Nichts spielte mehr eine Rolle.
Nichts, was vorher war.
Nur das Jetzt zählte.
Ab diesem Abend waren Mark und ich ein Paar. Es musste nicht drüber gesprochen, nichts dazu gesagt werden; es war einfach so.
Es war das Wunder meines Lebens.
Jedes Mal, wenn ich am Flughafen vor diesen Förderbändern stehe und auf mein Gepäck warte, habe ich Angst, dass es nicht dabei sein könnte. Ich bin schon viel geflogen, und nur ein einziges Mal ist mein Koffer anstatt in Frankfurt in Florida gelandet, aber seitdem bekomme ich Panikattacken, weil ich die Vorstellung, dass fremde Menschen meine Sachen auspacken und meine Kleidung unmodern oder schlicht nicht schön finden könnten, einfach nicht ertragen kann.
Zum Glück verkürzt der Titus mir die Wartezeit.
»Titus«, sagt die Mutter, »gleich sind wir beim Papi zu Hause, und der hat schon eine SMS von mir bekommen und macht dir gerade Fenchelgemüse. Und du, Titus, hör doch mal auf die Mamili, der Papi kauft auch Bionade Ingwer-Orange.«
»Bionade ist kacko-facko«, motzt der Titus und schleudert seinen Wilde-Kerle-Rucksack auf den Boden. »Ich will Wurstsaft.«
Mit einem milden Lächeln, das mich – natürlich nur innerlich – sehr aggressiv macht, hebt die Mutter den Zeigefinger und macht dann einen großen Fehler. Sie sagt: »Es gibt keinen Wurstsaft, Titus. In Gruselfilmen trinken die auch nie Wurstsaft. Da trinken sie immer nur Bluuut. Huuuh, Titus, huuuh!«
Der Titus dreht innerhalb einer Nanosekunde total durch.
»Wenns keinen Wurstsaft gibt, will ich Wurstsaft. Ich will immer das, was es nicht gibt. Mach Wurstsaft; mach Wurstsaft!«
Allmächtiger; steh mir bei. Wüsste ich; dass ich ein solches Kind bekomme; ich würde schon während der Vorwehen Gespräche mit adoptionswilligen Paaren führen und die nötigen Formulare ausfüllen.
Da kommt mein Koffer. Und – danke; Herr im Himmel – da kommt auch mein Didgeridoo auf dem Gepäckband zu mir. Das Didgeridoo ist nämlich mein ganzer Stolz.
Denn ich; Sanni Prinz; komme gerade aus Australien. Drei Monate war ich dort; und wenn es Mark nicht gäbe, ich hätte ohne Probleme weitere drei Monate bleiben können. Ein wunderbarer Kontinent. Und immer warm. Das mit den giftigen Tieren ist zwar nicht so schön; aber man soll nicht klagen und jammern. Ich meine, welche deutsche Jeans kann schon von sich behaupten, dass eine Taipan-Giftschlange in ihr wohnen wollte? Schade eigentlich, dass ich sie nicht mitgenommen habe, dann hätte ich sie jetzt dem Titus schenken können. Mit dem Köpfchen voran hätte ich die Schlange in sein Gesicht gedrückt. Selbstverständlich lächle ich gütig weiter.
»Ich will doch keinen Wurstsaft! Ich will das da!« Der Titus deutet auf mein Didgeridoo, das ich selbst in landestypischen Farben bemalt habe und auf dem ich wirklich schon ganz gut spielen kann. Dann reißt er sich von seiner Mutter los, die jetzt telefoniert, wahrscheinlich mit dem Papi, und klettert wie ein Wiesel auf das Förderband, um nach dem Didgeridoo zu schnappen. Aber da hat er nicht mit Sanni Prinz gerechnet. Ich reiße das von Termiten ausgehöhlte gute Stück an mich und halte es so hoch, dass der Titus auf gar keinen Fall drankommen kann.
Die Wurstsaft-Mutter kommt böse dreinblickend näher. »Was haben Sie denn mit dem Titus gemacht?«, will sie aufgeregt wissen. Ich möchte entschuldigend beide Hände heben, aber das geht ja nicht, weil ich ja schon beide Hände gehoben habe, um das Didgeridoo vom Titus fernzuhalten. Also lächle ich weiter und sage: »Ich schütze mein Blasinstrument vor Ihrem Sohn.«
»Aber der Titus tut doch nichts«, kommt es verteidigend, während der Titus im Begriff ist, an mir hochzuklettern. Leider bin ich zu höflich, sonst würde ich ihn abschütteln wie ein lästiges Insekt. Warum kann sie ihn nicht einfach an die Leine nehmen?
»Ich will das haben, ich will das haben!«, krakeelt der kleine Mistkerl weiter. Lange kann ich die Arme so nicht mehr halten.
»Herrje, jetzt geben Sie dem Titus doch das Holzstück!«, ruft die Mutter.
»Nein«, entgegne ich beherrscht. »Dieses Holzstück gehört mir.«
»Aber der Titus ist doch noch ein Kind!«
Genau. Und Kinder gehören nicht auf einen Flughafen. Kinder gehören vor einen DVD-Player. Von mir aus für immer.
»Titus, mein Schatz, komm. Die Frau mag uns nicht. Sie ist böse, böse, böse, und das Holzstück ist doof, doof, doof.«
»Uuäääh!«, macht der Titus. Die Leute gucken schon, und mir ist die Situation mehr als unangenehm. Jedenfalls lässt der Titus von mir ab und fängt an, seine Mutter wegen irgendwas anderem anzupöbeln. Endlich; endlich kann ich gehen. Titus’ gebrülltes »Ich will Senf-Eis haben!« höre ich noch; nachdem die automatische Glastür sich hinter mir schließt.
Ich liebe es, wenn mich jemand vom Flughafen abholt. Man kann sich in die Arme fallen; und der Abholende; sofern er erwachsen ist; beginnt jeden Satz mit dem Wort wie. »Wie war der Flug?«, »Wie war der Urlaub?« oder »Wie war das Wetter?«. (Wenn Kinder dabei sind; gibt es nur eine Frage, und die beginnt mit hast: »Hast du mir was mitgebracht?«) Dann hakt man sich unter und schiebt gemeinsam den Rollwagen aus dem Flughafengebäude und ist einfach nur glücklich. Ganz besonders schön ist es natürlich, von seinem Mann abgeholt zu werden. »Ich werde pünktlicher als eine Atomuhr sein«, hatte Mark mir kurz vor meinem Abflug versprochen.
Ganz besonders unschön ist es allerdings, wenn man aus der Sicherheitszone in die Empfangszone kommt und vor lauter Vorfreude strahlt und schnell geht, weil man es nicht erwarten kann, und dann ist keiner da. Mir ist das schon zwei-, dreimal passiert, und ich fühlte mich jedes Mal so, als sei ich sozial gestrauchelt. Ich hatte immer den Eindruck, mitleidig angeschaut zu werden, so nach dem Motto: »Ach, die Arme. Hat wohl niemanden, der sie abholt.« Oder: »Hat er sie doch versetzt.«
Jedenfalls stehe ich jetzt hier mit meinem Koffer und meinem Didgeridoo, und kein Mark ist da. Obwohl Atomuhren doch als äußerst zuverlässig gelten. Habe ich ihm eine falsche Uhrzeit genannt? Nein. Ich habe ja extra aufs Ticket geschaut, und das Flugzeug ist absolut pünktlich gelandet.
Ach, er wird die Autoschlüssel nicht gefunden haben. Ich habe Mark direkt nach der Hochzeit mit einem Porsche Cabrio überrascht. Spätestens da habe ich gewusst, dass er der Richtige für mich ist. Er hat nämlich nicht etwa gesagt: »O wie toll, danke! Aber das sind ja gar keine Ledersitze!«, nein, er hat gesagt: »Sanni Prinz, du spinnst wohl. Was soll ich denn mit einem Porsche? Das ist doch viel zu teuer. Außerdem brauche ich nur dich. Dich allein!« Sehen Sie. Das ist wahre Liebe. Natürlich habe ich trotzdem darauf bestanden, dass er den Wagen behält. Und er hat letztendlich zugestimmt. Mein Argument, es sei unhöflich, Geschenke abzulehnen, hat gezogen.
Jetzt muss er aber langsam mal kommen. Ich warte schon eine Viertelstunde. Außer mir wartet niemand mehr. Alle sind entweder abgeholt worden oder von selbst gegangen. Bald werden die nächsten Leute hier eintreffen, die Ankommende abholen wollen.
Ich ziehe meinen Koffer langsam hinter mir her, weil ich beschließe, schon mal mit der Rolltreppe hochzufahren und dort zu warten. Verfehlen können wir uns dann nicht. Und glücklicherweise ist der Fuhlsbütteler Flughafen klein und überschaubar.
Nach einer weiteren Viertelstunde beginne ich mir Sorgen zu machen. Ich werde Mark anrufen. Nicht dass da was passiert ist.
Aber Mark geht nicht ans Handy. Beziehungsweise die Handyfrau sagt mir, dass the person temporary not available ist. Das finde ich nun äußerst merkwürdig, weil Mark extra noch meinte: »Ich hab das Handy immer bei mir, damit ich erreichbar bin, falls was ist.« Und die ganzen drei Monate war er auch immer sofort dran. Jetzt mache ich mir wirklich und ernsthaft Gedanken, wähle die Nummer unseres Festnetzanschlusses und bin leicht irritiert, als ich höre, dass die Nummer nicht existiert. Was soll das heißen, die gewählte Rufnummer ist nicht vergeben? Das ist doch die richtige Nummer. Ich bin doch nicht bescheuert. Die ist doch abgespeichert. Gut. Neuer Versuch. Ich rufe in Marks Büro an. Das heißt, ich versuche es. Aber mein Handy funktioniert auf einmal nicht mehr. Es ist wie ausgestellt. Tot. Aber der Akku war doch geladen! Das hab ich doch extra vor dem Abflug noch gemacht. Und während des Fluges war das verdammte Ding doch gar nicht an. O mein Gott, bitte mach, dass Mark nichts passiert ist.
Während ich zu einem Taxistand haste, male ich mir die schlimmsten, grauenhaftesten Szenarien aus. Mark, der gefesselt nach einem Überfall in einer Holzhütte in einem einsamen Wald liegt, während seine Entführer vor ihm sitzen und über die Lösegeldhöhe diskutieren. Mark, der einem Trickbetrüger zum Opfer gefallen ist, der ihn niedergeschlagen und ausgeraubt hat. Aber Trickbetrüger kündigen doch keine Telefonanschlüsse. Ich verstehe das alles nicht.
Glücklicherweise gibt es hier genügend Taxen. Der asiatische Fahrer hievt meine Sachen in den Kofferraum, ich nenne ihm die Adresse, und los geht es.
Entweder habe ich ein Hirntrauma, oder irgendetwas stimmt hier nicht. Im Grunde genommen bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ich mit Nachnamen Prinz heiße; seinen Nachnamen vergisst man schließlich nicht so schnell. Und wo bitte in Dreiteufelsnamen ist unser Klingelschild? Ich meine, das Klingelschild ist schon da, aber da steht ein ganz anderer Name. Kaiser steht da. Möglicherweise ist Mark in meiner Abwesenheit namensmäßig befördert worden, aber das hätte er mir doch erzählt. Immerhin haben wir täglich telefoniert. Ich überlege kurz und gehe in mich. Ja, ich heiße Prinz und nicht Kaiser. Und das ist ganz sicher unser Klingelschild. Das weiß ich deswegen, weil sich daneben noch die Reste eines rosa Kaugummis befinden, den gleichgültige Menschen, die noch nie etwas von Mülltrennung gehört haben, vor meiner Abreise dort hingeklebt haben. Ich habe es zum Großteil mit einem kleinen Messer abgekratzt, aber ein kleiner Rest ist geblieben. Eben neben unserem Klingelschild.
Die Haustür geht auf, und eine große, blonde Frau Anfang dreißig steht vor mir. Ich weiß nicht, ob es eine Nachbarin ist. Jedenfalls habe ich sie in der kurzen Zeit vor meiner Abreise nicht kennengelernt. »Guten Tag«, sagt sie und will an mir Vorbeigehen, stolpert aber versehentlich über mein Didgeridoo.
»Entschuldigen Sie bitte«, sage ich schnell und stelle mein Didgeridoo neben mich.
»Ach, das macht nichts«, die Frau lächelt und betrachtet ihren rechten Fuß, an dem der Knöchel langsam anschwillt. »Schmerzen sind was ganz anderes. Ich wurde mal beim Joggen von einer Suppenschüssel am Kopf getroffen, die ein betrunkener Heißluftballonfahrer abgeworfen hat.«
»Von einer Suppenschüssel?«, wiederhole ich und halte mich an dem Didgeridoo fest.
»Mmhmm«, sie nickt. »Wie sich herausgestellt hat, stand der Betrunkene kurz vor der Hochzeit. Dann hat sich die Braut aus dem Staub gemacht; kurz vor dem Polterabend. Und dann …«, sie kommt näher, »… hat er das ganze Porzellan, das die Leute mitgebracht hatten, genommen, hat einen Heißluftballon geklaut und ist damit davongefahren. Einfach so. Dabei hat er sich sinnlos betrunken. Und danach hat er eben das ganze Zeug aus dem Ballon geworfen.«
»Wie schrecklich.«
»Nicht wahr? Na ja, ich muss dann mal weiter.«
»Warten Sie bitte«, ich stelle mich direkt vor sie. »Ich … also, wissen Sie vielleicht, ob hier irgendwo im Haus Leute wohnen, die Prinz heißen?«
Sie überlegt so lange, wie eben jemand überlegt, der von einer Suppenschüssel am Kopf getroffen wurde, also sehr lange. »Ja, doch«, kommt es dann. »Da wohnte ein Mark Prinz hier. Aber der ist vor ein paar Tagen ausgezogen. Von einer Frau weiß ich nichts. Ich wohne aber auch erst seit zwei Monaten hier.«
»Wissen Sie, wohin er gezogen ist?«, frage ich wie eine Kommissarin im Tatort, die durch gewollt gelangweiltes Nachhaken ihre Gesprächspartner zu weiteren, hoffentlich hilfreichen Aussagen bewegen will.
»Nein«, sie schüttelt langsam den Kopf. »Ich weiß nur von Nachbarn, dass er ins Ausland wollte.«
Ins Ausland! Möglicherweise zu mir, nach Australien. Jetzt ist alles klar. Am liebsten würde ich die Frau umarmen. »In welches Land?« Eigentlich weiß ich die Antwort ja schon.
»Das weiß ich auch nicht«, meint sie, während ihr Fuß die Form eines Heißluftballons annimmt. »Ach doch, jetzt erinnere ich mich wieder. Als wir uns im Treppenhaus getroffen haben, hat er’s mir erzählt. Er meinte, überallhin, aber auf gar keinen Fall nach Australien. Und gelacht hat er dabei. Ich hab mich damals noch gefragt, warum. Immerhin gibt es schlimmere Kontinente als Australien.« Sie nickt, um ihre Aussage zu bekräftigen, dann schaut sie auf ihre Armbanduhr. »Ups, ich muss los. Mein erster Patient wartet.« Sie dreht sich um und geht die Straße entlang. »Ich bin nämlich Logopädin«, ruft sie mir noch zu, als ob der Logopädenberuf der einzige sei, bei dem Patienten auf einen warten.
»Ja, danke«, sage ich. »Auf Wiedersehen.«
Ich verstehe immer noch nichts.
Ich weiß nicht, ob Sie das Gefühl kennen, dass irgendetwas Schlimmes passiert ist, das man aber nicht wahrhaben will. Dieses Gefühl habe ich gerade. Ich meine, es kann zum Beispiel tausend Gründe geben, warum ein Handy nicht funktioniert, aber mein Handy hat immer funktioniert, sogar im australischen Busch. Es hat sogar funktioniert, nachdem ich es auf eine kleine Anhöhe gelegt habe, die sich letztendlich als schlafendes Känguru entpuppt hat; und nachdem das Känguru vom Klingeln des Handys aufgewacht und mit ihm davongelaufen ist und es mir im Davonlaufen noch aus seinem Beutel zugeschleudert hat und das Handy auf den Boden gefallen ist, selbst da hat es noch funktioniert.
Aber jetzt wird es schon komplizierter: Welche Gründe kann es haben, dass der eigene Ehemann überallhin wollte, aber auf keinen Fall nach Australien? Welche Gründe kann es haben, dass er mich nicht vom Flughafen abgeholt hat? Wieso steht auf unserem Klingelschild ein anderer Name? Wo istMark? Kann mir das bitte jemand in kurzen, knappen und vor allen Dingen in nachvollziehbaren Sätzen erläutern?
Was soll ich denn jetzt machen, wo soll ich hin? Es ist nämlich so, dass ich in Hamburg niemanden kenne. Ehrlich nicht. Ich komme aus Würmelingen, einem kleinen Kaff in Nordrhein-Westfalen, wo meine Eltern – Gott hab sie selig – Fabriken besaßen, und bin direkt nach meiner Hochzeit hierhergezogen. In der kurzen Zeit, die ich vor meiner Abreise nach Australien hier war, habe ich niemanden kennengelernt außer den Leuten am Kiosk, beim Bäcker und denen im Supermarkt. Wobei man das auch nicht unbedingt kennenlernen nennen kann. Man hat geredet, sein Wechselgeld nachgezählt, gefragt wie’s denn so geht, und das war’s dann auch schon.
Ich bin so durcheinander. Zwischen Mark und mir, das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Ich weiß, dass Mark mich liebt. Es wird sich alles aufklären. Es muss.
Ich werde jetzt einfach bei diesen Kaisers klingeln und nachfragen. Und in weniger als einer Minute werde ich wissen, wo Mark sich befindet. Bestimmt hat er den Leuten die neue Adresse gegeben. Vielleicht hat er in meiner Abwesenheit ein Haus mit einem schönen großen Garten gekauft und will mich damit überraschen. Moment. Damit hätte er mich aber auch überraschen können, nachdem er mich vom Flughafen abgeholt hat. Das passt alles nicht zusammen.
Während ich auf den Klingelknopf drücke, hoffe ich, dass niemand öffnet. Warum, weiß ich auch nicht. Es öffnet aber jemand, und ich gehe langsam durch das Treppenhaus und klettere dann die Holzstufen in den ersten Stock hoch. Das Didgeridoo und meinen Koffer lasse ich unten stehen. Es ist ein schönes Treppenhaus. Im Eingangsbereich hängt ein alter Kronleuchter, eine Wandmalerei aus dem 19. Jahrhundert zeigt Hafenmotive und Segelboote, und das gedrechselte Treppengeländer hat irgendjemandem mal eine Menge Arbeit gemacht. Und die Wohnung erst! Mark und ich hatten uns sofort in sie verliebt. Typischer Hamburger Schnitt mit Flügeltüren und Parkett und Fenstern, die fast bis zum Boden gehen. Direkt an der Küche schließt ein großer Balkon an, fast schon eine Terrasse, den ich mir nach meiner Rückkehr pflanztechnisch vornehmen wollte. Also jetzt. Meine alten Möbel, alles antike Erbstücke, passen hier so wunderbar rein. Die Wohnung war sündhaft teuer, aber wir haben sie sofort gekauft. Sie ist für uns gemacht. Wir gehören hier einfach hin. Die Wohnung hat eine positive Ausstrahlung. So wie wir.
Endlich stehe ich vor der Wohnungstür. Keine Werbung steht auf dem Aufkleber, der unter dem Briefkasten angebracht ist. Der Aufkleber ist auch neu. Ich mag nämlich Werbung gerne. Wobei ich mich allerdings immer wieder frage, warum bei manchen Artikeln immer dabeisteht: »Nur solange der Vorrat reicht!« Ja, wie lange denn sonst, bitte?
Die Tür geht auf. »Ja bitte?« Ein Mann Ende sechzig steht vor mir. Er wirkt ein bisschen wie ein Professor für Biologie oder Geschichte oder beides.
Plötzlich weiß ich überhaupt nicht, was ich sagen soll.
»Ja bitte?«, kommt es wieder.
»Äh«, ich räuspere mich kurz und sage dann unbeholfen: »Das ist meine Wohnung.«
Der Mann schaut mich an, als hätte ich einen Schlag, dann schüttelt er den Kopf. »Sie müssen sich irren. Das ist meine Wohnung«, werde ich informiert.
Wie soll ich dem Professor denn jetzt bloß alles in launigen Worten erklären? Ich sehe es noch kommen, dass er die Polizei ruft oder die Seelsorge und ich auf einer Wache oder in einer Gummizelle in Erklärungsnot gerate.
»Ich habe hier aber gewohnt, bevor ich nach Australien geflogen bin«, fange ich nochmal an.
Er rückt seine Lesebrille gerade. »Es ist oft so, dass Leute irgendwo wohnen, bevor sie irgendwo hinfliegen«, sagt er sachlich.
»Verstehen Sie bitte. Ich … ich habe … mein Mann und ich haben hier gewohnt. Dann bin ich für drei Monate weggeflogen, und jetzt bin ich wieder da. Und dachte eigentlich, dass ich immer noch hier wohne, hahaha.« Das Hahaha kommt eher verzweifelt aus meinem Mund.
»Das sehe ich«, sagt der Mann, hinter dem mittlerweile seine Frau steht, die schlohweiße Haare hat, argwöhnisch dreinschaut und einen Topflappen in der Hand hält. Automatisch bekomme ich Hunger. Im Flugzeug habe ich vor Vorfreude nichts runterbekommen. Ich bin so hungrig, dass ich auch Fenchelgemüse essen würde. Oder Senf-Eis mit Wurstsaft.
»Ich heiße Sanni Prinz.« Vielleicht hilft das ja. Vielleicht schafft die Tatsache, dass ich ihm meinen Namen verrate, dass langsam, aber stetig ein Vertrauensverhältnis zwischen uns aufgebaut wird. Möglicherweise bekomme ich ja sogar eine warme Mahlzeit.
Die Frau schiebt ihren Mann zur Seite. »Prinz?«
Ich nicke. »Das verstehe ich jetzt nicht«, sagt sie. »Also sind Sie die Frau von dem Herrn Mark Prinz?«
JA! »Ja.«
»Der hat uns gar nicht erzählt, dass er verheiratet ist. Wir hatten den Eindruck, er sei alleinstehend. Er hat auch mal solche Andeutungen gemacht, von wegen die Ehe sei nichts für ihn. Seltsam.«
Kapitel 2
»Was verstehst du nicht?«
Henrik Ibsen: Die Wildente
Vierter Akt (S. 81, so etwa in der Mitte)
Ich liege in meiner ehemaligen Wohnung auf einem gepolsterten Möbelstück und versuche, nicht zu sterben. Mein Gehirn oder zumindest Teile davon weigern sich, den Tatsachen ins Gesicht zu sehen. Was ich da eben gehört habe, das kann und will ich nicht glauben.
Frau Kaiser möchte unbedingt, dass ich ein Gläschen Likör trinke, aber ich mag keinen Likör. »Kindchen«, sagt sie dauernd. »Kindchen, ach Kindchen, nun nehmen Sie doch ein Likörchen.«
Herr Kaiser ist ratlos und rastlos. Er läuft wie ein Tiger im Käfig auf und ab. »Wie leid mir das tut.« Er bleibt kurz stehen, läuft dann aber weiter. »Aber was sollen wir tun? Da sind auch uns die Hände gebunden.«
Ich nippe doch am Gläschen und trinke ein Schlückchen vom Likörchen. Es ist zwar erst zehn Uhr morgens, aber das macht dem Likörchen nichts aus. Und mir auch nicht. Mein Mann hat mich offensichtlich verlassen. Er hält nichts von der Ehe. Davon habe ich nichts gemerkt. Und ich hatte nicht nur in Gedanken Sex mit ihm, das darf man mir wirklich glauben.
»Wann war denn das?«, will ich matt wissen und lehne mich wieder zurück.
»Vor zwei Wochen haben wir den Kaufvertrag unterschrieben, und vor einer Woche sind wir eingezogen. Das mit den Möbeln, wissen Sie, das war uns ganz recht. Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Deswegen wollten wir unbedingt eine möblierte Wohnung haben. In der Schweiz haben wir wiederum unsere ganzen Möbel verkauft.« Frau Kaiser schüttelt den Kopf. »Ach je, ach je. Wenn wir das gewusst hätten, oder, Max? Also, also, also.«
»Das geht doch nicht. Das geht doch nicht«, kann ich nur dauernd sagen.
»Haben Sie denn niemanden hier in der Stadt, zu dem Sie jetzt gehen können?«, will Frau Kaiser besorgt wissen.
Nein. Hab ich nicht. Meine Eltern sind tot, Geschwister habe ich keine, auch keine Onkel und Tanten und Cousinen und Cousins und was weiß ich. Meine Freunde, also die Leute, die ich aus Würmelingen kenne, befinden sich gerade auf einer Weltreise, die noch ein knappes Jahr dauern wird. Sie waren mit mir in Australien und sind dann weitergereist. Da es eine Basic-Weltreise sein soll, wurden nur Rucksäcke, aber keine Telefone mitgenommen. Ich kann da jetzt niemanden erreichen. Die Fabriken meiner Eltern, die Würmelingener Wurstwaren, haben wir kurz nach der Hochzeit verkauft. Mark meinte, wir würden jetzt viel Geld dafür bekommen, aber in einigen Jahren könnte das schon ganz anders aussehen. Viele Millionen Euro haben die vier Fabriken mir gebracht. Beziehungsweise uns.
Mir wird schlecht. Ein Riechfläschchen wäre jetzt schön.
Ich richte mich auf. »Darf ich mal Ihr Telefon benutzen?«, frage ich Frau Kaiser, und die nickt natürlich sofort und holt das Telefon, bei dem es sich tatsächlich noch um ein Uralt-Modell mit Wählscheibe handelt. Umhüllt ist es mit grünem Samt, und da, wo der Samt für die Wählscheibe ausgestanzt wurde, befindet sich eine Brokatbordüre. Die Kaisers müssen es mitgebracht haben, denn wir hatten selbstverständlich eine hypermoderne Telefonanlage. Während ich die Nummer von Marks Büro wähle, fällt mir auf, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich eine Wählscheibe benutze. Wir hatten immer nur Tastentelefone. Es ist allerdings auch möglich, dass ich derzeit einfach nur so durcheinander bin, dass ich mich an meine früheren Telefoniergewohnheiten schwer erinnern kann.
Das Freizeichen ertönt dreimal, dann nimmt jemand ab, und ich könnte vor Erleichterung aufjaulen.
»Riemenschneider Consulting, Lützow, guten Tag«, leiert eine Frauenstimme herunter. »Hallo?«, sagt Frau Lützow, nachdem ich nicht gleich etwas hervorbringe.
Ich versuche, mich zu räuspern, bringe aber eher ein Krächzen hervor und bin dann erst imstande, einen Satz zu formulieren: »Sanni Prinz. Ich möchte bitte, ich möchte bitte … meinen Mann sprechen. Mark Prinz.« Ich habe es geschafft!
»Hier ist Riemenschneider Consulting«, sagt Frau Lützow.
»Warum?«, will ich verzweifelt wissen.
»Wie bitte?«, fragt Frau Lützow irritiert.
»Warum ist da Riemenschneider?«
»Die Firma heißt so.«
»Warum denn?«
»Wer sind Sie eigentlich?« Frau Lützow möchte offenbar klare Fakten.
»Ich bin die Frau meines Mannes«, informiere ich Frau Lützow und schließe kurz die Augen, weil ich genau weiß, dass ich Schwachsinn von mir gebe. Und sie weiß es auch.
»Das freut mich«, kommt es. »Aber was hat das mit uns zu tun?«
»Die Nummer ist mein Mann. Ich meine, mein Mann hat eine Nummer.«
»Hier ist kein Gefängnis, hier ist eine Firma für Anlageberatung«, sagt Frau Lützow, und ich weiß, dass sie gerade den Kopf schüttelt und mit den Fingern auf der Tischplatte trommelt.
»Aber das geht doch nicht«, rufe ich Frau Lützow ins Ohr. »Wo ist denn dann die Nummer meines Mannes?«
»Da ich mein Geld nicht als Magierin verdiene, kann ich Ihnen da leider nicht weiterhelfen.« Frau Lützow versucht jetzt auch noch, witzig zu sein, eine Tatsache, die ich alles andere als witzig finde. Nichts ist hier witzig. Rein gar nichts.
»Falls es Ihnen weiterhilft: Wir sind erst seit ein paar Tagen hier. Vorher war hier ein Unternehmensberater. Möglicherweise war das ja Ihr Mann.«
»Mark Prinz …«, sage ich schnell.
»Warten Sie mal«, antwortet Frau Lützow und schaltet die Warteschleife ein. Während Guantanamera in der Instrumentalversion in mein Ohr dudelt, muss ich blödsinnigerweise daran denken, dass ich in Australien gar nicht danach gefragt habe, wie ich das Didgeridoo reinigen soll. Trocken, feucht? Verträgt es Reinigungsmittel, oder verzieht es sich dann? Mir fallen plötzlich auch die ganzen Sachen ein, die mein Vater mal ersteigert hat und die jetzt den Kaisers gehören. Wer kann schon von sich behaupten, ein Holzklosett von König Ludwig zu besitzen? Ich kenne niemanden. Mein Vater hatte unter anderem eine Vorliebe für skurrile antike Sachen und hat diese Dinge gesammelt. Irgendwo hier muss auch noch eine Perücke vom Alten Fritz herumliegen. Ich werde Frau Kaiser noch den Zettel für die Pflegehinweise heraussuchen, wenn sie es möchte. Sonst nisten sich die Motten ein.
»Ich bin wieder da«, sagt Frau Lützow. »Die Unternehmensberatung hieß Prinz, ja. Der Inhaber Mark Prinz. Aber der ist aus Hamburg weggezogen. Wohin, weiß hier keiner. Sonst noch was?«
»Danke«, flüstere ich und lege auf, ohne mich weiter von Frau Lützow zu verabschieden. Warum auch? Ich werde bei Riemenschneider Consulting sowieso nie mehr anrufen.
Kaisers zwingen mich, noch ein Viertelstündchen auf meiner Chaiselongue liegen zu bleiben, die ja jetzt ihre ist. Das muss ich auch; ich wäre sonst umgekippt. Zum tausendsten Mal sage ich mir, dass es sich hier um einen tragischen Irrtum handeln muss. Es kann doch nicht sein, dass er diese Wohnung samt Mobiliar einfach so verkauft hat. Vielleicht hat Mark einen Doppelgänger. Das wäre immerhin eine Möglichkeit. Aber wieso sollte ein Doppelgänger die Wohnung verkaufen? Der Doppelgänger hat doch gar keine Unterlagen und auch keine Befugnisse. Ich muss diesen möglichen Handlungsstrang später weiter überdenken. Oder neu.
»Der Sekretär da gehörte meiner Mutter«, erkläre ich Frau Kaiser und deute auf das zweihundert Jahre alte, kostbare Stück.
Frau Kaiser ist das alles schrecklich unangenehm.
Mir ist das alles aber noch viel unangenehmer.
Ich habe also keine Wohnung mehr. Und auch keine Einrichtung. Er hat alles verscherbelt. Ohne das vorher mit mir abzusprechen. Ohne mich überhaupt darüber zu informieren. Er hat die Wohnung mit Gewinn verkauft. Klar. Fünf Zimmer, hundertsechzig Quadratmeter, dann die ganzen Möbel. Meine Möbel. Antiquitäten, für die Händler ihr Leben gegeben hätten. Kaisers haben sechshunderttausend Euro bezahlt. Fünfhunderttausend Euro hatte ich bezahlt. Das sind dann hunderttausend mehr. Na ja, klar, die Einrichtung. Die wertvollen Antiquitäten. Die skurrilen Sachen.
»Wir haben die Gegenstände, die wir nicht in der Wohnung haben wollten, in Kisten gepackt und in den Keller getragen«, sagt Herr Kaiser reumütig. »Wenn Sie möchten, können Sie wenigstens das mitnehmen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber es ist ja nicht so, dass wir Ihnen etwas gestohlen haben. Wir haben ja ordnungsgemäß gezahlt. Emmi, nun sag doch auch mal was.«
Emmi nickt. »Das hat alles seine Richtigkeit. Aber die Sachen aus dem Keller, die können Sie gern haben.«
Eine Viertelstunde später stehe ich in Kaisers Keller und wühle wie eine Obdachlose in meinem ehemaligen Eigentum herum, das mir jetzt gönnerhafterweise wieder zugesprochen wurde. Die Kaisers scheinen es mit dem Skurrilen nicht so zu haben, fast die komplette Sammlung meines Vaters befindet sich hier unten. Da fällt mir ein, dass es ja nett ist von den Kaisers, mir die Sachen überlassen zu wollen, aber wohin soll ich denn damit? Unten im Hausflur stehen mein Koffer und das Didgeridoo. Das muss ich ja auch tragen. Ich kann die Sachen jetzt also nicht mitnehmen. Und ich habe Kaisers sowieso schon viel zu lange aufgehalten.
»Sie können kommen und die Sachen holen, wann immer Sie wollen«, sagt Frau Kaiser. »Ach Kindchen, ich würde Ihnen ja anbieten, bei uns zu bleiben erst mal, aber heute Nachmittag reisen unsere Kinder und die Enkelkinder an, da ist die Wohnung voll, und die bleiben eine Zeit, weil mein Mann nämlich die Tage einen runden Geburtstag feiert.«
Um ehrlich zu sein, hatte ich gehofft, eventuell bei den Kaisers wohnen zu können, natürlich nur vorübergehend, aber warum sollte etwas, das ich hoffe, wahr werden?
»Das ist nicht nötig«, sage ich mit fester Stimme und versuche, Haltung zu bewahren. »Ich werde bei einer Freundin Unterkommen. Ich fahre gleich hin.«
Welche Freundin?
»Da bin ich aber beruhigt.« Frau Kaiser schließt den Kellerraum sorgfältig ab. Dann bringt sie mich gemeinsam mit ihrem Mann zur Haustür.
Ich nehme meinen Koffer und mein Didgeridoo und trete raus auf die Straße. Ich werde zur Bank gehen. Ich muss jetzt etwas unternehmen. Und während ich Kaisers nochmal zunicke, bete ich inständig, dass sich doch noch alles als ein ganz, ganz dummes Missverständnis entpuppt.
Wenn dieser Bankangestellte jetzt nochmal »Puha« sagt, drehe ich durch. Ich habe von jeher eine Aversion gegen diese gekünstelte Freundlichkeit und diese antrainierte rhetorische Professionalität. Und zusätzlich hat sich Herr Ingwersen auch noch dieses unverbindliche und gleichzeitig nervtötende »Puha« angeeignet. Er sagt »Puha«, während er konzentriert auf seinen Flachbildschirm schaut. Dann schüttelt er den Kopf. »Das sieht ja wirklich und in der Tat und ganz und gar nicht gut aus«, meint Herr Ingwersen und lächelt mich gewinnend an, so als ob er mir gerade eine wahnsinnig positive Mitteilung gemacht hätte.
»Wie meinen Sie das?«
»Ich …«, er setzt ein strahlendes Lächeln auf und winkt einem vorbeilaufenden Kunden zu, »… ach hallo, guten Tag, Herr Becker, puha, was macht die Hüfte? Alles neu, alles neu macht der Mai, sag ich immer, hahaha … ja, also, die Sache ist folgendermaßen: Sie haben nichts mehr auf Ihrem Konto. Puha.«
»Auf meinem Konto? Wir reden hier nicht von einem Konto. Ich habe sechs Konten bei dieser Bank. Meine Eltern waren bei Ihnen ebenfalls Kunden. In der Würmelingener Filiale.«
»Das habe ich puha auch gar nicht bestritten«, sagt Herr Ingwersen und lächelt. »Möglicherweise habe ich mich auch falsch ausgedrückt. Ich meinte natürlich, dass auf keinem dieser Konten ein Bargeldbestand besteht.«
»Aber warum denn nicht?« Wäre ich drogenabhängig, jetzt wäre der passende Zeitpunkt für den Goldenen Schuss.
»Weil das Geld abgehoben wurde.« Herr Ingwersen zwinkert mir zu. »Übrigens sind das sehr schöne Kontonummern, die Sie haben. Leicht zu merken. Hat auch nicht jeder. Puha.«
Guten Tag. Mein Name ist Sanni Prinz. Ich habe sechs Konten; auf denen sich nicht ein Cent befindet; dafür aber superklasse Kontonummern; die man sich gut merken kann. Also hören Sie mal; das hat auch nicht jeder.
»Wie kann das sein?«; will ich von Herrn Ingwersen wissen. »Da waren Millionenbeträge drauf. Teilweise war das auch längerfristig angelegtes Festgeld. Das kann man nicht einfach alles so abheben. So mir nichts, dir nichts.«
»Tja«, sagt Herr Ingwersen und kratzt sich am Kinn. »Die Festgeldkonten waren puha jeweils zum Quartalsende kündbar. Und von dieser Kündigung hat Ihr Mann ganz offensichtlich Gebrauch gemacht. Es hatte alles seine Ordnung. Er hatte ja puha auch alle Vollmachten. Also, falls ich etwas dazu sagen soll, dann finde ich, dass das vielleicht ein falscher Weg war.«
Weil ich zu schwach bin, um zynisch zu reagieren, nicke ich nur langsam, dann schüttele ich den Kopf, dann nicke ich wieder. Als sei ich eine Marionette und jemand würde lustig an den Fäden ziehen.
»Heißt das, ich kann jetzt auch nichts abheben?«, frage ich Herrn Ingwersen fast ängstlich.
Der lacht laut auf. »Das ist ja eine witzige Frage«, keucht er dann. »Was wollen Sie denn abheben? Die Konten sind leer. Da ist doch gar nichts mehr drauf.«
»Aber ich brauche doch Geld. Ich könnte … einen Kredit aufnehmen. Vorübergehend natürlich nur.« Herr Ingwersen muss mir doch helfen. Immerhin steht auf dem Tisch so ein Pappaufsteller. Sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen gern.
Herr Ingwersen beugt sich ein Stück zu mir nach vorn, stützt beide Hände auf den Tisch und funkelt mich durch seine randlose Brille an. »Ein Kredit muss abbezahlt werden«, sagt er dann. »Wenn Sie mir einen Arbeitsvertrag vorlegen können und die ersten drei Monatsgehälter bei uns eingegangen sind, dann können wir puha mit Sicherheit ins Geschäft kommen. Aber ohne Sicherheiten geht selbst bei uns nichts. Das verstehen Sie sicher, Frau Prinz. Puha.«
»Ich gebe Ihnen mein Didgeridoo.« Ich deute auf das gute Stück. »Das habe ich selbst bemalt.«
»Ein Didgeridoo als Sicherheit für einen Kredit reicht leider nicht aus. Da muss ich noch nicht mal puha meinen Vorgesetzten fragen.«
Mir fällt noch etwas anderes ein. »Ich könnte Ihnen ein Holzklo vorbeibringen. König Ludwig hat es benutzt. Und noch mehr antike Sachen.«
Herr Ingwersen horcht auf. »Das ist natürlich etwas anderes. Haben Sie die entsprechenden Expertisen, die die Echtheit der Sachen bescheinigen?«
Mein Vater hat auf so was nie Wert gelegt. Er hatte ja auch nie vor, die Sachen wieder zu verkaufen. Warum auch? Geld war ja immer genug da. Ich musste mir nie über das Thema Geld Gedanken machen. Ich habe immer gut gelebt, ach was, luxuriös. Wir hatten ein Schwimmbad im Keller und einen Pool draußen; wir hatten viele Autos, die immer alle vollgetankt waren. Wir haben die ganze Welt bereist. Ja, wir waren sehr reich, aber meine Eltern sind trotzdem nie abgehoben, sondern waren bodenständige Menschen, die geschätzt haben, was sie hatten. Und mein Vater hat hart für das viele Geld gearbeitet. Lieber heute als morgen, das war das Motto meiner Eltern. Sie haben das Geld mit vollen Händen und mit viel Lust ausgegeben, ohne dabei arrogant oder überheblich zu sein. Und ich bin genauso, glaube ich. Oder war. Ich habe mich nie für etwas Besseres gehalten. Warum auch?
»Es gibt keine Expertisen«, sage ich, und Herr Ingwersen sagt »Puha«. Ich glaube, so langsam will er, dass ich gehe. Er streckt mir die Hand entgegen, und automatisch ergreife und schüttele ich sie.
»Ähem«, macht Herr Ingwersen. »Verabschieden können wir uns gleich. Wenn Sie vorher bitte noch so freundlich wären, mir Ihre EC-Karten auszuhändigen.«
»Was?«
»Die EC-Karten. Die sind ja puha nun sowieso überflüssig. Ich werde sie vernichten.«
Weil ich nichts mehr zu verlieren habe, hole ich mein Portemonnaie raus und zunzele die Karten daraus hervor. Meine Hände zittern, während ich sie Herrn Ingwersen gebe.
»Danke«, meint er fröhlich, nachdem er kontrolliert hat, ob ich ihm auch wirklich alle gegeben habe. »Haben Sie denn puha noch Konten bei einer anderen Bank?«
»Nein«, sage ich leise.
»Ich frage das nur, weil ich da auch noch drei Kreditkarten in Ihrer Geldbörse sehe. Wenn Sie also nur bei unserer Bank Konten unterhalten haben, muss ich puha davon ausgehen, dass die fälligen Kreditkartenbeträge auch von diesen Konten abgebucht wurden. Liege ich da richtig?«
Ich nicke.
»Sehen Sie? Und da sich ja auf den Konten keine Guthaben mehr befinden, darf ich Sie puha nun ebenfalls um die Aushändigung der Kreditkarten bitten.«
»Die Kreditkarten«, wiederhole ich.
»Richtig.« Herr Ingwersen strahlt nun über das ganze Gesicht. Vielleicht bekommt er pro eingezogener Karte Provision.
Also zunzele ich auch die Kreditkarten heraus. Mein Portemonnaie sieht plötzlich ganz schön leer aus. Herr Ingwersen holt eine Schere aus einer Schublade und zerschneidet alle Karten. Er geht sehr sorgfältig vor und runzelt dabei die Stirn, so als müsse er sich während dieses Vorgangs unglaublich konzentrieren.
»Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag«, sagt er und nickt mir zu. »Nehmen Sie das alles nicht so schwer. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Sie sind ja noch so jung.« Dann greift er unter den Tisch und drückt mir zwei Bonbons in die Hand, auf denen sich das Logo der Sparkasse befindet. »Mit Süßigkeiten im Magen sieht die Welt gleich ganz anders aus«, sagt Herr Ingwersen. »Puha.«
Bevor ich in eine öffentliche Telefonzelle gehe, wo immer auch eine sein mag, brauche ich Sagrotan. Und wenn ich Sagrotan kaufe, habe ich kein Geld mehr, um zu telefonieren. In meinem Portemonnaie befinden sich noch exakt zehn Euro. Ich könnte natürlich herumlungernden Jugendlichen ihre Handys klauen und sie mit meinem Didgeridoo niederknüppeln, sollten sie es wagen, Einwände zu erheben. Und dann? Wen sollte ich anrufen?
Ich brauche jetzt einen Kaffee. Egal, dass mir dann nur noch acht oder neun Euro bleiben, aber ich muss jetzt einen Kaffee haben.
Zwei Minuten später setze ich mich mit meinem Pappbecher auf eine Bank und überlege meinen nächsten Schritt. Nach weiteren zwei Minuten wird mir klar: Es gibt keinen. Ich werde als Obdachlose enden, in Mülltonnen nach Getränkedosen suchen, die Colareste enthalten, oder mit geschickten Zungenbewegungen noch die letzten Krümel aus Sandwichverpackungen herausholen. Ein Passant kommt vorbei und wirft fünfzig Cent in meinen Kaffeebecher, so als ob er mich schon mal mental auf mein restliches Leben vorbereiten wollte.
Fazit: Ich heiße Sanni Prinz, bin sechsunddreißig Jahre alt und mit Mark verheiratet. Ich habe braune Haare, die mit Sicherheit bald grau werden, und dunkle Augen, die von einigen Menschen zusätzlich als »warm« bezeichnet werden. Wo diese Menschen gerade sind und wer das überhaupt mal von meinen Augen gesagt hat, das weiß ich nicht mehr. Das Einzige, was ich derzeit noch habe, sind acht Euro Bargeld und ein Holzinstrument, das in landestypischen Farben bemalt ist. Und schmutzige Wäsche, in der der Staub Australiens wohnt.
Würde irgendjemand eine Vermisstenanzeige aufgeben, könnte die im Radio vom Moderator so vorgetragen werden:
»Vermisst wird seit heute Morgen die 36-jährige Sanni Prinz aus Hamburg Frau Prinz ist bekleidet mit einer ausgewaschenen Jeans, braunweißen Turnschuhen, einem T-Shirt mit der Aufschrift Crocodiles x-ing und einer grauen Sweatshirtjacke. Frau Prinz wirkt ungepflegt und verwirrt Sie trägt außer einem Koffer ein Didgeridoo bei sich, das sie fest umklammert.«
Und wenn das noch ein paar Tage so weitergeht, kommt noch der folgende Satz hinzu: »Sie benötigt dringend Medikamente und ist nicht in der Lage, sich zu orientieren.«
Kapitel 3
»Weiß Gott! Ich lege mich so oft zu Bette mit dem Wunsche, ja manchmal mit der Hoffnung, nicht wieder zu erwachen.«
Johann Wolfgang Goethe: Die Leiden des jungen Werther
Zweites Buch, 3. November (die ersten beiden Sätze)
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: