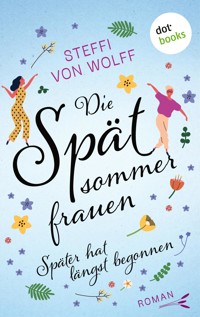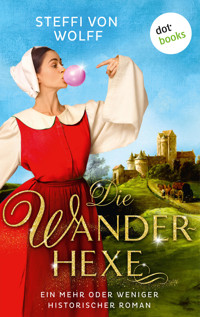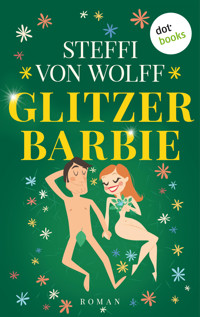0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Katastrophe kommt selten allein: Der humorvolle Roman »Kein Mann ist auch (k)eine Lösung« von Steffi von Wolff jetzt als eBook. Carolin ist Mitte 30, Moderatorin einer Radiosendung, die keiner hören will, und chronischer Single. Die einzige Sache, auf die sie sich aktuell verlassen kann, ist ihr Talent, in die absurdesten Situationen zu geraten – und so wundert sie sich nicht einmal mehr, als sie bei einem Selbstbewusstseins-Coaching von der Kursleiterin beschuldigt wird, einen geheimen Wunsch zum Töten zu haben. »Schlimmer kann es nicht mehr werden«, denkt sich Carolin, als sie auf den hünenhaften Hardrocker Pitbull Panther trifft, der sie prompt auf ein Bier einlädt. Nach einer durchzechten Nacht haben die beiden einen verrückten Plan ausgeklügelt: Gemeinsam wollen sie in der Stadt einen Swingerclub eröffnen – doch damit geht das Chaos natürlich erst richtig los … »Lesen Sie dieses Buch nicht im Bett. Sie werden vor Lachen rausfallen«, sagt Bestsellerautorin Susanne Fröhlich. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die Liebeskomödie »Kein Mann ist auch (k)eine Lösung« von Steffi von Wolff wird alle Fans von Petra Hülsmann und Gaby Hauptmann begeistern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Carolin ist Mitte 30, Moderatorin einer Radiosendung, die keiner hören will, und chronischer Single. Die einzige Sache, auf die sie sich aktuell verlassen kann, ist ihr Talent, in die absurdesten Situationen zu geraten – und so wundert sie sich nicht einmal mehr, als sie bei einem Selbstbewusstseins-Coaching von der Kursleiterin beschuldigt wird, einen geheimen Wunsch zum Töten zu haben. »Schlimmer kann es nicht mehr werden«, denkt sich Carolin, als sie auf den hünenhaften Hardrocker Pitbull Panther trifft, der sie prompt auf ein Bier einlädt. Nach einer durchzechten Nacht haben die beiden einen verrückten Plan ausgeklügelt: Gemeinsam wollen sie in der Stadt einen Swingerclub eröffnen – doch damit geht das Chaos natürlich erst richtig los …
»Lesen Sie dieses Buch nicht im Bett. Sie werden vor Lachen rausfallen«, sagt Bestsellerautorin Susanne Fröhlich.
Über die Autorin:
Steffi von Wolff, geboren 1966 in Hessen, war Reporterin, Redakteurin und Moderatorin bei verschiedenen Radiosendern. Heute arbeitet sie freiberuflich für Zeitungen und Magazine wie »Bild am Sonntag« und »Brigitte«, ist als Roman- und Sachbuch-Autorin erfolgreich und wird von vielen Fans als »Comedyqueen« gefeiert. Steffi von Wolff lebt mit ihrem Mann in Hamburg.
Die Autorin im Internet: steffivonwolff.de und facebook.com/steffivonwolff.autorin
Steffi von Wolff veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre Bestseller »Glitzerbarbie«, »Gruppen-Ex«, »ReeperWahn« und »Rostfrei«, »Fräulein Cosima erlebt ein Wunder«, »Das kleine Segelboot des Glücks«, »Der kleine Buchclub der Träume«, »Das kleine Hotel an der Nordsee«, »Das kleine Haus am Ende der Welt«, »Das kleine Appartement des Glücks«, »Die Spätsommerfrauen«, »Kein Mann ist auch (k)eine Lösung« und »Die Wanderhexe«, »Taxifahrt mit einem Vampir« und »Für Rache ist es nie zu spät«.
Außerdem erschienen ihre Kurzgeschichten-Sammelbände »Das kleine Liebeschaos für Glückssucher« und »Das kleine Glück im Weihnachtstrubel«.
Eine andere Seite ihres Könnens zeigt Steffi von Wolff unter ihrem Pseudonym Rebecca Stephan im ebenso einfühlsamen wie bewegenden Roman »Zwei halbe Leben«.
***
eBook-Neuausgabe September 2024
Die Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel »Fremd küssen« im Fischer Verlag, Frankfurt am Main.
Copyright © der Originalausgabe 2003 Fischer Taschenbuch Verlag in der S. Fischer GmbH, Frankfurt am Main
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Dara_T, GoodStudio
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98952-346-3
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13, 4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/egmont-foundation. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Steffi von Wolff
Kein Mann ist auch (k)eine Lösung
Roman
dotbooks.
Für die zwei wichtigsten Fs in meinem Leben: Flippo und Fridtjof.
Für Karsten, Jan und Doktor Mösch. Die wissen schon, warum.
Für den besten Zlatin der Welt (Hoooon mir Sulunfeis un ganz viel anner Eis. Was issen d’accord?) und für meine Chaoten von hr-xxl.
Hat irgendjemand was zu essen?
Wärt ihr traurig, wenn ich weggehen würde? Nein? Eine Frechheit!
Kapitel 1
»Nimm du Sraup in regt Hand und dann dreh link. Vorsigt mit Kabel und andere Strom. Wenn gesraupt, dann gud. Wenn nigt, dann du Fehler gemagt«, steht in der Gebrauchsanweisung.
Also nehme ich die Schraube in die rechte Hand und drehe nach links. Die Schraube dreht durch. Es steht nichts von einem Dübel in der Gebrauchsanweisung und es steht auch nichts darüber, was man tun muss, wenn die Schraube durchdreht. Ich fange an zu schwitzen. Einmal nur in meinem Leben möchte ich etwas richtig zu Ende bringen, ohne jemanden um Hilfe bitten zu müssen. Also, alles noch mal von vorne. Sraup in regt Hand. Bitte sehr. Die Schraube dreht durch. Und ich drehe auch gleich durch.
Ich muss also mal wieder zu Richard und ihn um Hilfe bitten. Richard wohnt ein Stockwerk über mir und hat eine Wohnung, vor der ich einfach nur Angst habe. Sämtliche Wände sind schwarz gestrichen, damit bloß kein Sonnenlicht reflektiert. Obwohl das gar nicht möglich wäre, denn Richards Fenster sind immer geschlossen und die Klappläden wurden wohl in den fünf Jahren, in denen er hier wohnt, noch nie geöffnet. Wahrscheinlich würden sie sich jetzt auch gar nicht mehr öffnen lassen, weil sie völlig eingerostet sind.
Richard ist ein Albino mit großen roten Augen, weißen Haaren und einer derart durchsichtigen Haut, dass man meint, die Blutzirkulation durch seinen Körper mit bloßem Auge erkennen zu können. Als Richard mir einmal einen Toilettendeckel montierte - es war Sommer und sein Oberkörper ausnahmsweise frei -, lag er halb unter dem Klosett und ich schwöre, dass ich seinen Zwölffingerdarm gesehen habe. Wenn Richard aus dem Haus geht, trägt er, auch bei vierzig Grad im Schatten, grundsätzlich einen hochgeschlossenen Parka, lange Hosen, Stiefel und eine Skibrille. Er hat eine derart panische Angst davor, dass er einen Sonnenbrand bekommen konnte, dass es schon fast krankhaft ist.
Ein einziges Mal waren wir im Sommer zusammen einkaufen, da trug er eine Mütze, die nur an den Augen schmale Schlitze hatte. Frau Gerber an der Kasse vom AKTIV-Markt hat sofort den Alarmknopf gedrückt, weil sie der Meinung war, Richard wolle die Bareinnahmen aus ihrer Kasse und hielte mich als Geisel. Dabei hat sich Richard nur an mir festgehalten, weil die Mütze verrutscht war und er nichts mehr sehen konnte.
Sämtliche Kunden liefen auf die Straße und schrien, und Frau Gerber bedrohte Richard mit dem Scannerleser ihrer Kasse, in der Hoffnung, er würde annehmen, es handele sich dabei um ein Elektroschockgerät. Die Polizei kam und umstellte den Markt. Ich versuchte, das Missverständnis aufzuklären, aber wie immer hörte mir keiner zu. Richard war verwirrt und brachte es irgendwann fertig, den Sehschlitz seiner Mütze wieder vor seine Augen zu platzieren, was mit entsetzten Schreien der Angestellten honoriert wurde, vermutlich, weil seine Augen vor Panik noch röter waren als sonst.
»Geben Sie auf. Verlassen Sie mit erhobenen Händen das Gebäude!«, quakte das Überfallkommando von draußen.
Ich fing an, laut zu heulen, Richard begriff gar nichts mehr und wollte mich in den Arm nehmen.
»Lass mich«, schniefte ich und schubste ihn weg. »Wo ich hinkomme, passiert irgendwas Schlimmes.«
Richard strauchelte, verlor das Gleichgewicht und stürzte mit dem Süßwarendrehständer auf den Boden. Diesen Moment nutzte Werner Pluntke, der Marktleiter, um sich mit Todesverachtung auf Richard zu werfen. Hektisch riss er einen Beutel mit Lakritze auf, rollte die Schnecken auseinander und versuchte, Richard damit zu fesseln und somit dingfest zu machen. Frau Gerber, eine geborene Stuttgarterin, lief an die Ladentür, gestikulierte und ging dann, als die Polizisten die Waffen sinken ließen, vors Haus.
»De Schef hot den Monn gschwind überwäldigt!«, schwäbelte sie erleichtert. »Heiligs Blechle, un des om frühe Morge!«
Richard und ich wurden in eine Ecke gedrängt und festgehalten, und endlich konnte ich alles erklären. Richard sagte gar nichts mehr. Er ist seitdem nie mehr mit mir einkaufen gegangen.
Ich heiße Carolin. Nein, nennen Sie mich bitte Caro. Obwohl ich Carolin sehr schön finde. Die Prinzessin von Monaco heißt auch so und sie hat auch so viel Pech wie ich und knabbert bestimmt wie ihre Schwester Stephanie an den Fingernägeln. Ich habe das mal in einer Klatschzeitung gelesen und habe dann auch angefangen, an den Fingernägeln zu knabbern. Ich dachte, wenn eine Prinzessin das tut, ist das bestimmt sehr chic. Ich versuche heute ständig, es mir wieder abzugewöhnen, und schaffe es auch immer für ein paar Monate. Und dann fange ich wieder damit an. Mein Freund Gero behauptet, ich würde das unterbewusst machen, um mich selbst zu quälen. Psychotherapeuten nennen es sogar »Selbstverstümmelung«. Haha. Als hätte ich so nicht schon Ärger und Chaos genug. Ich bin jetzt 34 Jahre alt und habe das Gefühl, noch keine 20 zu sein. Aber dazu später mehr.
Jetzt muss ich also erst mal zu Richard. Ich lasse den ganzen Kram liegen und gehe ein Stockwerk höher. Richard hat keine Klingel und möchte auch nicht, dass man bei ihm klopft. Seitdem er einen Volkshochschulkurs besucht hat, der sich mit übersinnlicher Wahrnehmung beschäftigte, glaubt er, Menschen vor seiner Tür spüren zu können. Selbstverständlich fand dieser Kurs abends im Winter statt. Um Richard also ernst zu nehmen, habe ich es mir angewöhnt, vor seiner Tür entweder ganz laut zu hyperventilieren oder aber einen Hustenanfall zu bekommen. Er öffnet dann immer sofort und sagt: »Ich habe gewusst, dass du vor der Tür stehst!«
Ich huste laut. Die Tür geht auf und Richard sagt: »Ich habe gewusst, dass du vor der Tür stehst!« und lässt mich rein.
»Richard«, sage ich, »könntest du eben mit runterkommen und mir ein beklopptes Regal zusammenbauen? Ich kriege sonst einen Nervenzusammenbruch.«
Richard schaut auf seine geschlossenen Klappläden. Die Schlitze reflektieren nichts. Keine Sonne. Fast schon dunkel. Er kann also ohne Mantel und Mütze die zwei Treppen runter in meine Wohnung laufen, ohne durch den Lichteinfall im Treppenhaus eine UV-Vergiftung zu bekommen.
»Okay«, sagt er und kommt mit. Bei mir angekommen, kickt er die Gebrauchsanweisung mit dem Fuß zur Seite, nimmt einen meiner Kreuzschlitzschraubenzieher und baut das Regal in genau 27 Sekunden zusammen, ohne es sich dabei auch nur einmal genau ANZUSCHAUEN! Ich komme mir vor wie der letzte Depp.
»Du denkst auch, ich bin total blöd, oder?«, frage ich.
»Nein nein«, sagt Richard. »Es muss doch nicht jeder alles können.
Dafür kannst du andere Sachen ganz prima!«
Ich bin erleichtert. »Was denn?«, frage ich erwartungsvoll.
Richard öffnet den Mund und schließt ihn nach einer Weile wieder. Ihm fällt offensichtlich nichts ein. Ich frage auch nicht noch mal. »Wo willst du das Regal denn hinstellen?«, will Richard stattdessen wissen und schaut sich um.
»In den Flur«, sage ich, »genau neben die antike Garderobe. Es passt genau hin. Auch von der Holzmaserung her. Und ich habe alles genau ausgemessen!« Ich berste vor Stolz.
Wir gehen in die Diele und ich zeige Richard die Stelle, wo ich das Regal hinstellen möchte. Richard schaut mich nur an.
»Was ist?«, frage ich. »Schau doch!« Ich ziehe das Regal vom Wohnzimmer in den Flur und rücke es genau neben die Garderobe. Richard schaut mich immer noch an. Was ist denn? Sitzt eine Spinne auf meiner Nase? Habe ich vielleicht ein Loch in der Backe, ohne dass ich es weiß? Blute ich aus den Augen?
Richard fragt: »Und wenn ich jetzt gehen möchte?«
Was ist los mit ihm? »Dann geh doch«, sage ich.
Richard greift an die Türklinke und will die Tür öffnen. Die Tür lässt sich nicht öffnen, weil das Regal direkt davorsteht. Ich renne ins Wohnzimmer, werfe mich auf die Couch und fange laut an zu heulen. Richard sucht währenddessen einen geeigneteren Platz für das Regal.
Zwei Stunden später haben wir die dritte und letzte Flasche Prosecco geleert und streiten darüber, ob wir mit Amaretto oder Sherry weitermachen sollen. Wir spielen »Wer zuletzt keine Antwort mehr auf eine Frage weiß, hat verloren« und Richard lässt mich gewinnen (ich weiß, dass er weiß, dass Mozart die Zauberflöte komponiert hat, ich habe die CD bei ihm gesehen), wahrscheinlich, um mir einmal ein Erfolgserlebnis zu gönnen. Ich wanke in die Küche, um die Sherryflasche zu holen. Wo ist sie nur? Da höre ich aus dem Wohnzimmer ein ohrenbetäubendes Geschmetter. Ich rase zurück. Richard ist panisch dabei, die Fensterläden zu schließen, obwohl um 23 Uhr auch nicht mehr nur ein Rest Sonne zu sehen ist.
»Was machs’n du?«, lalle ich, während ich sehe, dass sämtliche Gläser aus meiner Vitrine kaputt auf dem Boden liegen. »Spinns du oda was?« Richard ist völlig aufgebracht. Stammelnd versucht er mir zu erklären, dass eine Straßenlaterne, die direkt in das Fenster leuchtet, zu allem Unglück auch noch in die Vitrine gestrahlt hätte. Das wiederum hätte zur Folge gehabt, dass das Licht von den Gläsern der Vitrine aus ganz plötzlich direkt mitten in Richards Gesicht gestrahlt hätte. Er habe gespürt, wie sich in Sekundenschnelle eine Brandblase auf seiner linken Wange gebildet hätte, und habe dann, um größeres Unheil zu verhindern, schnell auf sichtbare Art und Weise für Abhilfe gesorgt. Es ist zwar keine Brandblase zu sehen, aber ich gehe nicht weiter auf das Thema ein. Meine schönen Gläser.
»’ch kauf dir neue. Vers-prech’s dir«, lallt Richard. Egal. Ich will nur saufen.
Ich weiß ja auch nicht, was mit mir los ist. Alles geht schief. Ich komme mir wie eine Versagerin vor, seit ich denken kann. Das Sprichwort »zwei linke Hände haben« passt zu mir wie der Deckel auf den Topf. Mein erstes bewusstes traumatisches Erlebnis hatte ich mit sechs Jahren. Es waren die letzten Sommerferien vor Schulbeginn, ich war bei meinen Großeltern, und vor mir und den Nachbarskindern lag ein traumhaft langes Wochenende. Wir wollten zelten und ein Baumhaus bauen. Wir bauten erst die Zelte auf und dann das Baumhaus. Da ja alles geheim war, durfte niemand außer uns wissen, wo sich das Baumhaus befand. Stundenlang kletterten wir die Holzleiter von Holgers Vater rauf und runter, um Bretter und Decken zu transportieren. Die Jungs nagelten unbeholfen alles in der Krone einer ungefähr siebenhundert Jahre alten und acht Meter hohen Linde fest und wir Mädels versuchten, mehr schlecht als recht ein Heim zu schaffen. Es war ein herrlicher Samstagnachmittag, die Sonne brannte heiß und wir waren einfach nur glücklich. Und als wir dann endlich die letzten Bretter festgenagelt hatten und alle Decken und Kissen oben waren, jubilierten wir, denn wir mussten jetzt nur noch einmal runter, um die Wasserflaschen und die von den Eltern liebevoll gepackten Picknickkörbe hochzuholen. Ich hatte, wie alle anderen auch, schrecklichen Durst und wollte unbedingt als Erste die Leiter runterklettern. Dummerweise verhakte sich mein linker Fuß an einer Sprosse, die Leiter rutschte weg, kippte nach hinten um und landete auf dem Boden, direkt neben unseren Wasserflaschen und Picknickkörben. Da saßen wir dann in unserem selbst gebauten Baumhaus in der Mittagshitze und heulten und hatten Durst und Hunger und kein Erwachsener wusste, wo wir waren. Die anderen gaben mir natürlich die Schuld und behaupteten, dass wir nun wegen mir alle sterben müssten. Die 12-jährige Veronika aus der Bodestraße 12 beschrieb uns detailgetreu, wie man nach hundert Jahren unsere ineinander verkeilten Skelette in dem heruntergekommenen, vermoderten Baumhaus finden würde, was wir alle mit entsetztem Aufheulen quittierten. Jahre später wurde mir klar, dass sie schlicht aus dem »Glöckner von Notre-Dame« zitiert hat. Seitdem habe ich Angst vor der Szene, in der Gina Lollobrigida und Anthony Quinn skelettiert vor der Kamera liegen, und schalte immer vorher aus. Wie dem auch sei, wir sind nicht gestorben, gegen 21 Uhr fanden uns die Väter von Rolf und Jan und mein Opa, und ich war schrecklich froh, dass sie nicht erst um 22 Uhr gekommen waren, denn es bildete sich in dem Baumhaus eine Art Ku-Klux-Klan gegen mich, in dem beschlossen wurde, dass ich genau um diese Zeit aus dem Baumhaus gestoßen werden sollte, wenn bis dahin keine Hilfe in Sicht war. Wir bekamen alle großen Ärger und durften keine Baumhäuser mehr bauen. Und kein Nachbarskind wollte an diesem Wochenende mehr mit mir spielen. Tja, so sind die Geschichten aus meinem Leben.
Gegen drei Uhr morgens bitte ich Richard zu gehen. Wir haben allen Alkohol getrunken, der in meiner und in Richards Wohnung zu finden war. Richard will nicht gehen. Dauernd behauptet er, mir unbedingt etwas sagen zu müssen. Er kann es mir aber angeblich nur sagen, wenn er eine bestimmte Promillegrenze überschritten hat. Ich frage mich, welche Grenze wir noch überschreiten könnten, und werde langsam wirklich müde. Außerdem muss ich in genau sechs Stunden in der Redaktion sein und weiß nicht, wie ich das alles packen soll. Richard hat gut reden. Er ist Krankenpfleger und hat, weil er nur nachts arbeitet (die Sonne, die Sonne), immer mal wieder »sonderfrei«. So auch heute und die nächsten drei Tage.
»Rischard«, nuschle ich, »ich muss ins Bedd. Bidde geh. Wir könn doch ein andermal weidermachn!«
Richard steht auf und torkelt in mein Schlafzimmer. Ich bin schlagartig nüchtern. Ist es das, was er mir sagen muss? Findet er mich sexuell attraktiv und möchte einmal in seinem Leben eine heiße Nacht mit mir verbringen? Braucht er dazu einen »bestimmten Alkoholpegel«?
Ich setze mich auf und trinke die Reste aus unseren beiden Batida-de-Coco-Gläsern.
Sex mit Richard? Eine Vorstellung, die ich noch nie hatte. Man kann sagen, was man will, unattraktiv ist er nicht, wären da nicht die knallroten Augen, die weißen Haare und die transparentpapierige Haut. Wie groß seiner wohl ist? Ist er beschnitten? Ist er Rechts- oder Linksträger? Breite Schultern hat er und auch eine sehr angenehme Stimme. Außerdem ist er immer für mich da. Ich brauche noch was zu trinken. Nichts mehr da. Ich lecke mit der Zunge über den Couchtisch, Richard hat vorhin ein Glas Portwein umgeschüttet, die eingetrockneten Reste schmecken auch so. Was soll ich tun? Ihm ins Schlafzimmer nachgehen und mich lasziv vor ihm aufs Bett legen, wenn er nicht schon längst drinliegt?
Plötzlich bin ich richtig wild auf Richard. Ich stelle mir vor, wie er mir die Unterwäsche zerreißt und behauptet, ich wäre das Geilste, was ihm je untergekommen wäre. Das sagte er nämlich letztens über seine neue Bohrmaschine, die er bei »Klugkauf« im Sonderangebot ergattert hatte. So einen Enthusiasmus hatte ich noch nie in seiner Stimme gehört! An diesem Tag ist er durchs ganze Haus gelaufen und hat alle Nachbarn gefragt, ob sie Einbauküchen hätten, die noch montiert werden müssen. Leider hatte kein Nachbar eine noch zu montierende Einbauküche parat. Schließlich kam er zu mir. Ich hatte auch keine Einbauküche, aber Richard tat mir so leid, dass ich mit ihm in den Keller gegangen bin und er mir Vorratsregale zusammenschrauben durfte, die seit sieben Jahren unmontiert herumlagen. Danach haben wir uns eine Pizza bestellt und hatten es riesig gemütlich.
Ich stehe auf. Kann ich stehen? Ich kann stehen. Soll ich einfach ins Schlafzimmer gehen? Trägt Richard wohl Calvin-Klein-Slips, aus denen sein Teil fast herausspringt? Ich will es wissen. Zu gern hätte ich vorher meine Straps-Korsage angezogen, aber die befindet sich leider im Schlafzimmer, in dem Zimmer, in dem Richard sich gerade befindet, lüstern, geil, unvorbereitet auf das, was ich ihm jetzt bieten werde! Ich torkele ins Bad und mache die »Entsetzlich«-Beleuchtung an. Soll heißen, dass hier eventuelle Orangenhaut unbarmherzig zum Vorschein kommt. Soll auch heißen, dass hier eventuell entstandene Falten krass ins Auge fallen. Na ja, es geht. Im Schlafzimmer ist es eh dunkel, und Richard ist wahrscheinlich so geil, dass er auf so was wie Falten oder Dellen im Oberschenkel nicht mehr achten wird. Ich schaue in den Spiegel. »Willst du’s wirklich?«, frage ich mich selbst. »Ja, ich will!«, antworte ich mir. Also denn. Raus aus dem Bad, nochmal über den Couchtisch geleckt - jetzt ist aber wirklich nichts mehr da -, und dann stehe ich vor der Schlafzimmertür. Eins, zwei, drei. Soll ich anklopfen, damit er Zeit hat, sich in Positur zu werfen? Soll ich ihm so eventuell die peinliche Situation ersparen, vor meinen Augen seine Zehenzwischenräume mit dem Daumennagel zu reinigen? Möchte ich nach dem Anklopfen einfach hören: »Komm rein, Baby, und mach die Beine breit ...«?
Ich atme durch. Ich bin bereit. Ich öffne die Schlafzimmertür. Es quietscht. Natürlich, warum sollte ich die Tür auch ölen. Mich stört es ja nicht. Plötzlich kriege ich schreckliches Herzklopfen. Was ist, wenn ich ihm nicht genug Zeit gelassen habe? Was ist, wenn er einfach nur auf meinem Bett liegt und schläft? Vorsichtig versuche ich, den Kopf unbemerkt in das Zimmer zu stecken, knalle aber natürlich mit der Stirn gegen das Holz. Mein Gott, was soll’s, denke ich, schließe die Augen und stoße die Tür auf. Niemand von uns sagt etwas. Ob ich wohl blind den Weg zum Bett finde? Nein, nein, Carolin, lieber nicht ausprobieren, womöglich brichst du dir auf den zwei Metern das Schlüsselbein. Was tun?
»Richard«, sage ich leise. »Ich bin hier. Wo bist du?«
»Hier, direkt vor deinem Bett!«, kommt es heiser zurück. Ich jubiliere innerlich.
»Ich komme jetzt zu dir«, stammele ich und taste mich langsam vor. Es ist eine unglaublich erotische Situation.
»Nein«, hält mich Richard auf. »Warte!«
Ich höre ihn zur Tür laufen und den Lichtschalter anknipsen. »Du sollst es im Licht sehen!«
Es? Er meint ja wohl ihn! Umso besser. Das Licht können wir von mir aus anlassen. »Dreh dich um!«, kommt es laut und bestimmt von Richard. »Du sollst es jetzt wissen!« Mein lieber Schwan, der geht ja ganz schön ran. Aber gerne doch, gerne doch drehe ich mich um. »Öffne die Augen!« Auch gut. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, vorher zu sehen, was auf einen zukommt. Langsam halte ich es vor Erregung nicht mehr aus. Ich öffne die Augen. Schreiend taumle ich zurück. Vor mir steht eine Frau mit meinen Kleidungsstücken und meinen hohen Pumps. Die Frau ist stark geschminkt und hat unverschämterweise auch noch meinen Schmuck an. Ihr Busen hängt ziemlich tief und an zwei völlig verschiedenen Stellen. Ich bin fassungslos. Wo ist Richard?
»So, Carolin!«, sagt die Frau. »Jetzt ist es raus. Ich fühle mich als Frau. Ich möchte eine Frau sein. Ich werde mich auch operieren lassen.
Bleiben wir trotzdem Freunde!«
Wir sehen uns ungefähr eine Minute schweigend an. Dann fange ich hysterisch an zu lachen.
Jaja. Ich hatte noch nie Glück mit Männern. Meinen ersten Freund hatte ich mit vierzehn. Er hieß Thorsten und ich habe ihn angebetet wie ein Depp. Hätte Thorsten mir befohlen, als Beweis meiner Liebe zu ihm einen Liter Salzsäure zu trinken - ich hätte es getan. Er merkte natürlich schnell, dass er mit mir machen konnte, was er wollte, und nutzte es schamlos aus. Nach einem guten Jahr verließ er mich dann wegen meiner besten Freundin Babsi und ich redete mir ein, an allem schuld zu sein. Florian, meine nächste große Liebe, hatte wie ein Pascha immer drei Freundinnen gleichzeitig und trug unglaublich viele Goldkettchen an Hals und Armen. Außerdem hatte er sich die Namen aller Exfreundinnen eintätowieren lassen. Es waren sehr viele Tätowierungen. Ich trennte mich von ihm, als er von mir verlangte, mit anderen Männern zu schlafen, bei denen er Schulden hatte. Dass ich das nicht toll fand, konnte er nicht verstehen. Er meinte, das hätte doch mit unserer Beziehung nichts zu tun.
Kapitel 2
Am nächsten Tag melde ich mich krank. Mein Schädel dröhnt, und außerdem muss ich erst mal alles verkraften. Richard hat bei mir übernachtet und schläft noch. Ich habe ihm einige Kleider von mir geschenkt, er hat sich sehr darüber gefreut. Erst mal Kaffee machen. Und Aspirin nehmen.
»Männer sind Schweine, dadada«, summe ich vor mich hin. »Sie wollen alle nur das eine ... dadada, und am nächsten Morgen sind sie fort!« Na, da hab ich ja noch mal Glück gehabt, bei mir ist einer geblieben. Welch absurde Situation. Wieso ziehe ich solche Dinge immer magisch an? Das Telefon klingelt. Wahrscheinlich mein Kollege Henning, der mir nicht glaubt, dass ich wirklich krank bin. Ich verstelle meine Stimme. »Hallo!«, krächze ich in den Hörer.
»Gott sei Dank, du bist zu Hause!«, schreit es. »Du musst sofort kommen. Sofort!«
Es ist Susanne. Wenn Susanne anruft, ist immer etwas passiert. Entweder hat sie sich aus Versehen schmutzig gemacht, was für Susanne eine Katastrophe ist, sie hat eine Schmutz-Phobie, oder aber Michael ist mal wieder spurlos verschwunden.
Michael ist Susannes Mann. Ich habe noch nie einen orientierungsloseren Menschen kennen gelernt. Einmal waren wir zusammen in der Oper und er musste in der Pause zur Toilette. Die Pause war vorbei, Michael kam und kam nicht wieder. Susanne hatte schon fast einen Nervenzusammenbruch und wollte aus der Oper rauslaufen, um ihn zu suchen, wir aber waren der Meinung, dass Michael alt genug wäre, um seinen Platz in der siebten Reihe alleine wiederzufinden. Also setzten wir uns alle wieder auf unsere Plätze. Die Oper begann und Michael war immer noch nicht da. Susanne rutschte hektisch auf ihrem Sitz hin und her. Der Vorhang ging auf und eine Frau im barocken Gewand begann zu singen. Sie trällerte, dass ihr Geliebter sie verlassen hätte und sie den Geliebten auf jeden Fall zurücknehmen würde, was immer auch geschehen möge. »Kohohohomm, kohoho- homm zuuuuuuuuu miiiiiiiir, ihihihich verherzeiheihe dihihir ...«, sopranierte die Dame.
Offenbar war nun geplant, dass der Geliebte aus einem Holztor hervortreten und reumütig vor ihr auf die Knie fallen sollte. Stattdessen kam plötzlich Michael aus einer improvisierten Rosenhecke und fragte verwirrt: »Wo ist das Parkett?«
Ein erstauntes Raunen ging durch den Saal. Die Dame hörte auf zu singen, der zurückzunehmende Liebhaber trat nun auch auf die Bühne. Höflich schüttelte Michael ihm die Hand und stellte sich vor. Der Liebhaber war überfordert mit der Situation und sang: »Nur mit diiir alleiheihein kann ich glücklich seiheihein ...«
Michael wich entsetzt vor ihm zurück und hob abwehrend beide Hände. »Nicht!«, rief der Liebhaber. Michael lief desorientiert weiter rückwärts.
»Halt!«, kam es nun auch von der Sopranistin. Michael hörte auf niemanden, stürzte rückwärts in den Orchestergraben und begrub drei Cellospieler unter sich. Wir saßen mit offenen Mündern in unserer Reihe sieben. Michael schrie laut auf, offensichtlich hatte er sich verletzt. Gero und ich stürzten nach vorne, Susanne fing laut an zu heulen. Den Rest des Abends verbrachten wir dann alle im Krankenhaus. Michael musste operiert werden, er hatte sich das Wadenbein gebrochen. Seitdem waren wir nie mehr zusammen in der Oper.
»Was ist?«, frage ich Susanne mit normaler Stimme.
»Bitte, Carolin«, sagt sie. »Michael fliegt morgen zu einem Kongress nach London und hat keinen einzigen Anzug mehr. Er behauptet, ICH hätte sie weggeworfen, ja als ob ich Anzüge wegwerfen würde! Ich glaube eher, dass er sie mal in einer klaren Minute in die Reinigung gebracht hat und den Zettel verschlampt hat. Natürlich weiß Michael heute nicht mehr, in WELCHE Reinigung er sie gebracht hat, ganz zu schweigen davon, dass er nie zugeben würde, sie jemals in eine Reinigung gebracht zu haben. Ich weiß ja auch nicht. Ich mache den Schrank auf und kein Anzug hängt darin. Vielleicht hat er sie ja auch jemandem geschenkt, der geklingelt und nach dem Weg gefragt hat!« Ich seufze. »Und ich soll jetzt mit Michael einen Anzug kaufen gehen oder was?«, nehme ich Susanne die Frage vorweg.
»Danke!«, sagt sie erleichtert. »Du bist wie immer ein Schatz! Kannst du um drei hier sein?«
Na klar bin ich um drei Uhr da. Mit Michael einen Anzug kaufen gehen. Toll. Das kann was geben. Lieber würde ich mit hyperaktiven Drillingen alleine ins Phantasialand fahren. Oder eine Woche lang freiwillig öffentliche Toiletten putzen. Um zwei ruft Susanne mich wieder an, um mir zu sagen, dass ich Michael in der Klinik abholen soll. Das wird ja immer schöner. Michael ist Pathologe. Ich habe ihn schon mal mit Susanne abgeholt, da hat er mir unbedingt seinen Arbeitsplatz zeigen wollen. Wir fuhren mit dem Aufzug ins Kellergeschoss, und als die Tür des Fahrstuhls aufging, schlug mir ein entsetzlicher Geruch von Verwesung und Formaldehyd entgegen. Wir gingen in einen Raum, in dem ungefähr 50 Studenten an 50 nackten Leichen herumschnippelten. Mir wurde schlecht, aber Michael zwang mich, zu »seiner Leiche« zu gehen, auf die er ganz besonders stolz war. Er zeigte mir die Leber und die Milz und hielt mir zur Krönung wie Hannibal Lecter das Herz des Mannes unter die Nase.
»Infarkt!«, sagte er theatralisch. »Sehe ich auf einen Blick. Hier, die geplatzten Arterien. Ging ganz schnell!«
»Toll!«, würgte ich hervor.
»Interessiert es dich?« Michael war ganz aufgeregt. »Ich kann dir auch
noch Nummer 24 zeigen, die hat ein Raucherbein!«
»Nein danke!«, brachte ich nur noch hervor. Seitdem habe ich bei jeder Zigarette Leichen vor den Augen.
Punkt 15 Uhr stehe ich, immer noch verkatert, vor dem Kiosk im Krankenhaus, in dem Michael arbeitet. Er kommt um halb vier. Ich winke, aber er rennt an mir vorbei. Was sonst. Ich laufe ihm hinterher, rufe »Michael, Michael«, und endlich bleibt er stehen.
»Carolin! Was machst du denn hier?«
Ich erkläre ihm, dass wir jetzt zusammen zu Hertelhuber gehen und einen Anzug kaufen, da er ja zu einem Kongress muss. Verwirrt blickt er mich an, folgt mir aber brav zum Auto. Innerlich verfluche ich Susanne. »Das kostet dich zwei Essen im Rimini«, denke ich grimmig. Wir fahren los und kaufen den Anzug. Es ist eine Katastrophe. Man könnte meinen, Michael sei farbenblind. Er besteht darauf, eine nachtblaue Satinhose zu einem karierten Oxfordsakko mit Lederflicken an den Ellbogen anzuziehen. Der Verkäufer und ich reden mit Engelszungen auf ihn ein, aber er stampft wie ein trotziger Junge mit dem Fuß auf und behauptet, wir hätten keinen Geschmack. Um 18 Uhr verlassen wir das Geschäft. Ich bin fix und fertig, habe Michael aber dazu bringen können, eine zweiteilige Kombination zu kaufen. Dafür muss ich ihm versprechen, Susanne nicht zu erzählen, dass er seine Kreditkarte verschlampt hat. Das stellten wir nämlich gegen Ladenschluss fest, als der Verkäufer entnervt fragte, ob wir bar oder mit Karte oder überhaupt zu zahlen gedenken. Ich musste den Zweiteiler letztendlich bezahlen und bin total wütend. Michael behauptet auf der ganzen Heimfahrt, dass Susanne oder einer seiner Studenten ihm die Karte gestohlen hätten. Aber sicher doch! Ich setze Michael zu Hause ab und brause wütend heim.
Leise schleiche ich die Treppen hoch, in der Hoffnung, dass Richard mich nicht hört. Ich kann mich nicht schon wieder betrinken. Soll er doch heute Abend meine ausrangierten Kleider anprobieren und sich schminken. Aber bitte ohne mich! Fast lautlos schließe ich meine Wohnungstür auf. In diesem Moment geht das Licht im Korridor an. »Frau Carolin, Frau Carolin!«
Ich sinke in mich zusammen. Frau Eichner hat mir gerade noch gefehlt. Magdalena Eichner ist 74, logischerweise Rentnerin, und bekommt alles mit, was in unserem Hause so abgeht. Bei ihr in der Wohnung sitzt angeblich der Schwamm und manchmal denkt sie, Geister würden in ihren vier Wänden wohnen. Außerdem hat sie schon ungefähr fünfzigtausend Außerirdische von ihrem Küchenfenster aus beobachtet. Einmal klingelte sie mich nachts aus dem Bett, weil Ufos auf ihrem Fensterbrett landen wollten. Nachdem ich schlaftrunken in ihre Wohnung getaumelt war, stellte sich heraus, dass es sich bei den vermeintlichen Ufos um einen vom Licht irritierten Mückenschwarm handelte. Andererseits ist Frau Eichner unglaublich hilfsbereit und putzt einmal in der Woche meine Wohnung. Ich mag sie sehr, obwohl sie eine Nervensäge ist.
»Was ist denn?«, frage ich lustlos.
Frau Eichner kommt mit Hausschlappen und Lockenwicklern die Treppe hoch. »Frau Carolin, Sie glaubes net!«, legt sie los. »Heut war en Mann da, der hat behauptet, er käm von de Stadt und müsst bei mir die Zähler ablese, dabei war im letzte Jahr doch schon einer da!« »Aber die kommen doch immer einmal im Jahr«, sage ich, »das ist doch ganz normal!«
Frau Eichner wird rot. Sie wird immer rot, wenn sie sich aufregt. »Aber der Mann heut war so komisch. Isch mein, der hätt noch e anner Person in sisch gehabt. Der war so genervt un hat als gesacht, isch tät misch anstelle!«
Das glaube ich wiederum gern, weil Frau Eichner sich immer anstellt. »Was ist denn jetzt das Problem?«, will ich wissen.
»DER MANN HAT GESACHT, ER WILL WAS ZU TRINKE!!!«, brüllt Frau Eichner im Hausflur los.
Erschrocken zerre ich sie in meine Wohnung und schließe die Tür.
»Isch han em was zu trinke gebbe, dann hat er die Zähler abgelese und hat gesacht, des wird en deure Spaß! Des wor mer zu viel, Frau Carolin, da han isch gesacht, des sehn mer dann. Da sacht er, er müsst auf die Toilette!«
»Ja und?« Bitte, bitte, geh doch endlich!
»Isch han gesacht, das gäht nett. Da hat er gesacht, jeder Bürger wär verpflichtet, en annere uff die Toilett gehe zu lasse. Un da geht der Mann einfach uffs Klo.«
Frau Eichner führt wirklich ein ungemein aufregendes Leben.
»Ich bin müde, Frau Eichner«, sage ich und will sie zur Tür hinausschieben, aber sie schüttelt mich ab.
»Es Schlimmste kommt ja noch!«, schreit sie.
»Ja, was denn noch?«
Frau Eichner, Frau Eichner, wenn ich Sie nicht hätte. Wahrscheinlich hat sie den armen Stadtwerkemenschen von hinten erschlagen, weil er ihre Toilette benutzt hat, ohne auf ihr Nein zu hören. Frau Eichner hält die Hände vor ihr Gesicht und fängt laut an zu heulen. Schnell schließe ich die Tür wieder. Sie wirft sich in meine Arme.
»Ich han de Mann erschlache!«, schreit sie. »Von hinne! Mit erer Milschkann!«
Mir wird schwarz vor Augen.
»Des ganze Blut. So e Sauerei! Frau Carolin, komme Se, komme Se mit, ich hab schon en Schlachtplan endworfe. Mir mache des wie im Tatort. Mer lasse die Leische verschwinne. Oder mer friern se ein. Oder mer verbrenne se im Ofen. Oder mer ziehn ihn runner in die Waschküsch un betoniern ihn da ein. Isch han Werkzeusch da, isch han alles da! Bitte! Isch trau misch auch alleine net mer in mei Wohnung. Isch han im Keller gewort, bis Sie gekomme sin!« Frau Eichner springt im Kreis um mich herum wie ein aufgescheuchter Truthahn. Ich kann sie kaum beruhigen. Ein Toter, denke ich nur. Was kann denn in dieser Woche noch alles passieren? Was soll ich nur tun? Susanne anrufen? Bloß nicht, die ist mit solch einer Situation mit Sicherheit überfordert. Die Polizei? Natürlich, was denn sonst. Ich sage: »Wir rufen die Polizei an!«
»Nein!«, kreischt Frau Eichner. »Wolle Se misch dann besuche un durch e Glasscheib mit mer schpresche, un wolle Se sisch angugge, wie isch von Woch zu Woch mehr zugrunde geh?« Sie fällt vor mir auf die Knie. »Bitte, bitte. Isch bin 74 Jahrn, isch han in meim Lebe keim Mensche was zuleid getan. Isch war nur für annere da. Isch han geputzt, gewasche, gekocht un war a gut Mutter! ISCH WILL NET IN DE KNAST!!!«
Ihre Stimme überschlägt sich. Ich bekomme es mit der Angst zu tun. Wir stehen im Flur, im Prinzip kann uns jeder Nachbar hören. »Schsch!«, mache ich und halte den Finger vor den Mund. Frau Eichner wird leiser und weint vor sich hin. Ich ziehe sie hoch und verfrachte sie erst mal in meine Küche. Ein Schnaps. Ich brauche einen Schnaps, obwohl ich immer noch Kopfweh von der vergangenen Nacht habe. Panisch renne ich ins Wohnzimmer. Leere Flaschen und kaputte Gläser liegen verstreut im ganzen Raum herum. Natürlich, Richard und ich haben ja gesoffen wie die Haubitzen. Und aufgeräumt ist auch noch nicht. Das ist jetzt auch egal. Mist. Kein Alkohol im Haus. Dann koche ich halt Kaffee. Oder Tee. Als ich zurück in die Küche komme, sitzt Frau Eichner auf meinem Küchentisch und macht »Ommmm, ommmm«.
»Was soll das denn?«, frage ich verwirrt.
»Des is gud für mei Nerve!«, sagt sie. »Isch tu in de Bauch atme, da gehen die Verspannungen weg und da komm isch wieder zu mer ... Ommm, ommm!«
Gleichmäßig wiegt sie ihren Oberkörper hin und her. »Des han isch von meiner Enkelin gelernt. Die geht nämmlisch in Esoterik-Kurse ... ommm!«
Wie schön, dass Frau Eichner sonst keine Probleme hat.
»Wir müssen jetzt mal in Ihre Wohnung gehen und nachsehen«, sage ich barsch. »Der Tote verschwindet bestimmt nicht von selbst!« »Gehen Sie gugge, Frau Carolin, bidde!«, fleht Frau Eichner. »Isch tu des net verkrafte!«
Ach, das ist ja interessant, aber ich soll das verkraften. Was soll ich denn heute noch alles verkraften?
»Sie kommen mit!«, befehle ich und ziehe sie vom Küchentisch | runter. Sofort fängt sie wieder an, laut zu heulen.
»Isch kann nett. Isch muss erst ferdisch atme, sonst nutzt mer die ganz Übung nix! «
»Frau Eichner, wir gehen jetzt runter in Ihre Wohnung und schauen nach dem Toten. Sie können nicht erst jemanden erschlagen und danach Entspannungsübungen machen!« Jetzt bin ich wütend. Und müde. Und verzweifelt. »Wir schauen jetzt unten bei Ihnen, was wir mit dem Toten machen!«
»Mit welchem Toten?«
Entsetzt drehe ich mich um. Vor mir steht Gero. Gero Krauss. Mein allerbester Freund. Gero ist schwul und dafür liebe ich ihn. Wir kennen uns seit 10 Jahren, er hat mich damals von der Straße aufgelesen, nachdem ich mit dem Fahrrad gestürzt war. Quasi hat er mir damals das Leben gerettet, denn direkt nach ihm kam ein 12-Tonner mit überhöhter Geschwindigkeit die Bundesstraße entlanggerast. Er fuhr mich ins Krankenhaus und kollabierte im Behandlungsraum, als meine Jeans vom Arzt aufgeschnitten wurde und darunter eine riesige Platzwunde am Knie zum Vorschein kam. Gero kann nämlich kein Blut sehen. Ich wartete dann, bis er verarztet war, und wir fuhren gemeinsam eine Pizza essen und sind seitdem die dicksten Freunde. Aber was tut Gero hier und vor allem, wie kommt er in die Küche? »Die Tür war offen«, sagt Gero. »Habe ich irgendwas verpasst? Haben wir eine Leiche im Keller? Ha!«, lacht er ob dieses Wortwitzes.
Er stellt zwei Taschen ab. Ich sehe frisches Gemüse, Nudeln und allerhand anderes Zeug. Richtig! Wir wollten ja heute zusammen kochen und dann zum vierzigsten Mal »Titanic« schauen. Wir können beide ganze Passagen synchron mitspielen und -sprechen. Ich bin Rose de Witt Bukater, er ist Jack Dawson oder manchmal auch Caldon Hockley, Roses Verlobter. Am ergreifendsten ist für uns die Szene, in der Jack und Rose, nachdem die Titanic untergegangen ist, im Wasser vor sich hindümpeln, sie auf einer nicht versunkenen Holztür der ersten Klasse liegend, er im Atlantik treibend vor ihr. Sie schläft oder ist im Halbkoma wegen der Kälte oder was auch immer, kriegt jedenfalls nichts mit, und er stirbt währenddessen. Sie wacht auf, weil ein Offizier aus einem Rettungsboot ruft: »Ist da wer?« Sie sieht, dass Hilfe naht, Jack aber tot ist und seine Hände wegen der Minustemperaturen an der Holztür festkleben. Sie sagt zu Jack: »Ich werd es nie vergessen. Ich versprecht dir«, löst seine Hände und lässt den armen Leonardo di Caprio zu den Fischen tauchen. Da müssen wir beide immer heulen. Einmal sagte Gero zu mir während dieser Szene: »Ich wäre auch für dich gestorben!«
Grundgütiger! (Das sagte Rose, als sie von Mr. Andrews, dem Schiffsbauingenieur, erfuhr, dass die Titanic in spätestens zwei Stunden auf dem Grund des Ozeans liegen würde.) Aber so ist Gero eben. Ein Freund auf ewig. Hoffentlich.
Meine Kontaktlinsen brennen in den Augen. Hektisch blicke ich zu Frau Eichner. Die heult immer noch.
»Was ist denn hier los?«, fragt Gero. »Klärt mich mal einer auf? Ich habe Hunger.« Nicht für tausend Euro könnte ich jetzt einen Bissen essen.
»Hast du Wein dabei?«
»Klar!« Gero packt vier Flaschen Bordeaux aus, eine reiße ich ihm sofort aus der Hand. Zwei Minuten später trinken wir das erste Glas. Dann finde ich den Mut, Gero zu erzählen, welches Problem Frau Eichner hat. Er steht auf. »Kommt mit!«
»Ei, wo wolle Se dann hin, Herr Krauss, was wolle Se dann mache?«, lamentiert Frau Eichner.
»Wir werden jetzt in Ihre Wohnung gehen und nachsehen!« »Geht ihr zwei, isch net. Isch bleib hier und tu putze. Gell, Frau Carolin!«
Von mir aus. Aber erst noch ein Glas Wein. Auf ex. Gero und ich gehen Hand in Hand ein Stockwerk tiefer und schließen Frau Eichners Wohnungstür auf. Plötzlich finde ich das alles total aufregend und bekomme schreckliches Herzklopfen. Aus der Wohnung dringt ohrenbetäubender Lärm. Natürlich, Frau Eichner hat ja immer den Fernseher laufen. Wir gehen ins Bad. Nichts außer Blut. Hat sich der Tote noch ein paar Meter weit schleppen können? Wo könnte er sein? Wir schauen ins Schlafzimmer und in die Küche. Kein Toter zu sehen. Dann öffnet Gero die Wohnzimmertür. Der Tote sitzt auf dem Sofa und hat vor sich auf dem gekachelten Couchtisch Bierdosen stehen. Im Fernsehen läuft Fußball. Irgendjemand schießt ein Tor, was der Tote zum Anlass nimmt, aufzuspringen und laut zu schreien. Da erblickt er uns.
»’n Abend!«, sagt er. »War das Ihre Oma, die mir mit der Kanne einen übergebraten hat? Mit der ist nicht gut Kirschen essen!« Drehen jetzt hier alle durch?
»Warum sind Sie denn überhaupt noch hier?« Gero ist fassungslos. »Weil mich hier keiner beim Fernsehgucken stört!«, grölt der Tote. »Und die Alte ist ja abgezischt. Mein lieber Schwan!«
Er greift sich an den Kopf. Irgendwie hat er ein Handtuch um seine Wunde gewickelt. Ich schaue mir die ganze Sache näher an. Frau Eichner hat wirklich ganz schön zugeschlagen. Aber allzu schlimm scheint es ja dann trotzdem nicht zu sein. Langsam beruhige ich mich wieder. »Dann können wir ja jetzt kochen«, beschließe ich.
»Ich könnte auch was vertragen«, meint der Tote und macht den Fernseher aus. »Hab zuletzt zum Frühstück eine Fleischwurst gegessen!« Eine halbe Stunde später sitzen Gero, Frau Eichner, der Tote und ich an meinem Küchentisch und essen Gemüsespaghetti mit Kalbfleisch. Die vier Flaschen Bordeaux werden auch leer und dann geht Frau Eichner noch einmal in ihre Wohnung und holt Nachschub.
Der Tote entpuppt sich als ein genialer Stepptänzer und plättelt in meiner Küche »Im singing in the rain«. Wir singen alle mit und haben eine Menge Spaß. Gegen halb drei ruft der Tote sich ein Taxi, Frau Eichner schläft am Küchentisch ein, und Gero und ich fallen todmüde ins Bett.
Kapitel 3
Ich hasse nichts mehr als einen Kater. Dagegen sind meine Migräneanfälle ein Witz. Am nächsten Morgen habe ich das Gefühl, dass mein Kopf in tausend Stücke zerspringt. Ich setze mich auf und spüre tausend Messer, die sich in meine Hirnmasse bohren. Gero schläft neben mir mit offenem Mund, aus dem er auf mein Spannbetttuch sabbert. Eklig. Kein Wunder, dass er keinen anständigen Mann abkriegt. Geros Freunde beziehungsweise Bettpartner waren bis jetzt der absolute Horror. Einer war der völlige Sadomasotyp und fesselte Gero in dessen Wohnung auf den Küchentisch, um dann nach Hause zu gehen. Der arme Gero lag einen ganzen Tag lang bäuchlings und schrie um Hilfe, die aber erst abends nahte, als die Nachbarn von der Arbeit heimkamen. Es war eine sehr peinliche Situation für Gero. Nach dieser Geschichte kündigte Gero die Wohnung und zog in einen anderen Stadtteil.
Ich schüttle ihn. »Hmmmpf!« Er zieht sich die Bettdecke über den Kopf. Von mir aus. Soll er krankmachen, ICH muss arbeiten. Wenn ich heute nicht in die Redaktion gehe, kann ich das ganze Wochenende arbeiten. Aus der Küche kommt der Geruch von frischem Kaffee. Herrlich. Frau Eichner ist also entweder noch oder schon wieder da. Sie hat ja einen Schlüssel, weil sie bei mir sauber macht. Ich versuche, aus dem Bett zu steigen, ohne mich zu übergeben. Erst mal eine Tasse Kaffee.
»Guten Morgen!!!«, trällert mir Frau Eichner entgegen. »De Disch is gedeckt. Ich han aaach schon Brötscher g’holt! Des war e Nacht!« Allerdings. Ich setze mich erst mal. Halb acht. Noch Zeit. Zeitung. Kaffee. Kein Brötchen. Ich kann nicht mehr. Noch so eine Nacht mit so wenig Schlaf werde ich AUF GAR KEINEN FALL mehr verkraften. Heute Abend liege ich um sieben im Bett. Nein, um sechs. Ich werde auf der Arbeit behaupten, dass wir einen Wasserrohrbruch hatten und um sechs der Klempner kommt. Wenn ich dann noch lebe. Frau Eichner springt herum wie ein Wiesel. Sie scheint keine Kopfschmerzen zu haben. Vielleicht ist es ja so, dass man, je älter man wird, umso mehr verträgt. Nee. Ich vertrage ja immer weniger, das kann nicht stimmen.
»Wo is dann de Herrn Krauss? Dud er noch schlaafe?«, fragt sie. »Nein!«, brummelt Gero. Er steht mit zerzaustem Haar in der Tür. »Aber ich will gleich weiterschlafen! Tust du mir einen Gefallen, Carolin, Liebste?«
Ich verdrehe die Augen und äffe ihn innerlich nach: >Kannst du auf der Baustelle anrufen, dass ich krank bin? Bitte! Mir glauben die nichts!< Und wenn ich dann sage, ruf doch selber an, ist er tödlich beleidigt und sagt: >Ist gut, ist gut, aber du willst noch mal was von mir.. .< Da ich aber letztendlich doch auf der Baustelle anrufen werde, spare ich mir das gewohnte Procedere. »Gib’s Telefon!«
Gero hat es natürlich gleich mitgebracht. »Ich will aber mithören!« Das kann ich nicht ausstehen, und das weiß er. Er presst sein Ohr immer so fest an den Hörer, dass ich kaum mehr was verstehe. Ich wähle die Nummer von seinem Chef. »Höbau Müller!!!«, brüllt es. Warum können diese Menschen nicht normal sprechen? Warum müssen sie schreien?
»Guten Morgen, Schatz hier. Ich bin die Nachbarin vom Herrn Krauss und wollte nur Bescheid geben, dass er heute leider nicht kommen kann. Er ist sehr erkältet und ...« Am anderen Ende der Leitung schnaubt es. Stille. »Hallo!«, sage ich.
Der Mann von Höbau mit dem Namen Müller holt Luft. »Wenn isch des dem Scheff sach, dreht er dursch!«, brüllt er. »Die Schwuchtel is jetzt schon des dritte Mal krank innerhalb von zwei Woche!« Entsetzt starre ich Gero an. Woher wissen sie, dass er schwul ist? Er gestikuliert mit beiden Händen, aber ich verstehe nicht, was er meint. »Isch hol de Scheff!«, meint Höbau-Müller. »Des kann so net weidergehe! SCHEFF!!!«, schreit er, wahrscheinlich über den Hof. »Unser Tucke Geraldine hat sisch mal wieder zu oft de Nickel verchrome lasse!«
Geraldine? Verstehe. Sie wollen Gero fertig machen. Der ist mittlerweile aufgesprungen und schreibt hektisch etwas auf ein Blatt Papier. Ich reiße es ihm aus der Hand. HABEN MICH AUF PARKPL GES steht da. Auf dem Parkplatz gesehen? Ja und? Ich blicke ihn verständnislos an. Was soll denn daran so schlimm sein? Verzweifelt macht Gero eine eindeutige Handbewegung. Alles klar. Ich konzentriere mich wieder auf den Höbau-Müller.
»Hallo?«, frage ich.
Bei Höbau-Müller ist inzwischen die Hölle los. Ich höre ungefähr siebzehntausend Stimmen im Hintergrund diskutieren. Ist da vielleicht ein Streik im Anmarsch? »Ich lege auf!«, sage ich zu Gero. Der sinkt auf die Knie. »Bitte nicht!«, formen seine Lippen. Meine Güte!
»Hallo!!! Hallo!!! Wo is de Bengel???«
Das muss der Chef sein.
»Ja, guten Morgen, mein Name ist Carolin Schatz, ich bin die Nachbarin von ...«
»Hörn Se uff mit dem Quatsch!«, schreit der Mensch. »Sie sin im Leebe net die Nachbarin. Wo issen unser Mädsche?« »Welches Mädchen?« Ich bin irritiert.
»Ei, unsern Schwule! Hat er wieder zu viel Vaseline verbraucht
oder was?«
Wie asozial. Ich sage kalt: »Hören Sie, Herr Krauss ist krank. Er wird heute nicht kommen. Ich verbitte mir diese Unterstellungen und vor allen Dingen diesen Ton!«
Brüllendes Gelächter bei Höbau. »Einer geht noch, einer geht noch rein!«, singt man dort gruppendynamisch im Chor. Der arme Gero. Er hat bestimmt kein einfaches Leben dort. Ich lege den Hörer auf. In diesem Moment fängt Gero lautlos an zu weinen. Ich brauche erst mal noch einen Kaffee.
»Was ist denn bei dir auf der Arbeit los?«, frage ich. »Woher wissen die denn, dass du schwul bist?«
»Die haben mich auf dem Parkplatz hinter dem Wiesental gesehen. Also zwei von denen. Du erinnerst dich doch bestimmt noch an Hektor.« Verheult blickt er mich an. Ich überlege. Hektor. War das nicht dieser entsetzliche Brummifahrer, der siebenhundert Kilo wog?
»Der Dicke?«, frage ich.
»Genau«, heult Gero, »und der hat auf Outdoorsex gestanden. Und da wollte er eine Nummer am Auto schieben. Und ich hab ja gesagt. Und dann kamen zwei von der Baustelle vorbei, haben angehalten und uns gesehen, und was glaubst du, was da los ist seitdem bei mir in der Firma!!!« Ich kann es mir lebhaft vorstellen. »Ich werde gemobbt!«, weint er. »Letztens haben die mir einen Dildo hingestellt und eine Ölflasche daneben, und alle haben gelacht. Dann haben sie auch mal versucht, mir die Hose runterzuziehen!«
Er heult immer lauter. Ich bin entsetzt. Das ist ja furchtbar. »Deswegen hast du so oft krankgemacht in letzter Zeit, stimmt’s?« Gero nickt. Gott, wie tut er mir leid. »Jetzt geh erst mal schlafen und kurier dich aus. Ich muss in die Redaktion. Heute Abend reden wir weiter.« Ich lege Gero in mein Bett und decke ihn zu.
»Kussi!«, sagt er. »Zwei Kussis!«
Ich küsse ihn rechts und links auf die Backen und gehe wieder in die Küche.
Frau Eichner ist auch wieder aufgetaucht und legt Wäsche zusammen. Sie verspricht mir, Gero was Leckeres zum Essen zu kochen, wenn er wach wird. Jetzt muss ich mich total beeilen. Natürlich komme ich trotzdem zu spät.
Ich arbeite beim Radio. Hört sich toll an, was? Soll ich Ihnen was sagen? Es ist auch toll. Meistens jedenfalls. Wir sind ein tolles Team, wer bei uns arbeiten darf, bestimmen wir alle zusammen, und wir unternehmen auch alle miteinander privat ziemlich viel. Dann trinken wir alle miteinander ziemlich viel. Manchmal habe ich Angst, schon eine Halbalkoholikerin zu sein, und sehe mich in einer Selbsthilfegruppe mit lauter rotnasigen Mittfünfzigern mit karierten Hemden und gelben Augäpfeln sitzen, um dann aufzustehen und zu sagen: »Ich heiße Carolin und bin Alkoholikerin!« Aber ich tröste mich immer wieder damit, dass ich mir sage, dass es auch Tage gibt, an denen ich überhaupt keinen Alkohol zu mir nehme. Und richtige Alkoholiker trinken ja angeblich schon morgens Parfümflaschen leer, wenn nichts Trinkbares mehr im Hause ist. Das ist mir noch nie passiert.
Der Hauptpförtner scheint eine schlechte Nacht gehabt zu haben; er blickt extra nicht von der Bildzeitung auf, als ich vor der Tür stehe. Mein Klopfen und Rufen ignoriert er. Schließlich werde ich böse und kratze mit meinem Autoschlüssel an die Scheibe, woraufhin er »Ei, sehn Se dann net, dass die Dür offe is?« durch den kleinen Lautsprecher brüllt.
Entschuldigungen murmelnd haste ich durch die Eingangshalle. Alle sind schon da. Hoffentlich sieht mich keiner, was aber quasi unmöglich ist, da alle Büros verglast sind. Natürlich erblickt Henning mich sofort und kommt mir schnurstracks entgegen.
»Mit wem hast du geschlafen?«, fragt er gierig. »Wie kommst du denn darauf?«, frage ich zurück.
»A warst du gestern krank und b hat der Ben vor einer Viertelstunde bei dir zu Hause angerufen und DA GING EIN TYP ANS TELEFON!!!« Ben schießt um die Ecke. »Der war noch ganz verpennt!«, ruft er.
Ja, ist denn das zu fassen! Hat man denn in diesem Saftladen überhaupt keine Privatsphäre mehr? Müssen alle darüber informiert werden, dass man seit einer Woche auf seine Tage wartet, ’ wann wo ein Muttermal wegoperiert wird und wie der letzte One-Night-Stand sich angestellt hat (»Stellt euch vor, Gaby hat im >Living< einen abgeschleppt und hat die ganze Nacht mit ihm I I gebumst. Der konnte zwölf Mal hintereinander! Gaby hat gesagt, so gut hat es ihr lange keiner mehr besorgt!« »Nein, wer war das denn?« »Irgendein Christoph. Von Klöthe und Schramm, so ein Werbefuzzi!« »Mit dem hatte Ina auch schon was!« »Was? Du erzählst mir SOFORT, wann das war!«)? Und so weiter. Ich gebe es auf. Es ist sowieso sinnlos. Ben und Henning stehen vor mir wie Schießhunde. »Kann ich mich vielleicht erst mal setzen?«
Sie nicken gnädig.
»Ohne Kaffee kann ich gar nichts erzählen«, sage ich entnervt.
Sofort stürzt Ben zur Kaffeemaschine. »Wehe, du fängst an zu erzählen, bevor ich wieder da bin!«, droht er mir im Laufen. »Carolin hatte Sex!«, brüllt er durch die Redaktion. Alles schießt von seinen Sitzen hoch. Ich bin verzweifelt. Sie erwarten natürlich jetzt alle die Riesenstory. Und wenn ich was von Richard und Transvestit und einem vermeintlichen Toten und dem schwulen Gero und Höbau Müller erzähle, glaubt es mir eh keiner. Ich entschließe mich, etwas von einer heißen Nacht zu schwafeln. So was wird immer gerne gehört und geglaubt. (»48 Zentimeter. Ich werde verrückt!« »Er hat tatsächlich deine Beine an der Küchenlampe festgebunden und dann Geflügelwurst von deinem Körper geschleckt?« »Er hat so laut gestöhnt, dass die Pfandflaschen von der Spüle gefallen sind?«) Da kommt Ben mit dem Kaffee. Entspannt lehne ich mich zurück und lege los.
Um 18 Uhr habe ich alles weggewurstelt, was ich mir für heute vorgenommen habe. Gero hat zwischenzeitlich angerufen und gefragt, was ich heute Abend mache. Schlafen, Gero, schlafen. Ich räume meinen Schreibtisch auf und möchte gehen, aber Henning kommt gerade von einem Außentermin und fuchtelt mit den Händen herum. »Was ist heute?«, fragt er beleidigt.
»Was soll heute sein? Heute ist Freitag«, sage ich mürrisch.
Henning verschränkt die Arme. »Du hast mir VERSPROCHEN, dass du heute Abend mit mir zu der Vernissage von Kalodiri Monasidumo Schmidt kommst!«, sagt er herrisch.
Wer ist Kalodiri Monasidumo Schmidt? Dunkel erinnere ich mich an eine entsetzlich aufgemachte Einladungskarte, auf der keine Buchstaben standen, sondern auf der in Zeichnungen erklärt wurde, welche Ausstellung einen wann und wo erwarten würde. Ich hasse Vernissagen, habe Henning damals aber wirklich versprochen, mit ihm dort hinzugehen. Henning liebt alles, was irgendwie »trash« und »hip« und »in« ist. Er verbringt sein halbes Leben damit, Abende mit arroganten Menschen zuzubringen, die glauben, die Schöpfer des Universums zu sein. Ich hingegen hasse solche Typen. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich selber ganz und gar nicht »trash« und »hip« finde. Aber ich kann Menschen nun mal nicht ausstehen, die ihre Sektgläser kaum in der Hand halten können, weil so viele Cartier-Armbänder dranhängen. Wie dem auch sei. Versprochen ist versprochen. Wieder kein ruhiger Abend. Ich habe Hunger. »Da gibt es mit Sicherheit genug zu essen«, beruhigt mich Henning. Das will ich hoffen, mir hängt der Magen in den Kniekehlen.
Als wir in der Galerie »Geschwader« ankommen, könnte ich kotzen. Eine Million dünne Models in schwarzen hautengen Dolce & Gabbana-Kleidern und - hahaha, hab ich’s nicht gesagt - mit kiloweise Schmuck. Und lauter Kerle mit zurückgekämmten Haaren und Handys, in die sie ununterbrochen reinschreien: »Nein, wir verkaufen erst ab drei Millionen!!!« »Wir versuchen, die Fusion mit Schreier und Partner morgen hinzukriegen!!!« Derweil stehen die Damen gelangweilt herum und starren mit ihren perfekt geschminkten Augen auf ihre perfekt manikürten Fingernägel. Natürlich schauen alle auf uns, als wir zur Tür hereinkommen. Ich fühle mich entsetzlich deplatziert.
Dieses Gefühl wird noch verstärkt, als drei Magersüchtige mich mit hochgezogenen Augenbrauen von oben bis unten mustern. Ich konnte mich noch nie gut anziehen. Hauptsache bequem - und das sieht man auch heute. Jeans passen immer, denke ich jeden Tag. Außerdem habe ich nicht das Geld für Designerklamotten. Leider habe ich aber auch nicht genug Selbstbewusstsein, um dazu zu stehen! Sofort fühle ich mich unwohl und fange an zu schwitzen. Da fällt mir ein, dass ich heute Morgen noch nicht mal Deo benutzt habe. Und geschminkt bin
ich auch nicht. Wo ist eigentlich Henning? Er hat sich natürlich sofort unter die »wichtigen« Leute gemischt und beachtet mich nicht mehr. Dann suche ich eben alleine das Büfett. Ich könnte sterben für kleine Frikadellchen und Nudelsalat. Nachdem ich mich durch die Models gezwängt habe, finde ich es schließlich. Und das soll Essen sein? Verwirrt blicke ich auf mehrere schwarze Röllchen, die mit Bindfäden zusammengehalten werden.
Dazu gibt es schwarzes Kraut mit schwarzen Bällchen, die beim ersten Hinsehen als verkohlte Fleischklopse durchgehen könnten. Ein überforderter Asiate steht hinter den Tischen und fragt nach meinen Wünschen.
»Was ist das?«, frage ich auf die Röllchen deutend.
»Oooooh. Is Sin-Hei-Song. Ist gekogt Fiss mit Ingwerwurzel und swarz Pfeff. Un hiiiier mir han Wodu-Ka-Mosa, is Niere von Sildkrot mit Safran!«, teilt er mir mit. Stehen Schildkröten nicht unter Naturschutz?
»Dann bitte einen Teller mit Sin-Hei-nochwas!«
Auf einen Unterteller bekomme ich ein einziges Röllchen gelegt, makabrerweise wünscht der Asiate mir noch einen guten Appetit. Das Röllchen schmeckt nach nassem Zewa-Wisch-und-Weg und ich bin noch hungriger als vorher. Ich will SOFORT zu McDonald’s! Wo ist nur Henning? Ich brauche jetzt erst mal Sekt. Mit einem Puppenglas in der Hand wühle ich mich wieder durch die Menge zurück. Da sehe ich ihn. Er lehnt lässig an einer Säule und hört zwei Schickimickischicksen zu, die ihm wahrscheinlich etwas über ihren letzten Urlaub auf den Cayman Islands erzählen. Oder darüber, wie ihr Privatjet über Trinidad plötzlich Turbulenzen ausgesetzt war und der 78er Veuve Cliquot sich über den Jil-Sander-Blazer ergossen hat. Vielleicht sind sie auch ganz einfach verzweifelt darüber, dass sie zu viel Geld haben und nicht wissen, was sie sich denn jetzt noch kaufen könnten.