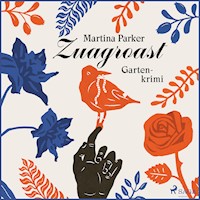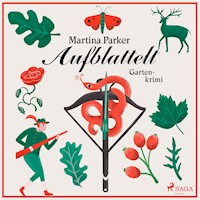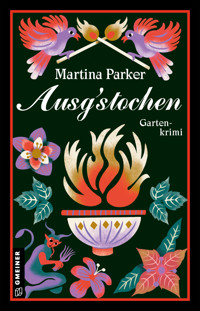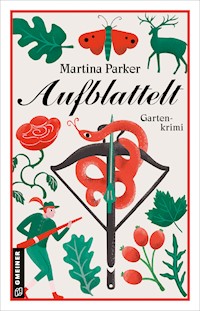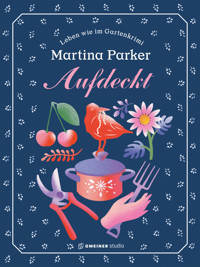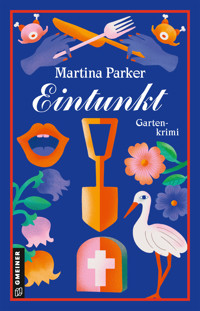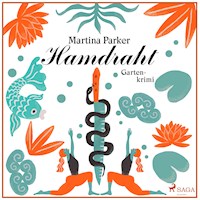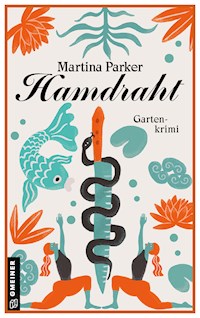
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Klub der Grünen Daumen
- Sprache: Deutsch
Sanfter Tourismus im Südburgenland? Von wegen. Der „zuagroaste“ Arno will den „Hiesigen“ zeigen, wie Wellness geht, setzt sich dabei aber ordentlich in die Nesseln. Die kräuterkundige Köchin Mathilde kocht lieber ihren Chef ein als die Gäste. Die beißen ohnehin bald ins Gras. Lokaljournalistin Vera recherchiert und gräbt dabei zu tief. Und auch die Mitglieder des Gartenklubs haben ihre grünen Daumen im Spiel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Martina Parker
Hamdraht
Gartenkrimi
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Ausnahmen sind Personen des öffentlichen Lebens, mit denen eine Namensnennung abgesprochen wurde.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
Illustration und Cover Design Lena Zotti, Wien
ISBN 978-3-8392-7096-7
Zitat und Widmung
»Nichts bleibt, mein Herz. Und alles ist von Dauer.« Erich Kästner
Immer noch für Dich
Prolog
Der Boden unter seinen Füßen schwankte. Er wusste nicht, ob das am Alkohol lag oder am Wellengang. Er hielt sich mit beiden Händen fest, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, während er die zwei Stufen in die Kabine hinabstieg. Die »Pedrazzini« war sein neuestes Spielzeug. Ein Motorboot, so schön wie ein Designmöbel. Eine Mahagoniverschalung, die für das perfekte Finish achtmal gestrichen und zwölfmal lackiert worden war. Ergonomisch perfekte Bänke und Sonnenliegen aus elfenbeinfarbenem Leder, zwei 230 PS starke Motoren. Feinstes italienisches Design, hergestellt in Schweizer Präzisionsarbeit. Ein Boot für Individualisten, die das Außergewöhnliche suchen. Ein Boot für Menschen wie ihn.
Er kramte in seiner Brusttasche, bis er das kleine Briefchen fand. Seine Augen schweiften durch die Kabine. Er suchte eine glatte Ablage, um eine Line zu legen, aber dann war ihm das ob des ständigen Schwankens doch zu unsicher. Er setzte sich auf die Liege in der Kabine, deren Polsterung nach neuem Auto roch. Dann zog er einen winzigen silbernen Kokainlöffel hervor, füllte ihn mit dem weißen Pulver und stopfte sich den Inhalt ins rechte Nasenloch. Er drückte das linke Nasenloch zu und zog das Koks mit einem schniefenden Geräusch hoch. Als Kind hatte er es immer gehasst, wenn ihm Wasser in die Nase und die Nebenhöhlen gekommen war. Jetzt konnte er über diese Empfindlichkeit nur lachen.
Er wiederholte den Vorgang mit dem zweiten Nasenloch. Er schluckte zweimal, um den bitteren Schleim loszuwerden, der sich in seinem Rachen gebildet hatte. Das Briefchen war jetzt leer. Dennoch befeuchtete er den Zeigefinger und fuhr damit über das Papier, bis er sicher war, dass auch der letzte Krümel daran haften geblieben war. Dann rieb er mit der Fingerkuppe über sein Zahnfleisch. Immer und immer wieder. Er spürte, wie die Droge ins Hirn schoss, er fühlte sich stark und unverwundbar. Sein Rachen und sein Zahnfleisch waren jetzt taub. Das störte ihn nicht. Nur diesen bitteren Geschmack im Mund musste er loswerden.
Er ging wieder hinauf und griff nach der offenen Flasche »Ruinart«. Schenkte sich das Glas randvoll und trank es gierig aus. Das war das Gute am Koksen, da konnte man saufen, wie viel man wollte.
Er merkte, dass sie ihn beobachtete. Er bemühte sich, nicht mit den Zähnen zu knirschen. Er knirschte immer mit den Zähnen, wenn er »drauf« war.
Er ging zum Cockpit. Ein Universum aus poliertem Holz und Chrom. Sein Freund lenkte die Jacht mit sicherer Hand.
»Geh, lass mich einmal.«
»Das geht nicht, Alter, du weißt eh, du hast kein Schiffspatent.«
»Geh bitte, was soll denn schon sein? Das ist wie Autodrom fahren.«
Er wartete auf eine Antwort, aber als keine kam, wurde er jähzornig. »Sei nicht so ein i-Tüpferl-Reiter. Das ist mein Boot«, zischte er leise.
Der Freund sah ihn zweifelnd an. Sie kannten sich seit ewigen Zeiten. Er wusste, dass es sinnlos war, sich mit ihm zu streiten, wenn er so drauf war.
Der Mann zückte ein weiteres Briefchen Kokain und steckte es seinem Freund, der immer noch die Jacht steuerte, in dessen Badehosentasche. »Da, geh dir die Nase pudern, und nachher pudern1 wir die Kleine.« Er sah zu dem jungen Mädchen hinüber, das sie mit auf die Jungfernfahrt genommen hatten.
»Du bist so ein perverser Trottel. Bevor ich mit dir einen Dreier schieb, stech ich mich hier rein.« Er ließ mit einer Hand das Steuer los und zeigte auf seinen Hals.
»Jetzt gib schon her.«
Er drängte den Freund zur Seite und griff ihm ins Lenkrad. Die Jacht schlingerte kurz. »Ich hab alles im Griff. Ich verspreche es dir.«
»Und jetzt putz di2!« Er lachte laut und schlug dem Freund kräftig auf die Schulter.
Der zuckte unschlüssig mit den Schultern und trat zur Seite. Der Mann hatte nichts anderes erwartet. Endlich konnte er sein Spielzeug ausprobieren. Das war sein Baby, sein Eigentum. Er griff nach dem Lenkrad. Was für eine lächerliche Diskussion. Er war schon oft Motorboot gefahren. Als ob man dafür einen Führerschein brauchte.
Sobald der Fahrer den Gashebel betätigt hatte, zerriss die archaische Akustik der Achtzylinder die beschauliche Stille. Der satte Sound ging mit entsprechender Kraftentfaltung einher. Das Vorderteil des Bootes hob sich bei der Beschleunigung leicht, wie ein Pferd, das im Begriff war, sich aufzubäumen. Das Mädchen, das sich hinten auf der Liege gesonnt hatte, kreischte auf und hielt sich am Rand des Bootes fest, als sie bemerkte, wie rasch die Jacht Geschwindigkeit aufnahm. Das war es. Das war Freiheit.
Der Mann fühlte, wie Glückshormone seinen Körper durchfluteten. Wegen so was lebt man, nur wegen solcher Momente, dachte er. Er spürte, wie der Fahrtwind sein dünner werdendes Haar zerzauste, er spürte die hochspritzende Gischt auf seiner Haut, er spürte die Kraft der Motoren unter sich, als er eine schnittige Kurve fuhr und das Boot das Wasser teilte.
Sie rasten über den See.
»Nicht so schnell«, warnte der Freund, »da vorne ist ein Surfer.«
Der Mann riss das Lenkrad herum. »Erzähl mir nicht, wie ich fahren soll«, herrschte er seinen Hawerer an, während er das Lenkrad herumdrehte. Der Surfer war vor lauter Schreck über das heranbrausende Motorboot längst freiwillig ins Wasser gesprungen.
Der Mann hatte ihn in seinem Rausch gar nicht bemerkt, aber das hätte er nie im Leben zugegeben.
»Entspann dich.« Er sah, dass sein Freund jetzt ebenfalls weißes Pulver an den Nasenhärchen kleben hatte, und grinste. »Na wird scho, gleich hast mehr Spundes, Oida.«
Aus dem Augenwinkel sah er, dass das Mädchen versuchte, von der Sonnenliege nach vorne zu robben, vermutlich wurde es ihr hinten zu abenteuerlich.
»Hör auf mit dem Scheiß«, sagte der Freund.
»Mir wird schlecht«, stöhnte das Mädchen und beugte sich über die Reling.
Na hoffentlich kotzt die nicht den ganzen teuren »Ruinart« wieder raus, dachte er.
Der Freund tastete sich schwankend zu ihr vor. »Alles okay?«
Der Besitzer der Jacht blickte wieder nach vorne. Der See glitzerte heute fast türkis. Ein unglaubliches Gefühl von Freiheit erfasste ihn. Wozu bauen sie solche Boote, wenn man sie nicht mit Vollspeed fahren darf, dachte er. Er beschleunigte, genoss das Adrenalin, das durch seine Adern schoss. Er war frei, er war glücklich. Er zog noch eine Kurve und dann noch eine in die andere Richtung. Wie hieß dieses coole Manöver, das man immer in Filmen sah? Power Turn? Das hatte er auch drauf.
Er beschleunigte auf Höchstgeschwindigkeit. 36 Knoten, 66 Stundenkilometer, dann riss er das Lenkrad nach links. Das Boot legte sich in die Kurve, das Wasser teilte sich wie eine Fontäne. Er fuhr die Schleife so eng wie möglich, kreuzte sein eigenes Fahrwasser, bremste scharf ab. Er hörte Schreie. Er riss den Hebel auf »retour«. Das Nächste, was zu hören war, war ein Rumpler. Danach war es totenstill.
1 Vulgärer österr. Ausdruck für Sex
2 Verschwinde
1 Mathilde bekommt ein Tattoo
Das System der Arbeitsteilung bei Ameisen wird manchmal mit dem indischen Kastensystem verglichen. Tatsächlich ist die Organisation des Lebens in einem Ameisenhaufen nicht so starr, wie man denkt. Jede Arbeiterameise wird in jungen Jahren mit den Arbeiten im Inneren des Haufens beginnen. In den letzten Jahren ihres Lebens wird sie jedoch außerhalb arbeiten.
Der Schmerz war schneidend, brennend, schabend. Winzige Blutstropfen traten aus der verletzten Haut, vermischten sich mit der flüssigen Farbe. Der Tätowierer griff zu einem Tuch und wischte sorgsam über die Haut. Mathilde versuchte, ruhig und gleichmäßig zu atmen und sich zu entspannen. »Geht es noch?«, fragte der Tätowierer.
Mathilde nickte. »Wenn ich mich beim Kochen schneide oder verbrenne, tut das mehr weh.«
Es war schon ihre achte Sitzung. Das Motiv wuchs und wuchs. Buntstieliger Mangold, rote Chilis, gelbe Tomaten, eine lila-weiß gefleckte Melanzani, grüner Koriander. Auf Mathildes Arm und Schulter entspross ein ganzes Gemüsepotpourri.
»Koriander mag ich nicht, der schmeckt nach Seife«, sagte der Tätowierer, blickte kurz auf und lächelte.
»Da sind deine Gene schuld.« Mathilde blickte dem Mann in die Augen, die von Lachfältchen umgeben waren. »Manche Menschen haben Geruchsrezeptoren, die Koriander nach Seife schmecken lassen.« Sie war froh über das Gespräch, es lenkte sie ab.
»Wie geht es in der Arbeit?«, fragte der Tätowierer.
»Ich habe gekündigt«, sagte Mathilde.
Der Tätowierer schnalzte mit der Zunge, während er die Feder seiner Tätowiermaschine in ein winziges Farbtöpfchen mit grüner Farbe tauchte. Das Töpfchen stand in einem Klecks Vaseline auf der Arbeitsplatte, damit es nicht verrutschen oder umkippen konnte.
Mathilde dachte kurz daran, wie sie in ihrer Ausbildung zur Köchin gelernt hatte, Dessertschälchen mit Marzipan auf dem Teller festzukleben, damit diese beim Servieren nicht verrutschten. Eigentlich dasselbe Prinzip.
»Ich bin dort nicht weitergekommen. Der Küchenchef hat immer mehr Convenience Food eingekauft. Schnitzel vom Fließband, Kartoffelsalat aus dem Kübel, Packerlsuppen. Er glaubt, das ist die Zukunft.«
»Pfui Teufel«, sagte der Tätowierer.
»Naja, das Zeug schmeckt nicht mal so schlecht. Die Lebensmitteltechnik wird immer besser. Und man spart unglaublich viel Zeit bei der Zubereitung. Aber mich langweilt das.«
»Ich verstehe«, sagte der Tätowierer. »Eine Arbeit, die keinen Spaß mehr macht, macht keinen Sinn.« Der Tätowierer hatte vor vier Jahren sein gut gehendes Tattoo-Studio in der Stadt aufgegeben und war ins Nirgendwo gezogen. Dorthin, wo es garantiert keine Nachbarn gab, keinen Handyempfang und einen nicht einmal das Navi fand. Die, die ihn finden wollten, fanden ihn trotzdem.
»Und was machst du jetzt?«, fragte er.
Mathilde strahlte: »Ich fange in drei Wochen als Küchenchefin im ›Fia-mi‹ an.«
»Wo?«
»Im ›Fia-mi‹. Das ist Dialekt und bedeutet ›Für mich‹. Ein neues Vital-Resort an einem Fischteich zwischen Litzelsdorf und Oberdorf, die wollen dort moderne, regionale Küche, viel Gemüse und Wildkräuter.«
»Na dann sollte ich dir wohl noch ein paar Bärlauchblätter stechen«, sagte der Tätowierer.
»Bärlauch gibt es nur in Rechnitz. Mach mir besser eine Schafgarbe, die hat so tolle Doldenblüten«, lachte Mathilde.
»Das nächste Mal«, lächelte der Tätowierer und legte sein Werkzeug beiseite.
»Ich geb dir noch was von meiner Salbe mit, die ist selbst gemacht.«
Mathilde schnupperte daran. Die Salbe roch nach Bienenhonig und Fichtenharz.
»Meine Tattoos sind in drei Tagen verheilt.« In der Stimme des Tätowierers klang Stolz mit.
Mathilde bewunderte das bunte Gemüsebild auf ihrer Haut. »Mein alter Chef würde auszucken.« Aber das »Kurfürsten-Hotel« war Vergangenheit. Die holistisch orientierten Inhaber des »Fia mi« waren hoffentlich weniger engstirnig.
Als Mathilde die kurvigen Straßen der Buckligen Welt in Richtung Südburgenland hinunterfuhr, blickte sie immer wieder auf ihren Arm. Das Tattoo tat kaum weh. Das mussten die Endorphine sein.
Sie lenkte ihren alten Chevrolet Malibu Richtung Bernstein. Das Auto hieß Patsy, war aus dem Jahre 1983 und zum größten Teil weinrot, nur die Lackierung auf der Seite erinnerte an Holzmaserungen. Mathilde liebte Patsy so sehr, dass sie ihr auch ihren unglaublichen Benzin-Durst verzieh.
Patsy war ihr teuerstes Hobby. Neben dem Gerhard. Mathilde parkte Patsy vor dem windschiefen alten Bauernhof ein, den sie gemeinsam mit dem Gerhard vor sechs Jahren bei einer Versteigerung spottbillig erworben hatte.
Die Idee mit dem Hof war Gerhards Idee gewesen. Mathilde hatte sich erst gesträubt, weil sie fand, dass der Hof eine schlechte Energie hatte.
»Das bildest du dir nur ein, weil es hier so aussieht«, hatte der Gerhard gesagt. Und »ausgesehen« hatte es tatsächlich. Das Unkraut rund um den Hof war meterhoch gewesen. Dazwischen lagen achtlos weggeworfene Eisenstangen, rostiger Stacheldraht und ein kaputtes rosa lackiertes Kinderfahrrad. Der Anblick des verbeulten Kinderfahrrads hatte sie auf eine seltsame Art betroffen und traurig gemacht. »Ich weiß nicht«, hatte Mathilde zweifelnd gesagt, »ein Versteigerungshaus. Das heißt, die vorherigen Besitzer müssen in einer verzweifelten Lage gewesen sein. Verzweiflung, das bedeutet Streit und oft auch Alkoholismus und Gewalt. Ein Haus inhaliert so was.«
Aber dann hatte der Gerhard sie doch überzeugt, dass man sich dieses Schnäppchen nicht wegen einer »esoterischen Spinnerei« durch die Finger gehen lassen sollte. Und Mathilde hatte den Kaufvertrag mit unterschrieben und gleich danach zum Räucherwerk gegriffen, um die schlechte Energie zu vertreiben.
Heute, sechs Jahre später, zweifelte sie immer noch daran, dass dieser Hauskauf eine gute Idee gewesen war. Nicht wegen der schlechten Energie der Vorbesitzer. Nein, wegen der immer schlechter werdenden Energie zwischen ihr und dem Gerhard. Und dagegen half das ganze Räuchern und Lüften nicht.
Als sie den Gerhard vor sieben Jahren kennengelernt hatte, war er ein aufstrebender junger Bildhauer gewesen. Die Kritiker hatten sich mit Lobhudeleien überschlagen angesichts dessen, was der Gerhard aus Holz, Stein und Metall schuf. Sie lobten seine radikale Brutalität im Umgang mit Materialien und Formen. Sie waren voll der Begeisterung über seine schonungslose Ästhetik. Nur Geld verdienen ließ sich damit nicht. Ein einziges Mal hätte der Gerhard einen wirklich lukrativen Auftrag einfahren können. Da hatte der Bürgermeister der Nachbargemeinde eine Skulptur für den neuen Hauptplatz bestellt.
Aber als die dann geliefert wurde, hatte der Bürgermeister einen Rückzieher gemacht. »Bist depppert worn, Gerhard? Kim sufurt und ram des schiache Graffl wieder weg!«3
Das schiache Graffl sah aus wie eine Mischung aus Fitness- und Foltergerät. »Das ist kein Graffl. Das ist ein Mahnmal gegen den Optimierungswahn des modernen Menschen«, hatte der Gerhard wütend gebrüllt.
»Des schaut aus wie wos, des in der Hinterkammer vom Oberwarter Laufhaus steht«, hatte der Bürgermeister entgegnet.
»Du musst das ja wissen«, hatte der Gerhard zornig gekontert.
Es war das erste und letzte Mal gewesen, dass von öffentlicher Hand ein Auftrag an den Gerhard herangetragen worden war. Seither künstlerte er nur mehr für sich selbst. Und im Garten des windschiefen Bauernhauses mehrten sich Skulpturen, die bei Mathilde dieselben gruseligen Assoziationen weckten wie das Kinderfahrrad, das beim Einzug dort gelegen war.
»Machen Sie sich auf die Suche nach dem verlorenen Geschmack neben der eigenen Haustür«, hatte ihr neuer Chef, Arno Radeschnig, ihr beim Einstellungsgespräch eingeschärft.
Er hatte natürlich von Essen gesprochen, aber Mathilde musste über die Doppeldeutigkeit dieses Satzes nachdenken, als sie langsam zum Haus hinaufging, vor dem kopflose Figuren mit schablonenhaften Waffen Spalier standen. Die stählernen Umrisse von Messern und Harpunen ließen sie langsam, aber sicher an Gerhards Gemütszustand zweifeln.
Der Gerhard selbst stand über eine Werkbank gebeugt und drosch mit einem Vorschlaghammer auf ein Stück Dachrinne ein. Mit seinem zerzausten Bart und seinen wilden rötlichblonden Locken sah er aus wie ein Wikinger, dachte Mathilde. Wie ein Wikinger, der langsam blad wurde. Aber daran war sie auch ein bisschen schuld. Sie und ihre gute Küche. Mathilde selbst war auch nicht die Schlankste. Gerhard war so in seine Arbeit vertieft, dass er Mathilde nicht bemerkte, als diese ins Haus ging. Sie war froh darüber.
Das Bauernhaus hatte kein Vorzimmer. Man stand sofort in der Küche, und diese sah aus, als hätte hier ein Gelage stattgefunden. Sie ließ die Schuhe an. Sonst wäre sie nur in den Dreck gestiegen, der hier umherlag. Morgen würde sie putzen. Morgen. Seufzend fing sie an, Teller und Tassen wegzuräumen und in den Geschirrspüler zu schlichten. Gerhard rührte im Haushalt keinen Finger. Er war Künstler, kein Hausmann.
»Und ich bin sein depperter Lotsch, der hackelt, ihm hinterherräumt und das alles bezahlt«, ärgerte sich Mathilde. Auf der Kommode, in der sie das alte ungarische Herend-Porzellan ihrer Oma aufbewahrte, stapelten sich die Rechnungen.
Die mussten warten, bis sie das erste Gehalt vom »Fia mi« bekommen würde.
Mathilde schaltete die Kaffeemaschine ein, ging zur Brotdose und nahm den Striezel heraus, den sie gestern gebacken hatte. Der Anschnitt war trocken, weil der Gerhard vergessen hatte, das Bienenwachstuch darüber zu wickeln. Auf dem Schneidbrett lag ein marmeladebeschmiertes Buttermesser. Daneben stand ein offenes Glas Ribiselmarmelade4.
In der Marmelade waren kleine weiße Flecken zu sehen. Schimmel? Nein, Butter. Gerhard musste dasselbe Messer für Marmelade und Butter benutzt haben, obwohl ihm Mathilde Hunderte Male eingeschärft hatte, das nicht zu tun, weil die Marmelade dann schneller schimmlig würde. Sie nahm den letzten sauberen Kaffeelöffel aus der Lade und fischte stirnrunzelnd die Butterflankerl heraus.
Dann bereitete sie sich einen Kaffee zu, schnitt ein Stück Striezel ab und bestrich die angetrocknete Seite mit Butter. Die Butter war streichfähig, was daran lag, dass der Gerhard vergessen hatte, sie in den Kühlschrank zurückzulegen. Weil der das schon öfters vergessen hatte, war die Butter außen schon ganz gelb und schmeckte ein bisschen komisch.
Mathilde merkte, wie der Ärger in ihr hochstieg. Ein nagendes, brennendes Gefühl, das sie nur allzu gut kannte. Sie atmete tief durch. Sie wollte sich nicht ärgern, sie hatte keine Kraft mehr, sich zu ärgern, und auch keine Lust. Sie musste die Speisekarte für das »Fia mi« fertig machen. Sie räumte den Stapel Werbeprospekte vom Tisch. Sie hatte schon oft gedacht, die Werbung abzubestellen, aber dann würde sie auch die Gratiszeitungen für den Bezirk nicht mehr bekommen, und das wäre schade. Denn dann würde sie auch nicht mehr wissen, was los war. In der Gratiszeitung hatte sie auch gelesen, was für ein Kapazunder ihr neuer Chef war. Dieser Arno Radeschnig war nicht einfach nur ein Hotelier, der war ein berühmter Coach und Persönlichkeitstrainer. Die wichtigsten Menschen des Landes – Politiker, Sportler, Manager – besuchten seine Seminare, um von ihm zu erfahren, wie man gesünder, glücklicher und erfolgreicher wurde. Sogar der Bundeskanzler hatte sich angeblich von ihm beraten lassen.
Mathilde hatte zuvor noch nie von Arno Radeschnig gehört, aber das lag vermutlich daran, dass sie sich noch nie mit Lebensberatern auseinandergesetzt hatte. Das Internet war auf alle Fälle voll mit Links zu Arno Radeschnig. Es gab Bücher, Seminare, Multimedia-Programme und Trainingssysteme, die von Tausenden und Abertausenden Menschen genutzt wurden. Gesundheit, Sport, Beziehungen, Job, Finanzen, Zeitmanagement. Arno Radeschnig hatte für jeden Lebensbereich die richtige Strategie zum Erfolg. Und genauso erfolgreich sollte auch die Küchenlinie im »Fia mi« werden.
»Lebensmittel sind Medizin, und ich denke dabei an Traditionell Burgenländische Medizin TBM«, hatte der Hotelier salbungsvoll gesagt. Dass diese erst erfunden werden musste, hatte er nicht dazugesagt.
Mathilde schnappte sich ihr Tablet und dachte nach. Regional sollten die Gerichte sein. Aber wenn sie an regionale Gerichte dachte, fielen Mathilde nur fette und kohlenhydratreiche Spezialitäten der südburgenländischen Arme-Leute-Küche ein: Grammelpogatscherl5, Bohnensterz, Krautstrudel. Alles mit viel Schweineschmalz zubereitet und somit nicht der leichten, modernen, ganzheitlichen Philosophie des Resorts entsprechend.
»Ich muss ganz von vorne anfangen«, sagte Mathilde leise zu sich: »Welches Gemüse wächst bei uns?« Sie dachte an ihr Tattoo, das durch die Plastikfolie, die der Tätowierer darübergeklebt hatte, nur schemenhaft zu sehen war. Was für eine immerwährende Gedächtnisstütze das doch war. Mathilde visualisierte Tomaten, Paprika, Chili, Rüben, Gurken …
Eine leichtere Variante der Umurkensuppe – der burgenländischen Gurkenkaltschale – könnte funktionieren. Ihr Gehirn begann zu arbeiten. Oder mit Goldhirse gefüllte Minipaprika mit Tomatensoße. Mathilde durchforstete ihre Rezeptdatenbank. Was hatte sie schon einmal gekocht? Wie könnte man das variieren? Pflücksalat mit bitteren Rübensprossen und Pfirsichen.
Was wäre, wenn sie statt der Pfirsiche süße Kirschen vom Leithaberg nehmen würde? Je mehr sie an Essen dachte und je weniger an Gerhard, desto mehr besserte sich auch ihre Laune. Eine neue Idee poppte auf. »Zuispeis6« aus Kürbis und Weißkraut, garniert mit frischen Mikrogreens. Da gab es doch eine neue Firma in Oberwart, die diese produzierte. Sie machte sich eifrig Notizen am Tablet. Sie wusste, sie war auf dem richtigen Weg. Von wegen Traditionell Burgenländische Medizin. Dem Südburgenland stand eine Küchenrevolution bevor.
3 Komm sofort und räum das hässliche Gerümpel weg!
4 Rote Johannisbeermarmelade
5 Salziges Gebäck mit Grieben
6 Beilage
Gedanken einer Wasserleiche
Nie hätte ich gedacht, dass ich so enden würde. Menschen denken nicht gerne über ihren zukünftigen Tod nach. Alle wünschen sich, dass sie einmal friedlich einschlafen. Tatsächlich krepieren die meisten an Krebs. Ich dachte, mein Schicksal wäre ein klassischer Rock’n’Roll-Tod. Eine Überdosis, ein Autounfall im Alkoholrausch. Leben auf der Überholspur, sterben auf der Überholspur. Ich bin doch noch jung, war jung. Jetzt bin ich für immer jung, konserviert am Boden des Sees.
2 Arno im Tank
Karpfen haben ein gutes Gedächtnis. Sie vermeiden noch nach drei Jahren die Optik eines bestimmten Angelköders, wenn sie einmal auf ihn hereingefallen sind.
Ego me absolvo. Arno drehte an einer kleinen Holzperle seines Armbandes. Ego me absolvo. Seine Hand tastete zur nächsten Perle, er spürte ihre glatte Oberfläche zwischen den Spitzen von Daumen und Zeigefinger. Seine Hände waren kalt. Ego me absolvo. Ich vergebe mir. Es war so ähnlich wie Rosenkranzbeten. Nur anders.
Der Tank war an eine große Filteranlage angeschlossen, die vibrierte und blubberte, als Arno den Raum betrat.
»Keine Angst, Herr Radeschnig«, sagte die Therapeutin, »die wird ausgeschaltet, sobald es losgeht. Damit Sie wirklich ungestört sind.«
Die Therapeutin war eine kleine kompakte Frau mit kurzen brünetten Haaren. Sie hatte diesen aufmunternden Ton, in dem Ärzte gerne mit Schwerkranken oder Senilen sprachen.
Arno räusperte sich: »Ich geh mal duschen.« Er war nervös.
»Reiß dich zusammen!«, herrschte er sich selber an. Er versuchte, die Kontrolle über seine Atmung zurückzubekommen, seinen Puls genauso zu besänftigen, wie er es in Hunderten Seminaren gelehrt hatte. Er stellte sich eine riesige silbrig glitzernde Seifenblase vor, in der er sich befand. Alle negativen Gefühle waren außerhalb dieser Bubble. Nichts konnte ihm etwas anhaben.
Aber sein Herz war heute widerspenstig und klopfte in seinem eigenen holprig-schnellen Takt. Vielleicht hatte er sich zu viel zugemutet. Hier in diesem Raum kam ja einiges zusammen: der Tank, die fremde Frau, vor der er sich keine Blöße geben wollte. Dann diese Kapsel und die großen Erwartungen. »Sie haben eine sehr überreaktive Amygdala, also ein sehr aktives Angstzentrum, das überdurchschnittlich darauf konzentriert ist, mögliche Gefahren in Ihrem Umfeld wahrzunehmen.« Die Frau gab sich enthusiastisch: »Wir müssen Ihr Gehirn ›umprogrammieren‹, ohne es zu überfordern. Brauchen Sie noch etwas Zeit?«
Er verneinte und ignorierte die warnende Stimme in seinem Hinterkopf. Vielleicht hätte er sich doch noch mehr Zeit nehmen sollen, die Räumlichkeiten und Geräte genauer zu inspizieren und auf sich wirken zu lassen. Vielleicht hätte er mehr Fragen stellen sollen, sich besser eingrooven. Aber er wollte es nur rasch hinter sich bringen. Herrgott, er war ein Profi. Ein Lebenshilfe-Profi. Der erfolgreichste Motivations-Coach des Landes. Er hatte das alles im Griff.
Er legte das Handtuch, das er um die Hüften geschlungen hatte, ab und legte seine Hände schützend über seinen Unterleib. Er war nicht prüde, aber fühlte sich plötzlich extrem bloßgestellt und verletzlich. Hatten Therapeuten auch eine Verschwiegenheitspflicht wie Ärzte? Was, wenn die Frau mit der Presse reden würde? Was würde sie wohl über ihn erzählen? Rasch stieg er über die kleine Leiter in die Kapsel und ließ sich ins Salzwasser gleiten.
»Legen Sie sich auf den Rücken«, sagte die Therapeutin, »lassen Sie los, spüren Sie, wie das Wasser Sie trägt. Der Deckel des Tanks liegt nur ganz leicht auf, er schließt zwar gut ab, rastet aber nirgendwo ein und ist deshalb von innen ganz leicht zu öffnen. Sie können ihn jederzeit wegschieben«, beruhigte sie ihn. Er schluckte dennoch, fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, die salzig schmeckten. Der Schweiß stand ihm auf der Oberlippe. Er atmete wie in seinen Vorträgen. Vier Takte einatmen, bis sechs zählen, ausatmen und währenddessen bis acht zählen.
»Hier sind die Knöpfe für unsere Klangbeschallung. Sie können sie abdrehen, wenn es Sie stört. Für den Fall der Fälle gibt es auch einen Notrufknopf im Tank.«
Komplette Stille und Dunkelheit fand er unerträglich. Dann schon lieber Walgesänge.
Er versuchte, sich auf seine Atmung zu konzentrieren. Loslassen, Ruhe im Kopf. Atmen.
»Sind Sie bereit?«
Im abgedunkelten Raum sah sie das nervöse Flackern in seinen Augen nicht.
»Ja.«
Der Deckel schloss sich. Er spürte, wie sein Blutdruck stieg. Er hatte keine Angst zu ertrinken. Er hatte auch keine Klaustrophobie. Er hatte Angst vor der Angst.
Seine Nackenmuskeln verspannten sich schmerzhaft, als er sich im Wasser zurücklegte. Genau das sollte nicht passieren. Hinlegen, treiben lassen, vertrauen, dachte er.
Das Ganze gelang ihm doch immer beim Meditieren. Warum schaffte er es hier in diesem Floating Tank nicht? Er sollte in der Solelösung in einen Zustand der Schwerelosigkeit geraten, Körper und Geist entspannen. Stattdessen wurde er immer gereizter und nervöser.
Seine Ellenbogenbeuge begann zu jucken. Er kratzte sich, die Stelle begann augenblicklich zu brennen. Das ist das Salzwasser, dachte er, aber dann freute er sich über den Schmerz, weil es etwas war, das seinen unruhigen Geist ablenkte.
Einatmen, zählen, ausatmen. Wie viele Minuten er wohl schon hier drinnen war?
Seine überreizten Nerven begannen, gezielt nach Wahrnehmungen zu suchen. Er bildete sich ein, seinen Herzschlag immer lauter zu hören. Das Herz schlug immer noch beängstigend schnell. Seine Atmung wurde schneller und flacher. Er spürte, wie das Adrenalin in seine Adern schoss. Oh mein Gott, ich kriege in diesem verdammten Tank zu wenig Luft, dachte er. Mit Sicherheit werde ich gleich ohnmächtig.
Er versuchte, mit den Beinen Halt am Grund des Tanks zu bekommen, aber das war gar nicht so einfach, weil die gesättigte Salzlösung für einen enormen Auftrieb sorgte.
Er schwitzte jetzt am ganzen Körper und begann zu zittern. Seine Muskeln fühlten sich an wie in Salzsäure getaucht. Das Blut in seinen Ohren rauschte. Er musste nur diesen verdammten Deckel zur Seite schieben, aber er war unfähig, die Arme zu heben. Er fühlte sich wie paralysiert, wie gelähmt, er wartete darauf zu sterben. Und noch während die Panikattacke anhielt, hatte er zusätzlich Angst vor dem Angstzustand, was die Symptome immer schlimmer machte. »Der Knopf, wo ist der verdammte Panikknopf?« Er schlug mit der Hand panisch gegen den Beckenrand. Die Walgesänge verstummten. Der Tank war plötzlich in ein eigentümliches oranges Licht getaucht. Nach einer gefühlten Ewigkeit wurde der Deckel zur Seite geschoben. Die Therapeutin lächelte ihn an: »Herr Radeschnig, das waren jetzt 58 Sekunden.«
Ophelia wartete auf ihn vor dem Behandlungsraum. Sie sah sofort an seinem Gesicht, wie es gelaufen war. Sie umarmte Arno und strich ihm über den glatt rasierten Schädel. »Das wird schon, du musst Geduld haben.« Sie legte den Kopf gegen seine Schulter. Arno konnte ihr Haar riechen. Es roch vertraut nach Jasmin und Sandelholz. Sie hob den Kopf. Ihre großen türkisen Augen blickten ihn an. Er konnte die Umrandung ihrer farbigen Kontaktlinsen erkennen. Ophelia hatte eigentlich wasserblaue Augen, die immer ein bisschen trüb wirkten. Aber jetzt legte sie ihr ganzes Mitgefühl in diesen Blick. Ophelia war Mitte 30, sah aber jung, fast mädchenhaft aus. Keine einzige Falte fand sich in ihrem Gesicht. Ihre Haut war milchig weiß, makellos bis auf ein paar zarte Sommersprossen auf der Nase. Sie ernährte sich konsequent vegan und praktizierte jeden Tag eine Stunde Kundalini-Yoga. Das Ergebnis war eine schlanke, aufrechte Figur, die sie durch feenhafte Outfits noch betonte. Heute trug sie ein hauchdünnes langes blaues Kleid, das mit Silberfäden durchzogen war und fast wie ein Negligé wirkte. Ihre blonden Haare waren offen und fielen wie ein Wasserfall ihren Rücken hinunter. Goldene und honigfarbene Strähnen erweckten den Eindruck, dass immer die Sonne darauf schien. An Ophelias Armen baumelten Dutzende Armreifen, die klirrten, als sie sich an ihn drückte und begann, seinen Rücken zu streicheln. Arno spürte ihren Busen, der sich gegen seinen Oberkörper presste. Normalerweise hätte ihn das erregt. Aber nach dem Erlebnis im Tank fühlte er sich zu enttäuscht und erschöpft, um auf ihre weiblichen Reize zu reagieren. Er hatte es nicht einmal eine Minute im Wasser ausgehalten. Nicht einmal eine verdammte Minute. Er sehnte sich nicht nach Ophelia, der Geliebten, er sehnte sich danach, getröstet und bemuttert zu werden. Ophelia spürte das. Auch diese Rolle hatte sie gut drauf. »Mein armer Liebling«, sagte sie und streichelte ihm die Wange. Ihre Hand war kühl. Sie wusste um die Macht ihrer Berührung.
Auch Ophelia war enttäuscht, dass Arno an dem Experiment mit dem Floating Tank gescheitert war. Aber sie ließ sich nichts anmerken. Sie würde niemals Druck auf ihn ausüben. Sie war gerne seine Stütze, sein Fels in der Brandung. Aber das Geheimnis war, ihn nicht wissen zu lassen, dass es so war. Denn dann würde er sich noch unsicherer fühlen, nicht Manns genug. Und Arno war einer dieser Männer, für die ihre Männlichkeit alles war. Ein Bär von einem Mann, ein Macher, ein Erfolgstyp, ein Beschützer. Muskeln, Glatze, Testosteron. Wie brüchig sein Ego war, seit er unter diesen Panikattacken litt, wusste nur sie.
Auf der Heimfahrt lenkte sie den Wagen mit der linken Hand, die rechte lag auf dem Oberschenkel ihres Mannes. Ihr Blick ruhte auf der Straße. Sie musste eine Lösung finden. Bald, bevor das Ganze ausartete.
Sie räusperte sich. »Weißt du, ich glaube, dieser Tank war zu künstlich. Ich verstehe, dass du Frieden mit dem Wasser finden willst, aber ich denke, es muss in der Natur passieren. Vielleicht sollten wir das Problem doch zu Hause angehen.«
Sie spürte, wie sich seine Muskeln verkrampften. »Wie soll ich in einen Teich steigen, wenn ich es nicht einmal in diesem Tank ausgehalten habe?«, sagte Arno hölzern.
Sein Zuhause. Das war seit diesem Sommer das Wellness Retreat »Fia mi« – Für mich. Eine Rieseninvestition. Ein Projekt, das nicht nur die touristische Zukunft der Region, sondern auch ihrer beider Leben verändern sollte. Ein Yoga Hotel war immer schon Ophelias Lebenstraum gewesen. Arno war nur zu schnell bereit gewesen, diesen Traum mit ihr zu verwirklichen. Sie hatte die Vision. Er hatte das Geld. Das Ergebnis war ein Ort voller Licht, Leichtigkeit, Ruhe, Gelassenheit. Ophelia hatte an alles gedacht. Erfrischende Behandlungen mit der Kraft der Natur, regionale Köstlichkeiten und Aktivangebote. Dass das Grundstück, auf dem das Hotel stand, an einem Teich lag, sollte ebenfalls zur puren Entspannung beitragen.
Seit Arno unter den Panikattacken litt, war diese Entspannung aber beim Teufel.
»Du musst dich mit dem Universum versöhnen«, sagte Ophelia, während sie beruhigend sein Knie tätschelte. Der Druck ihrer kleinen festen Hand beruhigte ihn. »Ich werde Christoph anrufen.«
»Welchen Christoph?«
»Den Christoph, mit dem ich früher mal in Kärnten in einem Hotel zusammengearbeitet habe«, sagte sie beiläufig, »Doktor Christoph Meierhofer, ich habe dir doch von ihm erzählt. Er ist Sport- und Vitalmediziner, aber auch aufgeschlossen gegenüber alternativen Heilmethoden. Er kennt sich auch gut mit TCM aus.«
»Unser Haus fokussiert auf Traditionell Burgenländische Medizin, nicht auf chinesische«, widersprach er. »Ohne diesen Fokus klappt das mit der Förderung nicht.«
Arno war reich, weil er kein Dummkopf war. Er hatte immer schon gewusst, wo Geld zu holen war.
»Na perfekt. Christoph kommt eigentlich aus Unterpodgoria«, antwortete sie leichthin. »Das liegt im Südburgenland.«
Dass sie und Christoph in der Vergangenheit mehr als nur Kollegen gewesen waren, verschwieg sie. Ophelia hatte schon von klein auf lernen müssen, dass es besser war, über manche Dinge nicht zu sprechen.
Sie blickte kurz auf die Uhr am Armaturenbrett und wechselte das Thema. »Wir haben später noch einen Termin.«
»Was für einen Termin?«, fragte Arno.
»Ich hab ein Meeting mit der neuen Köchin ausgemacht. Wegen der Eröffnung nächste Woche. Ich hab sie gebeten, über eine Produktlinie nachzudenken, die wir promoten können. Marmeladen, Chutneys, Kräutersalz. Alles mit unserem Logo.« Arno nickte zustimmend. Das klang gut. Wenn er sich auf sein Business konzentrierte, war er auf sicherem Terrain. Dann konnte er diese belastenden Panikattacken am besten zur Seite schieben.
Er hatte alles im Griff gehabt, bis er mit Ophelia zu Ostern auf die Malediven geflogen war. Dort hatte er beim Schnorcheln die erste Panikattacke gehabt. Aus heiterem Himmel. Der Anlass war lächerlich gewesen. Ein Schwarm Anemonenfische war auf ihn zugeschwommen. Bunte Riffbarsche, wie aus dem Film »Nemo«. Komplett harmlos. Aber wie sie da auf ihn zugesteuert waren mit ihren dicken Lippen und ihren Glubschaugen. Wie er da auf einmal mittendrin war in dem orangefarbenen Schwarm, hatte es bei ihm ausgesetzt. Erst hatte er gedacht, er hätte unter Wasser einen Herzinfarkt erlitten. Der Arzt im Resort hatte ihm später nach ein paar Tests erklärt, dass mit seinem Herzen alles in Ordnung war. Er könne beruhigt sein. Das wäre nur eine »panic attack« gewesen. Als ob ihn das beruhigt hätte. Er war der erfolgreichste Motivations-Trainer des Landes. Es war sein Job, anderen Menschen die Angst zu nehmen. Wenn bekannt würde, dass er nicht einmal mit seiner eigenen Angst klarkam, würde ihn das geschäftlich ruinieren. Es durfte nicht rauskommen.
Ophelia schien seine Gedanken zu lesen. »Christoph ist Arzt. Er redet nicht über die Beschwerden seiner Patienten. Und die Floating Tante hat einen Disclaimer unterschrieben.«
Sie dachte immer an alles.
Ophelia lenkte den Wagen auf die Bundesstraße Nummer 50 Richtung Süden und stieg aufs Gas. Der weiße Tesla reagierte sofort darauf. Sie spürte, wie ihr zarter Körper beim Beschleunigen durch die Schwerkraft in den Sitz gedrückt wurde. Sie mochte es, schnell zu fahren. Sie warf Arno einen Seitenblick zu. Er hatte nichts gegen ihren rasanten Fahrstil einzuwenden. Mit Geschwindigkeit hatte er noch nie ein Problem gehabt. Als sie ihn kennengelernt hatte, hatte auch er ein Leben auf der Überholspur geführt.
Erst bei der Ortseinfahrt Litzelsdorf reduzierte sie das Tempo. Auf den ersten Blick war Litzelsdorf eines dieser typischen Dörfer am Land, für das man weder abbremst noch anhält. Nichts links und rechts der Straße erscheint reizvoll genug, um deswegen einen Stopp einzulegen. Die wahre Schönheit der Ortschaft offenbart sich erst, wenn man von der Hauptstraße Richtung Olbendorf abbiegt und plötzlich im Paradies landet. Sanfte Hügel mit urigen Bauernhäusern, alte Obstbäume, Wiesen. Jetzt im Herbst war alles in ein goldenes Licht getaucht. Die Gebäude im Dorf lagen so weit verstreut, als hätte jemand ein »Monopoly«-Spiel genommen und die Steine, die die Häuser symbolisieren, einfach willkürlich über seine Schulter geworfen. Für nicht ortskundige Postboten und Paketzusteller waren die weitläufigen Streusiedlungen ein Albtraum. Es war fast unmöglich, ohne Ortskenntnis hier die richtige Hausnummer zu finden. Erschwerend kam hinzu, dass es nicht einmal flächendeckenden Internetempfang für die digitale Orientierung gab.
Ophelia fuhr an der Wiese des Himbeerbauern vorbei, auf der sich die auf Draht gespannten Himbeerruten der Sonne entgegenreckten. Die letzten Früchte reiften in der Oktobersonne. Sie passierte die Koppel mit den Wollschweinen und ein weiteres Feld, auf dem Pferde in der Nachmittagssonne dösten. Auf der Straße waren braune Reifenabdrücke zu sehen. Ophelia wich einem Haufen Stroh und Kuhdung aus. Ein leichter Jauchegeruch lag in der Luft. Jemand war hier vor Kurzem zum Miststreuen durchgefahren. Bei der nächsten Abbiegung verlief die Spur nach rechts. Ophelia bog links ab. Überall gab es hier Kreuzungen und Abzweigungen.
Ophelia machte sich eine gedankliche Notiz: »Zufahrtsschilder«, sie würde mindestens ein Dutzend brauchen, damit die potenziellen Gäste das Resort auch finden würden.
Sie erreichte die Einfahrt des »Fia mi« und parkte den Wagen direkt vor dem Haupteingang ein. Sie stieg aus und blickte sich um. Sie war stolz auf das, was sie hier in so kurzer Zeit geschaffen hatte.
Das Haupthaus war ein moderner zweistöckiger Bau mit viel Glas. Die Fassade bestand aus unzähligen schmalen Holzleisten, die mit exakt je 26 Millimeter Abstand nebeneinander genagelt waren. Seitlich neben dem Eingang befand sich eine Terrasse, über die ein riesiges dreieckiges Sonnensegel gespannt war. Daneben bemühte sich ein über eine Laube wuchernder Weinstock, zusätzlich Schatten zu spenden. Die Traube hieß Ripatella, eine Uhudlertraube. Jahrelang war der Verkauf von Uhudlerwein im Südburgenland verboten gewesen. Es hieß, er wäre schädlich und dass man deshalb nach dem Genuss so verwirrt dreinschauen würde wie ein Uhu. Nomen est omen. Die Kellerinspektoren kamen und beschlagnahmten Tausende und Abertausende Liter von Uhudler und leerten ihn in den Kanal. Die Bauern bauten ihn weiter heimlich an. Und als der Uhudler am 1. August 1992 dann endlich legalisiert wurde, wurde dieser Tag zum inoffiziellen Feiertag des Südburgenlandes. Klar, dass ein südburgenländisches Retreat nicht auf dieses Wahrzeichen verzichten wollte.
Weiter vorne am See standen mehrere Holzbungalows, die auf den ersten Blick aussahen, als hätte man überdimensionale Weinfässer in je zwei Hälften geschnitten und diese aufgeklappt. Leben im Fass wie ein antiker Philosoph. Das renommierte Wiener Architekturbüro hatte bei der Herausforderung, Modernität und einen Hauch Spiritualität mit südburgenländischer Tradition zu verbinden, ganze Arbeit geleistet.
Arno stieg aus dem Auto. »Ich leg mich ein bisschen hin«, sagte er. »Alleine!«, fügte er hinzu.
Obwohl Ophelia gar nicht vorgehabt hatte, ihn zu begleiten, fühlte sie sich durch die Aussage zurückgewiesen.
Sie sah ihrem Mann nach, der Richtung Haupthaus ging. Die gemeinsame Wohnung befand sich im Obergeschoss.
Arno ging gebeugt und wirkte grau im Gesicht. Ophelias aufgesetztes Lächeln verschwand. Sie blickte der Gestalt, die sich in gebückter Haltung entfernte, nach. Wie ein alter Mann, dachte sie. Arno war 19 Jahre älter als sie. An Tagen wie diesen wurde es ihr deutlich bewusst.
Als er außer Hörweite war, griff sie zum Handy und wählte eine Nummer. Nach dreimaligem Läuten war die Verbindung hergestellt.
»Christoph, ich bin’s. Ja, ich hab ihn endlich so weit. Du kannst herkommen. Besser früher als später. Nein, mach dir keine Sorgen. Ich regle das schon.«
Gedanken einer Wasserleiche
Ich bin froh, dass es hier so dunkel ist. Ich würde vor meinem eigenen Anblick erschrecken. Wachshautbildung ist das wesentlichste Merkmal einer Wasserleiche. Weil ich auf dem Seegrund liege und keine Luft an mich herankommt, verwese ich nicht. Mein Körperfett ist zu Fettwachs geworden und konserviert die äußeren Umrisse meines aufgedunsenen Leichnams wie ein Panzer.
3 Mathilde, das Multitalent
Es gibt viele Insekten, die sich als Blätter tarnen. Entweder, um nicht von anderen gefressen zu werden, oder, um sich auf die Lauer zu legen und in Folge andere zu fressen.
Mathilde war nervös. Ein Angestellter, der sich als Zsolt vorgestellt hatte, hatte sie in die Küche geführt. »Herr und Frau Radeschnig kommen gleich«, hatte er gesagt. Sie blickte sich um. Die Mitte des Raumes wurde von einer riesigen Kochinsel eingenommen. Ein achtflammiger Gasherd, daneben eine großzügige chromblitzende Anrichte mit integriertem Tellerwärmer. Alles funkelnagelneu. Sie schnupperte. Küchen rochen im besten Fall nach Speisen, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen ließen. Nach frisch gehackten Kräutern, nach in Butter gedünsteten Zwiebeln, einem knusprigen knoblauchduftenden Bratl, nach warmem Schokokuchen, heißen Himbeeren und süßem Karamell.
Im schlimmsten Fall stanken sie nach altem Frittierfett. Aber hier roch es einfach nur nach neuen Möbeln wie in einem Einrichtungshaus. Sie öffnete die Vorrats- und Kühlladen und ging dann zum Spülbereich. Ihre Schritte waren auf dem fugenlosen Epoxidharzboden kaum zu hören. Mathilde mochte das. Geschirrklappern, Gemüsehacken, Fleischklopfen, das Schmähführen7 einer gut eingespielten Küchenbrigade – in Profiküchen war es ohnehin nie leise. Da musste man nicht noch ihr Getrampel hören.
Sie ging weiter, passierte einen Durchgang und erreichte einen kleinen Raum, der wohl das Speisezimmer für das Personal war. Die Wand in diesem Raum war in einem zarten Rosagrau gestrichen. Als Abschluss kurz unter der Decke war eine Bordüre gezogen worden. Das Muster der Dekoleiste bestand aus filigranen Lavendelzweigen. Mathilde erkannte, dass das Dekor mit einer Malerwalze gemacht worden war, denn einer der Lavendelzweige war ein bisschen breiter als die anderen, und diese Besonderheit wiederholte sich alle 30 Zentimeter.
Mathilde lächelte. Die Bordüre erinnerte sie ein bisschen an die Musterzeile, die sie in der Volkschule als Abschluss einer Hausübung gemalt hatte. Mathilde hatte immer Blümchenornamente gemalt. Es waren Kleinigkeiten wie diese, die ihr viel über die Besitzer sagten. Wer sich Gedanken machte, dass das Personal es im Pausenraum nett hatte, hatte bei ihr schon gewonnen.
Sie blickte auf ihre Uhr. Schon 16.15 Uhr. Sie zückte einen altmodischen Kosmetikspiegel aus den 50ern, den sie am Flohmarkt erworben hatte, und warf einen kurzen Blick hinein, um ihr Aussehen zu überprüfen. Sie hatte ihre Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden und die Stirnfransen frisch geföhnt. Schnell kontrollierte sie, ob nichts von dem kirschroten Lippenstift, den sie heute gewählt hatte, auf ihren Zähnen klebte. Mathilde trug immer Lidstrich und Lippenstift, auch in der Küche. Weder Hitze noch Dampf konnten sie davon abhalten, sich im Stil der 1950er-Jahre zu schminken. Sophia Loren und Marilyn Monroe waren ihre Stilvorbilder. Die beiden hatten zu Mathildes Freude wie auch sie Kleidergröße 46 gehabt und waren nicht solche Hungerhaken gewesen wie die heutigen Models.
Mathilde trug heute eine schwarz-weiß getupfte Bluse mit einem roten Cardigan darüber, der ihre Tattoos verdeckte. Die Radeschnigs kannten bisher nur Mathildes obere Körperhälfte, denn sie hatten die Köchin per »Zoom Call« engagiert. Zum Zeitpunkt des Gesprächs war Arno auf einer Vortragreise gewesen, und Ophelia hatte ihn begleitet. Die beiden hatten Mathilde also eingestellt, obwohl sie im wahrsten Sinne des Wortes kein vollständiges Bild von ihr hatten.
Ich bin, wer ich bin, und an meinen Hintern und an meine Haxen werden sie sich gewöhnen müssen, sinnierte Mathilde. Heute steckte ihr Unterteil in Caprihosen mit sehr viel Stretchanteil, der ihre ausladenden Formen vorteilhaft zurechtdrückte.
»Ich kann ja schon mal anrichten«, sagte sie leise zu sich und nahm die mitgebrachten Kostproben aus dem Korb. Frau Radeschnig hatte Mathilde am Telefon gebeten, ihr beim ersten Termin kulinarische Ideen für den geplanten Hotelshop zu unterbreiten. Der lang gezogene Esstisch in diesem Raum bot sich für eine Präsentation förmlich an.
Mathilde nahm die Bügelgläser aus ihrem Korb, stellte sie auf die Arbeitsfläche und öffnete die Deckel. Dann drapierte sie blütenweiße Servietten mit Lochstickmuster und hölzerne Kostlöffel darum herum. Sie war stolz auf das, was sie in den letzten Wochen fabriziert hatte. Berberitzen-Apfel-Gelee mit Minze, Kartoffelrosen-Chutney, Mädesüß-Sirup, Löwenzahnwurzel-Likör, Rosen-Vollkornnudeln, Dillgurken mit Ribiselblättern, Feldthymian-Salz.
Mathilde war nicht nur gelernte Köchin, sondern hatte sich durch zahlreiche Zusatzausbildungen auch mit der Kunst des Wildkräutersammelns und -verarbeitens vertraut gemacht.
Endlich öffnete sich die automatische Tür zwischen Speisesaal und Küchenbereich, und die Besitzer des »Fia mi« traten ein.
Arno Radeschnig wusste, wie man eine Bühne betrat. Locker, aber dynamisch wie ein Showmoderator. Wenn er in einen Raum kam, vermittelte er den anderen Anwesenden immer das Gefühl, nun würde gleich etwas Großartiges passieren. Er hatte diese hinreißende Ausstrahlung. Er lächelte, und in seinem Gesicht ging die Sonne auf. Winzige Augenfältchen tanzten dann wie Sonnenstrahlen. Arno breitete die Arme aus.
»Es tut mir so waaaaahnsinnig leid, dass wir zu spät sind.«
Er grinste wie ein Schulbub, der etwas ausgefressen hatte, und trotzdem hatte er dabei die natürliche Dominanz eines geborenen Anführers. Er musste sich gar nicht als Chef vorstellen. Er war der Chef. Ophelia kannte den gewinnenden Effekt, den Arno auf Menschen hatte. Sie schmunzelte leise, als sie sah, wie Mathilde von der ersten Sekunde an seinem Charme verfallen war. Sie fraß ihm bereits aus der Hand. Wie alle.
Mathilde trat auf die beiden zu und wollte ihnen die Hand schütteln. Aber in der Sekunde, als sie ihre Hand ausstrecken wollte, verneigte sich Arno Radeschnig und legte die rechte Hand an sein Herz. »Willkommen, Mathilde, schön, dass du hier bist«, sagte er mit fester, wohlklingender Stimme.
»Ophelia Radeschnig«, sagte seine Frau. Auch sie verzog freundlich die Mundwinkel, aber ihr Lächeln kam nicht in ihren Augen an. Sie war eine dieser gertenschlanken Frauen, neben denen sich Mathilde sofort unterlegen fühlte. Dass Ophelia Plateauwedges trug, mit denen sie Mathilde um einen halben Kopf überragte, verstärkte diesen ersten Eindruck.
Die Hand-aufs-Herz-Begrüßung verwirrte Mathilde zusätzlich. So einen Gruß kannte sie nur aus alten »Raumschiff Enterprise«-Folgen. War es jetzt chic, sich zu begrüßen wie Außerirdische? Sie war sich auch nicht sicher, ob die Tatsache, dass Arno sie heute duzte, bedeutete, dass sie nun automatisch auch mit ihm per Du war. Im »Zoom Call« waren sie noch per Sie gewesen. Gab es einen Kompromiss. Sollte sie Herr Arno sagen? Lieber nicht. Das klang so nach Friseur. Sie beschloss, die direkte Ansprache so weit wie möglich zu vermeiden. Das war gar nicht so leicht. Ihr Hirn kämpfte schon mit dem nächsten Satz. Wollen Sie gleich mit der Verkostung beginnen, wollt ihr mit der Verkostung beginnen? Sie spürte, wie ihr heiß wurde.
»Ich habe einige Kostproben mitgebracht«, sagte sie schlussendlich.
»Toll, dann lass uns gleich anfangen, bevor wir noch mehr Zeit verlieren.«
Arno nickte anerkennend, nahm den angebotenen Holzlöffel und probierte etwas von dem Apfel-Berberitzen-Gelee. »Da ist irgendwas Frisches drinnen«, stellte er fest. »Lass mich raten«, er legte den Kopf schief, »Limette, nein, keine Zitrusfrucht, das muss ein Kräuterauszug sein. Zitronenthymian?«
»Fast«, lachte Mathilde. »Das ist Minze.«
Ophelia schnupperte an einem Löffel Mädesüß-Sirup. »Das riecht nach Vanille.« Sie kostete, bevor sie ihr Urteil abgab. »Schmeckt auch nach Vanille, gut, aber sehr süß.«
Sie studierte die Etikette. 90 Prozent Zucker. Sie hob eine Augenbraue und wandte sich dann an die Köchin: »Könnte man den Sirup auch kalorienärmer herstellen?« Sie musterte Mathilde.
Diese zog automatisch den Bauch ein und errötete ein bisschen. »Ja, das geht schon.«
»Das hört sich gut an«, sagte Ophelia. »Wir sind hier auf eine sehr gesundheitsbewusste Klientel fokussiert.« Es war eine ganz allgemeine Bemerkung, freundlich formuliert, aber sie genügte, dass sich Mathilde gemaßregelt fühlte. Skinny bitch, dachte sie trotzig. Mathilde schätzte, dass Ophelia annähernd gleich alt war wie sie. Irgendwas Mitte 30. Trotzdem kam sie sich jetzt vor wie ein Schulmädchen, dem von der Lehrerin auf den Zahn gefühlt wurde. Und die Prüfung ging weiter.
»Was ist das?« Ophelia hatte sich über Mathildes Korb gebeugt, in dem drei bunte Vierecke, in Zellophan gewickelt, lagen: »Noch was zum Naschen?« Sie lachte ein glockenhelles Lachen.
Chefin hin oder her. Mathilde fand es etwas übergriffig, dass diese Frau einfach in ihren Korb langte, aber dann überwog der Stolz auf ihr Produkt.
»Nein, das sind Seifen, die wir in unserem Gartenklub sieden. Wir sind der ›Klub der Grünen Daumen‹. Eine Gruppe Frauen, die an Pflanzen und Natur interessiert ist.«
»Selbst gemachte Seifen aus der Region?« Arno zog einen Sessel heran, setzte sich verkehrt herum darauf und stützte sich mit den Armen auf die Lehne: »Das klingt interessant. Erzähl uns mehr.«
Mathilde wickelte die Seifenstücke aus. Sofort entfaltete sich ein zarter Duft. »Das hier ist eine Haarseife mit Brennnessel und Minze«, erklärte sie. »Und die gelbe ist eine Gesichtsseife mit Traubenkernöl und Lindenblüten.« Sie reichte Arno das dritte Stück. »Und die, die so zitronig riecht, ist eine Körperseife mit Kapuzinerkresse und Zitronenmelisse.«
Arno schnupperte daran und reichte das Stück dann Ophelia weiter. Diese schien auch ganz angetan. »Verkauft ihr diese Seifen auch?«
Mathilde druckste ein bisschen herum. Der »Klub der Grünen Daumen« siedete seit Jahren Seifen. Allerdings mehr oder weniger unter der Hand. Die offiziellen Zulassungen für die Rezepturen waren bisher zu teuer gewesen. Es hatte deswegen schon Zoff mit dem Lebensmittelinspektor gegeben, in dessen Zuständigkeit auch handgerührte Kosmetik fiel.
»Noch nicht«, sagte sie. »Die Zulassungen sind für uns als Privatpersonen zu teuer!«
»Na, darum könnten wir uns ja kümmern. Ich hätte in den Badezimmern gerne eine eigene Kosmetikserie aus der Umgebung«, befand Arno.
Ophelia betrachtete die handgeschriebenen Etiketten der Seifen.
»Körperseife klingt ein bisschen altbacken«, befand sie. »Wie wäre es mit ›Festes Duschgel‹, der Begriff ist, denke ich, mehr am Punkt der Zeit.«
Mathilde runzelte die Stirn. »Festes Gel, das ist doch Blödsinn«, entfuhr es ihr impulsiv. »Entweder ist etwas gelförmig oder fest.«
Arno Radeschnig lachte laut auf. »Du hast recht«, sagte er. Er mochte diese Mathilde auf Anhieb. Sie erschien ihm direkt und aufrichtig.
»Wie gesagt, wir wollen regionale Kosmetik in unserem Retreat anbieten«, erklärte er ihr, »am besten nach traditionellen Rezepten.«
»Traditionell haben die Burgenländer Seife aus Asche und Schweineschmalz gesiedet«, erwiderte Mathilde. »Meine Uroma hat das noch so gemacht. Man hat Löcher in ein altes Weinfass gebohrt, eine Schicht Kies und darüber ein Tuch hineingegeben und das Ganze mit der Holzasche aus dem Ofen aufgefüllt. Und wenn es dann in das Fass hineingeregnet hat, hat das Wasser die Salze aus der Asche gelöst, und diese Lauge hat man dann mit Schweineschmalz aufgekocht.« Sie lächelte: »Ist das traditionell genug?«
»Ich habe es schon vorher erwähnt. Unsere Gäste sind gesundheitsbewusst. Da sind viele Veganer dabei. Schmalz passt da nicht ganz in die Philosophie«, sagte Ophelia.
Wieder war ihr Tonfall freundlich und neutral. Aber Mathilde fühlte sich erneut kritisiert.
»Die Seifen, die Sie hier sehen, enthalten Ziegenmilch«, erwiderte Mathilde. »Aber die waren ja auch gar nicht für Sie, äh, euch bestimmt, die waren nur zufällig im Korb.«
Sie hatte das Gefühl, sich ständig vor Ophelia verteidigen zu müssen. Und das ärgerte sie.
»Haben die Seifen auch eine Heilwirkung?«, fragte Arno, nahm erneut ein Stück Seife in die Hand und schnupperte daran.
»Das haben sie«, erklärte Mathilde, »Brennnesseln machen das Haar glänzend und fördern das Haarwachstum. Lindenblüten beruhigen gereizte und entzündete Haut. Und die wohltuende Wirkung der Zitronenmelisse kennt man ja vom ›Klosterfrau Melissengeist8‹.«
Arno wiegte den Kopf. »Klosterfrau, das gefällt mir. Wir könnten doch auch einen Klostergarten anlegen.« Er schlug begeistert mit der rechten Faust gegen seine linke geöffnete Hand und sprang auf. »Das ist genial. Das wird unseren Gästen gefallen.«
»Ich habe letztes Jahr mit den Frauen aus unserem Klub einen Klostergarten neben der Kapelle von Schloss Kohfidisch angelegt«, erzählte Mathilde. »Traditionelle Heilkräuter, biblische Pflanzen wie Linsen und Granatapfel, aber auch Küchenkräuter für den täglichen Gebrauch.«
»Na, da haben wir ja ein richtiges Multitalent eingestellt«, freute sich Ophelia. In Mathildes Ohren hallte eine Prise Sarkasmus mit. Vielleicht war sie aber auch überempfindlich. Arno schien es nicht zu bemerken. Oder er ignorierte es.
»Genau das wollen wir. Regionale Kosmetik und einen traditionellen Heilkräutergarten. Das müssen wir gleich planen und vermarkten. Apropos, kennst du unsere Marketingdirektorin? Sie kommt ja auch aus der Gegend – Sylvia Zieserl?«
»Flüchtig« sagte Mathilde. Zu Sylvia Zieserl hatte sie ihre eigene Meinung, aber sie ließ sich nichts anmerken.
Ophelia ließ die Information auf sich wirken. Dass diese Weiber sich alle untereinander kannten, behagte ihr nicht. Aber was sollte man machen? Auf dem Land war es halt so, und die Zuständigen in der Tourismusbehörde hatten klargemacht, dass das mit der Förderung nur hinhauen würden, wenn sie möglichst viele Menschen aus der Region beschäftigen würden.
»Dann ist es also abgemacht«, sagte Arno Radeschnig. »Wir setzen uns nächste Woche einmal mit eurem Klub zusammen, wegen der Seifen.«
Mathilde nickte zustimmend. »Sie reden am besten mit Johanna. Die leitet den Klub. Der nächste Gartenstammtisch ist am Freitag, ich schicke Ihnen die Adresse per Mail.«
»Abgemacht. Wir sehen uns dann am Freitag«, sagte Arno.
Mathilde nickte. Kaum hatte sie das Hotelgelände verlassen, griff sie zum Telefon und rief ihre Freundin Vera an, eine Lokaljournalistin, die ebenfalls Mitglied im »Klub der Grünen Daumen« war. »Vera, du glaubst nie, was gerade passiert ist. Ich habe mich ja heute mit meinen neuen Chefs getroffen. In dem Wellnesshotel, das demnächst eröffnet. Der Inhaber, dieser Radeschnig, will allen Ernstes unsere Seifen kaufen. Die zahlen sogar für die Zulassung. Einen Kräutergarten wollen sie auch. Und jetzt kommt das Allerärgste, halt dich fest: Die Zieserl macht hier das Marketing.«
7 Scherzen
8 Bekanntes Kräutertonikum
Gedanken einer Wasserleiche
Das Wasser, in dem ich liege, hat immer vier Grad. Sommers wie winters. Dennoch weiß ich, wann Winter ist. Dann ist der See spiegelglatt, und die Boote mit den Echoloten kommen, um die Fische zu zählen. Das Echolot ist seitlich am Bootsrand befestigt und sendet Millionen von Schallwellen in die Tiefe des Sees. Der Gewässergrund sowie die Fische reflektieren das akustische Signal zurück zum Echolotgerät. Ich frage mich, wofür man mich hält. Vermutlich für einen vermoderten Baumstamm.
4 Der Gartenklub macht Sauerkraut
Erdflöhe sind zwischen eins Komma fünf und drei Millimeter große Käfer, die dank ihrer kräftigen Sprungbeine flohartig hüpfen können. Werden sie beim Unkrautentfernen oder Harken vom Menschen gestört, können die Flöhe auf den Gärtner springen und versuchen, diesen zu beißen. Solche »Erdfloh-Bisse« sind lästig und bei einer Neigung zu Allergien gefährlich.
Johannas Laden war wie ein burgenländischer Garten Eden. Hier gab es aromatisches Roggenbauernbrot, das nach Kümmel und Anis duftete, und dicke rahmige Milch in Glasflaschen. Chilischarfe Würstel vom Zickentaler Moorochsen und cremigen Ziegenkäse, sauer eingelegtes Pusztagemüse und eine Zwetschken-Mohn-Marmelade, die so schmeckte, als hätte man einen Germknödel ausgepresst.
Auch allerlei Kramuri wartete hier auf den passenden Käufer. In mit graugrünem Schleiflack bemalten Bauernkommoden und Regalen fand man pastellfarbenes Emaillegeschirr und grobe Tischtücher aus Hausleinen. Es gab Häferl mit Blumenranken und altmodisch aussehende Guglhupfformen, handgesiedete Kräuterseifen und Naturkosmetik, die nach Zitronenmelisse oder Lavendel duftete.
Trat man durch das große Hoftor, so fand man sich in dem lauschigen Innenhof wieder, wo sich Obst und Gemüse der regionalen Produzenten türmte. Jetzt im Herbst waren es vor allem Berge von Kürbissen, Körbe mit dunklen Uhudlertrauben und kleine duftende Rosenäpfel, die, auf Hochglanz poliert, von einem bemerkenswert glänzenden Rot waren, das jeden Betrachter sofort an Schneewittchen und die böse Stiefmutter denken ließ.
Als Nahversorgerin in einem kleinen südburgenländischen Dorf hatte Johanna jahrelang mehr schlecht als recht von den Erträgen ihres Hofladens gelebt. Aber dann wurde das Garteln wieder in. Das naturnahe Garteln genauer gesagt. Und die Menschen im Südburgenland fingen an, ihre Gärten zu verändern. Die Buchsbaumhecken, die vom Buchsbaumzünsler ohnehin arg bedroht waren, wichen Naschhecken, in denen Ribiseln, Egrescherln, Himbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren wuchsen. Die japanischen Zierkirschen wurden durch essbare Kirschen ersetzt. Auf den öden Rasenflächen, auf denen bis dato die Rasenmähroboter einsame Kreise gezogen hatten, entstanden nun Gemüsehochbeete und Kräuterspiralen.
Und weil Johanna den grünsten Daumen im ganzen Land besaß, kamen die neuen Selbstversorger nun in Scharen zu ihrem Hofladen und fragten sie um Rat. Erst besorgte Johanna ihren Kunden aus reiner Gefälligkeit die von ihr empfohlenen Harken, Samen und Stecklinge. Aber irgendwann war der Bedarf so groß, dass sie ihr Sortiment dauerhaft erweiterte. Sie baute aus alten Glasfenstern an der Südwand ihres Hofes ein Glashaus, in dem sie Kräuterstecklinge zog. Sie besorgte sich alte ausgediente Badewannen, füllte diese mit Erde und errichtete Schaubeete, die sie mit buntem Mangold, süßen Zuckererbsen, fruchtigen Kirschtomaten, satt glänzenden Melanzani und scharfen Pfefferoni bepflanzte. Dazwischen blühten orange Ringelblumen, rote Kapuzinerkresse und blauer Ysop. »Gärtnern im Quadrat« nannte Johanna das. Indem sie die Badewannen-Hochbeete in kleine Quadrate statt der herkömmlichen Reihen einteilte, gewann sie auf einer kleinen Fläche dank Mischkultur eine große und abwechslungsreiche Ernte. Und ganz nebenbei waren ihre kreativen Hochbeete plötzlich auch noch voll im Trend. Die Kunden waren begeistert und bauten die Beete eins zu eins nach. Alles, was sie dafür benötigten, von den bunt lackierten Badewannen über die Jungpflanzen bis zum Regenwurmdünger und den Schafwollflocken, die die Schnecken abwehren sollten, bekamen sie nun bei Johanna. Das alles konnte man mittlerweile natürlich auch im Gartengroßcenter kaufen. Aber dort gab es weder Johannas unerschöpfliches Gartenwissen noch ihren wohlschmeckenden Apfelkuchen mit Mürbteigdeckel, für den es kein Rezept gab, weil Johanna ihn immer irgendwie »iwahaps«9 machte.
Auch Johannas Gartenverein, der »Klub der grünen Daumen«, hatte vom Trend zum Selbstversorgergarten profitiert. Zum heutigen Workshop »Sauerkraut selber machen« hatten sich ein Dutzend Frauen und auch ein paar Männer angemeldet. Johanna blickte in die Runde. Viele neue Gesichter waren dabei, aber auch ein paar vertraute: Vera, die Journalistin, die immer so viele Fragen stellte; Mitzi, die Bäuerin, die noch richtiges Heanzisch, den südburgenländischen Dialekt, sprach; Grete, die Künstlerin, die sich einst in der Hainburger Au an Bäume gekettet hatte und nun und mit Feuereifer Samenbomben auf die Grüninseln inmitten der Kreisverkehre warf; Isabella, die Drogistin, die sich so gut mit Kräutern auskannte; und Mathilde, die kurvige Köchin mit Petticoat und Tupfenbluse, deren Gemüsetattoo – so kam es Johanna vor – schon wieder gewachsen war.
Johanna blickte in die Runde und musste blinzeln, weil die tief stehende Herbstsonne sie blendete. Sie saß im Hof vor ihrem Laden. Die Ärmel ihrer selbst gestrickten grünen Jacke waren hochgerollt, ihr rotes lockiges Haar war aufgesteckt.
Johanna hatte einen großen Krauthobel auf dem Schoß. Besser gesagt, das eine Ende des Krauthobels. Der Hobel war so riesig, dass man auf dem Schlitten gleich drei Weißkrautköpfe gleichzeitig über die rasiermesserscharfen Messer ziehen konnte. Das andere Ende des Hobels lag auf einem ihr gegenüber an der Wand platzierten Sessel. Das Arbeitsgerät war dieserart waagerecht zwischen Johannas rundlichem Bauch und der Sessellehne eingeklemmt. Darunter stand eine Emaillewanne bereit, um das gehobelte Kraut aufzufangen.
Johanna bewegte den Schlitten, auf dem die Krauthappel10 lagen, und passte dabei ganz genau auf, dass ihre Finger nicht mit den scharfen Messern in Berührung kamen. Krautstreifen rieselten herab. Ein scharfer und würziger Geruch stieg von der Wanne hoch.
»Derf i a amoi?«, fragte Mitzi begierig. »Weil wia i klua woar, homa im Herbst daham a immer as Kraut eigmocht. Des Krautfassl wor so groß«, sie zeigte zu Johannas Schulter, »und i hob as Kraut imma obledschn miassn.«11
»Was hat sie müssen?«, fragte Vera, die lange in Wien gelebt hatte und des Heanzischen nicht so mächtig war. Mathilde grinste wissend.
»Obledschn, das Kraut abblättern, sie hat die äußeren Blätter entfernt«, flüsterte sie zurück.
Mitzi drehte sich nach den beiden um. »Dei Bladln und d’ Strunk hom d’ Hiana und Schweindln kriagt. Und mir hom imma vü Kraut gmocht. Hot jo an gaunzn Winta reichen miassen. Mir homs im koidn Kölla stehn ghobt, dass länger hoit. Und as erste Kraut im Johr hots imma erst noch da Christmettn gebn.«12
Während Mitzi Johanna ablöste und weiter hobelte, gab Johanna das bereits geschnittene Kraut in Kübel und vermischte es mit Salz, Wacholder, Lorbeer und Kümmel. Dann verteilte sie es unter den Anwesenden. Jeder der Teilnehmer hatte einen sauberen Gärtopf, einen Krauttopf oder ein großes Einweckglas mitgebracht.
»Ihr müsst das Kraut jetzt richtig festdrücken und stampfen, damit sich Krautsaft bildet«, erklärte sie. »Am besten geht das mit einem Stößel. Hier in der Kiste liegen welche.«
»Wie viel Gramm Salz verwendet man auf wie viel Gramm Kraut?«, fragte Vera. »Das macht man iwahaps«, hätte Johanna am liebsten gesagt. Aber ihr war klar, dass Backen nach Gefühl nicht jedem lag. Zum Glück hatte sie sich vorbereitet:
»Ein bis fünf Prozent pro Kilogramm frischem Kraut, also zehn bis 50 Gramm. Für zehn Kilogramm Kraut liegt die Spanne also zwischen 100 und 500 Gramm Salz.«
Vera notierte sich die Angaben.
»Ich würde beim ersten Mal eher weniger Salz nehmen«, riet Mathilde. »Ihr könnt euer Krautrezept übrigens individuell variieren. Es gibt unzählige Varianten. Man kann beim Einstampfen Apfelsaft, Bier, Wein oder sogar Champagner zum Kraut gießen. Man kann es zusätzlich mit Essig und Zitronensaft säuern. Oder ihr gebt Trauben, Orangen-, Mandarinen- oder Ananasstücke zum Fermentieren mit in den Topf.«
»Was passiert genau beim Fermentieren?«, fragte Vera.
»Es bilden sich Milchsäurebakterien, die das Kraut konservieren. Die sind übrigens ganz toll für den Darm. Gekauftes Sauerkraut ist fast immer pasteurisiert. Da ist dann nicht mehr viel übrig von den guten Bakterien«, erklärte Johanna.
Sie hatte ihr Krautfass bereits zu vier Fünftel vollgefüllt und drückte das Kraut energisch nach unten. »Das Kraut muss immer mit Salzlake bedeckt sein, sonst verdirbt es. Wir legen deshalb zum Abschluss ein ganzes Krautblatt als Deckel drauf und beschweren es mit Krautsteinen, damit das Ferment unterhalb des Flüssigkeitsspiegels bleibt. Und dann verschließt ihr die Gefäße, aber keinesfalls luftdicht. Es müssen noch Gase entweichen können.«
»Unsere Krautstua dahuam san aus Granit und so groß wia Fuaßboi«, sagte Mitzi. »I ho mein Papa gsogt, dass er ma dei vererbn muas, owa er pflanzt mi imma und sogt, die san scho fuart, die hot er a scho wo eibetoniert.«13 Sie lachte schelmisch und schüttelte ihre kurzen Locken. Mitzi war deutlich älter als die anderen, aber hatte sich eine kindliche Unbeschwertheit und Fröhlichkeit bewahrt, die sie deutlich jünger wirken ließen.
Mathilde liebte Mitzis Geschichten. Die musste eine echte Bullerbü-Kindheit gehabt haben. Sie selbst war im Oberwarter Hochhaus aufgewachsen. Was für ein Kontrastprogramm.
»Und was passiert jetzt?«, fragte Vera ungeduldig. Johanna sah zu der brünetten Frau in Jeans und Kapuzensweater hinüber. Vera wirkte wie ein Pferd, das gleich beginnen würde, mit den Hufen zu scharren. Johanna führte Veras Ungeduld darauf zurück, dass diese zu lange in der schnelllebigen Großstadt gelebt hatte.
»Das wollt ich grad erklären«, sagte sie. »Also, ihr lasst das Sauerkraut erst mal bei Zimmertemperatur gären. Es werden Bläschen aufsteigen, und irgendwann wird das Ganze zu blubbern beginnen. Da müsst ihr nur aufpassen, dass es nicht überläuft. Und wenn sich Schaum bildet, schöpft ihr den einfach mit einem sauberen Löffel ab. Nach einer Woche stellt ihr das Gefäß wo hin, wo es kühler ist. Und nach vier bis sechs Wochen könnt ihr das Kraut essen,« erklärte Johanna.
»Aber woher weiß ich, wann es fertig ist?«, drängte Vera.
Johanna lachte: »Am besten kosten. Bei einem Naturprodukt ist die Gärung übrigens nie ganz abgeschlossen. Das Kraut wird nach und nach immer saurer.«
»Man kann es aber unter fließendem Wasser in einem Sieb abwaschen, das nimmt die Intensität«, ergänzte Mathilde.
»Baut ihr das Kraut selber an? Bei mir im Garten wird das nie etwas«, seufzte Grete. »Ich hab immer diese grünen Raupen, die alles anfressen, oder diese lästigen Flöhe. Die Blätter sehen dann aus, als wären sie mit winzigen Nadeln durchstochen.«