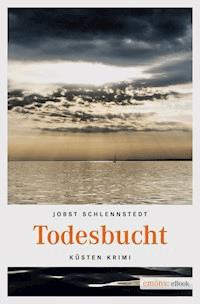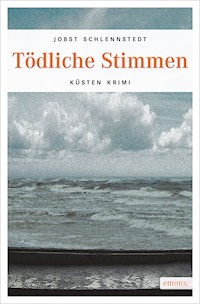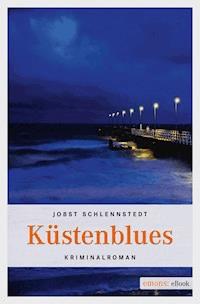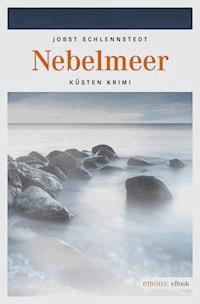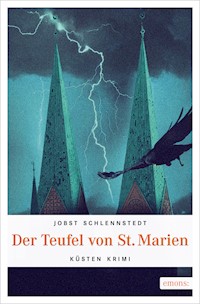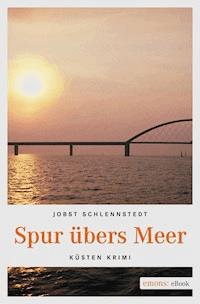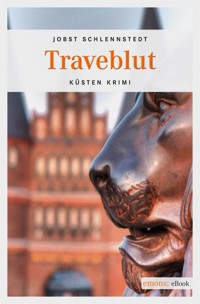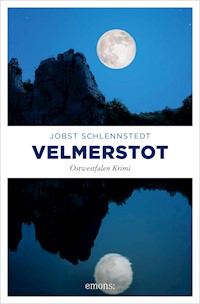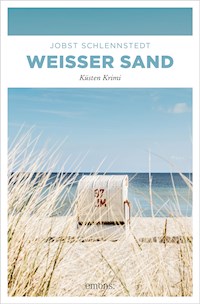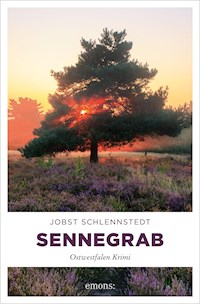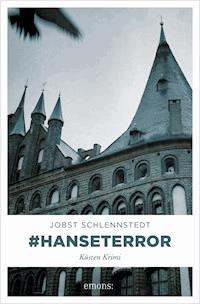
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Küsten Krimi
- Sprache: Deutsch
In Lübeck kommen die wichtigsten Außenminister der Welt zum G7-Gipfel zusammen. Mehr als dreitausend Polizisten verwandeln die Stadt in eine Hochsicherheitszone. Ausgerechnet an diesem Tag wird ein bekannter Unternehmer entführt. Als Kriminalhauptkommissar Birger Andresen in eine Geiselnahme mitten in der Innenstadt verwickelt wird, droht die Situation zu eskalieren: Der Terror hat in der altehrwürdigen Hansestadt Einzug gehalten . . .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jobst Schlennstedt, 1976 in Herford geboren und dort aufgewachsen, studierte Geografie an der Universität Bayreuth. Seit Anfang 2004 lebt er in Lübeck. 2006 erschien sein erster Kriminalroman. Hauptberuflich ist er Geschäftsführer eines Lübecker Beratungsunternehmens für die Hafen- und Logistikwirtschaft. Im Emons Verlag erschienen die Westfalen Krimis »Westfalenbräu« und »Dorfschweigen«. Außerdem die Küsten Krimis »Tödliche Stimmen«, »Der Teufel von St.Marien«, »Möwenjagd«, »Traveblut«, »Küstenblues«, »Todesbucht«, »Spur übers Meer« und »Lübeck im Visier« sowie der Thriller »Küste der Lügen«. Mit »#hanseterror« liegt jetzt der siebte Band seiner Kriminalreihe um Kriminalhauptkommissar Birger Andresen vor.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: ©mauritius images/Alamy Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Hilla Czinczoll eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-990-5 Küsten Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Macht kaputt, was euch kaputt macht.
Rio Reiser
RAF 4.0
Mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen lehnte sich Bela Blank zurück und griff nach dem Rotweinglas, das er auf dem Schreibtisch abgestellt hatte. Er verzog den Mund, als die Säure auf seinen Gaumen traf. Für einen kurzen Augenblick war er versucht, den Wein wieder auszuspucken, doch er schluckte ihn hinunter.
Sein Blick fiel auf das Etikett der Flasche, die ihm sein Vater einst zu seinem bestandenen Diplom geschenkt hatte. Ein 95er Château Margaux. Jemand hatte ihm mal gesagt, die Flasche sei mittlerweile mindestens fünfhundert Euro wert. Er hätte sie daraufhin um ein Haar aus dem Fenster geschmissen.
In diesem Moment wünschte er sich, er hätte es getan. Der Wein war ungenießbar. Vielleicht widerte ihn aber auch einfach nur die Vorstellung an, etwas zu trinken, das sich üblicherweise nur die Reichsten der Reichen leisten konnten.
Er stellte das Glas wieder ab und wandte sich dem Blatt zu, das vor ihm lag. Dickes, strukturiertes Papier, auf dem seine Handschrift besonders gut zur Geltung kam. Die schwarze Tinte verwischte leicht, als er seinen rechten Zeigefinger etwas zu fest über die letzten Sätze seines Werks gleiten ließ. Auf sie war Bela Blank besonders stolz.
Jedes einzelne seiner Worte war wohlüberlegt gewesen, und doch gab es da diese herausragenden Sätze, die Großes bewirken konnten. Er war überzeugt, dass sie über viele Jahre, womöglich sogar Dekaden hinaus, Menschen faszinieren und von seinen Ideen überzeugen könnten.
Ohne Zweifel hatte er etwas geschaffen, das die politische Ordnung und das bestehende Wirtschaftssystem der westlichen Welt ein für alle Mal zu Grabe tragen würde. Ein System, das bereits zum Scheitern verurteilt gewesen war, als man es eingeführt hatte. Ein System, das Tag für Tag seine hässliche Fratze zeigte. Ein System, das niemals zum Wohle aller installiert worden war, sondern immer darauf abgezielt hatte, diejenigen zu bevorteilen, die ohnehin an der Macht waren. Die Mächtigen noch mächtiger zu machen. Die Reichen noch reicher. Und die Schwachen noch schwächer. Ein System, das die Menschheit in ihrer Existenz gefährdete, weil sie sich eines Tages selbst zerfleischen würde.
Da lag es vor ihm, sein Manifest für die Menschheit. Exakt tausendneunhundertsiebzig Zeichen lang. Ohne Leerzeichen. Blank hatte penibel darauf geachtet, denn eines war ihm vom ersten Moment an wichtig gewesen: die Wurzeln seiner Idee, die Vergangenheit, auf der alles beruhte, seine Vorbilder, die er nie hatte kennenlernen können, nicht zu vergessen. Kleine, versteckte Hinweise darauf, worauf seine Werte bauten, womit seine Gegner zu rechnen hatten. Diese Hinweise sollten zukünftig das Markenzeichen der Kommunikation mit den Medien und der Staatsgewalt sein.
Er atmete tief durch und ließ die letzten Monate noch einmal vor seinem inneren Auge vorbeiziehen. Die Vorbereitungen, die Gedanken, die er sich rund um die Uhr gemacht hatte, um jedwedes Risiko zu minimieren. Denn die Vergangenheit hatte ihn gelehrt, wie wichtig es war, alles bis ins letzte Detail zu planen. Akribie, Disziplin und Verschwiegenheit waren die Grundsätze, auf denen er das Fundament ihrer Gruppierung errichtet hatte. Jedem seiner Mitstreiter hatte er die Bedeutung dieser Wörter wieder und wieder eingebläut. Bis er schlussendlich überzeugt gewesen war, dass jeder Einzelne verstanden hatte, wofür sie zu kämpfen hatten.
Blank nahm die restlichen Kopien vom Tisch und vergewisserte sich, dass er nichts hatte liegen lassen. Er wollte den Raum schon verlassen, doch nachdenklich schloss er die Tür wieder.
Das Manifest war vollendet. Ein halbes Jahr hatte er daran geschrieben, an jedem Wort gefeilt. Und in wenigen Augenblicken würde er es den anderen überreichen. Ein Moment, dem wohl erst im Nachhinein die gebührende Bedeutung verliehen werden würde. Vielleicht von einem der Mitstreiter, der seine Rolle einnehmen würde, wenn die Zeit dafür reif war.
Er wusste schon jetzt um die Bedeutung dieses Augenblicks. Ehe er in die glühenden Augen der anderen sah, würde er noch ein letztes Mal jeden Satz, jedes einzelne Wort in sich aufsaugen. Sich noch einmal vergewissern, dass er tatsächlich den richtigen Ton getroffen hatte. Ein letztes Mal die Worte wirken lassen, ganz für sich. Blank begann laut zu lesen.
Wechsel
Macht ist menschlich. Tief verankert in uns allen. Menschlicher als Politik. Menschlicher als Religion. Menschlicher als Systeme.
Macht ist mächtig. Will immerzu die Oberhand gewinnen. Lässt sich nicht verdrängen, sobald sie tief verankert ist. Macht ist mächtiger als Liebe. Mächtiger als Glaube. Mächtiger als Geld.
Macht ist ein Teil von uns allen, den wir zu beherrschen wissen müssen. Denn Macht ist endlich. Endlicher als Liebe, endlicher als Leben. Etwas, dessen wir uns immerzu bewusst sein sollten.
Doch die Macht des Einzelnen ist nicht mächtig. Sie wirkt tödlich. Verheerend für die anderen, die doch auch nur nach ihr streben.
Macht im Kollektiv macht uns stark. Ohne Führer, aber mit Führung. Ein gemeinsames Denken, in dessen Mittelpunkt der Einzelne steht, ohne Egoismen zu fördern. Ein Ideal, das das Denken beherrscht und die selbstzufriedene Wohlstandsgesellschaft an den Pranger stellt.
Die Implementierung eines gemeinschaftlichen, antikapitalistischen Systems ist die einzige Chance, die neoliberalistischen und faschistischen Strukturen dieses Staates aufzubrechen.
Klassenkampf anstelle friedlicher Optionen. Als Instrument, um unser ultimatives Ziel zu erreichen. Die Bewaffnung als realistische, unumgängliche Lösung.
Bewaffnung all jener, die bereit sind, den Kampf bis zum Ende zu führen. Ein Ende, das erst dann erreicht ist, wenn auch das letzte Kapital den Bonzen entrissen und auf das Kollektiv verteilt wurde.
Märtyrer wollen leiden. Sterben. Ihnen fehlt das Ziel. Die Vision, etwas Neues zu schaffen. Den Wechsel herbeizuführen. Stattdessen zerstören sie, weil sie ihren Glauben an einen Gott verschwenden, den es nicht gibt. Weil sie kein Kollektiv sind. Weil sie der falschen Macht vertrauen.
Wir dagegen sind anders. Wir sind das Kollektiv. Der Schwarm. Die Intelligenz. Die Menschen, die den Wechsel wollen. Individuen, die für den Kampf gegen den Kapitalismus ihre Selbstsucht ablegen. Männer und Frauen, die in einer Welt leben, in der Verteilungskämpfe geführt werden müssen, um Verteilungskämpfe für immer zu beenden.
Niemand wird, was wir begonnen haben, stoppen können. Niemand wird sich unserer Idee entziehen können. Der Wechsel ist längst im Gange. Denn wir sind diejenigen, die das System verändern werden. Durch uns wird alles anders werden. Und nach uns alles anders bleiben.
gez.
Rote Armee Fraktion4.0
Er starrte noch minutenlang auf das Blatt Papier. Auf die Sätze. Die Worte, die ihm so wichtig waren. Die alles verändern sollten. Die sich verbreiten sollten. Es waren seine Worte.
Sein Blick fiel auf den Kalender an der Wand. Er war so neu und frisch wie das Manifest, das er verfasst hatte. Das Jahr, in dem sich alles ändern würde, in dem er die Pläne, die so lange in ihm gereift waren, endlich umsetzen würde, hatte gerade erst begonnen.
Vom morgigen Tage an waren es noch exakt drei Monate, bis das Warten ein Ende hätte. An diesem Tag im April würde der Terror in dieser Stadt losbrechen und von dort aus die gesamte Gesellschaft verändern. Ab diesem Moment würde es kein Zurück mehr geben. Sie würden das fortsetzen, was seine Vorbilder ins Leben gerufen hatten. Jedoch kraftvoller. Mächtiger. Unumstößlicher. Ohne den geringsten Zweifel am Erfolg ihres Unterfangens.
Er nahm die Zettel in die Hand und atmete tief durch. Er war plötzlich nervös. Ein Gefühl, das er kaum noch kannte. Ihm war klar, dass die nächsten Minuten nicht nur über seine eigene Zukunft, sondern die der Gesellschaft, die er verändern wollte, entscheiden würden. Die Leute, die ihm vertrauten, mussten sich zu ihm bekennen. Zu ihm und zu seinem Manifest, der Grundlage ihres zukünftigen Handelns. Nur mit ihrer bedingungslosen Unterstützung würde es gelingen, das umzusetzen, was er seit Jahren plante.
HERINGSSAISON
Der Fisch, der in seiner Hand zappelte, erinnerte ihn an seine Kindheit. An die Urlaube mit seinen Eltern hoch oben in Norwegen, wenn sein Vater Lachse aus dem Alta gefischt und sie lachend in die Kamera gehalten hatte.
Er war stolz auf seinen Vater gewesen. Hatte er doch mühsame Stunden damit verbracht, in dem flachen Fluss zu stehen und darauf zu warten, dass einer der riesigen Atlantiklachse anbiss. Die meisten anderen Väter waren erfolglos geblieben. Hatten unverrichteter Dinge aufgeben und ihren Kindern von ihrem Scheitern berichten müssen. Aber sein Vater hatte einfach immer einen Lachs gefangen. Er konnte sich nicht erinnern, dass er jemals mit leeren Händen nach Hause gekommen war.
Andresen öffnete die Augen. Der kleine Hering zappelte noch immer und japste nach Luft. Vorsichtig entfernte er den Angelhaken, dann warf er den Fisch zurück in die Untertrave. Dies hier hatte nichts mit dem Lachsangeln in Norwegen zu tun, das er als Kind so sehr geliebt hatte.
Er warf einen raschen Blick in seinen Eimer und zählte bereits ein Dutzend Heringe. In weniger als einer halben Stunde gefangen. Er brauchte seine Angel nur ins Wasser zu werfen, schon biss einer der kleinen Fische an, die in riesigen Schwärmen zum Laichen aus der Ostsee in die Mündung der Trave schwammen. Er kam sich beinahe vor wie an der Fischtheke eines Supermarkts, neben ihm unzählige andere Kunden. Und alle wollten sie möglichst viele Heringe aus dem noch kalten Wasser angeln.
Er packte seine Sachen ein, verstaute die Angel, die er sich von seinem Sohn geliehen hatte, in einer Plastiktüte und drückte einem älteren Mann den Eimer mit den geangelten Heringen in die Hand. Während der Mann noch überrascht dreinschaute, nickte Andresen kurz und ging um den Schuppen9 herum. Dann überquerte er die Straße. Doch dort, wo er heute in den frühen Morgenstunden noch ungehindert entlanggegangen war, waren bereits erste Absperrgitter aufgestellt. Polizisten kamen ihm entgegen und forderten ihn auf, den Bereich weiträumig zu umgehen.
Er war versucht, den süddeutsch klingenden Beamten der Bundespolizei zu sagen, dass sie ihn nicht belehren mussten, weil er einer von ihnen war. Doch er verzichtete auf eine Erwiderung und lief entlang der Absperrgitter in Richtung Kanalstraße.
Offiziell hatte er sich für die kommenden Tage krankgemeldet. Drei Tage im April, an denen in Lübeck Ausnahmezustand herrschen würde. Denn schon in wenigen Stunden würden die ersten Außenminister der wichtigsten Industrienationen eintreffen, um in der Hansestadt ihr jährliches G7-Treffen abzuhalten. Und sie würden ausgerechnet hier, unweit der vielen Heringsangler, im Europäischen Hansemuseum zusammenkommen.
Andresen blieb stehen und sah sich um. Das Hansemuseum war in den vergangenen drei Jahren unter großem Aufsehen der Öffentlichkeit gebaut worden und würde erst in wenigen Wochen offiziell eröffnet werden. Das Gebäude, für das sogar der Bunker, in dem sich lange Zeit ein Jazzclub befunden hatte, und die alte Seemannsmission abgerissen worden waren, erschien aus der Nähe mächtig. Und doch passte es sich mit braunem Klinker und hanseatischer Zurückhaltung gut in die benachbarte Bebauung ein. Andresen nickte, als wolle er bestätigen, dass in Lübeck endlich wieder etwas entstanden war, auf das man stolz sein konnte.
Er ging weiter in Richtung Hubbrücke. Er war nicht im eigentlichen Sinne krank. Er hatte kein Magen-Darm-Virus, so wie er es dem Kollegen im Präsidium telefonisch mitgeteilt hatte. Doch das, was er vor ein paar Tagen erfahren hatte, nahm ihn seelisch mehr mit als jeder Fall, den er in den vergangenen Jahrzehnten aufgeklärt hatte. Ausgerechnet sein Erzfeind, seine Nemesis Boris Roloff, hatte ihn mit der schmerzlichen Nachricht konfrontiert, dass es Wiebke gewesen war, die sein früheres Haus in der Innenstadt in Brand gesteckt hatte.
Noch war er nicht so weit, mit ihr darüber zu sprechen. Denn seine Wut war grenzenlos. Noch schützte sie ihn davor, etwas zu tun, das er später bereuen würde. Das, was sie getan hatte, war so ungeheuerlich, dass er jedes Mal Herzrasen bekam, wenn er nur daran dachte. Egal, wie sehr er sie verletzt hatte, indem er sich nicht zu ihrem gemeinsamen Zuhause am Brodtener Steilufer bekannt hatte. Egal, was sie über ihn und seine Affäre mit seiner Kollegin Ida-Marie womöglich gewusst oder zumindest geahnt hatte, sein Haus anzuzünden und in Kauf zu nehmen, dass auch Menschenleben gefährdet sein können, war ein schweres Verbrechen und durch nichts zu entschuldigen. Er hatte sich geschworen, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Selbst wenn das am Ende bedeutete, dass er den Kindern ihre Mutter nahm.
Andresen spürte sein Herz hinter der Brust pochen, die Gedanken an Wiebke trieben seinen Blutdruck in die Höhe. Was für ein Hass musste sich all die Jahre lang in ihr aufgebaut haben, dass sie zu so etwas fähig gewesen war? Obwohl ihre Beziehung Höhen und Tiefen gehabt hatte und Wiebke kein Mensch war, der ein Blatt vor den Mund nahm, hatte nichts jemals darauf hingedeutet, dass sie eine derartige Straftat begehen würde. Dass sie ihm das nähme, was ihm so viel bedeutet hatte.
Andresen bog in die Kanalstraße ein und unterquerte die Burgtorbrücke. Er würde nach Hause gehen, sich auf sein Bett legen, bis es ihm besser ginge und er endlich wüsste, was er Wiebke sagen sollte.
Er nickte einem dunkel gekleideten Mann zu, der hinter einem Mauervorsprung des Brückenpfeilers stand und ein Funkgerät an sein Ohr hielt. Auch auf der anderen Seite der Kanaltrave sah er jemanden, der sich offenbar im Schatten der Brücke positioniert hatte. Die Kollegen der Bundes- und Landespolizei schienen bestens vorbereitet zu sein und jeden Winkel rund um den Bereich des Hansemuseums im Blick zu haben.
Auf der Kanaltrave näherte sich ein Schlauchboot aus Richtung Süden. Es steuerte mit hoher Geschwindigkeit auf die Hubbrücke zu, drehte jedoch im letzten Moment ab. Andresen sah sich zu dem Mann um, der ihm gerade zugenickt hatte, und hörte, wie er mit ruhiger Stimme in sein Funkgerät sprach, ohne jedoch Einzelheiten verstehen zu können.
Er erinnerte sich an seine Ausbildungszeit, in der er gelernt hatte, sich intensiv auf große Ereignisse vorzubereiten. Auch wenn diese Zeit mittlerweile mehr als dreißig Jahre zurücklag und die Anforderungen und Gefahrenlagen längst nicht mehr mit den heutigen zu vergleichen waren, gab es einige grundlegende Regeln, die immer galten. Dazu gehörte vor allem, bei der polizeilichen Observation eines potenziellen Anschlagsziels so diskret wie möglich vorzugehen.
Er wandte sich um und trat auf den Mann mit dem Funkgerät am Ohr zu, der die Uniform der schleswig-holsteinischen Landespolizei trug. Ihn überraschte, wie jung der Mann aussah. Andresen schätzte ihn auf Anfang zwanzig. »Kennen wir uns vielleicht?«, fragte er.
Der irritierte Blick des Mannes war Antwort genug. Hastig verstaute er das Funkgerät in seiner hinteren Hosentasche und baute sich vor Andresen auf. »Wer sind Sie?«
»Birger Andresen, Kripo Lübeck. Darf ich fragen, woher Sie kommen?«
»Ich würde gerne Ihre Marke sehen.«
Andresen lächelte und sah den groß gewachsenen Mann herausfordernd an. »Ich bin privat hier«, sagte er. »Sie sind nicht aus Lübeck, richtig?«
»Nein.«
»Sie wollen nicht reden?«
»Ich komme von der Westküste, allerdings nicht gebürtig.«
»Das hätte mich auch gewundert. Sie klingen, als kämen Sie aus Bayern.«
»Lässt sich wohl niemals ganz unterdrücken.«
»Gut, dass Sie nach meiner Marke gefragt haben«, sagte Andresen. »Wenn ich Ihnen jedoch noch einen kleinen Tipp geben darf: Sie sollten etwas dezenter vorgehen. Nicht jeder muss mitbekommen, auf welche Eventualitäten sich die Polizei hier vorbereitet.«
»Natürlich nicht«, antwortete der Mann und lächelte zurück. »Dann seien Sie doch bitte so nett und reden Sie mit niemandem darüber, was wir hier machen.«
»Ich bin in Lübeck bis vor wenigen Monaten Leiter der Mordkommission gewesen«, entgegnete Andresen schmallippig. »Glauben Sie mir, ich weiß, mit wem ich worüber reden darf. Und jetzt machen Sie weiter, Sie müssen wachsam sein. Und lassen Sie sich nicht in Gespräche verwickeln.« Andresen zwinkerte kurz, ehe er sich von dem Mann abwandte und weiterging.
Nach einigen Metern drehte er sich noch einmal um. »Gibt es einen Grund, weshalb Sie hier stehen?«, fragte er, ohne dass es ihm gelang, seine Neugier zu verheimlichen. »Ich meine, gibt es Hinweise auf eine konkrete Anschlagsgefahr?«
»Hören Sie, solange ich nicht sichergehen kann, dass Sie tatsächlich Kriminalbeamter sind, verrate ich Ihnen gar nichts. Und selbst wenn, dürfte ich Ihnen nicht–«
DER LETZTE TAG
Früher, das war eine andere Zeit. Früher, das kam ihm wie ein anderes Leben vor. In diesem Leben hatten seine Eltern in dem Haus mit dem großen Garten gewohnt, vor dem er gerade wartete. Hier in dieser Straße, in der er jeden Baum kannte.
Sie hatten hier gelebt, bis seine Mutter verstorben war und sein Vater schon kurz danach beschloss, die noch ausstehenden Jahre seines Lebens zehntausend Kilometer entfernt hinter großen Mauern, dafür jedoch mit Blick auf das Kap der Guten Hoffnung zu verbringen. Gemeinsam mit einer neuen Frau und der ganzen Kohle, von der er sein Leben lang nie hatte genug bekommen können.
Hier in dieser Straße, in der er im Haus seiner Eltern die ersten achtzehn Jahre seines Lebens verbracht hatte, reihte sich Villa an Villa. Architektonisch konnte er ihnen sogar einiges abgewinnen. Und er mochte die fast parkähnlichen Gärten einiger Anwesen mit eigenen Bootsanlegern hin zur Wakenitz. Doch wenn er bedachte, was sich hinter den dreifach isolierten Fenstern der Häuser abspielte, welche geldgierigen, konsumverdorbenen Menschen dort wohnten, überkam ihn eine Wut, die ihm geradezu die Luft abschnürte.
Diese Menschen lebten den Kapitalismus in Reinkultur. Große Limousinen, Porsche Cayenne und AudiQ7, die auf den Auffahrten standen. Eisentore, die sich nur öffneten, wenn standesgemäßer Besuch vorfuhr. In diesem Umfeld hatten seine Eltern versucht, ihm Werte zu vermitteln, die er schon als Teenager verachtet hatte. Es gab keinen Wunsch, den sie ihm ausgeschlagen hatten. Meistens hatte er diese Wünsche nicht einmal äußern müssen. Seine Eltern waren ihm zuvorgekommen. Hatten ihn überhäuft mit sämtlichen Dingen, die sie für Geld kaufen konnten, ohne jemals auch nur ansatzweise zu merken, dass ihn das nicht glücklich machte.
Gemeinsam hatten sie die spektakulärsten Urlaube verbracht, die weitesten Reisen unternommen und in den teuersten Hotels gewohnt. Im Winter waren sie Ski fahren gewesen, in Kitzbühel. Er konnte bereits Snowboard fahren, als die Dinger noch kaum jemand gekannt hatte. Freunde hatte er keine gehabt. Weder in der Schule noch in der Nachbarschaft.
Überhaupt hatten nur wenige Kinder in der Straße gelebt. Die meisten, die sich hier eine der Villen oder zumindest eine Wohnung leisten konnten, waren Pärchen zwischen Mitte dreißig und Mitte fünfzig gewesen, die, anstatt eine Familie zu gründen, Karrieren als Unternehmer, Berater, Anwälte oder Ärzte gemacht hatten. Nicht etwa aus Passion, nein, er kannte diese Leute. Ihnen ging es einzig und allein darum, ihren Reichtum zu maximieren, und das auf Kosten anderer. Ihnen lag nicht das Geringste daran, für eine gerechtere Welt zu sorgen. Reichtum etwa umzuverteilen. Im Gegenteil: Die Ungerechtigkeit des Systems war Grundlage ihrer Existenz. Ihr ungezügelter Konsum konnte nur auf dem Rücken des Großteils der Gesellschaft funktionieren. Sie verstanden einfach nicht, dass dieses System eine Einbahnstraße war. Dass es zwangsläufig zu einem Ende führen musste, das vor allem für sie selbst schmerzhaft sein würde.
Die Menschen hier lebten wie unter einer großen Glocke. Dass sie glaubten, sie seien der Teil der Gesellschaft, der das System vorgeben könne, schien ihm absurd. Denn eines Tages würden sie überrollt werden von der Masse der Einzelnen. Von dem Schwarm, der schon bald verstehen würde, dass die Zeit für einen Wechsel längst überfällig war.
Bela Blank drehte den Schlüssel seines alten Passats herum und legte den ersten Gang ein. Er hatte genug gesehen, kannte jeden Zentimeter des Grundstücks, auch wenn mittlerweile zwanzig Jahre vergangen waren, seit er es zuletzt betreten hatte.
Sein Pulsschlag beruhigte sich, als er die Roeckstraße in Richtung Gustav-Radbruch-Platz befuhr. Heute war der letzte normale Tag. Die nächsten Wochen, vielleicht sogar Monate, würde er im Untergrund verbringen müssen. Das, was in der kommenden Nacht losbrechen würde, würde ihn von einer auf die andere Sekunde zum meistgesuchten Mann des Landes machen. Obwohl er alles versuchen würde, seine eigene Identität und die der anderen so lange wie möglich geheim zu halten, wusste er, dass die Staatsmacht früher oder später herausbekommen würde, dass er hinter der ganzen Aktion steckte.
Irgendwann in einigen Wochen würde ohnehin der Punkt kommen, an dem sie sich zeigen mussten. Sie würden aus der Anonymität ausbrechen und Gesichter zu ihren Taten liefern. Jeder sollte wissen, wer sie waren. Wer hinter der Idee stand. Wer das Manifest geschrieben hatte. Und wem sich die Menschen anschließen sollten.
Blank fand einen Parkplatz an der Kanalstraße und schlenderte die Rippenstraße hoch in Richtung Altstadtkern. Ein letztes Mal für eine sehr lange Zeit. In diesem Bewusstsein sog er den Geruch der Stadt tief ein. Er genoss es, sich die Schaufenster der kleinen Geschäfte anzusehen. Die Ladenbesitzer bewunderte er. Sie schafften es, sich gegen die großen, globalen Ketten mit ihrer Maxime der reinen Profitorientierung durchzusetzen und ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. Nicht die Aussicht auf das große Geld trieb sie an, sie gingen einzig und allein ihren Träumen nach.
Er wünschte ihnen, dass es so bliebe. Allzu oft hatte er jedoch erfahren müssen, dass das Geld die Menschen veränderte. Es war verführerisch, konnte aus Visionären eiskalte Kapitalisten machen. Kaum jemand war davor gefeit. Denn oftmals spürten die Menschen nicht einmal, wie sie sich veränderten. Wie sie der Verlockung nach und nach erlagen und ihr Handeln nur noch dem Kapital unterwarfen. Sie schmissen Prinzipien über Bord und waren plötzlich selbst Opfer des kapitalistischen Systems, das sie Jahre zuvor noch verflucht hatten.
Blank verweilte unter den Arkadenbogen des Kanzleigebäudes und war sogar versucht, es sich im Niederegger Café gemütlich zu machen. Doch dann ermahnte er sich selbst und erinnerte sich wieder an die Werte, die er nicht nur geschaffen und verinnerlicht hatte, sondern auch weitergeben wollte. Diesem Unternehmen, das Menschen zum Konsum geradezu verführte, kein Geld in den Rachen zu werfen. Und in diesem Café nicht Stuhl an Stuhl mit Menschen zu sitzen, die er verachtete.
Er ging quer über den Marktplatz bis zur Holstenstraße. In etwas mehr als vierundzwanzig Stunden würde hier die Hölle los sein. Er versuchte sich vorzustellen, wie Dutzende Einsatzfahrzeuge der Polizei und Krankenwagen die Straßen verstopften. Der Ausnahmezustand, der ohnehin schon in der Stadt herrschte, würde in totales Chaos umschlagen. Und niemand würde auch nur ahnen, dass der eigentliche Schlag, der die Gesellschaft in Aufruhr bringen würde, erst noch bevorstand.
Als Blank den Kohlmarkt hinter sich ließ, warf er noch einen letzten Blick über die Schulter. Ihr Plan würde funktionieren. Sie hatten sich wochenlang vorbereitet, kannten jeden Winkel der Stadt und ihrer Gebäude. Sie hatten einen exakten Zeitplan, wussten genau, wann sie was zu tun hatten. Jeder Einzelne war über seine Aufgabe informiert. Wie zu reagieren war, wenn etwas außer Kontrolle geraten sollte.
Während das Holstentor auf seinem weiteren Weg langsam in sein Blickfeld geriet, spürte er sein Herz schneller schlagen. Die Ruhe, die er monatelang empfunden und ausgestrahlt hatte, schien plötzlich einer nervösen Anspannung zu weichen. Vielleicht einer gesunden und nötigen Anspannung. Denn sie alle mussten sich in den kommenden Stunden in den Tunnel begeben, in dem nur noch die völlige Fokussierung auf ihre Aufgabe zählte.
Noch einmal nahm er den Weg entlang der Untertrave, den er seit Weihnachten fast täglich gegangen war, vorbei an den Museumsschiffen und der Drehbrücke. Ein letztes Mal wollte er auf dieser Seite der Altstadt überprüfen, dass alles noch so war, wie sie es sich eingeprägt hatten. Dass es keine unvorhergesehenen Komplikationen gab, keine zusätzlichen Polizeiabsperrungen.
Er stand an der Kaikante der Untertrave in Höhe des Hafenschuppens6 und blickte die Engelsgrube hinauf, an deren Ende die St.Jacobi-Kirche den nördlichen Altstadtteil überragte. Die Stadt, in der er groß geworden war. Ein letztes Mal, bevor sich nicht nur Lübeck, sondern das gesamte Land für immer verändern würde.
Blank atmete tief durch und sah einem Fahrgastschiff hinterher, das soeben zu einer Fahrt rund um die Altstadtinsel abgelegt hatte. Noch durften sie fahren, doch das würde sich schon bald ändern. In weniger als achtundvierzig Stunden würde dieser Bereich der Stadt einer Hochsicherheitszone gleichen. Dann würde nicht nur die Straße An der Untertrave ab der Drehbrücke gesperrt sein, sondern auch die Trave selbst.
Bedächtig griff Blank in die rechte Jackentasche und umfasste sein Handy, das er heute Morgen bereits in den Werkseinstellungsmodus zurückgesetzt hatte. Als er sich sicher war, dass ihn niemand beobachtete, zog er das Handy hervor und ließ es unauffällig in die Trave fallen.
Es war eine von vielen Vorsichtsmaßnahmen, die er in den vergangenen Tagen getroffen hatte. Von jetzt an war die Kommunikation per Telefon und Internet mit seinen Leuten gekappt. Die Einzigen, die er vorher noch persönlich treffen würde, waren David und Leo. Sie würden ihn mit den wichtigsten Informationen versorgen. Alle anderen waren auf sich allein gestellt. Und ihm blieb nichts anderes übrig, als darauf zu hoffen, dass alles glatt verliefe. Er musste ihnen vertrauen. Hoffen, dass jeder von ihnen verstanden hatte, was zu tun war.
Plötzlich verspürte Blank einen Anflug von Panik. Die Tatsache, nicht mehr eingreifen zu können, setzte ihm mehr zu, als er befürchtet hatte. Den absurden Gedanken, alles sofort abzubrechen, verdrängte er mit aller Macht. Er besann sich auf das wirklich Wichtige. Auf die Werte, auf ihr gemeinsames Ziel. Auf das, was er in seinem Manifest niedergeschrieben hatte. Und vor allem auf das, was in den kommenden achtundvierzig Stunden geschehen würde.
Entschlossen setzte er seinen Weg fort zu dem Ort, der zum Symbol ihrer Idee werden sollte. Zum Symbol für den Beginn einer neuen Zeitrechnung. Der für immer als der Ort in den Geschichtsbüchern verankert sein würde, an dem die vierte Generation der »Rote Armee Fraktion« den Grundstein für den Wechsel des Systems gelegt hatte. Mit einem Schlag, der weltweit für Aufsehen sorgen würde. Der ihn selbst und die RAF von einem auf den anderen Tag wieder auf die politische Landkarte Deutschlands spülen würde.
POLEN
»Es gibt kein Zurück mehr.« Nikolaus Wieckhorst wandte sich von seiner Frau ab und blickte gedankenverloren durch das Panoramafenster seines Wohnzimmers in den von mehreren Strahlern beleuchteten Garten.
»Bist du dir wirklich über die Konsequenzen dieser Entscheidung im Klaren? Ich will mir gar nicht vorstellen, wie sie über uns herfallen werden, wenn du das öffentlich–«
»Es ist alles gesagt zu dieser Sache«, unterbrach Wieckhorst seine Frau. »Wir können nicht noch länger warten. Diese Stadt und ihre verbohrten Politiker sind es einfach nicht wert. Dank mir gibt es hier Hunderte Arbeitsplätze. Dank mir wurden Straßen gebaut und Kindergärten errichtet. Ich habe Geld in die Universität gesteckt, dem Flughafen geholfen, und dieser Bürgermeister wäre schon lange nicht mehr im Amt, wenn ich nicht gewesen wäre. Wenn man wirklich gewollt hätte, dass mein Unternehmen hier in Lübeck bleibt, hätte man sich uns gegenüber einfach anders verhalten müssen. Oder soll ich wirklich noch einmal aufzählen, welche Steine man mir in den Weg gelegt hat?«
»Natürlich nicht«, antwortete Vanessa Wieckhorst mit einem verständnisvollen Lächeln auf den Lippen. Der Argwohn hinter ihrem Blick entging Nikolaus Wieckhorst jedoch nicht.
»Selbst wenn du Zweifel hast, mein Entschluss steht ohnehin längst fest. Ich werde das Werk in Polen bauen lassen. Die WieckhorstAG wird Lübeck Stück für Stück den Rücken kehren.« Er zuckte zusammen, als plötzlich der durchdringende Ton der Haustürklingel durch die Räume hallte.
»Es ist Viertel nach zehn«, sagte Vanessa Wieckhorst. »Erwartest du noch jemanden?«
»Hast du jemals erlebt, dass ich um diese Uhrzeit Besuch bekommen habe?« Verdrossen verließ Wieckhorst den Raum in Richtung Hausflur, der in eine Art Empfangshalle mündete.
»Überleg es dir gut mit dem Werk in Polen«, rief sie ihm hinterher. »Deine Mitarbeiter werden dich dafür hassen. Und auch deine Freunde werden alles andere als begeistert sein.«
»Welche Freunde denn?« Wieckhorst gab ein verächtliches Schnauben von sich. An der Haustür angekommen, warf er einen Blick auf das Display der Kamera, die den Bereich vor dem großen Eisentor am unteren Ende der Auffahrt einfing. Doch niemand war zu sehen. Auch die Kamera, die den Abschnitt der Roeckstraße vor seiner Villa filmte, zeigte keine auffälligen Personen.
»Siehst du jemanden, oder waren das irgendwelche Spaßvögel?« Vanessa Wieckhorsts Stimme schallte vom Wohnzimmer über den Gang bis zur Haustür.
»Ich schätze, es waren die Jugendlichen aus der Nachbarschaft«, antwortete Wieckhorst. »Zumindest kann ich auf dem Display nichts erkennen.«
»Dann komm jetzt schnell zu mir. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich.«
»Ist es das, was ich denke?«
»Wenn ich es dir verrate, ist es ja keine Überraschung mehr.«
»Ich komme sofort«, rief Wieckhorst. »Ich will mich nur noch ein wenig frisch machen.« Er öffnete die Tür zur Gästetoilette, die sich gleich neben der Eingangstür befand, und schloss sie hinter sich. Das sanfte Licht der Badlampen erhellte sich wie von Geisterhand. Der penetrante Duft des Lavendels auf der Fensterbank stieg ihm in die Nase.
Wieckhorst knöpfte seine Hose auf und ließ sich langsam auf die Toilettenbrille sinken. Nervös blickte er auf sein Handy. Seit Tagen erhielt er anonyme Anrufe, ohne dass sich am anderen Ende der Leitung jemand meldete. Das Klingeln an der Haustür hatte ihn sofort an diese Anrufe erinnert.
Er lockerte seine Krawatte und öffnete den obersten Knopf seines weißen Seidenhemds. Jeden Morgen um halb sieben schlüpfte er in Anzug, Hemd und Krawatte, und erst, wenn er zu Bett ging, streifte er die Kleidung wieder ab. Nachdenklich stützte er sich mit beiden Händen auf dem breiten Waschbecken ab und fixierte sich im Spiegel.
Er sah müde aus. Geschlaucht und mitgenommen von den Ereignissen der vergangenen Wochen. Obwohl er es sich nicht eingestehen wollte, hatten ihm die Angriffe auf seine Person zugesetzt.
Wie zum Teufel konnten ihm diese Menschen bloß vorwerfen, dass er für sein Unternehmen einstand? Dass er jeden Tag bis zur Erschöpfung für den Erfolg arbeitete? Sich in einem zunehmend umkämpften Markt behaupten musste? Unpopuläre Entscheidungen zu treffen, gehörte nun einmal dazu, wenn es darum ging, Arbeitsplätze langfristig zu sichern. Mehr als zweitausend Menschen in dieser Stadt standen bei ihm in Lohn und Brot. Und das nur, weil er Tag und Nacht dafür sorgte, dass das Unternehmen, das er von seinem Vater mit damals gerade einmal zwanzig Mitarbeitern übernommen hatte, weiter wuchs und Jahr für Jahr neue Umsatzrekorde brach.
Niemand in dieser Stadt hatte jemals etwas für ihn getan. Nicht das geringste Entgegenkommen, wenn er mal wieder Probleme anlässlich einer Erweiterung seines Betriebs gehabt hatte. Meistens war sogar das Gegenteil der Fall gewesen– sie hatten ihm Steine in den Weg gelegt, wann immer es ging. Hatten ihm Vorhaltungen gemacht, dass er sich bei der Bezahlung seiner Mitarbeiter nicht an den Mindestlohn halte. Dass unzumutbare Zustände in seinem Betrieb herrschten. Wie er es wagen könne, auch noch Forderungen an die Stadt zu stellen.
Sie hatten nicht aufgehört, ihn zu kritisieren. Im festen Glauben, dass er seine Ankündigung ohnehin niemals in die Tat umsetzen würde. Große Teile des Unternehmens einfach nach Polen zu verlagern, wo man ihn mit offenen Armen empfangen hatte, schien ihnen schlichtweg unvorstellbar.
Einige wenige Manager seines Unternehmens und altgediente Mitarbeiter, die seit mehr als dreißig Jahren für ihn schufteten, hatte er bereits informiert, doch der große Gang vor die Belegschaft stand ihm noch bevor.
Wieder fixierte Wieckhorst sein Spiegelbild. Angst war ein Gefühl, das er in seinem Leben im Grunde niemals verspürt hatte. Er war immer vorangegangen, hatte Entscheidungen getroffen. Zum Wohl seiner Firma und der Stadt. Fair und sozial, jedoch ohne die Fäden aus der Hand zu geben.
Doch in diesen Stunden, den vielleicht wichtigsten seines Lebens, verließ ihn der Mut. Die Überzeugung, die richtigen Entscheidungen treffen zu können, hatte er nicht mehr. Noch gelang es ihm, Vanessa und die wenigen Menschen, denen er vertraute, darüber hinwegzutäuschen, dass er vor seiner eigenen Entscheidung davonlief.
Diese Unschlüssigkeit machte ihm Angst. Nicht mehr auf seine Intuition vertrauen zu können, bereitete ihm weitaus größere Sorgen, als seine Feinde es taten. Denn die –und davon war er überzeugt– hatte er im Griff.
Wieckhorst schrak zusammen, als er plötzlich ein dumpfes Geräusch wahrnahm. Es drang über den Flur durch die Toilettentür zu ihm. Ein Hämmern auf Holz. Dann eine kurze Pause. Bevor das Geräusch erneut einsetzte. Jemand klopfte vehement an die Haustür.
Im nächsten Augenblick hörte er ein Knarzen, das Geräusch, wenn die Haustür geöffnet wurde, dann Schritte auf dem Flur.
»Vanessa?«, rief er laut. »Bist du das?«
»Ja.«
»Bleib von der Tür weg!«
Plötzlich nur noch Stille.
Wieckhorst riss die Toilettentür auf und stürmte in Richtung Haustür.
Seine Frau stemmte sich gegen die halb offene Tür, die jemand aufzustoßen versuchte.
»Geh zur Seite!«, schrie er.
Im nächsten Moment zerfetzten Schüsse die Eingangstür und hallten durch das Haus. Vanessa sank binnen weniger Augenblicke zu Boden. Sofort trat Blut aus ihrer Brust.
Wieckhorst blieb starr vor Entsetzen stehen. Abwechselnd blickte er auf den leblosen Körper seiner Frau und die beiden maskierten Männer, die sich ihm mit angelegten Maschinenpistolen näherten. Er spürte die Tränen, die an seinen Wangen herunterrannen. Fassungslos über das, was gerade geschah. Und unfähig, Hilfe zu rufen.
VIER MÄNNER
Andresen fluchte leise in sich hinein, als er am Nachmittag seine kleine Altstadtwohnung verließ und beinahe über das Rennrad stolperte, das vor seiner Tür abgestellt worden war. Kurz war er versucht, die Treppe wieder hinaufzugehen und bei seiner Nachbarin zu klingeln. Ihr zu sagen, dass ihm das stundenlange nächtliche Hin-und-her-Gelaufe genauso auf die Nerven ging wie die ständig überquellende Mülltonne vor dem Haus oder eben das Rennrad im Flur. Dass ein solches Gespräch mit der jungen Frau zu nichts führen würde, hatte er bereits vor einigen Tagen gespürt, als er sich über ihr Gitarrenspiel weit nach Mitternacht beschwert hatte und auf totales Unverständnis gestoßen war.
Andresen hatte die Wohnung An der Mauer vor einigen Monaten angemietet, nachdem es zwischen Wiebke und ihm zunehmend kompliziert und seine Sehnsucht nach einem Rückzugsort mitten in der Stadt immer größer geworden war. Seit Tagen fiel ihm jedoch die Decke auf den Kopf. Die Wohnung, unweit des Krähenteichs gelegen, war die kleinste Behausung seit seiner Ausbildungszeit. Auf gerade mal fünfunddreißig Quadratmeter verteilten sich zwei Räume, ein Badezimmer und eine winzige Pantryküche. Mit den niedrigen Decken wirkte die Wohnung derart beengt, dass Andresen sich wie in einem Puppenhaus fühlte. Wann immer möglich, flüchtete er raus in die Stadt. Lief durch die Gassen und Gänge. Mal, um Ruhe in der Anonymität der Stadt zu finden, mal auf der Suche nach ungezwungenen Gesprächen in Kneipen, die ihn auf andere Gedanken brachten.
Je weiter Andresen die Aegidienstraße in Richtung Altstadtmitte hinaufging, desto mehr Polizeikräfte fielen ihm ins Auge. Einige hielten sich dezent hinter Häuservorsprüngen oder auf Dächern versteckt, andere postierten sich für jedermann sichtbar an den Zuwegungen in Richtung Altstadtkern. Hunderte Polizisten der Bundespolizei und verschiedene Landespolizeien waren im Einsatz, dazu noch SEK-Einheiten und die Kollegen der Lübecker Schutzpolizei, unter denen er bislang allerdings noch kein bekanntes Gesicht gesehen hatte.
Ziellos ging Andresen durch die Stadt. Er bog in die Königstraße ab, lief bis zum Koberg, dann vorbei an St.Jacobi in Richtung Fußgängerzone. Bereits von Weitem konnte er beobachten, wie Polizisten damit begannen, Absperrgitter rund um das Rathaus und das Kanzleigebäude aufzustellen. In etwas weniger als vier Stunden würde bereits ein Teil der G7-Außenminister in den alten Gemäuern des Rathauses zu einem ersten Empfang zusammenkommen. Nur der US-amerikanische Außenminister verspätete sich. Er würde erst morgen früh am Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel landen und in einem Konvoi aus gepanzerten Limousinen und SUVs nach Lübeck gebracht werden.
Er hatte gelesen, dass noch heute Nachmittag die ersten Demonstrationen und Kundgebungen der G7-Gegner beginnen würden. Die meisten der Demonstranten würden friedlich durch die Stadt ziehen, auf Routen, die die Polizei bereits vor Wochen festgelegt hatte. Und doch befürchteten nicht wenige, dass es zu Blockaden und Krawallen gewaltbereiter G7-Gegner kommen würde. Andresen hatte die Bilder aus Frankfurt im Kopf, als die Situation bei der Eröffnungsfeier der Europäischen Zentralbank durch die Blockupy-Proteste eskaliert war. Brennende Barrikaden, Dutzende verletzte Beamte und Demonstranten, Hunderte Festnahmen und nicht zuletzt verschreckte Bewohner, die sich wie im Bürgerkrieg gefühlt haben mussten.