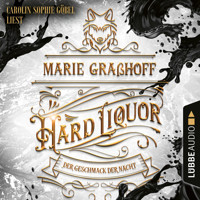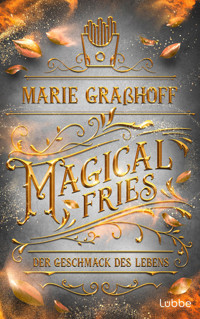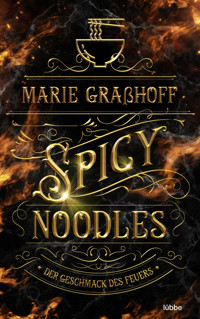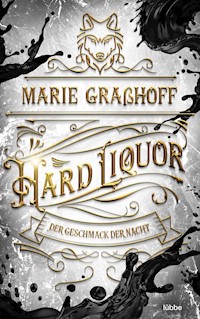
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Food Universe
- Sprache: Deutsch
Tycho ist als Nachfahrin alter Götter übermenschlich stark. Besonders, wenn sie Alkohol trinkt. Nicht schlecht, um sich als Barkeeperin in New York gegen zwielichtige Typen zu behaupten. Doch auch nicht ohne Schattenseiten. Damit niemand jemals hinter ihr Geheimnis kommt, muss sie selbst ihren besten Freund Logan auf Abstand halten. Dann taucht auf einmal die attraktive Grayson in ihrem Leben auf, und Tycho hat zum ersten Mal das Gefühl, sich jemandem öffnen zu können. Aber Grayson hat ihr nicht die ganze Wahrheit erzählt. Und als kurz darauf eine Sekte hinter Tycho her ist, um ihre Kräfte für sich zu beanspruchen, weiß sie nicht, wem sie vertrauen kann ...
»Hard Liquor ist Urban Fantasy vom Feinsten. Düster, sexy, actionreich und ganz am Puls der Zeit. Tycho ist cool. Grayson ist krass. Und die Geschichte der beiden einfach berauschend.« LAURA KNEIDL
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 613
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungINHALTSWARNUNGTYCHOS PLAYLISTKAPITEL 1KAPITEL 2KAPITEL 3KAPITEL 4KAPITEL 5KAPITEL 6KAPITEL 7KAPITEL 8KAPITEL 9KAPITEL 10KAPITEL 11KAPITEL 12KAPITEL 13KAPITEL 14KAPITEL 15KAPITEL 16KAPITEL 17KAPITEL 18KAPITEL 19KAPITEL 20KAPITEL 21KAPITEL 22KAPITEL 23KAPITEL 24KAPITEL 25KAPITEL 26KAPITEL 27KAPITEL 28KAPITEL 29KAPITEL 30KAPITEL 31KAPITEL 32KAPITEL 33KAPITEL 34KAPITEL 35ENDEDANKSAGUNGÜber dieses Buch
Band 1 der Reihe »Food Universe«
Tycho ist als Nachfahrin alter Götter übermenschlich stark. Besonders, wenn sie Alkohol trinkt. Nicht schlecht, um sich als Barkeeperin in New York gegen zwielichtige Typen zu behaupten. Damit niemand von ihrer Herkunft erfährt, muss sie selbst ihren Kindheitsfreund Logan auf Distanz halten. Doch dann taucht die gutaussehende Grayson auf und behauptet, ihr Geheimnis zu kennen. Und als Tycho kurz darauf von einer Sekte entführt wird, die ihre Kräfte für sich beanspruchen will, bleibt ihr nichts anderes übrig, als Grayson zu vertrauen …
Über die Autorin
Marie Graßhoff, geboren 1990 in Halberstadt/Harz, studierte in Mainz Buchwissenschaft und Linguistik. Anschließend arbeitete sie einige Jahre als Social-Media-Managerin bei einer großen Agentur, mittlerweile ist sie als freiberufliche Autorin und Grafikdesignerin tätig und lebt in Leipzig. Mit ihrem Fantasy-Epos Kernstaub stand sie auf der Shortlist des SERAPH Literaturpreises 2016 in der Kategorie »Bester Independent-Autor«.
Roman
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de).
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Klaudia Szabo, Leipzig
Umschlaggestaltung: Alexander Kopainskiunter Verwendung von Illustrationen von© Shutterstock: Globe Textures | Nimaxs | Wacomka | Angelatriks
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-0985-9
luebbe.de
lesejury.de
Für Reshi, Elodin und Eivor
Dieses Buch enthält explizite Darstellungen von Gewalt, Gewalt gegenüber Frauen, selbstverletzendem Verhalten, suizidalem Gedankengut und Alkoholkonsum.
Ihr entscheidet selbst, wie ihr damit umgeht. Sind diese Themen für euch schwierig oder besonders emotional aufgeladen, passt auf euch auf.
SOHN – Hard Liquor
Rangleklods – Dry Me Out
Apashe – Majesty
Ben Khan – Drive (Part 1)
Raveyards – The Pack
Sevdaliza – Marilyn Monroe
Breton – Got Well Soon
Mura Masa, Bonzai – What if I go?
Alby Daniels – This Dawn
Son Lux – Labor
Twenty One Pilots – Jumpsuit
Panama – It’s Not Over
TOKiMONSTA, Anderson .Paak, KRANE – Put It Down
BANKS – Warm Water (Snakehips Remix)
Rob Bailey & The Hustle Standard – Try ’n Hold Me Back
Hælos – Dust
Modeselektor, Thom Yorke – The White Flash
Flume, kai – Never be like you
Rangleklods – Broke
Passion Pit – Constant Conversations
Haywyre – Sculpted
WAS ICH IN DER NACHT SEHE
Diese Welt fürchtet mich nicht. Zwischen acht Milliarden Seelen gehen selbst Bestien in der Masse unter. Würden die Menschen sehen, wer ich wirklich bin, wäre New York ein Schlachtfeld, in dessen Rauchfahnen ich triumphierend auf den Leichen meiner Feinde stehe. Würden sie sehen, wer ich wirklich bin, würden sie Krieg gegen mich führen. Sie alle gegen mich allein.
Und sie würden verlieren.
Aber sie sehen mich nicht wirklich. Sie sehen eine junge Studentin in zerrissenen Strumpfhosen und einer viel zu dünnen Jacke, die ihre Schlüssel umklammernd durch die Upper West Side taumelt. Im Scheinwerferlicht der vorbeifahrenden Autos ist das Blut, das von meinen aufgeplatzten Fingerknöcheln in den Matsch fällt, kaum zu erkennen. Ich wickle die Ärmel meines Oberteils trotzdem enger um meine Hände, weil ich keine Spuren hinterlassen will.
Wenn ich morgen aufwache, werde ich froh sein, unsichtbar geblieben zu sein. Ich weiß es, ich habe es im Lauf der Zeit gelernt.
Es ist endlos anstrengend, mich Schritt für Schritt an der zweiundneunzigsten Straße entlang auf mein Wohnhaus zuzuschieben. Die Autos schlittern langsam durch den Schnee über die Kreuzung, als ich den Fußgängerweg am Broadway überquere. Ich sehe mich nicht nach ihnen um.
Nur noch ein Block.
Meine Beine fühlen sich tonnenschwer an, so sehr muss ich sie davon überzeugen, mich nur voranzutragen. Ich würde viel lieber rennen. Viel lieber auf etwas einschlagen, egal was. Viel lieber Verletzungen spüren, egal ob berstende Knochen unter meinen Fäusten oder meine eigenen, unter einem Aufprall von Körper auf Körper erschütternd.
Fast hoffe ich, dass eine der verlorenen Personen, die mir über den Weg laufen, sich herausnimmt, ein Wort zu mir zu sagen. Ein einfaches »Hey, Schätzchen« würde mir als Rechtfertigung reichen, mich selbst zu vergessen.
Aber mich spricht niemand an. Natürlich nicht. Selbst in der U-Bahn hat mich niemand eines zweiten Blickes gewürdigt.
Das Geräusch entfernter Sirenen erregt als gebürtige New Yorkerin meine Aufmerksamkeit nicht, aber es verschafft mir trotzdem ein kribbelndes Gefühl der Aufregung, mir vorzustellen, wohin die Polizei- und Krankenwagen wohl unterwegs sind. Mein alkoholgeschwängerter Atem wirft heiße Wolken in die Luft. Ich stelle mir vor, dass er das auch tun würde, wenn es nicht so klirrend kalt wäre. Das angestrengte Heben und Senken meiner Brust ist weniger Atmen als vielmehr etwas, das herauszubrechen droht. Wie ein Schrei, den ich nicht über meine Lippen lassen kann.
Ich versuche, mein Tempo zu beschleunigen, als mir klar wird, dass ich die Kontrolle wieder verliere. Aber meine Sicht ist zu verwischt, und mein Gleichgewichtssinn reißt mich ständig in die eine oder andere Richtung, sodass ich dem kaum entgegensteuern kann. Der Gestank der dampfenden Abflüsse und der vom Schnee bedeckten Müllbeutel, die an den Seiten der Gebäude aufeinandergestapelt sind, steigert die Übelkeit, die wie ein Kloß in meiner Kehle sitzt. Ich nehme sogar noch den metallisch dreckigen Geruch der U-Bahn wahr, der tief in meine Kleidung eingedrungen ist.
Um den Brechreiz zu unterdrücken, hebe ich meine Hand und presse die blutigen Fingerkuppen auf meine Lippen. Die rote Flüssigkeit ist noch warm.
Als ich das Blut rieche, spüre ich den Puls des Krieges durch meine Adern rauschen. Ich liebe es, wie mein Herzschlag sich beschleunigt, wie mein Atem heiß in der Nachtluft vibriert. Ich liebe die Erinnerung an Verzweiflung in fremden Augen und ehrliche Schreie aus erschütterten Kehlen. Ich kann die Vibrationen der Erde noch auf meiner Haut spüren, kurz bevor der Asphalt unter meinen Knöcheln zerbarst.
Ich brauche mehr davon. Ich brauche mehr. Jetzt.
Sobald sich dieser Gedanke manifestiert, reiße ich meine Hand fort und balle sie zur Faust.
So sehr bin ich auf meine Innenwelt konzentriert, dass ich fast an der Eingangstür des alten Hotels vorbeilaufe, in dem ich wohne. Als ich es realisiere, bleibe ich stehen und schaue die drei vereisten Treppenstufen an.
Die Menschen sehen mich nicht wirklich. Sie sehen eine knapp bekleidete Studentin, die so betrunken ist, dass sie dreimal auf die Fresse fällt, während sie versucht, ihre Haustür zu erreichen.
Ich kralle mich an das eiserne Geländer und schlittere mit meinen glatten Sohlen über die oberste Stufe, bis ich genügend Halt gefunden habe, um meinen Schlüssel ins Schloss zu rammen. Ich lasse mich gegen die Tür fallen, doch bevor ich einen Schritt in das Gebäude machen kann, fährt ein eiskalter Schauer über meinen Rücken, und ich erstarre.
Es kribbelt in meinem Nacken, und eine Hand an der alten Türklinke haltend wende ich mich um. Da ist etwas in der Dunkelheit zwischen den Gebäuden. Ich sehe es nicht, aber ich weiß es. Ein unbestimmtes Dunkel, verschmolzen mit der Schwärze der Nacht.
Für einige Sekunden starre ich in die Gasse zwischen den hohen Gebäuden. Dann löse ich mich von dem Anblick und trete endlich in den Flur.
Durchatmen. Das muss Einbildung gewesen sein, auch wenn die Härchen in meinem Nacken noch aufgerichtet sind.
Die Tür fliegt laut knarzend hinter mir ins Schloss, und das unangenehme Prickeln auf meiner Haut verschwindet sofort. Das flackernde Deckenlicht in der ehemaligen Empfangshalle brennt Tag und Nacht. Die Motten an den kühlweißen Neonröhren überleben hier sogar den Winter. Der Seitengang, der zum Fahrstuhl führt, dreht sich um sich selbst. Ich drücke auf den Knopf und schlafe fast im Stehen ein, während ich mich frage, ob ich über die Treppen nicht schneller im sechzehnten Stock gewesen wäre.
Als die Türen, von denen die mintfarbene Lackierung abblättert, sich endlich öffnen, kippe ich nach vorn und stütze mich am kühlen Metall ab. Die Innenwände des alten Aufzugs sind mit so viel Schmutz verkrustet, dass ein paar Blutspuren vermutlich gar nicht auffallen. Auch nicht auf dem feuchten Boden, wo sich Eisbrocken, Schlamm und Steine vermischen.
Der muffige Geruch des alten Teppichs schlägt mir entgegen, als ich nach einer weiteren Ewigkeit hinaustrete. Mich durch den Flur nach vorn schiebend, strenge ich mich an, nicht umzufallen, weil der ranzige Teppich so verlockend weich aussieht, und mich gleichzeitig nicht zu übergeben, weil irgendein abstoßend herzhafter Geruch aus einer Wohnung dringt. Nur noch ein paar Schritte.
Nur noch ein paar …
Ich kippe ein Stück nach vorn, kann mich aber an meinem Türrahmen abfangen. Beim ersten Versuch, das Schloss mit dem Schlüssel zu treffen, versage ich kläglich.
Warum fühle ich mich so beobachtet? Es interessiert sowieso niemanden, was ich treibe. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass ich so nach Hause komme.
Als ich nach etlichen Versuchen endlich das Klicken vernehme und den Schlüssel herumdrehe, stolpere ich erleichtert nach vorn. Dieser Druck, der sich in meiner Brust gestaut hat, ist noch immer so deutlich zu spüren, dass er mich zu zerbrechen droht. Aber jetzt habe ihn nicht nur in mir, sondern auch in dieser Wohnung eingeschlossen.
Die alte Holztür fällt hinter mir ins Schloss. Ich fummle die rostige Sicherheitskette angestrengt in den Riegel und taste nach dem Lichtschalter. Nachdem die kühle Deckenlampe angesprungen ist, wanke ich zu meiner kleinen Kochecke. Im Schrank unter der Spüle steht ein Glas mit Scherben, aus dem ich, eine Hand an der Anrichte festgeklammert, eine herausziehe.
Ich halte die linke Hand über das Waschbecken, setze die Scherbe in der Innenfläche an und drücke zu. Der Schmerz durchfährt mich vom Scheitel bis in die Sohle, als ich das Glas über die weiche, helle Haut ziehe.
Nicht zu tief, nicht zu tief, ich muss die Hand noch benutzen! Aber Himmel, der Schmerz fühlt sich so gut an, dass meine Knie weich werden und ich ein Stück am Küchenschrank hinabsinke, mich gerade so an der Anrichte halten kann, während das Blut den Abfluss hinunterrinnt.
Als die erste Welle vorüber ist, lasse ich die Scherbe fallen. Sie hat an einigen Stellen meine Finger der rechten Hand verletzt. Ich habe es gar nicht bemerkt.
Es gelingt mir, mich wieder aufrechter hinzustellen, um dem Blut zuzusehen, das in die Spüle läuft. Tropfen für Tropfen, nahezu meditativ. Und es riecht so gut.
Langsam führe ich die Hand an mein Gesicht, schließe die Augen und fahre mir von der Stirn bis ans Kinn. Die Feuchtigkeit auf meiner brennenden Haut fühlt sich nach Geborgenheit an. Ich spüre die Vergangenheit darin. All die Gewalt, die Zerstörung, den Sex, die Musik.
Ich starre eine Weile in das alte Waschbecken, bevor meine Knie endgültig nachgeben und ich mich mit letzter Kraft umdrehe, um mich an die kleine Küchenzeile zu lehnen.
Die Hand auszuwählen war keine gute Idee. Wie rechtfertige ich das morgen vor Logan? Er wird mir nicht glauben, dass es schon wieder ein Missgeschick in der Bar war.
Und wie bin ich eigentlich nach Hause gekommen? War ich nicht gerade noch in Harlem? Was habe ich getan? Ist jemand ums Leben gekommen?
Ich schaue auf meine Finger hinab und denke für einige Sekunden darüber nach. Nein. Nein, ich glaube nicht. Daran würde ich mich erinnern.
Aber ich erinnere mich an … Erde. Rohrleitungen. Autosirenen. Ich werde es morgen in den Nachrichten sehen.
Mein Herzschlag beruhigt sich langsam, als würde die Dunkelheit mit meinem Blut aus meinem Körper fließen. Sie macht Platz für klarere Gedanken. Den Gedanken, dass ich es vermutlich nicht mal mehr schaffe, aufzustehen, um mich ins Bett zu legen, obwohl es nur wenige Schritte dorthin sind. Den Gedanken, dass ich auf Logans Nachrichten antworten sollte, wenn ich vermeiden möchte, dass er hier morgen auf der Schwelle steht.
Und den Gedanken, den ich eigentlich in der hintersten Ecke meines Bewusstseins verschließen wollte. Dass ich mir wünsche, jemand wäre hier.
Jemand könnte …
Wie von allein gleitet mein Blick von meinen Handflächen zum Tisch in der anderen Ecke meiner winzigen Wohnung. Hinter einem halbleeren Pizzakarton steht ein gerahmtes Foto. Ein kleines Mädchen sitzt auf dem Schoß seines Vaters. Gemeinsam mit seiner Mutter und Großmutter grinst es in die Kamera. Die Erwachsenen halten das Kind so fest im Arm, als könnte ihre Bindung niemals zerstört werden. Als würden sie für immer da sein, um es zu beschützen.
Ich schließe die Augen, habe nicht einmal die Energie, um aufzustehen und das Bild umzudrehen. Nachts ist es so viel schmerzvoller, an meine Eltern zu denken, als am Tag.
Was ist aus mir geworden? Ich denke nicht, dass meine Familie gewollt hätte, dass es so weit kommt. Dass sie gutheißen würde, was ich tue und wer ich bin.
Andererseits ist sie nicht mehr hier.
Ich bin allein.
Mein Atem beschleunigt sich wieder, aber nun fühlt es sich an wie eine Last, die auf meine Lunge drückt. Ich kann nicht mehr atmen, so sehr versuche ich, gegen den Kloß in meinem Hals anzukämpfen. Wenn ich mich jetzt verliere … wenn ich jetzt das Haus verlasse, um der Welt zu zeigen, was ich wirklich bin, wäre das wirklich so schrecklich, wie ich befürchte? Es gäbe kein Zurück, aber vielleicht brauche ich genau das: keinen Ausweg mehr. Ein finaler Ausbruch aus diesem Gefängnis, das ich selbst geschaffen habe.
Darauf läuft es doch sowieso hinaus, oder? Ich werde es nicht ewig in mir behalten können. Das ist keine Frage danach, ob es passiert, sondern wann.
Also … warum nicht jetzt? Ich … ich würde so gern einfach loslassen.
Einem Impuls folgend taste ich mit zitternden Fingern nach meinem Handy und ziehe es aus der kleinen Tasche, die um meinen Körper geschlungen ist. Mir ist nicht danach, aber im Laufe der Jahre habe ich diese Bewegung nahezu automatisiert. Als wäre sie etwas, das mein Körper automatisch ausführt, wenn es zu eskalieren droht.
Die Panzerglasfolie ist von oben bis unten zersplittert, doch davon abgesehen scheint es noch zu funktionieren. Unter den Splittern zeigt mir der Startscreen Dutzende verpasster Nachrichten an. Ich kneife die Augen zusammen, um zumindest grob zu erkennen, wovon sie handeln. Anfragen für Lerngruppen, Partys, unwichtig … und Logan.
Logan, 12:58: Hey, wie geht’s dir?
Logan, 01:04: Wie war deine Schicht?
Darauf kann ich morgen antworten. Ich schiebe die Nachrichten weg und klicke in die Favoritenliste in meinen Kontakten. Nur ein einziger Name ist dort eingespeichert:
Dr. Ethan Williams.
Ich klicke und hoffe, dass ich getroffen habe, als die verschwommene Anrufoberfläche sich öffnet. Ein Freizeichen. Meine Hände beben, und meine Arme fühlen sich plötzlich so schwer an, dass es mir kaum gelingt, das kleine Gerät an mein Ohr zu heben. Der Schmerz in meiner Hand ist auch nicht stark genug, um mir beim Fokussieren zu helfen.
Noch ein Freizeichen. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus!
Ein weiteres Freizeichen, dann endlich aufgeregtes Keuchen. Ethans Stimme klingt endlos weit weg. Als stamme sie aus einer Welt, zu der ich gar nicht mehr gehöre.
»Tycho? Geht es dir gut?«
»Ich …« Mein Blick fällt auf die Spitzen meiner Haare. Auf die hellblonden Strähnen ist Blut getropft.
»Tycho?« Die Stimme kommt etwas näher.
»Ja, ich … Was?«
»Geht es dir gut? Warum hast du angerufen?« Er klingt noch außer Atem, dabei sollte er diese Anrufe mitten in der Nacht gewohnt sein. »Hattest du wieder eine Panikattacke?«
Ich spüre das Blut warm von meiner Handfläche aus über meine Finger rinnen. Es tropft an meinem Handy hinab in meinen Schoß und meine Haare. Sobald ich mich beruhigt habe, muss ich die Wunde versorgen. Aber noch tut der Schmerz zu gut.
»Was ist passiert?«
»Ich …« Ich atme tief durch und schließe die Augen. Mein Atem riecht nach Whiskey. Seine Stimme beruhigt mich, auch wenn ich ihm nicht die Wahrheit sagen kann. »Ich habe wieder an meine Eltern gedacht«, bringe ich über die Lippen.
»Wie fühlst du dich?«
Ich sinke ein Stück weiter hinab. Dieser alte, plattgetretene Teppich ist so weich, wie es ein Bett nicht sein könnte. »Nicht gut«, murmele ich.
»Wo bist du gerade?«
»In meiner Wohnung.«
»Bist du schon die ganze Nacht zu Hause?«
»Ich komme gerade von der Arbeit.«
»Und auf dem Weg hast du an deine Eltern gedacht?«
Ich zögere, bevor ich mir ein »Ja« abringe. Ich sinke weiter hinunter und stütze mich auf meinem Unterarm ab. Bevor ich einschlafe, sollte ich mich nach Pflastern umsehen. Aber nun, da der Knoten in meiner Brust sich langsam löst, bin ich auf einen Schlag so endlos müde, dass ich nicht weiß, ob ich es noch schaffe.
»Warum rufst du an?«
»Ich musste eine Stimme hören.« Ich atme angestrengt, als mein Kopf endlich den Boden berührt. »Ich glaube, ich verliere den Verstand.«
Ethan sagt etwas, aber ich kann es nicht mehr hören.
WIE MICH DER MORGEN EMPFÄNGT
»Guten Morgen, New York! Es ist der fünfte Januar, der Schneesturm hält sich schon seit zwei geschlagenen Wochen, und es ist keine Besserung in Sicht.«
»Es gibt aber wie immer etwas, das die Gemüter warm hält, Ash.«
»Du sagst es, Janey. Das Internet feiert nach wie vor die unbekannte Rächerin, der der Name Captain Wodka verliehen wurde. Gibt’s heute was Neues?«
»Bisher noch nicht, Ash, aber für alle Neugierigen da draußen haben wir der Captain-Wodka-Seite auf unserer Website ein großes Makeover verpasst. Neben vielen Themen, die im Zusammenhang mit ihr besprochen wurden, gibt’s jetzt auch eine Auflistung der hundertfünfzig spannendsten Fälle, die ihr zugeschrieben werden! Und alle bisherigen Phantombilder, inklusive des aktuellen. Obwohl noch nicht klar ist, ob es endlich passt.«
»Ja, sie scheint sehr gut darin zu sein, ihre Identität zu verschleiern. Einige Opfer sprechen davon, dass sie eine Wolfsschädelmaske trug. Unheimlich.«
»Und cool!«
»Was der heutige Tag wohl bringt? Mal sehen. Captain, wenn du da draußen bist: Meld dich bei uns. Wir von der Morning Show bei NYC Fresh würden dich gern mal interviewen. Also ruf uns an!«
»Bevor wir zu einem unserer absoluten Lieblingshits übergehen, liest euch Janey noch unsere liebsten Tweets zu unserer liebsten Heldin vor. Janey?«
»Yeah! Laura schreibt: ›#CaptainWodka, wenn du das liest: Ich liebe dich. Danke, dass du für Sicherheit sorgst!‹
Alex schreibt: ›Einmal mit #CaptainWodka einen trinken gehen. Neues Lebensziel.‹
Da kann ich mich nur anschließen!
Und Bibi schreibt: ›Man kann ja viel sagen, aber betrunken Bösewichte verkloppen hat einfach Style. Keep up the good work, gurl!‹«
»Da schließen wir uns an. Und pass auf deine Leber auf, Captain. Ihr da draußen natürlich auch. Wir nutzen wie immer die Chance, euch darauf hinzuweisen, dass Alkohol ein gefährliches Rauschmittel ist. Alkoholkonsum ist darüber hinaus die dritthäufigste Todesursache in Amerika. Hilfestellungen zur Suchtberatung findet ihr auf der Captain-Wodka-Seite auf unserer Website. Passt auf euch und eure Liebsten auf!«
»Und jetzt nur für euch: Midnight Drunk von Beyond Sanity.«
Ein Ruck geht durch meinen Körper. Ich verstehe nicht sofort, warum, und erst nach ein paar Sekunden wird mir klar, wo ich mich befinde. Der Teppich unter mir ist hart, voller Blut und …
Einen Moment. Hat es gerade geklopft? Bin ich deswegen aufgewacht?
Ich schiebe mich auf die Unterarme und blinzle gegen das viel zu grelle Licht an, das die Morgensonne durch die Fenster schickt. Meine Güte, es kann kaum früher als neun Uhr sein. Soll ich das Klopfen ignorieren?
Ich schaue auf meine Hände hinab. Ich kann mich nicht daran erinnern, den Schnitt verarztet zu haben, aber offensichtlich habe ich ihn mit Wundverschlussstreifen behandelt. Wie auch immer ich das geschafft habe.
Ich überlege gerade, mich zurück auf den Boden zu legen, um noch ein paar Stunden zu schlafen, da klopft es wieder. »Guten Morgen, Sonnenschein.«
Jeder Zentimeter meines Körpers schmerzt, aber Logans Stimme lässt mein Herz einen Satz machen. Erst weil ich froh bin, sie zu hören – dann weil ich realisiere, dass er auf keinen Fall das Chaos der letzten Nacht hier sehen darf.
»Tycho, bist du wach?«
»Bin ich!«, ringe ich mir ab. Mein Hals ist so trocken, dass jedes Wort schmerzt.
Ein Schlüssel im Schloss ist zu hören, aber ich habe die Sicherheitskette angelegt, also kann Logan die Tür nur einen kleinen Spaltbreit öffnen.
»Du hast mich wieder ausgeschlossen?« Ein kleines Lachen folgt seinen Worten, weil er nicht glaubt, dass ich ihn wirklich aussperren würde. Ich antworte nicht, bin viel zu sehr damit beschäftigt, mich auf die wackeligen Beine zu hieven und das getrocknete Blut von meinem Gesicht, aus der Spüle und von meinen Händen zu waschen. Die Scherbe werfe ich, blutig, wie sie ist, in das Glas unter der Spüle zurück.
»Tycho?«
»Ich mach gleich auf!« Ich greife nach einem Küchentuch und versuche, den Boden sauber zu reiben, aber das Blut ist längst geronnen. Sieht man bei der dunkelvioletten Farbe des Teppichs überhaupt, dass das Blut ist?
Nein. Nein, es fällt zwischen den anderen Flecken, die meine Vormieter hinterlassen haben, sicherlich gar nicht so sehr auf.
Eilig blicke ich an mir hinab. Zerrissene Strumpfhose, aufgeschürfte Knie, das Shirt und die Arme voll von getrocknetem Schneematsch.
»Ist alles gut bei dir?« Ich sehe immer wieder zur Tür, um sicherzugehen, dass Logan durch den Spalt nicht zu weit in die Wohnung schauen kann. »Ich hab in den Nachrichten was von einer Gasexplosion in Harlem gestern Nacht gelesen.«
Ich erstarre mitten im Versuch, mich aus meiner Kleidung zu winden. Ein Gasleck? Ist es das, was ich angestellt habe?
»Du hattest doch gestern Schicht im DUST. Hast du was mitbekommen?«
Ich schlucke schwer, um mich zu sammeln. Meine Gedanken sind überall, aber ich muss mich zusammenreißen, sonst fällt es auf!
»Was?«, tue ich unschuldig und fahre fort, mich meiner nach Alkohol stinkenden Kleidung zu entledigen. Mein Top bleibt an der Kette hängen, die Logan mir vor Ewigkeiten geschenkt hat. »Nein, nichts mitbekommen.« Ich falle zweimal zur Seite um und stütze mich an meinem Tisch ab, dann kicke ich die Sachen gemeinsam mit dem Küchentuch in mein winziges Bad.
»Soll ich wieder gehen?«
»N-nein, nicht gehen!«, rufe ich hektisch. »Ich ziehe mir nur noch was an!«
Ein rascher Blick in den fleckigen Spiegel zeigt mir, dass das Blut sich in meinen hellen Augenbrauen festgesetzt hat. Ich beuge mich über das rosafarbene Waschbecken, um mein Gesicht noch einmal zu säubern. Ich sehe praktisch vor mir, wie Logan die Augen verdreht, als ich es unsanft mit einem Handtuch trocken reibe und das Shirt ergreife, das ich irgendwann über den alten Heizkörper geworfen haben. Ich ziehe es hinab, um meinen Slip zu verbergen, dann schlittere ich auf die Tür zu.
Das war ein wenig zu schnell. Ich schlucke schwer, um die Übelkeit zu bekämpfen, dann löse ich endlich die Kette, öffne die Tür und schaue in Logans Gesicht hinauf. Seine kastanienbraunen Haare fallen ihm so tief in die Stirn, dass ich seine blauen Augen kaum sehe. Kleine Schneeflocken haben sich in den Locken und dem Kunstfell seiner Jacke verfangen, einige sind schon halb geschmolzen.
Es schneit also wieder? Ich habe gar nicht aus dem Fenster gesehen.
Logan streicht sich die Haare aus dem blassen Gesicht und offenbart die vor Kälte roten Wangen. »Hi!«
»Sorry, dass es kurz gedauert hat«, keuche ich und trete zur Seite, um ihn hereinzulassen. Wir haben uns seit einigen Tagen nicht mehr gesehen, und seine Gesichtsbehaarung ist ein bisschen dichter geworden als sein üblicher Dreitagebart. Es lässt ihn weicher aussehen. Noch netter als gewöhnlich.
Logan geht nicht an mir vorbei, sondern mustert mich mit einem irritierten Lächeln. »Wolltest du dir nicht etwas anziehen?« Er wirft einen untersuchenden Blick auf mein langes Shirt.
»Ich dachte, es reicht aus, wenn ich nicht komplett nackt bin.« Ich funkle ihn an, und er lacht, noch während sein Blick an mir vorbei- und in den Raum hineinhuscht. Ich drehe mich nicht einmal um, um zu prüfen, was er wohl sieht. Stattdessen verselbstständigen sich meine Hände, um nach einem der Kaffeebecher zu greifen, die er bei sich hat. Die Pappe ist noch heiß.
»Dein Shirt riecht nach Alkohol«, stellt er fest, als er sich endlich an mir vorbei in die Wohnung schiebt und ich die Tür schließen kann, um den kühlen Zug aus dem Flur auszuschließen. Durch die undichten Fenster kommt schon genügend Kälte herein.
»Nicht nur das.« Ich muss meine Zähne putzen, aber bevor ich wieder ins Bad verschwinde, folge ich seinem Blick in jeden Winkel der Wohnung, um zu schauen, ob ich bei meiner Putzaktion alles erwischt habe.
»Wilde Nacht?«, will Logan wissen, als sein Blick nahezu träumerisch an der kalten Pizza auf dem Tisch hängen bleibt.
»Ja. Aber nicht, was du denkst.« Das Desinfektionsspray und die Pflaster liegen noch auf dem Küchenschrank. Logan wendet sich im selben Moment dorthin um wie ich.
Er fragt nicht einmal, was passiert ist, sondern dreht sich sofort zu mir, um meinen Körper von oben bis unten zu mustern. »Was …« Er stöhnt und greift nach meiner verletzten Hand. Die Wundverschlussstreifen sind natürlich voll mit Blut. Ich habe nicht einmal gehofft, das verbergen zu können. »Was ist passiert?«
»Nur ein kleiner Unfall in der Bar.« Ich tue so locker wie möglich. »Hab ein Glas zerbrochen.« Der Schmerz hinter meiner Stirn hämmert so intensiv, dass ich nicht weiß, ob meine Lüge überzeugend ist.
»Schon wieder?« Ich ziehe meine Hand fort, und er schüttelt mit hochgezogenen Augenbrauen den Kopf. »Und was ist mit dem Rest?« Er deutet auf meine Fingerknöchel und Knie, die inzwischen nicht nur aufgeschürft, sondern auch blau und rot unterlaufen sind.
Ich folge seinem Blick. »Hingefallen«, tue ich es ab. »Es war rutschig auf dem Heimweg. Ich hatte High Heels an.«
Der Blick, mit dem er mich bedenkt, ist eine Mischung aus Unglauben und ein wenig Abschätzung. Als wolle er mich fragen, wann ich endlich beginne, auf mich aufzupassen. Ich weiß es, weil wir dieses Thema schon ein paarmal hatten.
Nachdem wir einander eine Weile in die Augen gesehen haben, sagt er allerdings lediglich: »Du bist zu tollpatschig.«
Vielleicht weil er weiß, dass es nichts bringt, darüber zu reden. Weil er weiß, dass ich etwas zu verbergen habe, immerhin ist er nicht naiv. Lügen ist in diesem Fall zwar besser als die Wahrheit – aber ich hasse es trotzdem, nicht aufrichtig ihm gegenüber sein zu können.
»Ich arbeite da erst seit ein paar Monaten«, sage ich leise und bewege die Muskeln in meinem Gesicht zu einem Ausdruck, der hoffentlich einem entschuldigenden Lächeln gleichkommt. »Ich übe noch.«
»Klar.« Sein Tonfall signalisiert seine Skepsis überdeutlich. »Vielleicht ziehst du dir in Zukunft einfach mal sicheres Schuhwerk an?«
»Das wär wohl ’ne Idee«, gestehe ich ein, und er scheint es nicht weiter kommentieren zu wollen. Dafür bin ich ihm dankbar, weil ich noch zu geistig umnachtet bin, um mir auch nur halbwegs ausgeklügelte Lügen einfallen zu lassen.
Ich schleppe mich mit so viel Würde, wie mir geblieben ist, in mein Bad, während Logan sich auf mein Bett fallen lässt und sich ein Stück Pizza schnappt. Ich stelle meinen Kaffee auf dem Waschbecken ab und greife nach meiner Zahnbürste. Das flackernde Licht über dem Spiegel beleuchtet die schweinchenfarbenen Fliesen, in die alles hier drin gekleidet ist.
»Tut’s weh?«, will er mit halbvollem Mund wissen. Durch den Spiegel sehe ich ihn. Er gibt sich offensichtlich Mühe, unbeschwert zu klingen. Seine Augen sagen etwas anderes.
»Geht schon.« Ich schiebe mir die Zahnbürste in den Mund und hoffe, dass der frische Minzgeschmack mich ein wenig wacher macht. »Frühstückst du heute nicht mit deiner Familie? Ist doch Samstag, oder?«
»Dad ist arbeiten, Mom und Grandma sind shoppen. Steht wohl bald irgendein Fest an.«
Ich nicke verstehend, auch wenn er es nicht sieht.
»Sollen wir trotzdem zu mir gehen?« Er sieht gedankenverloren aus dem Fenster. »Wenn sie wieder da sind, kann Mom sich mal deine Hand ansehen.«
»Ich hab heute nichts mehr vor.« Nicht, dass ich zu etwas in der Lage wäre. Vermutlich schlafe ich sofort ein, wenn irgendeiner meiner Körperteile eine Couch berührt.
Sobald ich meinen Mund ausgespült habe, fühle ich mich Millionen Mal besser. Noch immer nicht gut, aber das ist was anderes. »Ich dusche schnell«, füge ich hinzu.
Er grummelt zustimmend, mit seinem kalten Frühstück beschäftigt. Als ich die Tür zum Bad schließe, hoffe ich, dass ich nicht in Ohnmacht falle.
Grelles Sonnenlicht flutet die winterlichen Straßen der Upper West Side, während wir uns an der Fünfundneunzigsten entlang in Richtung Central Park bewegen. Der kühle Schein spiegelt sich in Fenstern und den schmutzigen Windschutzscheiben. Er wirft lange Schatten auf die schmalen Straßen und auf die vereisten Wege.
Hinauszugehen war ein Fehler. Es fühlt sich alles noch zu frisch an. Als würde ich der Welt meine Verletzlichkeit auf einem Silbertablett präsentieren. Als würde das Licht nicht nur die Welt, sondern auch meine Schwäche überdeutlich beleuchten. Ohne den Schleier aus Dunkelheit zwischen mir und allem anderen fühle ich mich sogar in meine dicke Winterkleidung gehüllt nackt. Das Glitzern des pulvrigen Schnees, der von den kahlen Bäumen auf uns herabrieselt, erscheint mir weniger magisch als verräterisch.
»Soll ich dich huckepack nehmen?«, fragt Logan, vermutlich, um mich aus meinen skeptischen Beobachtungen zu reißen.
Ich lache krächzend und ziehe den Mantel enger um meinen Körper. »Wir sind nicht mehr sechs.«
»Leider.«
Die Sonnenbrille auf meiner Nase schützt nicht nur meine Augen, sondern vor allem meinen Kopf, der nicht mehr weit davon entfernt ist, in tausend Teile zu zerbersten. Die Abgase von der Straße und die Dämpfe aus den Abflüssen steigern meine Übelkeit.
Dass ich mich überhaupt auf den Beinen halten kann, grenzt an ein Wunder. Genauso, dass ich den Kaffee bei mir behalte. Das muss eine Form von Körpergedächtnis sein. Positive Assoziationen oder so.
Logan wohnt nur wenige Blocks entfernt, also werde ich es wohl ertragen. Und seine Mutter ist Krankenschwester und hat die guten Schmerzmittel da, deshalb lohnt sich der Weg doppelt.
»Hast du die Aufgaben für Montag schon erledigt?«
Wir haben Aufgaben? Wenn Logan nicht wäre, würde ich Sachen wie Lernen, Hausarbeiten und all den Kram sicherlich vergessen. Viel mehr noch: Wenn Logan nicht wäre, würde ich vermutlich gar nicht studieren.
Altertumswissenschaften erinnern mich zwar an meine Großmutter und an meine Eltern – daran, wie sie mir jeden Abend vor dem Schlafengehen Geschichten über die griechisch-römische Antike und die Götter dieser Kulturen erzählt haben. Aber meine mangelnden Ambitionen sind offensichtlich.
»Welcher Kurs noch mal?«
»Griechisch zwei.«
»Das wollte ich morgen machen«, seufze ich mit einem Blick auf meine Stiefel. Wenn Logan nicht wäre – und wenn meine Eltern mir kein Geld für ein Studium hinterlassen hätten, das ich nicht für etwas anderes ausgeben wollte –, hätte ich mich nie dafür angemeldet.
»Lass uns zusammen dran arbeiten, dann geht’s sicher schneller«, schlägt er vor. Ich nicke mit so viel Eifer, wie ich aufbringen kann. Ich muss mich zusammenreißen, aber noch bin ich zu müde, um die Maske der Motivation aufzusetzen.
Das Klimpern der Schlüssel in Logans Hand löst eine gewisse Entspannung in mir aus. Unsere Familien haben nah beieinandergewohnt, solange ich mich erinnern kann, deswegen ist sein Zuhause eine Art Erweiterung von meinem. Das Haus seiner Familie kenne ich so viel länger als die Wohnung, in der ich jetzt lebe.
Er geht die wenigen Stufen zu der dunklen Tür in der hellen Wand hinauf. Allein die Fassade ist edel, mit den verschlungenen Verzierungen rund um den Tür- und die dunklen Fensterrahmen herum.
Logans Familie hat dieses Haus schon gekauft, als wir beide noch klein waren. Es sieht von außen zwar recht schmal im Vergleich zu den danebenliegenden aus, aber auf den fünf Stockwerken befinden sich neun Schlafzimmer, sechs Bäder und eine Terrasse für jede Person in diesem Haushalt. Von der Dachterrasse aus hat man einen guten Blick auf den Central Park direkt hinter der Straße.
Ich habe nie aus Logans Eltern herausbekommen, wie viele Millionen Dollar sie für dieses Stadthaus hingelegt haben, aber … vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Höchstwahrscheinlich wäre es desillusionierend.
Wir treten durch die kleine Eingangshalle in den hellen unteren Wohnbereich mit den hohen Decken, den gemütlichen Couches, dem Kamin und den Durchgängen zu Küche und Esszimmer. Durch die bodentiefe Fensterwand erhasche ich einen Blick auf den vollkommen verschneiten Garten, den Logans Großmutter in den Frühlings- und Sommermonaten akribisch pflegt.
»Ich schlage vor, du setzt dich auf die Couch und ich mach dir einen Tee«, sagt er, schließt die Tür hinter sich, streift seine Schuhe ab, und wir beginnen, unsere Jacken auszuziehen. Ein Fauchen reißt mich aus der Ruhe, die langsam in meinem Inneren einkehrt.
Ich drehe mich um und schaue dem weißen Kater in die Augen, der mit gesträubtem Fell einige Schritte von mir entfernt steht und bedrohlich knurrt. »Hey, Buddy«, murmele ich ihm zu, was ihn nur noch wütender zu machen scheint. Aufgeregt fuchtelt Logan mit den Händen, um ihn aus seinem Fokus zu reißen, während ich leise lache.
Diese Art von Begrüßung bin ich seit Jahren gewohnt. Ich vermute, dass Tiere etwas in mir erkennen, was Menschen nicht sehen. Zum Glück können sie nicht sprechen.
Während Buddy irritiert die Treppe hinaufläuft, schiebe ich mich auf eine der hellen Couches zu und lasse mich fallen. Der Stoff ist so weich, und ich hatte recht: Ich werde mich nicht dagegen wehren können, hier einzuschlafen. Meine Augen sind noch ganz schwer. Aber das kalte Wasser unter der Dusche und die frische Luft haben mich so weit belebt, dass es mir wohl gelingen wird, mich noch ein wenig wach zu halten. Zumindest lang genug, um die Medikamente einzuwerfen und ein paar Sätze mit Logan zu wechseln.
Ich beobachte ruhig, wie er den großen Fernseher einschaltet, um dann zur anliegenden Küchenzeile zu tänzeln und den Tee vorzubereiten. Mein Blick schweift über die vertraute Umgebung: die dicken Teppiche auf dem dunklen Parkettboden, die kunstvoll verschlungenen Lampen an den stuckverzierten Wänden und die gerahmten Familienstammbäume an den Wänden. Im Kamin brennt kein Feuer, aber es riecht noch nach warmem Holz und Asche. Durch die Fensterwand, die zu der breiten Terrasse hinausführt, fällt das warme Licht des Morgens auf die Mischung aus modernen Möbeln und den antiken Einrichtungseinflüssen, die Logans Großmutter in dieses Haus bringt.
Das Aufeinandertreffen der Generationen habe ich an diesem Haus schon immer geliebt.
»Willst du was Bestimmtes schauen?«, rufe ich Logan zu. Ich ziehe die Blümchendecke von der anderen Seite des Sofas zu mir und betrachte Logans Rücken durch den Zugang zur halboffenen Küche.
»Nö. Schalt ruhig was an, was du gut findest.«
»Hm.« Unsicher greife ich nach der Fernbedienung. Er weiß, dass ich nicht wirklich etwas gut finde. Filme, Serien, Bücher. Das alles erscheint mir langweilig. Ich unterhalte mich lieber mit Menschen über ihre Gedanken, Geschichten, Gefühle.
Aber vielleicht …
Ja, vielleicht die Nachrichten.
Ich zappe durch die Fernsehprogramme, bis ich an einem Nachrichtensender ankomme. Mein Blick ist noch zu verschwommen, um das Logo auszumachen, aber mein Herz macht einen kleinen Hüpfer, als ich die Straße erkenne, in der ich mich gestern herumgetrieben habe.
»In der vergangenen Nacht wurde ein Straßenzug in Harlem, nahe der St. Paul’s Church, komplett verwüstet«, sagt der Nachrichtensprecher, ein fast kahler weißer Mann. Bilder einer aufgebrochenen Straße aus unterschiedlichen Perspektiven werden gezeigt.
»Ah, das meinte ich vorhin«, ruft Logan aus der Küche.
Gut, jetzt habe ich eine Entschuldigung dafür, die Nachrichten laufen zu lassen, ohne dass es eigenartig erscheint.
Ich kneife die Augen ein wenig zusammen, um deutlicher sehen zu können. Der Riss im Asphalt reicht bis tief in die Erde hinein, legt Rohre frei und hat einige parkende Autos halb in seinen Abgrund gerissen.
Das ist also passiert. Meine Erinnerungen an gestern Nacht sind verschwommen. In ihnen sieht es nicht halb so schlimm aus.
Verdammt, das ist viel zu schlimm. Ich darf nie wieder derart die Kontrolle verlieren.
Ich sinke weiter in der hellen, weichen Couch ein, ziehe mir die Decke über die Beine und bis an die Brust. Ein Zittern ergreift meine Finger, aber in meinem Kopf herrscht so ein Chaos, dass ich nicht genau weiß, woher es rührt.
»Anwohner sprechen von einem Erdbeben. Es gab drei Schwerverletzte. Die Männer befinden sich derzeit im Krankenhaus, schweben allerdings nicht in Lebensgefahr. Weitere Einzelheiten gaben bisher weder Vertreter der Polizei noch der Feuerwehr bekannt.«
»In einem Sonderbericht direkt von der Unfallstelle sind unsere Kollegen bereits vor Ort«, schaltet sich eine Sprecherin mit dunkler Haut und deutlich jugendlicherem Aussehen ein. »Mehr dazu im Anschluss.«
Mein Blick ist starr auf den Bildschirm gerichtet, und ich presse die Lippen aufeinander, um nicht erleichtert aufzuatmen. Nach dem ersten Schock über die Verwüstung, die ich angerichtet zu haben scheine, beruhigt mich vor allem der Umstand, dass sie ein Erdbeben und wirklich nicht mich dahinter vermuten.
Ich muss nur noch ruhiger atmen.
Logan kommt aus der Küche und drückt mir zwei Tabletten und eine Flasche Wasser in die Hände. Ich versuche, den Schmerz, der mich von meiner rechten Handfläche aus durchzuckt, zu verbergen. Die Schmerzmittel werden hoffentlich doppelt helfen – meiner Hand und meinem Kopf.
»Weitere Nachrichten des Tages«, fährt der Mann in monotoner Stimme fort. Logan schaut ebenfalls gespannt zum Fernseher und lässt sich auf den Sessel neben mir fallen. »Die Vorfälle, bei denen Männer in New York des Nachts krankenhausreif geschlagen werden, häufen sich. Laut Ermittlungen sind viele der Opfer in der Vergangenheit durch übergriffiges Verhalten bei der Polizei bekannt gewesen. Die Personen unterschiedlicher Altersstufen trugen zwar nie lebensgefährliche Verletzungen davon, mussten aber allesamt mehrere Tage Krankenhausaufenthalt auf sich nehmen.«
»In sozialen Netzwerken wird spekuliert, dass ein unbekannter Rächer umherzieht und Selbstjustiz übt«, wirft die Frau ein und schaut erst in die Kamera und dann ihren Kollegen an.
»Die Menschen in den sozialen Medien sehnen sich ja nach solchen Figuren, die die Straßen durchstreifen und es mit üblen Kerlen aufnehmen«, spottet er und zuckt mit den Schultern. »Diese Vermutungen sind ausschließlich spekulativer Natur.«
»Alle Opfer gaben an, von einer jungen Frau Anfang zwanzig angegriffen worden zu sein, die stark alkoholisiert war. Es ist von übermenschlichen Kräften die Rede. Online gibt es sogar einen Namen für die Unbekannte: Captain Wodka.«
»Ja«, sagt ihr Kollege. Sein Tonfall klingt sarkastisch, aber der Ausdruck auf seinem Gesicht ist bitterernst. »Vermutlich würde jeder Mann, der von einer jungen Frau verprügelt wird, behaupten, sie hätte unnatürliche Kräfte.«
Sie wirft ihm einen kritischen Blick zu, dann geht er bereits zum Wetter über. Ich senke meinen Blick auf die Decke vor mir und denke erst jetzt daran, die Tabletten zu nehmen. Alles weitere Gesagte geht vollkommen im Strudel unter.
Das mit der Straße war wirklich ich? So schlimm war es noch nie und … Ich sehe auf meine Hände hinab, habe gar nicht bemerkt, dass sie zu zittern begonnen haben.
Ich wusste nicht, dass ich zu so etwas in der Lage bin.
Auf einmal wird mir noch übler. Ich glaube, ich muss mich übergeben, also presse ich die tauben Fingerkuppen auf meine Lippen.
Das hat ganz andere Dimensionen als die kleinen Streifzüge, die ich bisher unternommen habe. Ich habe wirklich die Kontrolle verloren. Jemand hätte ums Leben kommen können.
Die Stimmen der Nachrichtensprecher verschwimmen in einem Rauschen, das sich auf meine Ohren, meine Gedanken legt.
»Was meinst du, was das war?«, fragt Logan.
Ich brauche kurz, um mich aus meiner Starre zu lösen, und als ich aufschaue, liegt sein Blick ganz ruhig auf mir. Wie lang sieht er mich schon so an? Sein Gesichtsausdruck wirkt so weich, und ich weiß, dass er diese Sache über mich nicht wissen kann – viele Hinweise, die bisher über Captain Wodka zusammengetragen wurden, treffen nicht auf mich zu. Höchstwahrscheinlich, weil ein Großteil der Menschen, die ich mir vorgeknöpft habe, ebenfalls betrunken war. Oder weil sie danach eine Gehirnerschütterung hatten.
Also warum schaut Logan mich so an, während er das fragt?
»Woher soll ich das wissen?«, frage ich unschuldig lächelnd. Das Rauschen verschwindet langsam, aber es fällt mir noch schwer, meine Züge zu kontrollieren. Er muss sehen, wie unehrlich mein Lächeln ist.
Manchmal stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn ich es ihm einfach sagen würde. Wenn ich einfach sagen würde: »Hey, weißt du was? Das war ich. Kannst du mir helfen?« Aber solange die Chance größer ist, dass ich damit eher etwas zerstöre als etwas rette, lasse ich es. Ich kann natürlich nicht sicher sein, dass er mich aus seinem Leben verbannen würde, wenn er erführe, dass ich die unbekannte Rächerin bin. Vermutlich nicht, dazu kennen wir uns zu lang. Aber sein Bild von mir würde sich definitiv ändern, und das kann ich nicht zulassen.
Logan lacht und macht eine wegwerfende Geste. »Keine Ahnung. Ist schon komisch.«
»Total«, pflichte ich ihm schnell bei. »Wie läuft es eigentlich bei der Wohnungssuche?«, schiebe ich hastig nach, um das Thema zu beenden. Ich bin nach wie vor zu verkatert, um intelligent von meinen nächtlichen Ausflügen abzulenken.
Dieses Thema scheint wiederum ihm nicht zu gefallen. Er verzieht den Mund, wendet den Blick ab und lässt ein langes Seufzen entweichen. Hätte ich es nicht ansprechen sollen?
»Ich hab ehrlich gesagt nicht mehr geschaut.« Er presst die Lippen aufeinander, und ich richte mich ein Stück aus meiner eingesunkenen Position auf.
»Wegen deiner Familie?«, frage ich vorsichtig nach. Wenn er nicht drüber reden will, würde er es sagen. Aber so, wie er herumdruckst, scheint er nicht ganz abgeneigt zu sein.
Er wendet sich wieder zu mir herum und blinzelt mich vielsagend an. »Sie verstehen nicht, warum ich … ein bisschen Abstand brauche. Immerhin gehört das ganze obere Stockwerk mir.«
»Dasselbe Argument wie vor einem halben Jahr also.«
Er nickt. Plötzlich macht er einen viel nachdenklicheren Eindruck. »Ich meine, ich …« Er vollführt eine wegwerfende Geste und seufzt noch mal. »Ist ja nicht so, dass ich nicht trotzdem durch den Vordereingang müsste, wenn ich mal jemanden mit nach Hause bringen will.«
Das tut ein bisschen weh, aber ich lasse es mir nicht anmerken. Immerhin geht’s jetzt nicht um mich.
»Du hast auch dein Recht auf Privatsphäre«, pflichte ich ihm bei. »Und ich meine, was erwarten sie? Du kannst nicht für immer bei deinen Eltern wohnen.«
»Doch, das erwarten sie«, stöhnt er. »Meine Eltern haben immer bei meinen Großeltern gewohnt. Und meine Großeltern immer bei meinen Urgroßeltern.« Diese Geschichte ist bereits ein alter Hut.
Ich liebe Logans Eltern und seine Großmutter. Sie sind für mich fast meine eigene Familie, aber in dieser Sache hat er recht. »Das waren andere Zeiten«, sage ich also.
Er reibt sich mit den Fingerspitzen über die geschlossenen Lider. »Ich weiß.« Er blinzelt mich an, als würde er mit seinem Blick noch etwas anderes sagen wollen, das ich nicht bestimmen kann. »Aber Traditionen bedeuten ihnen alles und … Ich weiß nicht, ob ich derjenige sein kann, der mit ihnen bricht. Ich liebe meine Familie.«
»Das weiß ich.« Ich würde gern meine Hand ausstrecken, um ihn beruhigend zu berühren, aber dazu bin ich wieder zu weit eingesunken. »Und das wissen sie auch. Sie müssen verstehen, dass du deine Freiheit brauchst.« Ich versuche, die Stimmung mit einem Lächeln aufzuhellen. »Ich würde dir ja anbieten, bei mir zu wohnen. Aber meine Wohnung eignet sich nicht gerade für eine WG.« Er wirft mir einen schelmischen Blick zu, und ich sinke lachend tiefer in die Couch ein. »Aber ehrlich«, füge ich an. »Sprich noch mal mit ihnen.«
»Mache ich«, seufzt er. Es klingt nicht überzeugend, doch er greift bereits nach dem Buch auf dem Couchtisch neben ihm, also ist das Thema für ihn wohl erst mal beendet. »Und du schlaf am besten ein bisschen.«
Der große Mahagonitisch im Esszimmer von Logans Familie birgt endlos viele Erinnerungen für mich. Er erinnert mich an all die gemütlichen Stunden des Essens, der Spiele und Gespräche. Manchmal erinnert er mich sogar an meine Eltern und daran, wie unsere beiden Familien früher oft gemeinsam hier saßen und Zeit miteinander verbracht haben. Nicht immer, dafür ist es schon zu lang her. Aber tatsächlich macht es mir dieser Ort etwas leichter, mich zu beruhigen. Mich von dem zu lösen, was mir Sorgen bereitet.
Selbst wenn ich vollkommen verkatert über griechischen Texten sitze.
Durch die hohen Fenster dringt das warme Licht der frühen Nachmittagssonne herein, und durch die geschlossene Tür zur Küche ist das Brutzeln von Gemüse in der Pfanne und das Klappern von Töpfen zu hören. Durch die wenigen Extrastunden Schlaf belebt mich der Geruch, der von dort aus hereindringt, tatsächlich ein wenig, anstatt erneute Übelkeit auszulösen.
»Das Wort kenne ich, glaube ich, nicht«, murmelt Logan und zieht seinen Übersetzer zu sich heran, alles unter den aufmerksamen Blicken seiner Großmutter. Es ist schon fast eine Stunde vergangen, seitdem sie uns genötigt hat, unsere Uni-Aufgaben nicht weiter aufzuschieben, sondern sie einfach hinter uns zu bringen.
Mein Blick ist starr auf den Absatz gerichtet, den wir gerade durchgehen. Den Kugelschreiber in meiner Hand zu halten schmerzt ziemlich, aber ich versuche, es mir nicht anmerken zu lassen. Nachdem sich Logans Mutter meine Wunde angesehen und sie neu versorgt hat, fühlt es sich allerdings schon ein wenig besser an.
Ich schaue müde von Logan zu seiner Großmutter. Sie sieht mit ihrem lockeren, geblümten Cardigan und dem modernen goldenen Schmuck an Fingern und Hals nicht nur deutlich modebewusster aus als ich in meiner Collegejacke, sondern sicherlich auch fünfzig Jahre jünger.
Logan versucht sich erneut an der Übersetzung, und ich sammle alle Gehirnzellen, die noch eingeschaltet sind, um seinem Gedankengang zu folgen.
»Genau, aber du musst den richtigen Fall beachten«, sagt Oma Iota und deutet mit ihrem faltigen und mit etlichen Ringen geschmückten Finger auf ein Wort. Ich wünschte, diese Sprache würde mich genauso sehr begeistern wie die beiden. Manchmal färbt ein bisschen davon auf mich ab, wenn Logans Großmutter über ihre Reisen durch Europa und den Rest der Welt spricht. An Tagen wie heute packt es mich leider gar nicht.
»Tycho, hast du das auch verstanden, Liebes?« Ich sehe in ihr breit lächelndes Gesicht und kann nicht anders, als ihr Lächeln zu erwidern. Mit dem dicken weißen Pferdeschwanz, der von dunkelgrauen Strähnen durchzogen ist, sieht sie einfach so charismatisch aus.
»Ja, ich …« Ich fahre mir mit den Händen über das Gesicht und blinzle einige Male. »Ich bin nur ein bisschen müde, aber ich schau mir das nachher auch noch mal in Ruhe an.« Das muss ich wirklich, wenn ich mich übermorgen im Kurs nicht blamieren will.
»Na gut, aber mach langsam, ja?« Logans Großmutter gibt sich sehr mitfühlend, aber ihr ist natürlich bewusst, dass ich so fertig bin, weil ich einen Kater habe. Ich weiß nicht, warum ich mir wünsche, dass sie nicht solche Rücksicht auf mich nehmen würde, als sie mit Logan zum nächsten Paragrafen übergeht. Vielleicht, weil ich das Mitleid nicht will. Oder vielleicht, weil ich nicht möchte, dass sie denkt, ich würde es eigentlich nicht können.
Es ist mehr als offensichtlich, dass mich das Fach nicht sonderlich interessiert. Wie eigentlich das ganze Studium. Ich hatte gehofft, dass Altertumswissenschaften und die griechisch-römische Antike mich genauso sehr faszinieren würden wie meine Eltern und meine Großmutter. Schon in den ersten zwei Semestern ist mir klargeworden, dass dem nicht so ist – und ich habe nur weitergemacht, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. Und weil ich bei Logan sein möchte.
Aber obwohl ich wenig Interesse für die Fächer übrighabe, möchte ich gut darin sein. Wenigstens ein bisschen besser als durchschnittlich, das reicht mir schon.
Ich schaffe es tatsächlich, mich so weit zusammenzureißen, dass ich ein paar Sätze korrekt übersetze, bis das Klingeln des Haustelefons uns unterbricht. Logans Großmutter richtet sich überraschend flink auf, um zu der kleinen Kommode zu treten, auf der zwischen vielen gerahmten Fotos der Familie die Ladestation für das kabellose Telefon steht.
Nach einem raschen Blick auf das Display weist sie uns mit einem klimpernden Winken ihrer Hand darauf hin, dass sie geht und wir allein weitermachen sollen.
Ich warte, bis sie, einen fröhlichen Gruß auf den Lippen, den Raum verlassen hat, dann senke ich endlich den Kopf auf die Tischplatte. Er schmerzt nicht mehr, aber ich würde so gern hundert Stunden durchschlafen.
Logan lacht leise und klopft mir sacht auf den Rücken. »Geht’s?«
»Ja«, nuschele ich.
»Ich würde dich ja gern bemitleiden, aber du hast dir das selbst eingebrockt«, stichelt er.
»Ich weiß.«
»Wie geht das eigentlich? Betrinkst du dich während deiner Schichten in der Bar oder danach?« Sein Tonfall hat sich ein wenig verändert, ist angespannter. Das passiert nur, wenn er irgendetwas Wichtiges ansprechen will.
Ich stöhne, weil ich nicht weiß, ob ich nach der Griechisch-Lehrstunde geistig bereit für wichtige Gespräche bin.
»Danach.« Ich raffe mich auf, streiche die Haare vermutlich höchst unelegant aus meinem Gesicht und stütze mein Kinn auf die Hände. »Aber nicht dort.«
»Aha.« Das klingt so trocken.
Ich kneife meine Augen irritiert zusammen und versuche, in seinem Gesicht zu erkennen, was er eigentlich von mir wissen will.
»Hast du morgen wieder ’ne Schicht in der Bar?«, wechselt er allerdings das Thema.
Ich entspanne mich ein wenig. »Nein, erst Montag.« Ich überlege, ob ich ihm die nächste Information mitteile, aber er wird es sowieso erfahren. Und vermutlich macht er sich gar nichts daraus. »Ich geh morgen mit Neil feiern.«
»Feiern.« Logan zieht die Augenbrauen lächelnd hoch und betont das Wort, als sei es zweideutig. Eigentlich ist es das in diesem Fall auch.
Ich bin froh, dass er sich auf den Themenwechsel einlässt und nicht weiter nachhakt. Er macht sich Sorgen darum, dass ich mich so oft betrinke und mit Verletzungen nach Hause komme. Aber er scheint in letzter Zeit besorgter darüber als sonst.
»Willst du mitkommen?« Ich frage ihn oft, obwohl ich seine Antwort ohnehin kenne. Die meisten Leute, mit denen ich mich treffe, können ihn nicht sonderlich gut leiden; warum auch immer. Aber das ist mir egal. Und ihm auch.
Trotzdem lehnt er jedes Mal ab. »Ich bin zu alt für den Scheiß«, reagiert er wie erwartet.
Ich verdrehe amüsiert die Augen, auch wenn’s in meinem Kopf ziept. Er kommt nur nicht mit, weil er lieber daheim herumsitzt. Ich kenne alle seine Ausreden. »Du bist einundzwanzig Jahre alt! Und nur zwei Wochen älter als ich.« Dieses Spiel spielen wir sehr oft. Irgendwann wird er mich schon in einige Clubs begleiten. Es würde ihm sicher auch gefallen, die ganze Nacht durchzutanzen, er weiß es nur noch nicht.
»Zwei Wochen machen einen erheblichen Unterschied«, entscheidet er sich für seine Standardantwort.
»Tu doch nicht so. Du bist schon alt geboren worden.«
Er bricht in lautes Lachen aus und sieht tatsächlich ein wenig getroffen aus. »Was soll das denn heißen?«
»Du hast selbst auf dem Spielplatz immer den Überwacher gespielt!«
»Daran erinnere ich mich nicht.«
»Du erinnerst dich nicht daran, wie du mit dem Lineal die Kanten meiner Pyramide überprüft hast?«
Als er die Arme vor der Brust verschränkt und eine Schnute zieht, sieht er so knabenhaft aus, wie ich ihn von damals in Erinnerung habe. »Nein. Und außerdem«, fährt er lauter werdend fort, als ich ihn schon fragen will, ob ich die Fotos heraussuchen soll, »bin nicht ich derjenige, der den ganzen Vormittag halb tot in geblümten Steppdecken auf der Couch gelegen hat.«
Wir halten einige Sekunden lang den Augenkontakt, dann können wir gleichzeitig das Grinsen nicht mehr zurückhalten. Locker zieht er seinen Text wieder zu sich heran. Überaus unmotiviert will ich mich auch dem letzten Abschnitt widmen, aber ein Blinken meines Handys zieht meine Aufmerksamkeit auf sich.
Ich werfe einen Blick auf den Sperrscreen. Selbst nüchtern ist es schwer, etwas durch das zerbrochene Glas hindurch zu lesen.
Dr. Williams. Ich weiß nicht mehr, wie lang ich gestern mit ihm gesprochen habe oder wie das Gespräch geendet hat. Ein wenig Aufregung macht sich in mir breit, als ich kurz befürchte, mehr gesagt zu haben, als ich eigentlich wollte. Aber seine Nachricht ist nur eine Frage danach, wie es mir geht und ob wir später noch mal sprechen wollen.
Logan sieht es auch.
»Dr. Williams«, liest er den Namen vor, sieht aber weiter das Handy und nicht mich an. »Hast du bald wieder eine Sitzung?«
Ich nehme das kleine Gerät und drehe es um, lege es mit dem Bildschirm auf den Tisch. »Eigentlich stehen zurzeit keine mehr an.« Ich hatte schon genug und denke nicht, dass es ein Weiterkommen in der Therapie gibt, solange ich nicht über das eigentliche Problem in meinem Leben sprechen kann.
Ich schaue Logan an, und er sieht nur langsam zu mir auf, legt die Stirn in Falten. Wieder dieser zögerliche Ausdruck in seinen Zügen. »Bist du sicher, dass der Kerl dir noch helfen kann?«
»Was meinst du?«, hake ich sacht nach. Automatisch setze ich mich etwas aufrechter hin, und meine Gedanken klaren ein Stück auf, als mein Puls sich beschleunigt. So eine Anmerkung hat er noch nie gebracht.
»Ich meine, ich …« Er sieht mir immer noch nicht in die Augen. »Ach, ich weiß nicht, ob wir das jetzt besprechen sollten.«
Ich will aber auch nicht, dass das zwischen uns steht. »Sag ruhig, was du denkst.« Ich versuche, so wenig defensiv wie möglich zu klingen, aber ich bin unsicher, ob es mir gelingt. Ich bin einfach keine gute Schauspielerin.
Unsicher fährt er sich mit den Fingern durch die Locken. »Deine Eltern sind seit dreizehn Jahren tot. Deine Großmutter seit sieben Jahren. Und es geht dir … immer noch nicht besser, habe ich den Eindruck.«
Um zurückzuhalten, was ich dazu sagen will, beiße ich mir auf die Unterlippe. Ich weiß natürlich, dass das alles lang her ist. Aber ich habe mich auch damit abgefunden, dass das ein Teil meines Lebens ist. Welche Veränderung erwartet er denn von mir, um meinen Zustand als gut wahrzunehmen? Er kann mich immerhin schlecht an meinem achtjährigen Ich messen. Vor diesen ganzen Geschehnissen.
Aber vielleicht will er das auch gar nicht sagen. »Was meinst du?«, frage ich also.
Er schluckt schwer, als wollte er nicht aussprechen, was er denkt. »Ich will echt nichts Falsches sagen.«
Ich schürze provokant die Lippen und stupse seinen Arm an, um ihn wieder locker zu machen. »Ich will’s wissen. Geht’s ums Feiern? Oder den Sex?«
Sein Lachen wirkt tatsächlich ein wenig erleichtert. »Himmel, nein. Du kannst so viel Sex haben, wie du willst.« Sobald er das ausgesprochen hat, zieht er neckend die Augenbrauen hoch. Schon klar, ich hatte mein Aufklärungsgespräch über Verhütung und alles Weitere mit ihm und seinen Eltern. »Aber ich denke nicht, dass es gesund ist, wie viel du trinkst. Und dass das mit deinen … Problemen zusammenhängen könnte.«
Meinen Problemen. »Ist es denn so viel?« Ich kenne einige Leute, die öfter feiern gehen als ich und jedes Wochenende verkatert sind. Eigentlich ist es nichts Besonderes, vor allem nicht in unserem Freundeskreis. »Ich denke nicht, dass ich mehr trinke als Neil, Teddy, Ariel oder Matilda.«
»Nein, es …« Er blinzelt betrübt. »Es geht ja nicht um die Menge, sondern um die Auswirkung, die es auf dein Leben hat.« Er macht eine Geste, die irgendwie auf meinen ganzen Körper deutet. »Ich meine, diese Verletzungen …« Er seufzt noch einmal. »Ich mach mir einfach Sorgen um dich. Ich will nur, dass es dir gut geht.«
Nachdenklich lege ich die Stirn in Falten und lasse das wirken. Er macht sich tatsächlich Sorgen um mich. Und verdammt, ja, ich habe es übertrieben. Die Wunde in der Hand ist vermutlich der ausschlaggebende Punkt.
Ich sehe hinab und betrachte meine aufgeschürften Knöchel. Ich muss irgendetwas tun, um diese Verletzungen zu verhindern oder zu verbergen, wenn ich will, dass Logan sieht, dass es mir gut geht.
Es … es geht mir ja eigentlich gut. Ich habe nicht alles unter Kontrolle, aber das hat niemand.
»Danke«, murmele ich also. »Ich sollte wirklich mal mit Dr. Williams darüber reden.«
Logan nickt vorsichtig und reibt die Hände aneinander. »Ich will auch nicht komisch sein«, sagt er dann unangenehm berührt lachend.
Ich frage mich, ob er mit seinen Eltern über mich geredet hat. »Bist du nicht. Aber du musst dir wirklich weniger Sorgen um mich machen.« Ich grinse. »Das lässt dich noch älter wirken.«
Lachend verdreht Logan die Augen. »Nicht das wieder, bitte.«
»Komm jetzt«, sage ich und deute auf die Bücher, deutlich motivierter als vorher, weil sie mir als Ausrede dienen, dieses Thema zu beenden. »Ich will fertig sein, wenn es Essen gibt.«
WANN KÄLTE IN MICH EINDRINGT
Es dauert ungefähr sechs Minuten, bis das Gehirn beginnt, auf Alkohol zu reagieren. Bei mir geht das schneller.
Ich bin nicht schneller betrunken, aber ich spüre die Wärme schneller. Die pulsierende Hitze unter der Haut, das Kribbeln in meinen Gliedern, das berauschende Gefühl, die Kontrolle abzugeben. An irgendetwas Animalischeres, manchmal Dunkleres als mein eigenes Ich.
Heute spüre ich die Düsternis nicht. Es ist, als halte die Musik, die betäubend laut durch den Club wummert, sie in Schach. Die verschwitzte Masse an Menschen zuckt ekstatisch zum Sound der Elektrosongs. Ich gehe im Vibrieren der Menge, im Dunst aus Schweiß und im Bass der Musik unter.
Neil tanzt ganz dicht hinter mir. Zwischen all den Menschen ist sein Körper nicht der einzige, den ich berühre, aber derjenige, den ich am deutlichsten spüre. Seine Hände halten meine Hüfte, führen sie, um meine Bewegungen seinen anzugleichen.
Ich werfe einen Blick über meine Schulter, um im zuckenden Neon der Lichtshow zu ihm aufzuschauen. Seine Haut ist von einer schimmernden Schweißschicht überzogen, ebenso wie meine. Der stechende Blick hinter seiner Brille trifft meinen, und das Lächeln, das sich auf dem Gesicht mit den hohen Wangenknochen abzeichnet, wirkt schelmisch.
Ich werfe ihm ein Lächeln zu, und im Rhythmus des Songs presst er mich an sich, schlingt seinen Arm um meine Taille.
Wie lang tanzen wir schon? Es müssen ein paar Stunden sein, aber im fensterlosen Untergrund vergeht die Zeit sowieso anders.
Der Song geht flüssig in den nächsten über. Der DJ hat nicht den besten Geschmack, aber wenn so viel Alkohol geflossen ist, ist es mir für gewöhnlich egal, wie peinlich die Musikauswahl teilweise ist. Meine Bewegungen verlangsame ich passend zum Beat.
In der sich bewegenden Masse aus Menschen sind wir nur ein kleiner Teil von etwas Größerem. Ich liebe das Gefühl der vollkommenen Unsichtbarkeit, das sich in mir ausgebreitet hat.
Ich lehne mich ein Stück zurück und schiebe meinen Hintern an Neils Schoß.
Er greift meine Hüfte ein wenig fester und zieht mich enger an sich, sodass ich seine verschwitzte Brust in meinem Rücken beben spüre. Ich muss mich trotz der High Heels auf die Zehenspitzen stellen, als er sich zu mir herabbeugt und ich sein raues Kinn an meiner Wange kratzen spüre.
»Sollen wir zu mir fahren?« Sein Atem ist heiß, aber ich höre das amüsierte Lächeln in seiner Stimme. Mir grinsend auf die Unterlippe beißend, bewege ich meine Hüfte etwas herausfordernder, noch immer eng an ihn gepresst.
Er scheint den Hinweis zu verstehen. Natürlich fahren wir zu ihm. Vielleicht noch nicht jetzt, aber bald. Wir haben das schon oft genug gemacht, um zu wissen, worin es endet.
Er lockert den festen Griff seiner Hände ein wenig und lässt sie langsam an meinem Körper hinaufgleiten. Ich schmunzle, als sie meine Brüste erreichen und er sie sacht berührt. Unauffällig, fast als sei es ein Versehen, streichen seine Finger über sie. Der dünne Stoff meines Tops ist kaum ein Hindernis für seine Berührungen.
Ich lasse ein Seufzen von meinen Lippen, das nicht einmal bis an meine eigenen Ohren dringt. Ich denke nicht, dass wir jemandem auffallen, aber selbst wenn, ist es mir gerade egal. Ich schiebe meine Hände hinter meinen Körper, um spielerisch an seinem Hosenbund zu zupfen.
Neil ist mutig. Eine Hand noch immer über meinen Oberkörper geschlungen, gleitet die andere sacht zu meinem Rock, schiebt sich ein Stück zwischen meine Beine. Ich grinse überrascht, als mir klar wird, wie dringlich es ihm ist.
Das Wummern der Musik, deren Bass ich bis in mein Innerstes spüre, ist wie eine eigene Berührung. Das Zucken der Lichter dürfte nicht allzu viel Aufschluss darüber geben, was wir hier tun. Obwohl es durchaus etwas Spannendes hat, mir vorzustellen, es wäre so.
Ich lehne meinen Hinterkopf an Neils Schlüsselbein. Mein ganzer Körper ist heiß, aber zwischen meinen Schenkeln macht sich eine andere Art von Wärme breit. Eine aufregendere Art.
Neils Bart berührt wieder meine Wange. »Ich meine es ernst«, raunt seine dunkle Stimme an meinem Ohr. Er drückt meinen Unterleib weiter an seinen, und ich spüre die leichte Wölbung in seiner Jeans. »Wir sollten zu einem von uns fahren. Jetzt.«