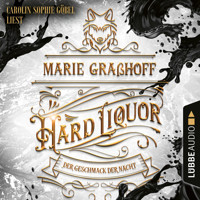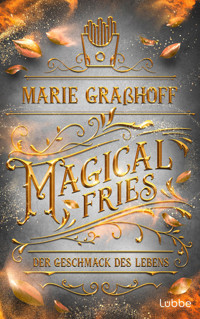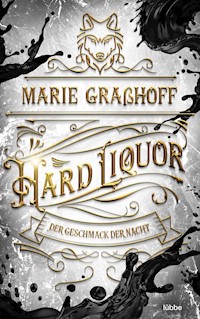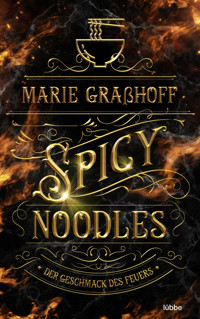
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Food Universe
- Sprache: Deutsch
Da ihn alle New Yorker Universitäten abgelehnt haben, muss Toma notgedrungen im Restaurant seines Großvaters Shiro arbeiten. Über Shiros Geschichten kann er nur den Kopf schütteln. Ihre Familie, so behauptet er, stamme von einem shintoistischen Feuergott ab und ein paar schlichte Essstäbchen in ihrem Besitz seien magische Gegenstände! Statt der Legende nachzugehen, macht Toma lieber der Stammkundin Akira schöne Augen. Als jedoch finstere Gestalten auftauchen und kurz darauf die Stäbchen gestohlen werden, beginnt Toma zu zweifeln. Gemeinsam mit Akari macht er sich an die waghalsige Verfolgung der Diebe - nicht ahnend, dass sie damit in einen jahrhundertealten Krieg hineingezogen werden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungINHALTSWARNUNGTOMAS PLAYLISTKAPITEL 1KAPITEL 2KAPITEL 3KAPITEL 4KAPITEL 5KAPITEL 6KAPITEL 7KAPITEL 8KAPITEL 9KAPITEL 10KAPITEL 11KAPITEL 12KAPITEL 13KAPITEL 14KAPITEL 15KAPITEL 16KAPITEL 17KAPITEL 18KAPITEL 19KAPITEL 20KAPITEL 21KAPITEL 22KAPITEL 23KAPITEL 24KAPITEL 25KAPITEL 26KAPITEL 27KAPITEL 28KAPITEL 29KAPITEL 30KAPITEL 31KAPITEL 32KAPITEL 33KAPITEL 34KAPITEL 35KAPITEL 36KAPITEL 37KAPITEL 38KAPITEL 39KAPITEL 40KAPITEL 41KAPITEL 42KAPITEL 43KAPITEL 44KAPITEL 45KAPITEL 46KAPITEL 47KAPITEL 48KAPITEL 49KAPITEL 50KAPITEL 51ENDEDANKSAGUNGÜber dieses Buch
Band 2 der Reihe »Food Universe«
Da ihn alle New Yorker Universitäten abgelehnt haben, muss Toma notgedrungen im Restaurant seines Großvaters Shiro arbeiten. Über Shiros Geschichten kann er nur den Kopf schütteln. Ihre Familie, so behauptet er, stamme von einem shintoistischen Feuergott ab und ein paar schlichte Essstäbchen in ihrem Besitz seien magische Gegenstände! Statt der Legende nachzugehen, macht Toma lieber der Stammkundin Akira schöne Augen. Als jedoch finstere Gestalten auftauchen und kurz darauf die Stäbchen gestohlen werden, beginnt Toma zu zweifeln. Gemeinsam mit Akari macht er sich an die waghalsige Verfolgung der Diebe – nicht ahnend, dass sie damit in einen jahrhundertealten Krieg hineingezogen werden …
Über die Autorin
Marie Graßhoff, geboren 1990 in Halberstadt/Harz, studierte in Mainz Buchwissenschaft und Linguistik. Anschließend arbeitete sie einige Jahre als Social-Media-Managerin bei einer großen Agentur, mittlerweile ist sie als freiberufliche Autorin und Grafikdesignerin tätig und lebt in Leipzig. Mit ihrem Fantasy-Epos Kernstaub stand sie auf der Shortlist des SERAPH Literaturpreises 2016 in der Kategorie »Bester Independent-Autor«.
Roman
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Buch wurde vermittelt von derLiteraturagentur erzähl:perspektive, München(www.erzaehlperspektive.de).
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Klaudia Szabo, Leipzig
Titelillustration: Alexander Kopainski
unter Verwendung von Illustrationen von© Shutterstock: Eduard Muzhevskyi | Nimaxs | Aperture75 | ParinPixs | Visual Generation | Stock_Good
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-2086-1
luebbe.de
lesejury.de
Für Lily und Luna
Dieses Buch enthält explizite Darstellungen von drastischer Gewalt, Tod und Mord.
Ihr entscheidet selbst, wie ihr damit umgeht. Sind diese Themen für euch besonders emotional aufgeladen, passt auf euch auf.
Ugly Ending – Best Frenz, Joywave, Jason Suwito
Blood – ANIMA!
SLOWDANCINGINTHEDARK – Joji
なんでもないよ、 – Macaroni Empitsu
Bad Friend (End of the World Remix) – Rina Sawayama
Put Me To Work – Big Data
Lies – The Toxic Avenger, LOOKMUMNOCOMPUTER
Pleasant – SebastiAn, Charlotte Gainsbourg
Hot Heavy Summer – Ben Howard, Sylvan Esso
VAPORS – KUNZITE
Bad Kingdom – Moderat
still feel. – half.alive
Busy earnin’ – Jungle
Cut My Lip – Twenty One Pilots
Nervous – Magic Bronson
HOME – BTS
Unstoppable – Gizzle
Be This Way – Arms and Sleepters, Steffaloo
Last Resort & Spa – Battle Tapes
Multi-Love – Unknown mortal Orchestra
Holding on for Life – Zeds Dead Remix – Broken Bells
Meateater – ALASKALASKA
WAS ICH IN DER NACHT SEHE
Overkill ist niemals allein. Das sagen die Leute. Overkill sieht alles. Gehörst du nicht zu seinen Anhängern, bist du sein Gegner. Und bist du sein Gegner, dann bist du sein Opfer.
Ein Kribbeln durchfährt meinen Körper vom Scheitel bis zur Sohle, als ich an der Zigarette ziehe und mich an diese Worte erinnere. Nachts ist es nicht mehr sicher auf den Straßen New Yorks. Seit Wochen schon nicht. Es ist leichtsinnig, nur draußen zu sein, weil ich nicht nach Hause will.
Trotzdem zieht es mich hinaus, wenn es zu dunkel in mir wird. Die Nacht trägt eine Schwere mit sich. So viele meiner Erinnerungen haben ihr ein Gewicht gegeben, das der Tag nicht tragen kann.
Ich knülle das Papier in meiner Hand fester zusammen. Eine Schar Krähen auf dem Gehweg vor mir flattert auf und verschwindet in eine Seitenstraße. Die frische Frühlingsbrise weht mir meine schwarzen Haare ins Gesicht. Sie trägt den Geruch eines Imbisswagens zu mir; den nach knusprigem, dunkel angebratenem Fleisch und einer Reihe nicht identifizierbarer Soßen, der verlockend in meiner Nase kitzelt.
Das Rauschen des Verkehrs auf der Zehnten in Hell’s Kitchen ist überall zu hören, jetzt da der Feierabendverkehr die Straßen verstopft. Die Scheinwerfer der Wagen, die sich neben dem Bürgersteig über den gerissenen Asphalt schieben, erhellen mein Sichtfeld zusammen mit einigen Neonreklamen und Werbetafeln.
Ich nehme einen weiteren Zug von der Zigarette, dann falte ich den Brief wieder auseinander. Ich habe ihn schon hundertmal gelesen, aber irgendetwas in mir hat die kindische Hoffnung noch nicht aufgegeben, ich hätte die Worte bisher nur falsch verstanden.
Zwischen all den tätowierten Blumen, Streifen, Mustern, Sternen und Monden lächelt mich ein Smiley an meinem Unterarm an. Als wolle er mir sagen, dass alles gut wird. Dabei weiß ich, dass es das nicht ist.
»Sehr geehrter Toma Daigo,
vielen Dank für Ihre Bewerbung an unserer Einrichtung. Nach eingehender Prüfung Ihrer Unterlagen tut es uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass …«
Ich ziehe an meiner Zigarette, bleibe stehen und halte den glimmenden Überrest an das Papier. Es würde mir gefallen, wenn es lichterloh zu brennen anfinge, aber der Brief kokelt nur gemächlich vor sich hin. Als nur noch ein Schnipsel übrig ist, trägt ihn die Brise ein paar Meter weit, bis er in eine Gosse fällt.
Jetzt ist alles vorbei.
Das war die letzte Bewerbung, die ich abgeschickt hatte. Das einzig Gute ist, dass das damit auch die letzte Absage war, die ich bekomme.
Mein Vater hatte recht. Ich bin ein Versager.
Ich konnte das Ultimatum, das er mir gestellt hat, nicht erfüllen. Wenn ich nicht an einer Universität studiere, bekomme ich keinerlei Unterstützung von meinen Eltern. Das haben sie mir das erste Mal klargemacht, als ich zwölf war.
Und ich werde es ihnen sagen müssen.
Ich werde nach Hause gehen und meinem Vater sagen müssen, dass ich genau der Loser bin, für den er mich immer gehalten hat.
Oder ich gehe einfach nicht mehr nach Hause. Dann bliebe mir zumindest das erspart.
Ein Seufzen auf den Lippen, setze ich meinen Weg schwerfällig fort. Wie soll es jetzt weitergehen?
Ich könnte mich auf Ausbildungen bewerben oder aufs Community College gehen. Aber das würde Dad nicht unterstützen. Er sagte, dass er das gesparte Geld nur für die Uni ausgeben würde. Was wiederum bedeutet, er wird es mir nicht geben, damit ich endlich ausziehen kann.
Vielleicht schmeißt er mich raus. Ich denke eh nicht, dass ich es noch länger mit ihm aushalte. Aber woher soll ich das Geld zum Leben nehmen? Ich zahle zwar auch auf das Sparkonto ein, seit ich denken kann, doch mit meinem Anteil komme ich vermutlich nicht weit.
Kann ich mir davon eventuell einen Platz in einer WG leisten? Ich hätte mich früher auf diesen Ausgang vorbereiten sollen, verdammt.
Mit gesenktem Kopf trete ich in eine Seitenstraße. Soll ich mir noch eine Zigarette anzünden? Überall wird gesagt, dass man nachts nicht auf die Straßen soll, wenn man es vermeiden kann, seitdem dieser Serienmörder unterwegs ist. Doch obwohl die ganze Stadt seit vier Wochen in Panik ist, fühle ich mich sicher hier draußen. Ich fühle mich sicherer als zu Hause.
Ich suche in meiner Jackentasche nach der Zigarettenschachtel, als ich zwischen parkenden Wagen vier Gestalten erkenne, die sich um einen Mann geschart haben. Sofort drossle ich mein Tempo. Ich weiß nicht, was mir an dieser Szene eigenartig vorkommt, aber als gebürtiger New Yorker weiß man wohl intuitiv, von welchen Situationen man sich fernhalten sollte.
Die Personen treiben den Mann mittleren Alters in eine Ecke, mehrere Meter von mir entfernt. Er hebt abwehrend die Hände. Ich verstehe nicht, was er sagt.
Wie von allein tragen mich meine Beine hinter eine steinerne Treppe, die zu einem Hauseingang führt. Durch die Berichte zu Captain Wodka vor über einem Jahr – all die Hinweise, wie man sich zu verhalten hat, sollte man Zeuge von Gewaltverbrechen werden – bin ich darauf konditioniert, unverzüglich mein Handy aus der Tasche zu ziehen. Ich wische nach links, um die Kamera zu öffnen und ein Beweisfoto aufzunehmen.
Jetzt nur nicht die Ruhe verlieren.
Die Personen reden offenbar miteinander, aber nur mit gesenkten Stimmen, sodass ich sie nicht verstehe. Meine Finger zittern, als ich die App wechsle, um die Polizei zu rufen. Selbst wenn es nur ein falscher Alarm ist, gehe ich lieber auf Nummer sicher.
Doch kurz bevor ich den Anruf starte, nähert sich eine Person dem Mann und streckt die Hand nach seiner Wange aus. Es sieht so aus, als wollen sie den Kerl nur beruhigen. Vielleicht hat er einen über den Durst getrunken oder irgendetwas eingeworfen. Das hatte ich in meinem Schrecken gar nicht in Betracht gezogen.
Ich atme auf.
Also ist es nur ein Missverständnis.
Erleichtert stecke ich das Handy weg und will auf dem Absatz kehrtmachen, um zurückzugehen. Doch was ich dann sehe, lässt mich mit weit aufgerissenen Augen stehenbleiben.
Der Kopf des Mannes explodiert.
Es gibt kein weiteres Geräusch, als das Blut und die Überreste seines Schädels in alle Richtungen spritzen. Keinen Schuss. Keinen Knall. Nur ein Knacken und Platschen. Und einen dumpfen Aufschlag, als das, was von seinem Körper übrig ist, zu Boden kracht.
Erstarrt schaue ich auf die Lache aus Blut, die sich rasch auf dem Asphalt ausbreitet, als die Angreifer von der Leiche zurückweichen. Ich habe kein Gefühl mehr für meinen Körper und von einer Sekunde auf die andere wird mir so übel, dass ich befürchte, mich noch an Ort und Stelle zu übergeben.
Ist das wirklich passiert? War das eine Verarsche für ein YouTube-Video? Kommen gleich die Leute mit den versteckten Kameras?
Nein. Ich habe es zu oft in den Nachrichten gehört. Es ist so surreal, dass ich mich bisher geweigert habe, es mir vorzustellen. Aber das ist sie. Die Art, auf die Overkill seine Opfer tötet.
Das Gewicht dieser Erkenntnis kracht wie ein Gebirge auf mich herab. Die Welle aus Angst, die darauf folgt, motiviert mich, mir meine Kapuze überzuziehen und mich endlich in Bewegung zu setzen.
Ich darf hier nicht gesehen werden. Von niemandem! Die Angreifer bewegen sich zwar zum anderen Ende der Straße, aber wenn sie sich umdrehen, bin ich geliefert! Ich renne, so schnell ich kann, den Schock so tief in den Knochen, dass meine Knie weich werden. Mein Magen rebelliert. Ich muss kotzen, aber meine DNA darf nicht am Tatort sein, sonst werde ich da mit reingezogen!
War er das wirklich? Diese Person, die den Kopf des Mannes einfach hat explodieren lassen. War das Overkill? Der Killer, von dem die Medien seit Wochen berichten?
Soll ich die Polizei rufen?
Meine Lunge brennt, aber ich werde nicht langsamer.
Ich muss die Polizei rufen, das weiß ich. Sie sagen es immer und immer wieder. Aber der letzte Augenzeuge, von dem berichtet wurde, ist wenige Tage nach seiner Aussage selbst zum Opfer von Overkill geworden.
Nein, ich darf da nicht mit reingezogen werden.
Erst als ich ein paar Blocks weit gelaufen bin, verlangsame ich meine Schritte und senke den Kopf, sobald mir Menschen entgegenkommen.
Zum Glück würdigt mich niemand eines zweiten Blickes. Sonst sähen sie, wie totenblass ich bin.
Den Schlüssel noch in der Hand, falle ich durch die türkis gestrichene Holztür und wanke ohne ein Wort durch die Wohnung. Ich weiß nicht, ob meine Eltern im Wohnzimmer mich bemerken, aber selbst wenn sie es täten, hätte ich keine Zeit, um ihnen meinen Zustand zu erklären. Ich lasse die Jacke von meinen Schultern fallen, taumle über den alten Parkettboden ins Bad, werfe die Tür hinter mir zu, öffne den Deckel der Toilette und übergebe mich.
Es fühlt sich befreiend an, nachdem ich das flaue Gefühl in meiner Kehle so lang heruntergekämpft habe.
Als ich fertig bin, schnappe ich nach Luft und lehne mich zurück. Mit dem feuchten Handtuch neben mir wische ich mir den Mund ab.
Dass ich es überhaupt bis hierher geschafft habe, ist ein Wunder. Und ich kann nach wie vor nicht glauben, dass das tatsächlich passiert ist. Dass ich ihn mit eigenen Augen gesehen habe. Overkill. Derjenige, von dem seit Wochen alle sprechen.
Wenn ich an das Bild zurückdenke, das sich mir geboten hat, wird mir wieder übel. Dabei habe ich mich so verdammt sicher gefühlt. Viel zu sicher.
Hat er mich gesehen? Was, wenn er mich erkannt hat? Oder die Personen, die ihn begleitet haben? Werden sie mich jetzt verfolgen? Aber hätten sie das nicht schon getan, wenn es so wäre? Warum sollten sie mich gehen lassen?
Ich atme tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus, um die Gedankenspirale zu durchbrechen. Nein, das kann nicht sein. Er hat mich nicht gesehen. Ich bin sicher. Alles ist gut.
Ein Klopfen lässt mich zusammenfahren.
»Toma, Schatz, alles gut?«
Meine Mutter.
Nein. Nein, es ist nicht alles gut. »Ja«, antworte ich. »Ich muss mir den Magen verdorben haben.«
»Brauchst du was, Liebling?«
»Nein«, ächze ich. Sie soll einfach gehen. Ich muss mich ein paar Momente lang sammeln, sonst sieht sie mir sofort an, dass es nicht nur eine Lebensmittelvergiftung ist. Nicht wenn meine Finger so zittern. Wenn meine Haut schweißüberströmt und heiß ist, weil ich so schnell gerannt bin wie gefühlt noch nie in meinem Leben. Wenn mein Atem so stotternd geht, als würde meine Lunge nur schreien und weinen wollen. »Ich komm gleich.«
»Soll ich dir einen Tee machen?«
Ich beiße mir auf die Unterlippe, um nichts Unfreundliches zu erwidern. »Nein, danke.«
Endlich entfernen sich ihre Schritte. Ich lausche ihnen, während ich mich paralysiert im Badezimmer umsehe. Zwischen den mintfarbenen Fliesen, dem Staub auf dem Boden, den etlichen Produkten, die den viel zu kleinen Raum so voll erscheinen lassen. Der Wäschetrockner läuft rumorend. Irgendwie beruhigt mich das Geräusch.
Was soll ich jetzt tun? Wenn das Overkill war, muss ich es jemandem sagen, oder? Bisher gibt es so gut wie keine Augenzeugenberichte und das FBI ist verzweifelt auf der Suche nach diesem Kerl.
Wenn ich nichts sage, bin ich dann nicht mitschuldig am Tod weiterer Menschen?
Andererseits würde ich mich damit selbst zur Zielscheibe machen. Zumal ich auch noch den Fehler gemacht habe, wegzulaufen und nicht am Tatort zu bleiben, wie ein echter Feigling.
Ich fahre mir durch die Haare und schaue zum Ganzkörperspiegel hinüber. Mein eigenes Spiegelbild erschreckt mich, aber ich zwinge mich, hinzusehen, um mich zu erden. Die halblangen, schwarzen Haare kleben an meiner verschwitzten Stirn und unter meinen dunklen Augen zeichnen sich violette Ringe ab. Meine Haut – vom Gesicht bis hin zu den tätowierten Armen, Händen und Fingern – sieht noch blasser aus als sonst. Das habe ich gar nicht für möglich gehalten.
Ich atme durch und sammle endlich genügend Energie, um mich wankend aufzurichten.
Als ich die Spülung bediene und mich dann zum Waschbecken schiebe, um meine Zähne zu putzen, beschließe ich, was ich gesehen habe, für mich zu behalten.
Wahrscheinlich finden sie Overkill bald. Das, was ich beizusteuern habe, würde vermutlich eh nicht weiterhelfen. Jetzt muss ich nur noch versuchen, diese Eindrücke aus meinem Kopf zu bekommen.
Das Geräusch, kurz bevor all das Blut durch die Luft gespritzt ist. Der kopflose Körper, der auf dem Boden aufschlägt. Die vermummten Fremden, die sich ohne Eile von der Leiche entfernen.
Dass ich meinem Vater beibringen muss, dass ich nicht zur Uni gehen werde, kommt mir plötzlich nur noch halb so schlimm vor.
WOHIN ICH VERSCHWINDEN SOLL
Ich sitze am Kopfende des alten Holztisches in unserem kleinen Esszimmer. Mom und Dad haben rechts und links von mir Platz genommen. Die Deckenlampe über uns verbreitet warmes Licht. Vor mir steht eine Keramikschale mit schrumpeligem Obst. Ich halte meinen Blick auf sie gerichtet, während ich mich nach wie vor bemühe, mich zu beruhigen.
Die Angst in mir ist ein wenig abgeflaut, aber mein Körper scheint noch nicht begriffen zu haben, dass ich in Sicherheit bin. Mein Herz schlägt schnell und mir wird abwechselnd heiß und kalt. Ich zittere am ganzen Leib, balle aber die Hände zu Fäusten, um es zu verbergen.
Eigentlich will ich mich nur in meinem Bett verkriechen und nichts mehr tun außer Musik zu hören und zu versuchen, meinen Kopf freizubekommen. Aber um zu erklären, warum ich so durch den Wind bin, musste ich den beiden die Neuigkeit der letzten Absage natürlich sofort überbringen.
Ich kann den Druck, den ihr vorwurfsvolles Schweigen auslöst, nicht ertragen. Das kenne ich gar nicht anders. Aber dieses Mal ist es schlimmer als sonst. Ich brauche sie jetzt. Mehr als jemals zuvor. Ich will, dass mich jemand in den Arm nimmt und mir sagt, dass alles wieder okay wird.
Aber solche Menschen sind sie für mich nicht. Ob ich das will oder nicht.
Also sitze ich nur mit gesenkten Schultern da, während sie überlegen, wie sie auf meine Offenbarung reagieren sollen. Auf die Offenbarung, dass ich ihren Ansprüchen ein weiteres Mal nicht gerecht werden konnte. Dass ich die Enttäuschung bin, für die sie mich immer gehalten haben.
Kaito schaut im Wohnzimmer nebenan Fernsehen. Die Geräusche der Kindersendung sind längst zum Hintergrundrauschen für mich geworden.
Unsere winzige Vierzimmerwohnung befindet sich direkt an der 10th Avenue in Hell’s Kitchen, gleich über einem Friseur für Männer. Als ich jünger war, haben wir in der Nähe des Restaurants gewohnt, das mein Grandpa, der Vater meiner Mutter, betreibt. Doch als ich acht war, gab es einen Wohnungsbrand, und wir sind in ein anderes Viertel gezogen. Vor allem, weil Dad meinen senilen Grandpa verabscheut. Sogar noch ein bisschen mehr als mich.
Die schmalen Fenster, vor denen die Nacht zu sehen und der Verkehr auf der Straße immer zu hören ist, lassen sich nie richtig schließen. Die bunten Teppiche, Möbel und Regale bilden ein Chaos, in dem ich mich als Kind das letzte Mal zu Hause gefühlt habe.
»Tja.« Das erste Wort aus dem Mund meines Vaters. Endlich regt er sich, und als wären sie Magnete, rutscht Mom auch ein wenig auf ihrem Stuhl zurecht. »Hättest du dich in der Schule mehr angestrengt, wären deine Zukunftsaussichten rosiger.«
Er trägt wie immer seinen schwarzen Anzug. Ist er noch nicht dazu gekommen, ihn auszuziehen, oder muss er noch mal in die Kanzlei? Man sieht ihm auf den ersten Blick an, dass er gern einer dieser erfolgreichen Anwälte wäre, die Millionen verdienen. Er will sich wie sie kleiden, aber sein Anzug von der Stange verrät ihn. Entweder hat er kein Glück, oder er ist nicht gut in seinem Job. So genau haben wir uns nie darüber unterhalten.
Sein Traum, dass ich eines Tages in seine Fußstapfen trete, ist jetzt auf jeden Fall ins Wasser gefallen.
»Ich kann die Vergangenheit nicht mehr ändern«, ringe ich mir niedergeschlagen ab. Es ist nicht so, als hätte ich mich nicht angestrengt. Es war nie mein Traum, Anwalt zu werden, aber einen anderen Weg habe ich auch nie gesehen.
»Du bereust es ja gar nicht«, grummelt Dad und lehnt sich zurück. Sein schwarzes Haar ist an einigen Stellen schon grau, obwohl er gar nicht so alt ist. Die Wut, die er ständig mit sich herumträgt, macht ihn vermutlich müde.
»Ich wusste gar nicht, dass du Gedanken lesen kannst.« Ich will mich nicht streiten. Wirklich nicht. Aber wir haben seit Jahren auf keine andere Weise kommuniziert. Es ist, als würde mein Mund die Worte von selbst sprechen.
»Dein Vater hat recht«, sagt Mom sanft und legt mir beruhigend die Hand auf den Oberschenkel. »Du erweckst nicht den Eindruck, als würde dich das stören. Aber wir müssen jetzt wirklich schauen, wie wir weitermachen.«
Ich erwecke nicht den Eindruck? Dann funktionieren meine Bemühungen, nicht zu sehr neben der Spur auszusehen, wohl zu gut.
Ich sehe Mom an und hoffe, dass sie in meinem Gesicht erkennen kann, dass ich ehrlich getroffen von der letzten Absage bin. Wäre es besser, wenn ich weine? Vielleicht sollte ich es versuchen.
Vielleicht verstehen sie mich dann wenigstens.
Die Lippen zu einem schmalen Strich zusammengepresst, lehnt sie sich wieder zurück und schaut meinen Vater an. Sie trägt eine Jeans und den beigefarbenen Cardigan, den sie so liebt. Sie sieht hundert Jahre jünger aus als er, dabei sind sie gleich alt.
»Wir können dich nicht länger aushalten, Toma.« Mein Vater schürzt die Lippen zu einem herablassenden Ausdruck. »Ich hoffe, du hast einen Plan, wie es jetzt mit dir weitergehen soll.«
»Was heißt denn aushalten?«, platzt es aus mir heraus. Die Wut, die an meinen Nervenenden kitzelt, gibt mir die Kraft, mich aus meiner eingesunkenen Position zu lösen und mich aufrechter hinzusetzen. »Ich hab ewig gekellnert und mein eigenes Geld verdient.«
»Aber …«
»Und«, rufe ich, um ihn zu unterbrechen, »ich habe auch Geld auf das Konto eingezahlt, das du für das Studium angelegt hast. Also kannst du kaum davon sprechen, dass ihr mich aushalten müsst!«
Mein Vater streckt die Brust raus und lehnt sich in einer bedrohlichen Geste nach vorn. Er hat mich nie geschlagen, aber er liebt es, es so aussehen zu lassen, als wäre er bereit dazu. »Du bist achtzehn Jahre alt, Toma«, sagt er in düsterem Ton. »Diese Wohnung ist schon lang zu klein für vier Personen.«
»Und was kann ich dafür?«
»Was du dafür kannst?«, fährt er auf. »Selbst wenn du nicht derjenige wärst, der unsere vorherige Wohnung abgefackelt hat! Du …«
»Das habe ich nicht!«, unterbreche ich ihn laut. »Das hat die Feuerwehr bestätigt!«
»Du sitzt an meinem Tisch, isst mein Essen, wohnst in meiner Wohnung! Ich habe dir gesagt, dass wir dich nicht unterstützen werden, wenn du nicht Jura studierst. Das wusstest du von Anfang an.«
Ich gebe mir Mühe, so ausdruckslos wie möglich zu schauen, obwohl ich innerlich koche.
»Und jetzt sitzt du hier, mit deinem arroganten Blick, und verlangst, dass wir dich aus der Scheiße holen. Aber du bist ein erwachsener Mann und kannst anfangen, dich um dich selbst zu kümmern. Und ein bisschen Dankbarkeit zu zeigen für alles, was wir bisher für dich getan haben!«
Ich fahre mir mit der Zunge über die Unterlippe, bevor ich antworte. Dieses Gespräch haben wir schon zu oft geführt. Ich weiß, dass er es nicht versteht. Aber ich werde nicht nachgeben. »Wow«, säusle ich in ironischem Tonfall, ziehe die Augenbrauen zusammen und lege den Kopf schief. »Willst du eine Entschuldigung von mir, dass ich geboren wurde? Wofür soll ich mich bedanken? Dass ich hier aufwachsen durfte? Dass ihr mich als Baby gefüttert habt?«
»Ja, das wäre mal schön!« Sein Gesicht wird etwas röter. »Du weißt gar nicht, wie gut du es hast im Vergleich zu vielen anderen Kindern!«
Dieses scheiß Argument wieder. »Dann sollte ich wohl auch dankbar sein, dass du mich nicht verprügelst. Weil das einige andere Eltern ja machen, was?«
»Schatz«, mischt sich Mom ein, als ich mich ein Stück weiter vorlehne, und legt ihre Hand wieder auf mein Bein. Als wäre ich derjenige, der sich wie ein Idiot verhält.
»Ist doch so!«, fahre ich sie an. Nicht, weil sie mir etwas getan hätte, sondern weil sie verdammt noch mal nie was zu ihm sagt. »Es tut mir leid, dass ich nicht gut genug für euch bin, oder warum auch immer er mich so hasst.«
»Du bist gut genug für uns, Schatz«, flüstert sie.
»Nein!«, fährt Dad weiter auf. »Er muss endlich mal so richtig wegen seines Verhaltens auf die Fresse fallen. Damit er lernt, dass seine Handlungen Konsequenzen haben.«
Wegen meines Verhaltens? Alles, was ich je verbrochen habe, ist, kein Eins-Plus-Schüler gewesen zu sein, wie er es sich gewünscht hätte.
Warum regt mich das alles so wahnsinnig auf? Genau diese Gespräche hatten wir doch schon Millionen Mal. Eigentlich kann ich mich kaum daran erinnern, jemals über etwas anderes mit meinem Vater gesprochen zu haben.
Aber jetzt bin ich auf seine Hilfe angewiesen. Darauf, dass er mich nicht wirklich fallen lässt, so wie er es tausendmal angedroht hat, sondern mir zumindest den verdammten kleinen Finger reicht. Freundliche Worte erwarte ich ja nicht mal.
Aber das bringt alles nichts, also beharre ich auf das Einzige, bei dem ich noch einen Sieg davontragen kann. »Ich will das Geld zurück, das ich auf das Studienkonto eingezahlt habe.«
»Auf keinen Fall.« Mein Vater lehnt sich zurück und verschränkt die Arme vor der Brust, um seine Überlegenheit zu demonstrieren.
Ich fasse es nicht. Nicht mal das will er mir zugestehen? Ist das sein scheiß Ernst? »Das ist mein Geld!«
»Es steht mir genauso zu wie dir. Wie gesagt: Du isst unser Essen. Du wohnst in unserer Wohnung.«
Ich hole tief Luft, um dem Drang zu widerstehen, ihm das faulige Obst an den Kopf zu werfen. »Du willst echt mein Erspartes behalten?« Fassungslos sehe ich zu Mom, dann wieder zu ihm. »Das Geld, das ich über Jahre hinweg verdient habe?«
Er nickt gemächlich. Ich spüre, wie die Hitze vor Wut abermals in meine Wangen steigt.
»Ja. Ich denke nicht, dass du verantwortungsbewusst damit umgehen würdest.«
Ich weiß nicht, was ich machen oder sagen soll. Weder mit Worten, noch mit Gewalt werde ich zu ihm durchdringen können. Verzweiflung mischt sich unter die Wut. »Das sind mehrere tausend Dollar. Ich brauche das, wenn ich mir ’ne Wohnung suchen soll.«
»Dann mach dir mal Gedanken drum.«
»Du bist so ein Arschloch!« Ich erschrecke mich selbst, als das über meine Lippen kommt, obwohl ich es ihm schon so oft sagen wollte. Aber der Ausdruck, der daraufhin auf sein Gesicht tritt, zeigt mir ganz klar, dass das ein Fehler war. Ein Ausdruck so wütend, wie ich es selten gesehen habe. Und ich lehne mich zurück, weil ich befürchte, dass er mir dieses Mal wirklich eine knallt.
»Das reicht!«, schreit er aus voller Kehle. Als er die Hand hebt, zucke ich zusammen, aber er deutet nur auf die Wohnungstür. »Raus hier! Du verschwindest aus meinem Haus und kommst erst zurück, wenn du dein Leben unter Kontrolle hast!«
»Aber …«
»Raus!« Er steht auf und deutet fortwährend auf die Tür.
Unsere Blicke sind für einige Sekunden fest miteinander verhakt, als keiner von uns sich einen Millimeter bewegt. Aber als Mom sich auch dieses Mal entscheidet, sich nicht einzumischen, schiebe ich meinen Stuhl zurück, erhebe mich und trete langsam an ihm vorbei.
Erst als ich den beiden den Rücken zugewandt und meine am Boden liegende Jacke aufgehoben habe, ergreift sie das Wort. »Du kannst ihn nicht auf die Straße schicken, Schatz«, wispert sie. »Du weißt doch, was da draußen los ist.«
»Er kommt schon klar, Liebling«, sagt er sanft wie immer zu ihr.
Ich bin so wütend, dass meine Finger jetzt aus einem anderen Grund zittern als zuvor. »Ich komme ohne dich auf jeden Fall besser klar als mit dir«, sage ich laut. Dann trete ich auf den Flur und schlage die Holztür krachend hinter mir zu.
WER FÜR MICH DA IST
»Und dann hat er dich wirklich rausgeschmissen?« Jay schüttelt schockiert den Kopf und richtet die Sporttasche auf seiner Schulter. Seine hell blondierten Haare sind noch nass von der Dusche und tropfen auf seine dunkle Haut. Er muss rausgerannt sein, ohne sie abzutrocknen, als ich ihm geschrieben hab.
»Ich … kanns auch noch nicht fassen.« Manchmal habe ich darüber nachgedacht, was wohl geschehen würde, wenn es zum Äußersten käme. Aber … »Das hätte ich nicht mal ihm zugetraut.«
»Das ist auch zu krass.«
»Hm.«
Inzwischen ist es kühler geworden. Ich verstehe gar nicht, wie es Jay in der kurzen Trainingshose und dem lockeren Shirt aushält, während ich schon in meiner dünnen Jacke friere. Aber vermutlich ist er noch warm von seinem Training.
Wir stehen vor der hell erleuchteten Trainingshalle, vor der ich auf ihn gewartet habe. Ich hatte keine Ahnung, wohin ich sonst gehen sollte.
»Und du denkst nicht, dass ihr das durch ein Gespräch wieder lösen könnt?« Der zutiefst besorgte Blick, mit dem er mich bedenkt, tut weh. Immer, wenn was mit meinem Dad ist, muss er sich stundenlang mein Gejammer anhören. Ich weiß gar nicht, wie er das erträgt.
Ich ziehe an meiner Zigarette und atme den Rauch kribbelnd ein. Die Straße ist weitgehend leer, aber aus offenen Läden rechts und links dringen Stimmen, Gelächter und Gerüche.
»Ich glaube nicht«, sage ich resigniert. »Es sei denn, ich krieche ihm in den Arsch, aber …« Das habe ich schon so oft getan. Eigentlich immer. Vielleicht hätte ich es wieder getan, wenn ich nicht so vollkommen aus der Bahn geworfen gewesen wäre.
Ich weiß gar nicht, welches Ereignis der letzten zwei Stunden mich mehr aufwühlt. Sie ringen in meinen Erinnerungen um die Vorherrschaft. Die Wut hat sich inzwischen vollends zu Verzweiflung gewandelt.
Und ich fühle mich hier draußen so nackt und unsicher. Beobachtet. Vermutlich ist der Mord schon in allen Medien. Ich habe es nicht gewagt, nachzuschauen. Auch das Foto auf meinem Handy habe ich bisher nicht angesehen. Gerade kann ich mir noch einreden, dass das alles ein Traum war. Nur eine Fantasie meiner gestressten Gedanken. Ich will nicht, dass die ganze Sache durch den einzigen Beweis, den ich habe, real wird.
Während ich gewartet habe, habe ich darüber nachgedacht, ob ich es Jay erzählen soll. Ich erzähle ihm alles, schon seit wir klein sind. Aber er wird darauf bestehen, dass ich zur Polizei gehe. Ohne Widerrede.
»Komm mit«, sagt er schließlich und setzt sich in Richtung U-Bahn in Bewegung. »Wir gehen erst mal zu mir.«
Obwohl ich ein »Danke« über meine Lippen bringe, habe ich nicht das Gefühl, dass es ausreicht. Wenn Jay mich nicht aufnehmen würde, müsste ich wohl wirklich auf der Straße übernachten.
»Ich weiß, das habe ich schon oft gefragt, aber: Sicher, dass der Arsch dein leiblicher Vater ist?« Jay bemüht sich offensichtlich um einen scherzenden Tonfall, für den ich ihm sehr dankbar bin. Daran, dass sein Zweifel an unserer Blutsverwandtschaft berechtigt ist, ändert das aber nichts.
»Ich zweifle manchmal daran.« Im Gehen lege ich den Kopf in den Nacken und sehe in den sternenlosen Himmel hinauf. »Kaito behandelt er nicht so.«
»Kaito ist auch der Vorzeigesohn, den er sich immer gewünscht hat. Weißt du noch, wie er die Polizei rufen wollte, als er uns auf der Feuertreppe beim Rauchen erwischt hat?«
Bei der Erinnerung muss ich lächeln. »Er ist eine alte Seele.«
»Da war er drei!«
Wir lachen und ich bin gleichzeitig amüsiert und fasziniert davon, wie Jay es schafft, für so gute Stimmung zu sorgen. »Übernachtest du noch bei Malik?« Wir haben bisher nur über mich geredet.
»Ja«, sagt er beschwingt. Es hätte mich auch verwundert, wenn es ihn stören würde, noch länger im supermodernen, hochwertig eingerichteten Apartment seines Bruders leben zu müssen. »Jemand muss ja auf Bruce aufpassen, während er nicht da ist.« Er mustert mich von oben bis unten. »Du kannst gern Klamotten von ihm oder mir haben, wenn du was brauchst.«
»Danke«, murmele ich erneut peinlich berührt. Ich hätte wenigstens die Weitsicht haben sollen, eine Tasche zu packen. Aber ich war zu aufgebracht, als ich rausgestürmt bin, um an so was zu denken. »Ich hab nicht vor, lang zu bleiben.«
»Na ja, ich meine …« Er sieht zu mir herüber, als überlege er, ob er seinen nächsten Gedanken aussprechen soll oder nicht.
Ich ziehe die Augenbrauen hoch, um ihn stumm dazu aufzufordern.
»Wahrscheinlich ist es gar nicht schlecht, wenn du erst mal von da weg bist.«
Ich weiß genau, was er meint, aber ich lasse ihn seinen Gedanken trotzdem zu Ende bringen.
»Dein Vater hat dich dein Leben lang kleingehalten. Das ist vielleicht eine Chance, dich endlich von ihm loszumachen.«
»Ich weiß.« Ich weiß es wirklich. Aber ich fühle mich so verloren wie ein ausgesetzter Hund. Hatte er recht und ich war doch immer abhängig von ihm?
»Du musst jetzt erst mal dein Selbstbewusstsein aufbauen«, redet Jay beschwingt weiter. »Das ging einfach nicht, solange du mit diesen toxischen Leuten unter einem Dach gewohnt hast.«
»Du meinst, dass er mich rausgeschmissen hat, ist eher eine Chance statt ein Rückschlag?« Ich stelle seine These nicht infrage. Ob sie richtig ist, wird sich erst herausstellen.
Jay fährt sich durch die blondierten Haare und lacht unangenehm berührt. »Na ja, so simpel ist das sicher nicht. Ich stehe so oder so hinter dir.«
»Danke.« Dieses Wort werde ich heute Abend noch oft sagen. Ich denke nicht, dass es ausreichen wird.
»Hast du eine Idee, was du jetzt machen willst?«
Ich weiß nicht, ob dieser Gedanke zu frisch ist, um ihn auszusprechen, aber im Grunde ist er meine einzige Option. »Ich hab überlegt, ob ich zu Grandpa gehe.«
Er macht große Augen. »Du meinst den mit dem Restaurant?«
»Ja.«
»Der, der gesagt hat, du hättest eure Wohnung mithilfe magischer Essstäbchen abgebrannt?«
Ich verziehe den Mund, als die Erinnerung an die Flammen mich heimsucht. »Das ist mein einziger Verwandter hier.«
»Hast du mit dem überhaupt noch was zu tun?«
»Mein Dad hasst ihn, also nein.« Ich werfe ihm einen vielsagenden Blick zu.
»Gibts jemanden, den dein Dad nicht hasst?«
Ich lache schallend. Anderenfalls müsste ich weinen. »Alle außer mich und Grandpa. Aber ihn hasst er mehr.« Ich wiege den Kopf hin und her. »Er ist auch ein bisschen durchgeknallt. Er hat immer davon geredet, dass wir von so einem shintoistischen Feuergott abstammen. Und er will, dass ich sein Restaurant übernehme, seitdem ich auf der Welt bin.«
»Das wäre ja der Traum!« Jay schließt genießerisch die Augen. »Ich würde jeden Tag dort essen.«
Ich ziehe die Augenbrauen zusammen. Er kann doch viel besser kochen als ich. »Als ob ich irgendeine Voraussetzung erfülle, die es braucht, um ein Restaurant zu führen.« Abgesehen davon, dass ich keine Lust auf den Stress hätte. »Ich würde nur aushelfen, bis ich was Richtiges gefunden habe.« Sofern Grandpa mich überhaupt noch sehen will.
»Du unterschätzt dich«, witzelt er. »Aber im Ernst: Wenn dein Dad euch beide nicht ausstehen kann, passt ihr vielleicht gut zusammen.«
Da hat er recht. »Vielleicht. Er wohnt allein, also hat er eventuell ein Zimmer für mich, bis ich was gefunden habe.« Das klingt optimistischer, als ich bin. Eigentlich kommt es mir schäbig vor, nach so langer Zeit bei ihm anzutanzen und ihn um Hilfe zu bitten. Ich kenne den alten Mann nicht gut genug, um einschätzen zu können, wie er darauf reagieren wird.
»Gute Idee«, sagt Jay allerdings. Er hat deutlich mehr Hoffnung als ich.
»Vielleicht braucht er ja Hilfe im Restaurant«, überlege ich laut. »Zufällig.«
Jay lacht. »Vielleicht bekommt er dich dann auch dazu, wirklich das Restaurant zu übernehmen.«
Ich verziehe amüsiert den Mund. »Auf keinen Fall.«
Die indirekte Beleuchtung, die Jay einschaltet, als wir in die Wohnung seines Bruders eintreten, umfängt mich zusammen mit der Wärme des Appartements. Ich rieche den metallischen Geruch der U-Bahn noch in meiner Kleidung, aber in dem angenehmen Duft nach Gewürzen und Holz hier drin wird der bald verzogen sein.
Während Jay seine Sporttasche auf den Boden knallt und in eins der Schlafzimmer verschwindet, sehe ich mich noch unsicher in der Wohnung um. Ich war erst eine Handvoll Mal hier.
Das Appartement ist nicht groß, aber modern und hochwertig eingerichtet. Die offene Küche grenzt an den Wohnraum, in den ich weiter trete. Die Arbeitsflächen aus Marmor stechen zwischen den offenliegenden Backsteinwänden hervor. Hinter den gemütlichen Möbeln und den handgeknüpften Teppichen wirkt der industrielle Look des Lofts eher ironisch als ehrlich.
»Weißt du, wann Malik endlich wiederkommt?«, rufe ich Jay zu.
Sobald meine Stimme durch die Wohnung hallt, schiebt der ältere Schäferhund seinen Kopf aus einem der Zimmer, um mich interessiert zu mustern.
»Meistens schläft der direkt im Büro«, antwortet Jay. »Die haben da ja sogar Duschen.«
Ich hebe skeptisch die Augenbrauen und halte dem großen Hund meine Hand hin. »Hey, Bruce«, murmele ich lächelnd und er setzt sich endlich in Bewegung, um schwanzwedelnd auf mich zuzukommen. Seine Krallen kratzen über das polierte Parkett. Sobald er bei mir angekommen ist, streiche ich wild durch das struppige Fell. Er umrundet mich aufgeregt, und ich kann das Lächeln nicht zurückhalten.
»Ich schätze, er wird erst in ein paar Tagen mal vorbeischauen«, sagt Jay und tritt aus seinem Zimmer. Er hat sein Trainingsoutfit gegen lockere Alltagskleidung ausgetauscht. »Aber ich denke, das wird so weitergehen, bis sie Overkill endlich schnappen.«
Eine Gänsehaut überzieht meine Arme, als ich den Namen höre. Und plötzlich komme ich mir in dieser Wohnung wie ein Eindringling vor. Ich befinde mich mitten im Reich eines der Menschen, die mit der Suche nach Overkill beschäftigt sind. Ich fühle mich wie ein Verräter, weil ich nichts gesagt habe.
Jetzt ist es zu spät, oder? Ich kenne Jay. Er würde sofort versuchen, mich zu überreden, zur Polizei zu gehen. Und das kann ich nicht. Ich kann nicht zur Polizei, und ich ertrage keine weitere Diskussion an diesem Abend.
Doch obwohl meine Entscheidung getroffen ist, bleibt das schlechte Gewissen.
»Krass«, sage ich, als mir einfällt, dass ich nicht reagiert habe. Irgendwie muss ich das Thema schnell umlenken.
Ich richte mich wieder auf, gehe zu den Sitzgelegenheiten hinüber und lasse mich auf die dunkle, breite Couch fallen. Bruce springt direkt neben mir hoch und schaut zwischen uns beiden hin und her. »Bist du sicher, dass das ein Job ist, den du mal machen willst?«
Jay lacht schallend und reckt die Brust. »Klar. Kannst du dir was Cooleres vorstellen, als beim FBI zu arbeiten?«
»Ja, im Spicy Noodles bei meinem Grandpa zu arbeiten«, antworte ich ironisch, und er grinst vor sich hin. »Gibt’s was Neues zu deiner Bewerbung?« Es interessiert mich wirklich, aber ich will auch Zeit schinden, um das bevorstehende Gespräch mit meinem Grandpa hinauszuzögern.
»In der Abteilung, in der mein Bruder arbeitet, braucht man ja ’ne besondere Ausbildung.« Jay schlendert ein wenig ziellos umher, meidet meinen Blick. »Und man kommt da wohl nur über Umwege rein. Aber er will mir Chancen verschaffen.« Er zuckt mit den Schultern. »Sobald das alles mit Overkill vorbei ist.«
»Klar.« Wieder denke ich an das Foto auf meinem Handy. Wenn Jay jemals herausfindet, was ich gesehen habe – was ich ihm verschwiegen habe – wird er so sauer auf mich sein wie vermutlich nie zuvor.
Mir wird wieder übel.
Jay deutet auf mich, als hätte er mich ertappt. »Ich mach erst mal was zu essen für uns«, sagt er allerdings nur und geht in die Küche, um im Kühlschrank nachzusehen, welche Zutaten er hat.
»Musst du nicht«, sage ich und setze mich aufrechter hin.
»Ich bestehe darauf. Du kennst mich doch.«
Mit schlechtem Gewissen schaue ich zu, wie er Töpfe und Pfannen aus den hellen Küchenschränken heraussucht. Jay liebt Essen so sehr, dass er für mich kocht, wenn es mir nicht gut geht. Das war schon immer so.
Und irgendwie hat es auch immer geholfen.
Mit einem resignierten Geräusch richte ich mich wieder auf und taste nach meinem Handy in der Tasche. »Dann führe ich mal den Anruf, der alles entscheidet.«
»Du packst das«, trällert Jay, schon ganz in seinem Element.
Kurz schaue ich seinen Rücken an. Er ist zu gut und zu fröhlich für mich. Ich muss mich bemühen, weniger düster draufzusein. Ich denke zwar nicht, dass es möglich ist, ihn mit in mein Loch herabzuziehen, aber er hat definitiv einen besseren Freund verdient, als ich es gerade bin.
Bruce schaut irritiert zu mir auf, also bedeute ich ihm in einer beruhigenden Geste, zu bleiben, wo er ist. Dann gehe ich seufzend in das Zimmer, in dem Jay übernachtet, schließe die Tür leise hinter mir und trete zum Fenster hinüber. Die orangefarbenen Lichter der Laternen erhellen die Seitenstraße unter mir. Ich sehe keine Menschen auf den Gehwegen.
Mit nur wenigen Klicks habe ich die Nummer meines Großvaters gefunden. Kurz gleitet mein Blick zu der kleinen Uhr oben links auf dem Display. Schon nach zehn. Hoffentlich wecke ich ihn nicht.
Das erste Freizeichen ertönt, als ich mir das kleine Gerät ans Ohr halte.
»Hallo?« Er hebt so schnell ab, dass ich erschrecke. Ich habe seine Stimme seit Ewigkeiten nicht mehr gehört.
»Hallo Grandpa. Ich bin es, Toma.« Ich spreche leise, weil ich ihn nicht überrumpeln will.
»Toma.« Er atmet aus. »Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass jemand so spät anruft. Geht es dir gut?«
Ich hätte damit rechnen sollen, dass er diese Frage stellt, aber ich bin trotzdem nicht darauf vorbereitet. Falle ich gleich mit der Tür ins Haus, oder rede ich um den heißen Brei herum? Was ist höflicher? »Ähm.« Ich schließe die Augen, weil ich mich so über mich selbst ärgere. »Ehrlich gesagt nicht. Deswegen rufe ich an.«
Schweigen am anderen Ende. Er wartet darauf, dass ich weiterspreche.
»Es tut mir leid, dass ich dich so aus heiterem Himmel anrufe. Aber Dad hat mich aus der Wohnung geschmissen und ich … weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll.«
Noch immer ist es still und ich lausche genauer, weil ich für einen Moment befürchte, er hätte aufgelegt. Doch ich höre ihn leise atmen.
Mein Vater konnte Grandpa nie leiden. Früher war ich noch zu klein, um zu verstehen, warum. Inzwischen ist mir klar, dass das auf Gegenseitigkeit basieren muss.
»Hast du einen Ort, an dem du unterkommen kannst?«
»Ja, ich kann bei einem Freund übernachten.« Ich stelle mir vor, wie er ruhig vor sich hin nickt. Das hat er früher immer gemacht.
»Was ist denn passiert?«
»Ich wurde von allen Universitäten abgelehnt, bei denen ich mich beworben habe. Jetzt sagt er, dass ich mich um mich selbst kümmern soll.« Ein schlechtes Gewissen beschleicht mich, weil es mir falsch vorkommt, meinen Vater in ein solches Licht zu rücken. Dabei ist es doch die Wahrheit.
»Was wolltest du denn studieren, Toma?« Seine Stimme klingt etwas älter, als ich sie in Erinnerung habe. Etwas brüchiger.
»Jura.«
Ein amüsiertes Lachen ist zu hören. Es irritiert mich. »Das klingt aber nicht nach dir«, sagt Grandpa schließlich.
Tatsächlich? Woher will er das wissen? Wir haben uns doch seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. »Ja«, pflichte ich ihm bei. »Ich weiß aber nicht, was ich anderes machen soll.«
»Möchtest du denn gern im Restaurant aushelfen?«
»Ja, ich … Deswegen rufe ich an.« Mein Blick ist nach wie vor nachdenklich aus dem Fenster gerichtet. »Aber ich will dir keine Umstände machen. Ich weiß, dass wir uns lang nicht gesehen haben.«
»Du bist immer mein Enkel, auch wenn wir uns noch länger nicht sehen.« Seine Stimme ist so warm, dass sie mein Herz schwerer werden lässt.
Ich atmete tief ein und blinzle heftig, weil ich es wirklich nicht gebrauchen kann, dass jetzt Tränen hinter meinen Lidern kribbeln. »Danke«, ringe ich mir ab. »Ich würde mich auch so nützlich wie möglich machen, bis ich etwas anderes gefunden habe.«
Wieder dieses kleine Lachen. »Unterstützung kann ich gut gebrauchen. Das Stockwerk über dem Laden ist auch frei. Erinnerst du dich daran? Du kannst dort einziehen, wenn du möchtest.«
»W-was?« Ein Stockwerk über dem Laden? Wusste ich davon? »Das ist wirklich nicht nötig! Es reicht mir auch, wenn …«
»Keine Ausrede, junger Mann.« Dieses Mal lacht Grandpa lauter. »Ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Und wenn ich dir helfen kann.«
Das ist viel zu nett. Viel netter, als ich erwartet habe. War er früher auch schon so? Ich erinnerte mich daran, dass er immer streng und ein wenig schrullig war. Aber er hat mich auch oft vor meinem Vater in Schutz genommen.
Ein warmes Gefühl breitet sich in mir aus. Zusammen mit Scham und Schuld. »Danke«, murmele ich wieder.
»Brauchst du Hilfe mit deinen Sachen?«
»Nein, ich hab nicht viel«, sage ich rasch. Wenn Jay morgen Zeit hat, kann er mir helfen, ein paar Kisten zu packen.
»Ich meine, ob ich dich begleiten soll, falls dein Vater da ist«, stellt er gleich klar.
Das lässt mich schwer schlucken. »Nein, er … er ist sicher bei der Arbeit.« Er ist immer bei der Arbeit. »Aber vielen Dank.«
»Na dann ist ja gut.« Der abfällige Unterton in seiner Stimme dringt sogar durch das Telefon bis zu mir. »Dann komm einfach morgen zum Restaurant. Weißt du noch, wo es ist?«
»Klar.« Ich denke zumindest, dass ich mit Google Maps hinfinden werde. »Ab wann bist du denn da?«
»Ich bin morgens immer Zutaten kaufen. Aber so ab halb sieben werde ich da sein.«
Ich mache große Augen. Wenn er ab halb sieben da ist, was bedeutet für ihn denn dann morgens? Alles davor ist doch Nacht.
»Ich denke, ich werde gegen Mittag kommen.« Dann kann ich vorher noch ein paar Sachen aus meinem Zimmer holen.
»Gut, gut. Ich freu mich schon, dich zu sehen, Junge.«
»Ich freu mich auch. Und danke.«
Als ich auflege, zittern meine Hände wieder, aber dieses Mal aus einem anderen Grund. Dank einer Art von Erleichterung, die ich mir noch nicht ganz erlauben will.
WAS ICH KONTROLLIEREN MUSS
Das Licht von den Straßen dringt kaum bis in den Hinterhof. Ich bin voller Blut. Es sammelt sich auf meinem Gesicht. Der metallische Geschmack auf meinen Lippen ist mir vertraut. Oft kann ich nicht rechtzeitig ausweichen. Eigentlich versuche ich es nicht mal mehr.
Ich bin nass, als hätte es geregnet. Organe und Fleischfetzen sind über den Boden verteilt. Das Licht des Mondes spiegelt sich in der Pfütze, die aus dem Körper dringt. Oder dem, was davon übrig ist.
»Das war ein echter Overkill«, sagt einer meiner Begleiter.
»Ich hatte es nicht unter Kontrolle«, antworte ich tonlos. »Das ist schon der dritte heute.« Eigentlich habe ich genug, aber das sage ich den anderen nicht.
Ich erinnere mich daran, wie übel mir früher geworden ist, wenn ich so etwas getan habe. Das passiert mir jetzt nicht mehr. Ich darf keine Schwäche zeigen. Nicht für einen Moment.
»Eine Schande, dass sie sich uns nicht angeschlossen haben«, sagt ein anderer. »Sie hatten so viel Potenzial.«
Ich weiß nicht, ob das stimmt. Bei dem jungen Mann tat es mir leid. Bei seinem Vater und Großvater nicht so sehr. Er war missgeleitet. Die anderen beiden haben ihr Schicksal selbst bestimmt.
»Sie haben die Wahrheit nicht gesehen«, sagt ein anderer.
»Jetzt sind ihre Augen offen.«
»Gehen wir«, sage ich, bevor sie sich im Philosophieren verlieren. Wir haben keinen Zeitdruck, aber ein unnötiges Risiko sollten wir nicht eingehen.
»Habt ihr den Jungen gesehen, der uns beim zweiten Fall beobachtet hat?«, will einer wissen.
Alle murmeln bestätigend.
»Der wird es nicht wagen zur Polizei zu gehen, nachdem wir den Zeugen vor einigen Wochen getötet haben.«
»Und wenn doch?«
»Müssen wir mit dem Headhunter besprechen«, sage ich. »Der hat uns das letzte Mal schon fast den Kopf abgerissen.«
»Weil der Mord eines Zeugen nicht ins Image passt.«
»Das Image ist Schwachsinn. Wir haben ein eindeutiges Zeichen gesendet.«
»Der Kerl kam mir bekannt vor«, überlege ich laut.
»Der, der uns beobachtet hat?«
»Ja.« Wir wischen unsere Gesichter ab und entfernen uns von der Leiche. »Egal.«
WOHIN ICH FLÜCHTE
»Guten Morgen, New York! Es ist der vierte April und hier sind Janey und Ash von der NYC Fresh Morningshow, für euch wie immer mit den freshesten Hits des Tages!«
»Du klingst wie üblich deutlich fresher als ich, Ash.«
»Ist ja auch früh. Aber ich klinge nur so. Ehrlich gesagt hab ich kaum geschlafen, seitdem die Nachricht gestern Abend kam.«
»Du meinst den Dreifachmord?«
»Genau. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt: Es gibt drei neue Mordfälle aus der letzten Nacht, die dem berüchtigten Serienmörder Overkill zugeordnet werden, der New York schon seit vier Wochen in Angst und Schrecken versetzt.«
»Vor gerade einmal fünf Minuten hat die Polizei auch bestätigt, dass die drei Männer, Elijah, Lucas und Benjamin Jones, miteinander verwandt waren. Es handelte sich um Sohn, Vater und Großvater. Sie wurden in Hells Kitchen, Tribeca und in den Morningside Heights aufgefunden.«
»Das bringt die Zahl der bekannten Opfer nun schon auf sechzig.«
»Ja. Und das ist das erste Mal, dass die Opfer etwas miteinander zu tun hatten. So schrecklich es auch ist: Ich hoffe, dass es dem FBI dadurch endlich gelingt, eine Spur zu finden.«
»Man sollte meinen, dass man im Laufe der Zeit abstumpft, was das angeht. Aber es schockiert mich immer wieder aufs Neue. Sechzig Menschen, die nicht mehr leben. Ich kann es gar nicht fassen.«
»Und es ist ja nicht nur die Anzahl der Opfer. Auch die drastische Brutalität der Morde und dass sowohl Polizei als auch FBI noch immer nicht wissen, wie genau sie verübt werden. Menschen mit explodierten Köpfen. Da wird einem einfach schlecht.«
»Das sehen auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so. Am Anfang haben wir uns gesorgt, dass wir zu viel über dieses Thema berichten. Ihr erinnert euch vielleicht daran. Aber es ist sowieso überall. Und ich halte es für besser, wenn wir einander in dieser Zeit unterstützen.«
»Stimmt. Eine unserer Zuhörerinnen schreibt über die App: Danke, dass ihr schon so früh auf Sendung seid. So fühle ich mich auf dem Weg zur Arbeit wenigstens nicht ganz allein. Sonst würde ich mich gar nicht mehr auf die Straße trauen.«
»Wir freuen uns, dass wir für dich da sein können. Da sind wir gern ab vier im Studio. Es gibt inzwischen aber auch eigens eingerichtete Hotlines, die ihr anrufen könnt, falls ihr nachts allein unterwegs sein müsst. Dort bekommt ihr persönliche Betreuer zugeteilt, die euch über das Telefon auf eurem Weg begleiten. Die Nummern findet ihr auf unserer Website.«
»Ein anderer Zuhörer schreibt über unseren Twitter-Hashtag: Danke für eure intensive Berichterstattung zu Overkill, Ash und Janey. Der Austausch dazu ist so wichtig, sonst verbreiten sich Fehlinformationen zu schnell. Ihr seid genau wie letztes Jahr bei Captain Wodka vollkommen zuverlässig. #machtnichtdieaugenzu Wir hängen da alle drin.«
»Solche Worte tun natürlich gut. Gerade, weil das mit den Fehlinformationen stimmt.«
»Sehe ich auch so. Der Fall ist so mysteriös und aufsehenerregend, dass etliche Leute Theorien anstellen, was oder wer dahinterstecken könnte. Von Kulten bis Magie ist alles dabei. Aber wir müssen uns an die Fakten halten, um so sicher wie möglich zu bleiben.«
»Exakt. Durch sein unübliches Opferspektrum ist Overkill Kriminalisten zufolge einer der gefährlichsten Serienmörder aller Zeiten. Die Opfer stehen in keinem Zusammenhang zueinander und es gibt nichts, was sie gemein haben. Sie sind unterschiedlichen Alters, Geschlechts, jeder Hautfarbe, Herkunft und sozialen Gruppe. Entweder der Mörder sieht eine Verbindung zwischen ihnen, von der wir bisher nichts wissen, oder er macht sich gar keine Gedanken darum, wer sein nächstes Opfer sein soll.«
»Und wo er es findet.«
»Das macht einen müde. Und wir wissen, dass ihr euch da draußen auch so fühlt. Also passt auf euch auf, Leute. Achtet auf die Anweisungen der Behörden und versucht, euch nicht von Verschwörungstheorien und den angeblichen Glaubenssätzen des Killers, die online verbreitet werden, ablenken zu lassen. Gemeinsam halten wir das aus.«
»Genau.«
»Aber wir müssen alle zusammenarbeiten.«
»Und nicht vergessen: Verlasst eure Wohnung nicht, wenn es nicht absolut notwendig ist. Und geht vor allem niemals allein irgendwo hin. Auch nicht aufs Klo in einem Club.«
»Was hältst du eigentlich von den Gerüchten, dass das alles etwas mit Captain Wodka zu tun haben könnte, Ash?«
»Das will und kann ich noch immer nicht glauben. Captain Wodka war vor über einem Jahr das letzte Mal aktiv. Sie hat nie jemanden getötet, und auch wenn ihre Superhelden-Art einen gewissen übernatürlichen Anklang hatte, war das ganz anderer Natur. Oder?«
»Sehe ich auch so, obwohl ich nicht so ein krasses Captain-Fangirl bin wie du. Diesen Januar durften wir sie erst in einem exklusiven Interview zuschalten, in dem sie erklärt hat, dass sie inzwischen mit dem FBI zusammenarbeitet. Also wenn sie etwas tut, dann höchstwahrscheinlich dabei helfen, diesen Killer zu schnappen.«
»Als Captain-Fan will ich mich ganz klar von den Gerüchten distanzieren, dass sie etwas damit zu tun haben soll. In den Zeiten, zu denen sie aktiv war, haben wir sehr viel über sie berichtet und viele positive gesellschaftliche Änderungen dokumentieren können.«
»Obwohl ihre Handlungen bezüglich Selbstjustiz nicht in Ordnung waren.«
»Klar.«
»Aber die Mordserie, die sich derzeit abspielt, mit so etwas zu vergleichen, ist nicht nur leichtsinnig, sondern sogar gefährlich.«
»Also bitte: Informiert euch auf unserer Website.«
»Ruft uns an oder schreibt uns eine Nachricht über die kostenlose NYC Fresh App, wenn ihr noch etwas zu dem Thema zu sagen habt.«
»Wir sind zurzeit extra lang für euch auf Sendung. Immer von vier Uhr morgens bis um zwölf. Also danke, dass ihr so fleißig zuschaltet.«
»Dem schließe ich mich an.«
»Und nun weiter mit unserem freshesten Hit des Tages: Die Purple Dragons mit Burn it all down!«
Im East Village auf der 9th Street, eingepfercht zwischen zwei hohen Wohnblöcken aus Ziegelsteinen, befindet sich das Spicy Noodles. Mit den nur zwei Stockwerken und der hölzernen, mit Glasfenstern versetzten Doppeltür sieht das Restaurant so unauffällig aus, dass Jay und ich fast daran vorbeigelaufen wären. Über der Tür weist ein altes Schild den Namen aus. Die gelben und roten Buchstaben sind kaum mehr zu erkennen.
Auf dem Dach und vor dem Eingang sitzen Krähen. Das Krächzen aus ihren Kehlen klingt wie Gelächter. Obwohl die Frühlingssonne scheint, wirkt dieser Ort alles andere als einladend.
»Sieht klasse aus«, scherzt Jay und schaut vielsagend zu mir herüber. Als würde er mich mit Blicken fragen, ob ich mir sicher bin, dass ich hier einziehen will.
»Besser als nichts.« Eigentlich ist es mir egal. Ich muss nicht auf der Straße schlafen und kann arbeiten. Das ist alles, was zählt. Ich fasse die zwei großen Pappkartons in meinen Händen neu. Jay schafft es irgendwie, doppelt so viel wie ich zu tragen.
In diesen Kisten und den zwei Taschen, die wir dabeihaben, befindet sich alles, was mir etwas bedeutet. Oder was ich gebrauchen kann.
»Bereit für dein neues Leben?«
»Ich schätze schon.«
Wir setzen uns über die mit Autos halb zugestellte Straße in Bewegung, auf den Ort zu, der den Beginn eines neuen Lebensabschnitts für mich darstellt. Zumindest übergangsweise.
Der einzige Grund, warum es mir ein wenig besser geht als gestern, ist vermutlich, dass mein Vater wider Erwarten zu Hause war, als ich meine Sachen geholt habe. Die Entschuldigung, die er erwartet hat, habe ich ihm nicht gegeben. Ich spüre noch immer die Genugtuung über seinen Wutausbruch darüber, dass ich bei Grandpa bleiben werde.
Obwohl mir seine Worte auf dem ganzen Weg hierher durch den Kopf gehallt sind. Irgendwann wird niemand mehr da sein, der dich für dein Versagen auffängt.
Jay bemerkt sofort, dass ich grüble. »Dein Vater ist so krass«, grummelt er mit düsterem Blick. »Er hat nicht davor zurückgeschreckt, dich zur Schnecke zu machen, obwohl ich dabei war. Ich meine, was will er denn von dir? Dass du auf der Straße lebst oder was?«
»Wahrscheinlich würde ihm das gefallen«, sage ich und schaue das Lokal genauer an. Ich habe kaum Erinnerungen daran.
Zwei große Fenster sind rechts und links von der Tür angebracht. Durch sie kann ich in den leeren Innenraum des Restaurants schauen. Obwohl das dunkle Holz an den Rahmen abgeblättert ist, sind sie überraschend sauber.
Neben der Tür ist ein kleiner Aufsteller mit dem derzeitigen Menü zu sehen. Von Regen und Wetter ist das Papier ganz vergilbt und die Schrift kaum zu lesen. Aber die Worte »Tonkotsu-Ramen«, die darüber prangen, sind zumindest zu erkennen.
»Sieht urig aus«, kommentiert Jay erneut, als wir durch die offene Tür in den Gastraum treten. Er trägt heute ausnahmsweise keine Sportkleidung, sondern Jeans und sogar ein Hemd. Ob er sich extra für Grandpa gut angezogen hat? Passen würde es zu ihm.
Einige verschwommene Erinnerungen habe ich an diesen Ort. Sie kommen über mich, als ich eintrete. An die alten Holztische und die ungemütlichen Stühle, auf denen ich als Kind manchmal gesessen und gemalt habe. An den roten Teppich, der noch abgetretener aussieht als vor Jahren.
Es ist höchstens Platz für dreißig Menschen, wenn man großzügig plant. Aber gerade ist niemand hier. Es sieht auch nicht aus, als wäre geöffnet. Das Licht, das durch die Fenster fällt, reicht zwar aus, um den ganzen Innenraum zu fluten, aber ist das Einzige, das den Raum erhellt. Die kleinen Lampen auf den Tischen sind nicht eingeschaltet. Und von Grandpa ist nichts zu sehen.
Wäre ich ein Gast, wäre ich wohl schon wieder gegangen.
Jay und ich bleiben in der Mitte des Gastraums stehen und sehen uns kurz um. An den Wänden hängen Schwarz-Weiß-Bilder von meinem Großvater und etlichen Menschen, die ich nicht kenne. Zwischen ihnen ist die Farbe an vielen Stellen abgesplittert.
Am Ende des länglichen Raums befindet sich ein Tresen mit einer Kasse und einer kleinen Bar dahinter. Wohin die Türen führen, die von dort aus abzweigen, weiß ich nicht mehr.
»Sieht aus wie früher«, murmele ich. Bis auf den Umstand, dass alles etwas älter und heruntergekommener aussieht. Und der Geruch. Dieser spezielle Duft nach den Gewürzen, die Grandpa verwendet, ist wie eine Zeitreise in meine Kindheit. Ich ziehe ihn tief in die Nase, und ein wohliger Schauer überkommt mich.
Gerade, als ich nach ihm rufen will, steckt Grandpa endlich seinen Kopf durch die Tür rechts vor dem Tresen.
»Toma!« Der alte Mann lächelt so breit, dass die Falten um seine Augen tief hervortreten. Sein kurzes Haar ist inzwischen ganz grau geworden. Er ist glattrasiert und einen Kopf kleiner als ich. Vermutlich auch, weil er ein wenig gebückt geht. Obwohl er für sein Alter ungewöhnlich energiegeladen wirkt und sich flink auf uns zu bewegt.
Unter seiner blütenweißen Küchenschürze trägt er ein schwarzes Hemd und eine schwarze Hose. Die Kleidung sitzt so gut, dass sie ihn erstaunlich schnittig aussehen lässt.
»Schön, dich zu sehen, Grandpa.« Ich schaue an den Kisten in meinen Händen vorbei.
»Ach!« Er winkt ab und krempelt die Ärmel hoch. »Du bist doch kein Kind mehr. Nenn mich Shiro.«
Ich schlucke, weil mir die Vorstellung falsch erscheint, aber ich unterdrücke den Drang, ihm zu widersprechen. »Na … na gut. Danke noch mal, dass du mich hier aufnimmst.«
Sein Grinsen wird breiter. Seine Zähne sind so weiß wie seine Schürze. »Wie schon gesagt: Du bist mein Enkel und daran wird sich nie etwas ändern. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich mehr Zeit mit dir verbracht.« Er zuckt mit den Schultern. Seine Bewegungen haben eine Energie, die ihn wirken lässt wie einen viel jüngeren Mann. »Wenn ich dir helfen und gleichzeitig noch deinem Vater eins auswischen kann, ist das so was wie ein Sieg auf ganzer Linie für mich.«
Jay kann ein lautes Lachen nicht zurückhalten, und sogar ich muss lächeln. So schlagfertig hatte ich ihn gar nicht in Erinnerung.
»Jetzt kommt aber erst mal mit, Jungs«, sagt er und wendet sich um. »Ihr müsst hier nicht länger mit den Kisten herumstehen. Ich zeig euch den Weg nach oben. Danach kann ich euch eine kleine Führung durch den Laden geben, wenn ihr wollt.«
»Liebend gern!«, sagt Jay sofort und wir folgen ihm durch den Gastraum. Obwohl Shiro sich links vom Tresen hält, werfe ich einen Blick zu dem Raum, aus dem er gekommen ist. Die Küche. Ein Topf steht auf einem überraschend modernen Herd. Etwas darin muss langsam vor sich hinköcheln. Im Gegensatz zum Rest des Restaurants sieht der Raum klinisch rein aus.
»Arbeitest du hier eigentlich allein?«, will ich wissen.
Shiro richtet seine Schürze und tritt auf eine hölzerne Tür zu. »Ja. Zurzeit kommen nicht so viele Leute, und ich habe das Restaurant immer als Familienbetrieb gesehen. Deswegen möchte ich niemand anderen einstellen.«
Was? Obwohl wir seit zehn Jahren kaum Kontakt zu ihm haben, weigert er sich, jemand anderen als Verwandte einzustellen?
»Ich hatte immer die Hoffnung, dass du eines Tages mal wieder herkommen würdest, Toma.«
Mein Herz setzt einen Schlag aus. Ich kann noch nicht genau sagen, was das Gefühl ist, das mich auf seine Worte hin beschleicht. Vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil ihm seine Familie offenbar so viel bedeutet und ich jahrelang nicht einmal die Anstrengung unternommen habe, den Kontakt zu ihm zu halten. Ein wenig aber auch die Sorge, dass er erwartet, ich würde langfristig hier arbeiten.
Obwohl ich noch nicht weiß, was ich mit meinem Leben anstellen will, ist mir recht klar, dass Koch zu werden kein Traum von mir ist.
Shiro öffnet die Tür direkt vor uns. Sie führt zu einer dunklen Holztreppe. Von dem oberen Raum sehe ich nichts als eine graue, unverkleidete Decke und einige Holzbalken.
Ich denke nicht, dass ich jemals dort oben war, aber ich muss mich zu sehr auf meine Schritte auf den knarzenden Stufen konzentrieren, um darüber nachzudenken. »Sicher, dass ich nicht lieber bei dir auf der Couch schlafen soll?«
»Ach, ein junger Mann braucht sein eigenes Reich.«
Er ist einfach zu nett.
»Gibt’s ’nen Hintereingang?«, will Jay unbeschwert wissen.
»Nein, man muss immer durchs Restaurant.«