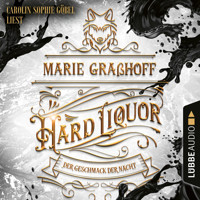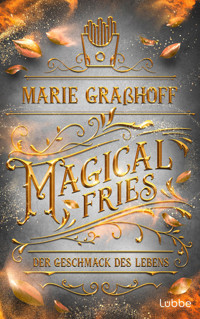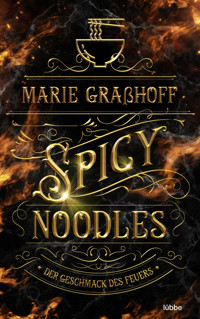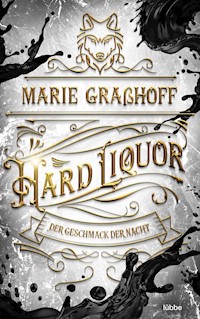12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Chaos Chroniken
- Sprache: Deutsch
»Ich hatte Angst. Aber nicht vor dir.
Ich hatte Angst davor, dass ich wusste, was du getan hast.
Ich hatte Angst davor, dass es mir egal war.«
Mordfälle erschüttern die Hauptstadt Sartins, gefährliche Tierwesen greifen Menschen an. Die 24-jährige Wächterin Rah soll helfen, den mysteriösen Vorfällen ein Ende zu setzen. Denn sie kann Lebewesen von der chaotischen Energie befreien, die sie aggressiv werden lässt. Während ihrer Ermittlungen trifft sie Irin, der sie um Hilfe bei der Aufklärung des Mordes an seinem besten Freund bittet. Doch Rah bemerkt sofort die seltsame Energie, die von Irin ausgeht. Und obwohl sie unsicher ist, ob sie ihm trauen kann, kann sie sich nicht gegen seine Anziehungskraft wehren ...
Währenddessen verzweifelt Shina, Studentin an einer staatlichen Akademie, an der Veränderung ihrer besten Freundin. Seit dem Tod ihrer Mutter verschwindet Mae Nacht für Nacht und taucht mit unerklärlichen Malen auf der Haut wieder auf. Legt Mae dieses Verhalten nicht ab, könnte das für sie beide den Rauswurf bedeuten. Als Shina eines Nachts Maes Geheimnis enthüllt, wird ihr Verständnis von richtig und falsch zerrüttet. Und sie muss sich fragen: Wie weit will sie für ihre Freundin gehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 687
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungINHALTSHINWEIS123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384EpilogENDEDANKSAGUNGÜber dieses Buch
»Ich hatte Angst. Aber nicht vor dir.
Ich hatte Angst davor, dass ich wusste, was du getan hast.
Ich hatte Angst davor, dass es mir egal war.«
Die 24-jährige Wächterin Rah wird in die Hauptstadt Sartins gerufen. Sie soll helfen, den mysteriösen Vorfällen dort ein Ende zu setzen: Gefährliche Tierwesen greifen immer wieder Menschen an. Und Rah besitzt die Fähigkeit, Lebewesen von der chaotischen Energie zu befreien, die sie aggressiv werden lässt. Dabei trifft sie auf den geheimnisvollen Irin. Rah bemerkt sofort die seltsame Energie, die von ihm ausgeht. Und obwohl sie unsicher ist, ob sie ihm trauen soll, kann sie sich nicht gegen seine Anziehungskraft wehren …
Währenddessen verzweifelt Shina, Studentin der staatlichen Akademie, an der Veränderung ihrer besten Freundin. Seit dem Tod ihrer Mutter verschwindet Mae Nacht für Nacht und taucht mit unerklärlichen Malen auf der Haut wieder auf. Legt Mae dieses Verhalten nicht ab, könnte das für sie beide den Rauswurf bedeuten. Als Shina eines Nachts Maes Geheimnis enthüllt, wird ihr Verständnis von richtig und falsch zerrüttet. Und sie muss sich fragen: Wie weit will sie für ihre Freundin gehen?
Eine Welt im Chaos, eine dunkle Prophezeiung - und eine Liebe, die dem Schicksal trotzt
Der Auftakt einer atemberaubenden Fantasy-Dilogie: spannend und unwiderstehlich
Über die Autorin
Marie Graßhoff, geboren 1990 in Halberstadt im Harz, studierte in Mainz Buchwissenschaft und Linguistik. Anschließend arbeitete sie als Social-Media-Managerin bei einer großen Agentur. Mittlerweile ist sie als Autorin und Grafikdesignerin tätig und lebt in Leipzig. Ihre Bücher wurden für mehrere Preise nominiert, u.a. stand sie zweimal auf der Shortlist des Phantastik-Preises SERAPH. Bereits zweimal gewann sie den LOVELYBOOKS LESERPREIS.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Buch wurde vermittelt von derLiteraturagentur erzähl:perspektive, München(www.erzaehlperspektive.de)
Copyright © 2024 by Bastei Lübbe AG,Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für dasText- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Tamara Reisinger (www.tamara-reisinger.de)
Umschlaggestaltung und -motive: © Alexander Kopainski
Kartenillustration Landkarte Innenklappe vorne: Marie Graßhoff
Illustration Innenklappe hinten: Sophie Gießelmann
(www.hamrikaa.carrd.co)
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-6135-2
luebbe.de
lesejury.de
Für OmaWir vermissen dich
INHALTSHINWEIS
Dieses Buch enthält explizite Beschreibungen von physischer Gewalt, Blut und Tod.
Ihr entscheidet selbst, wie ihr damit umgeht. Sind diese Themen für euch besonders emotional aufgeladen, passt auf euch auf.
1
BLUT & SCHLANGE
RAH
Die Wölfe sagten, wenn der Untergang kommt, dann kommt er langsam. Und leise. Wie der Fall des ersten Blattes im Herbst. Wie das Aufgehen des Mondes an einem Frühlingstag.
Ich weiß nicht, warum ich mich daran erinnere, als ich mit meinen fünf Begleitern in das prunkvolle Rathaus trete, das unter der schwarzen Kuppel verborgen liegt. Ihre Schatten verschlingen das Licht. Mein Herz schlägt höher. Es riecht nach Blut und Tod, aber das ist nichts Besonderes.
Und doch liegt etwas Endgültiges in der stickigen Luft. Ein Flüstern des Verfalls. Etwas hieran fühlt sich an wie der Beginn des Endes.
»Sieh in den Spiegel«, wispern die Wölfe in meinem Kopf. »Es manifestiert sich in dir.«
Ich lege die Stirn in Falten und schiebe die Stimmen zusammen mit dem unguten Gefühl von mir. Jetzt ist keine Zeit dafür. »Warum bitten sie uns um Hilfe und lassen uns dann nur durch den Hintereingang rein?« Meine Worte hallen an den marmornen Wänden wider. Das violette Flackern glitzernder Energien ist alles, was uns den Weg erhellt. Es reicht nicht einmal bis ans obere Ende der Säulen um uns herum.
Energieeruptionen weiter im Inneren des Gebäudes lassen die Schatten tanzen und wirbeln meine langen Haare auf. Die weißen Strähnen wehen um mein Gesicht. Die pastellfarben schimmernden Umhänge meiner Begleiter glänzen im Halbdunkel, obwohl sie mit der sonstigen schwarzen Kleidung fast in der Finsternis verschwinden.
»Die Regierung will verschleiern, dass ihre Astrale die Situation nicht unter Kontrolle haben«, flüstert der junge Mann vor mir.
Politisches also. Wie überflüssig.
»Sie müssen verzweifelt sein, wenn sie uns um Hilfe bitten.« Eine meiner Begleiterinnen beschleunigt ihren Schritt und legt die Hand auf meinen Unterarm. »Rah, ich glaube, wir sollten uns nicht einmischen. Caius hat es dir vielleicht noch nicht erzählt, aber die Lage zwischen der Regierung und den Wächtern ist angespannt. Es gibt Bemühungen von oben, unseren Einfluss zu untergraben. Also wenn wir hier unser Leben riskieren …«
»Schon gut«, unterbreche ich sie sanft. Die Spannungen habe ich am Rande mitbekommen, aber die anderen werden nichts tun müssen, was sie nicht wollen. Das sagte ich ihnen schon im Tempel.
Aus der großen Halle vor uns dringt das Echo von Rufen und Schritten, aber noch kann ich nicht sehen, was vor sich geht. In der Luft liegen der verbrannte Geruch von Energie und ein metallischer Geschmack, der sich schwer auf meine Zunge legt.
Mein Blick huscht über die Reliefs an den Wänden, die im flackernden Licht zum Leben zu erwachen scheinen. Über die glänzenden Mosaikfliesen auf dem Boden, die ganze Epochen der Stadtgeschichte darstellen. Blut, dunkel und noch nicht vollständig geronnen, schimmert auf ihnen, verläuft sich zwischen ihren Fugen. Je näher wir der Halle kommen, umso mehr wird es, bis wir den Pfützen nicht mehr ausweichen können. Ich muss das dunkle Kleid hochraffen, damit der Saum nicht befleckt wird. Ein kalter Schauer läuft mir über den Rücken.
Was ist hier passiert?
Die anderen Wächter dürfen nicht sehen, wie sehr mich der Anblick trifft, also zwinge ich mich, aufzuschauen, als die Haupthalle in Sicht kommt. Die verzierten Säulen tragen das Gewicht einer gläsernen Kuppel, die hoch über dem steinernen Saal aufragt. Hinter ihr zeichnet sich das Netz aus dunklen Fäden ab, das die Astrale gewoben haben, um das Rathaus von der Außenwelt abzuschirmen.
In der Dunkelheit sind all die Toten und Verletzten auf dem Boden erst bei näherem Hinsehen zu erkennen. Astrale, Angehörige der Staatspolizei und Zivilisten. Einige stöhnen leise, wimmern. Andere liegen regungslos da, klaffende Wunden im Körper, aus denen Blut und Gedärme dringen. Das diffuse Licht wirft gespenstische Schatten in ihre Gesichter.
Ich schlucke, um die Übelkeit aus meiner Kehle zu vertreiben. Ist die Regierung dieses Landes wirklich zu schwach, um so etwas zu verhindern? Ich darf nicht zulassen, dass zu viel Wut in mir aufkommt, doch es gelingt mir auch nicht, mich von den Menschen zu unseren Füßen abzuwenden.
Erst als die Geräusche des Kampfes zu unserer Linken lauter werden – die Schreie fremder Personen und das Dröhnen von Energiewellen in der Luft –, gelingt es mir, mich aus meiner Starre zu befreien.
Die Drachenschlange ist fast so hoch wie ein Gebäude. Ihr Körper ist lang und geschwungen wie die Äste alter Bäume, die Haut wie Rinde – rau und mit Flechten bedeckt.
Astrale versuchen, sie mit Energie zu halten, deren splitterartige Zacken sich tief in das Fleisch des Wesens bohren. Es wütet und windet sich, was die Fesseln nur tiefer in seine Schuppen und seine Haut treibt. Als es den Kopf nach vorn schnellen lässt, um nach einem der maskierten Männer zu schnappen, kann dieser nur in letzter Sekunde ausweichen.
»Ein Tiergott?«, flüstere ich.
Nein, das ist etwas anderes. Ich spüre es. Dieses Wesen anzusehen ist, wie in einen Wald zu sehen. Tiefes Grün vermischt sich mit erdigem Braun. Von seinem Körper gehen Ranken und Wurzeln aus, anstelle von Flügeln wachsen Blätter und Zweige aus seinem Rücken. Es bewegt sich ruckartig und gleichzeitig mit einer überraschenden Geräuschlosigkeit. Ich vernehme nur das Rascheln von Laub, das Knacken von Ästen und ein tiefes, grollendes Echo wie aus den Tiefen der Erde.
Sein ganzes Gesicht ist voll vom Blut der Menschen, die es umgebracht hat.
»Rah, wir sollten nicht …«, setzt einer meiner Kollegen an, wird jedoch von einem unterdrückten Ruf durchbrochen: »Bei den Königsgöttern, zurück mit euch!«
Wir weichen ein Stück weiter in den Gang zurück, aus dem sich uns zwei Staatspolizisten nähern. Ihre dunklen Uniformen sitzen sauber, aber sie sind voller Blut und Schmutz. Vermutlich waren sie bis eben noch an der Evakuierung beteiligt.
»Was tut ihr hier?«, fährt der Ältere von beiden auf. Die Sterne auf seiner Uniform sprechen von einem hohen Rang, doch seine aufbrausende Art raubt ihm jedwede Autorität.
»Ich habe nach ihnen schicken lassen«, erklärt der Jüngere sofort. Strähnen seines dunklen Haares kleben an seiner schweißüberzogenen Stirn. Er reckt die Brust trotz seines schweren Atems nach vorn. »Die Astrale kommen hier nicht weiter. Sie müssen uns helfen.«
»Du glaubst, Wächter könnten hier etwas ausrichten, wenn Astrale es nicht können?« Der Kopf des Älteren wird ganz rot.
Die Diskussion über solche Nichtigkeiten versetzt mir im Hinblick auf unsere Umgebung einen Stich. »Astrale kennen nichts als Kampf und Gewalt«, unterbreche ich die beiden, bevor sie noch mehr Zeit verschwenden. »Aber das ist nicht die Lösung für jedes Problem.«
Die hellen Augen des jungen Polizisten richten sich sofort auf mich. »Bist du die Wächterin aus Astyria?«
Ich schiebe den Ärmel meines Kleides hoch und zeige ihm das goldene Tattoo auf dem Unterarm. Dicke und dünne Linien, die sich wellenförmig über die helle Haut ziehen. »Ja.«
Der jüngere Polizist bemüht sich weiter um Fassung, während der ältere perplex zwischen uns hin- und herschaut, weil wir ihn übergehen.
»Was ist dieses Geschöpf?«, fragt eine meiner Begleiterinnen, bevor ich es tun kann.
»Wir wissen es nicht. Aber es ist so voll von chaotischer Energie, dass unsere Astrale es nicht läutern können.«
Ich sehe das Wesen noch einmal an, das weiterhin im Kampf mit den maskierten Astralen gefangen ist. So eine gewaltige chaotische Energie wie die, die von ihm ausgeht, habe ich noch nie zuvor gespürt. Wie das Donnern des Krieges. Eine tiefe, alte Macht, fast wie die eines Gestirns. »Hat es etwas Bestimmtes angegriffen?«, frage ich, während ich alle Möglichkeiten im Kopf durchgehe.
»Eine Statue in der Eingangshalle«, knickt der Ältere ein wenig ein. Die Astrale werden das Wesen nicht mehr lange halten können, er bemerkt das genauso wie wir. »E-eine von den sieben Gründern des Landes.«
Wie seltsam. Ich kann mir keinen Reim darauf machen – doch das spielt eigentlich keine Rolle. Wenn sie selbst nicht wissen, was es ist, werde ich es jetzt auch nicht mehr herausfinden. Ich löse mich also aus meiner Starre und streife mir die Schuhe ab.
Der jüngere Polizist wendet sich ab, während meine Kolleginnen mir dabei helfen, mich des Stoffs an meinem Körper zu entledigen. »Ist … ist das wirklich nötig?«, fragt er. Seine Wangen werden ein wenig röter, obwohl er in eine ganz andere Richtung schaut.
»Bei einem so mächtigen Wesen, ja«, antworte ich ruhig. »Meine Kleidung und mein Schmuck sind mit chaotischer Energie aufgeladen.« Ich nehme all die silbernen und goldenen Ketten ab, während eine andere Wächterin den Verschluss meines Kleides öffnet. Für Rituale tun wir das oft, also sind die Bewegungen fast einstudiert. »Wir tragen sie, um sie zu läutern, aber sie schränken harmonische Energie ein.« Hätten wir mehr Zeit gehabt, hätte ich mir etwas anderes angezogen.
»Bitte sei vorsichtig, Rah«, sagt eine meiner Begleiterinnen. Die tiefe Falte zwischen ihren Brauen zeugt von Sorge und Zweifeln. Sie und die anderen sind mitgekommen, um mich zu unterstützen, aber vermutlich spüren sie genauso wie ich, dass dieses Wesen zu stark für sie ist.
Für mich vielleicht auch.
»Mache ich«, flüstere ich, streife die letzten Kleidungsstücke ab und trete, nur gehüllt in meine weißen Haare, in die Haupthalle ein. Ich höre, wie die Polizisten meinen Kollegen weitere Fragen stellen, fahre mir allerdings mit der Zunge über die Lippen und konzentriere mich auf die Schlange.
Im schummrigen Licht der Halle sehe ich den Weg vor mir kaum. Unter meinen Füßen spüre ich Blut, kleine Trümmerstücke und Scherben.
»Bleib zurück!«, ruft mir einer der Astrale zu. In der dunklen Uniform sollen sie bedrohlich wirken, doch ihre Fähigkeiten untermauern das nicht gerade. Sie kennen nur Kampf und Gewalt, Angriff und Verteidigung. Damit werden sie hier nicht weit kommen.
Spüren sie die Energie dieses Geschöpfs überhaupt? Sie wird mit jedem Schritt, mit dem ich mich ihm nähere, gewalttätiger. Hungriger.
Mein Herz schlägt höher, aber ich bemühe mich, es im Zaum zu halten. Keine Aufregung. Keine Angst. Es darf kein Chaos in mir geben, obwohl ich davon umgeben bin. »Lasst es los und geht nach hinten weg«, sage ich, ohne die Astrale anzusehen.
Das Wesen hält in seinen Bewegungen inne, als es mich bemerkt. Seine Iriden haben das tiefe Leuchten von Kristallen.
Die Astrale zögern kurz, dann lösen sie die Energie auf und stürzen nach hinten. Gleichzeitig hebe ich meine Hand, und sofort senkt die Drachenschlange mir ihren Kopf entgegen. Blut tropft von ihrem Maul auf meine Finger. Ihr heißer Atem hüllt meinen Körper ein. Er riecht nach Moos und feuchter Erde.
Vorsichtig lege ich die Hand auf ihre Nase und schließe die Augen.
Ruhe.
Es muss vollkommen still in mir sein.
Nur ein reiner Geist kann einen anderen reinigen.
Ich atme ein und denke an einen weißen Tempel nahe einem großen Wald. Das Gras der Wiesenflächen kitzelt an meinen nackten Knöcheln. Die Sonne geht über den nebelverhangenen Landen auf. Ich denke an den Geruch von Tee. An das Klingen von Windspielen. Und gemeinsam mit meiner Atmung beruhigt sich auch mein Herz.
Das Wesen regt sich ein wenig, und die Farben der Bilder in meinem Geist verblassen. Der Wald um den Tempel verdunkelt sich, Schatten kriechen durch das hohe Gras. Dunkelheit nähert sich von den Seiten, und auf einen Schlag spüre ich nichts als Hunger. Hunger, so tief, dass es schmerzt.
Der Tempel erodiert, als würden Jahrhunderte in Sekunden vergehen. Ich sehe dunkle Könige auf schwarzen Pferden vor einem blutroten Nachthimmel. Ein Wüstenschlachtfeld, getränkt in goldenes Blut. Ein Loch im Himmel, das die Wolken verschlingt, bis keine mehr übrig sind.
Mein Gleichgewicht gerät ins Wanken, sowohl psychisch als auch physisch. Die Erde bebt unter meinen Füßen, ich öffne die Augen, stolpere zurück und falle fast, als die Schlange die Verbindung löst und mit dem Kopf herumruckt.
Schreie erfüllen die Halle. Das Geschöpf greift mich nicht an, aber Trümmer schießen durch die Luft, als es zu den Astralen herumwirbelt und dabei eine der Säulen rammt. Ich weiche weiter zurück und reiße die Arme hoch, um mein Gesicht zu schützen.
Die Mosaikfliesen zersplittern unter den Trümmern zu einem Meer aus Scherben. Der verzweifelte Versuch der Astrale, das Wesen wieder zu bändigen, wird im Keim erstickt, als ein Teil der Decke herabbricht und einige von ihnen unter sich begräbt.
Mein Herz hämmert gegen meine Brust. Ich kann in letzter Sekunde ausweichen, aber scharfe Steinstücke treffen mich an mehreren Stellen. Der Staub in meiner Lunge macht das Atmen schwer, also presse ich die Hand auf meine Lippen, um nicht noch mehr einzuatmen. Ein Teil von mir will fliehen, ein anderer, tieferer weiß allerdings, dass das keine Option ist. Diese Männer und Frauen haben keine Chance. Und ich weiß nicht, wer außer mir überhaupt eine hätte.
Ich weiß nicht einmal, ob ich eine hab. Diese Visionen, die meinen Geist geflutet haben, als ich das Wesen läutern wollte … was war das? Sie waren so intensiv, dass sie meine Konzentration unterbrochen haben.
So oder so: Ich muss es noch einmal versuchen, also zwinge ich mich, klar zu denken und die Schmerzen auszublenden. Ich muss mich neu ausrichten. Während ich die Drachenschlange fixiere und langsam durch die Trümmer und den Schutt auf sie zutrete, verschwimmen die Schreie um mich herum im Hintergrund. Tief in mir krieche ich zurück in den weißen Tempel, zu den Windspielen, zu der Ruhe.
Ich bin die Einzige, die auf das Wesen zugeht, während alle anderen vor ihm zurückweichen. Die Luft um mich herum vibriert unter seinen ruckartigen Bewegungen. Ich muss immer wieder zur Seite springen, um nicht von ihnen getroffen oder von einem Windstoß von den Beinen gefegt zu werden, als würde ich mich durch einen Sturm vorankämpfen.
Die Drachenschlange fährt herum, als ein weiterer Astral mit seinem Artefakt splittrige Fesseln erschafft und sie ihr um den Hals schlingt. Die Schlange stößt einen Schrei aus, hält allerdings einen Moment inne. Lange genug für mich, einen Satz nach vorn zu machen und eine Hand an ihre Seite zu legen. Die Schlange ruckt mit dem Kopf herum, und ich hebe die andere Hand, um erneut ihre Nase zu berühren.
Noch bevor ich die Augen geschlossen habe, kehren die Bilder zurück, die mich von oben bis unten tränken.
Eine sterbende Eule in einem Bett aus blutigen Federn.
Ein riesiger Mond, der über einer toten Welt aufgeht.
Meere aus Feuer.
Ich spüre ihre Hitze auf meiner Haut, doch ich schiebe sie weg. Überlagere sie mit Stille.
Ruhe.
Tau auf einem frischen Blatt in einem ruhigen Wald.
Das Rauschen des Meeres an einem menschenleeren Strand.
Das Plätschern einer Bergquelle in einem Tal.
Und unter meiner Berührung wird das Wesen allmählich ruhiger. Seine Bewegungen verlangsamen sich. Die warme, raue Haut verändert sich, gibt immer weiter unter meinen Fingern nach.
Ich fühle, wie der massive Körper schrumpft, wie das aufgeregte Pulsieren der Haut nachlässt. Ich gehe neben dem Geschöpf in die Hocke, während es kleiner und kleiner wird.
Als ich die Augen wieder öffne, hat es sich zu einer gewöhnlichen Schlange zurückentwickelt, die sich orientierungslos durch das Chaos windet. Aufatmend sinke ich auf die Knie, mitten in eine Lache aus Blut und Trümmern. Mein Blick schweift über die Zerstörung um mich herum, während der Staub sich legt und die Astrale und Wächter auf uns zueilen. Über all die Verletzten und Toten hinweg.
Wenn ich nur ein wenig früher gekommen wäre.
Mit zittrigen Händen wische ich mir über das Gesicht.
Ich verstehe es nicht.
Was waren diese Visionen? Diese Bilder, die ich gesehen habe, als ich sie berührte? Hin und wieder liegen verschwommene Eindrücke in den Energien von chaotisch aufgeladenen Lebewesen, aber so etwas Intensives habe ich noch nie in einem von ihnen gespürt. Das Echo der Zerstörung und des Hungers hallt noch immer in mir wider, lässt meinen Schädel dröhnen und meine Glieder beben.
»Vorsicht!«, ruft einer der Astrale und schreitet eilig auf die Schlange zu.
Ich realisiere zu spät, was er vorhat, und bevor ich etwas sagen kann, hat er sie mit einem Tritt seines Stiefels getötet. »Sie war keine Gefahr mehr«, keuche ich, schaffe es aber noch nicht, mich aufzurichten.
Der Astral wendet sich mir zu. Bis auf seine dunklen Augen ist hinter der schmucklosen schwarzen Maske nichts zu erkennen. »Kein Risiko eingehen«, grollt er, dann entfernt er sich, um seinen Kollegen und Kolleginnen zu Hilfe zu eilen.
Die Barriere um das Rathaus wird gelöst, und auf einen Schlag fällt das Licht des frühen Morgens durch die Glaskuppel in den zerstörten Raum. Der rote und rosafarbene Schein, in den die Wolken getaucht sind, offenbart viel zu viel Chaos und Tod.
»Rah.« Mir wird ein Mantel um die Schultern gelegt, als ich noch gegen das zu helle Licht anblinzle. Der schwere Stoff fühlt sich unangenehm rau auf meiner heißen Haut an. Die junge Wächterin berührt mich sacht am Oberarm, als sie sich neben mich hockt. »Geht es dir gut?«, will sie mit sanfter Stimme wissen.
Ich nicke abwesend, obwohl ich nicht weiß, ob es wahr ist. »Ich brauch nur kurz.« Ich muss mich noch immer darauf konzentrieren, ruhig zu atmen, um nicht doch noch von den Bildern überwältigt zu werden. Nicht nur von denen in meinem Inneren, sondern auch von denen um mich herum.
Astrale und Polizisten setzen sich in Bewegung, um sich um die Verletzten zu kümmern. Die anderen Wächter ziehen mich auf die Beine und helfen mir dabei, mich wieder anzuziehen.
»Du bist verletzt«, stellt einer von ihnen fest.
»Geht schon«, murmele ich. Die Schicht von Staub, die sich auf meine Haut gelegt hat, reibt unangenehm bei jeder Bewegung. »Ich werde mich im Tempel darum kümmern.« Jetzt will ich nur noch so schnell wie möglich von hier weg, um in Ruhe darüber nachdenken zu können, was gerade passiert ist. Was ich gesehen habe.
Ich habe schon etliche chaotisch aufgeladene Tiere und Menschen getroffen und geläutert – doch nicht so etwas. So viel chaotische Energie kann sich nicht einfach so anstauen.
»Das war beeindruckend«, sagt die junge Wächterin mit dem weichen Gesicht. Ich verziehe die Lippen zu einem Lächeln, obwohl ich spüre, dass es schwach ist.
Erst nachdem ich meine Kleidung vollständig angelegt habe, nähern sich uns die beiden Staatspolizisten wieder.
»Was hat mit diesem Ding nicht gestimmt?«, fragt der Ältere aufbrausend.
Er macht einen zu aggressiven Eindruck. Dafür bin ich jetzt noch nicht bereit, also schaue ich auf meine blutbenetzten Finger hinab. »Ich weiß es nicht.«
»An den Stadtmauern gab es keine Meldung eines Durchbruchs«, sagt der Jüngere offenbar um Beherrschung ringend. »Man hätte es nie durch die Tore gelassen. Es muss also hier geboren sein.«
»Von wegen«, grollt der Ältere. »Solche Dinge werden nicht in unserer Hauptstadt geboren. In der Kalten Stadt vielleicht oder in den Sümpfen des Südens, aber nicht hier.«
»Aber wir haben doch …«
»Einen Unfall mit dem göttlichen Gegenstand haben wir bereits ausgeschlossen, also …«
»Ruhe«, unterbreche ich sie leise – und sofort verstummen beide. Ich muss nachdenken. »War das ein isolierter Vorfall?« Die Bilder, die ich in der Energie des Wesens gesehen habe, waren nicht aus dieser Stadt. Also müssen entweder dieses Geschöpf oder die Energie von einem anderen Ort stammen.
»Nein«, antwortet der Jüngere sofort. »Es gab in den letzten Wochen mehrere Angriffe dieser Art.«
»Alle von solchen Tierwesen?«
»Ja.«
»Waren sie alle so unkontrollierbar?«
»Nicht in dem Ausmaß. Die vorherigen Anomalien konnten wir töten. Oder die Astrale konnten ihnen die chaotische Energie entziehen.«
Was hat das zu bedeuten? Der Ältere hat recht; Wesen, die so viel chaotische Energie in sich haben, gibt es in den Wilden Landen, aber nicht in den Städten.
»Und es kann definitiv nicht durch die Mauern in die Stadt gekommen sein?«
»Sartins Hauptstadt hat die besten Mauern ganz Qayas«, grollt der ältere Staatspolizist und reckt die Brust nach vorn. »Sie wurden in den letzten Jahrzehnten weiter ausgebaut. Nichts kommt ungesehen herein oder hinaus.«
Wie überaus seltsam.
Jemand ruft die beiden durch die Halle um Hilfe, und sie wenden sich um.
»Wir helfen jederzeit. Auch bei den Ermittlungen«, sage ich rasch, bevor sie gehen. Das ist nicht nur Freundlichkeit – sie haben es eindeutig ohne uns nicht unter Kontrolle. Und ich will auch wissen, was dahintersteckt. »Irgendetwas stimmt nicht. Wir sollten schnellstmöglich herausfinden, was.«
Einige der anderen Wächter nicken energisch, während Sanitäter in die Halle strömen, um die Verletzten zu stabilisieren und die Toten aus dem Raum zu schaffen.
»Das nächste Mal können wir vielleicht mehr Leben retten«, sagt einer der Wächter.
Der ältere Polizist schnaubt verächtlich. »Keine Sorge, das übernehmen die Astrale.«
Verwundert lege ich die Stirn in Falten und mustere die beiden Männer abwechselnd. Fällt ihm die Ironie an seinen Worten nicht auf? »Genauso, wie sie es hier übernommen haben?« Es noch immer damit zu rechtfertigen, dass sie uns aus politischen Gründen nicht um Hilfe fragen, ist an diesem Punkt mehr als leichtsinnig. Wie schlimm können die Spannungen zwischen der Regierung Sartins und den Wächtern denn sein, wenn selbst so offensichtliche Zeichen ignoriert werden, dass eine Zusammenarbeit sinnvoll wäre? Ich verstehe es nicht.
Der jüngere Polizist senkt beschämt den Kopf, sieht allerdings auf eine Weise zu mir auf, die ich nicht ganz deuten kann. Vielleicht kann ich darauf hoffen, dass er sich noch mal bei mir meldet. »Vielen Dank für die Hilfe«, sagt er und tritt einige Schritte zurück.
»Gern«, murmele ich.
»Und ihr solltet die Sicherheitsvorkehrungen für das Stadtfest erhöhen«, fügt eine meiner Begleiterinnen an.
»In Ordnung«, erwidert er sofort, bevor sein Kollege etwas entgegnen kann. Dann wenden sie sich ab.
Ich betrachte die Rücken der beiden, bis sie in einen Gang einbiegen, dann gleitet mein Blick wieder durch die Halle. Er bleibt an der toten Schlange hängen, als eine Wächterin mir ihre Hand auf den Oberarm legt, um mich zum Gehen zu bewegen.
Die Stimme in meinem Kopf ist zurück. »Das ist nur der Anfang«, flüstert sie.
2
UNIFORM & TÜREN
SHINA
»Neuigkeiten aus der Hauptstadt: Bei einem unerwarteten Vorfall wurde heute Morgen das zentrale Rathaus von einem unbekannten Energiewesen angegriffen. Astralen vor Ort ist es erfolgreich gelungen, das Wesen zu bändigen. Trotz der heldenhaften Anstrengungen der Sicherheitskräfte gibt es bedauerlicherweise Verletzte und Tote zu beklagen.
Die Regierung ruft die Bewohner dazu auf, Ruhe zu bewahren und sich von dem betroffenen Gebiet fernzuhalten, während die Rettungs- und Bergungsarbeiten fortgesetzt werden.«
Ich presse die Zähne aufeinander und starre das alte Radio an, aus dem knisternd die Stimme des Sprechers dringt. Ob meine Eltern in diesen Angriff mit hineingezogen wurden? Diese Angriffe von Energiewesen häufen sich in letzter Zeit, und in ihrer Position werden sie früher oder später auch gegen eins dieser Monster antreten müssen, über die sie mir nichts Genaueres erzählen wollen.
Mein Blick gleitet zu dem schwarz-weißen Foto auf dem Schreibtisch, an dem ich sitze. Darauf tragen beide ihre Uniform so stolz, wie man es sich nur vorstellen kann. Sie schauen streng. Ich kenne sie nicht anders. Doch bei dem Gedanken, ihnen könnte etwas zugestoßen sein, dreht sich mir der Magen um.
Wenn sie in einem Kampf verletzt worden wären, hätte man mich sicherlich benachrichtigt, aber … da ist trotzdem so eine Schwere auf meiner Brust, gegen die ich anatmen muss. Ich werde sie heute nach den Kursen besuchen. Nur, um sicherzugehen.
Ich drehe das Radio aus und reibe unsicher die Finger aneinander, während ich mich umsehe. Das tiefrote Morgenlicht, das durch die hohen Fenster einfällt und auf den grauen Wänden tanzt, tut meinen angespannten Nerven gut. Und obwohl mein Bett mit dem Stahlrahmen, der dünnen Matratze und grauen Bettwäsche nicht sonderlich einladend aussieht, freue ich mich jetzt schon darauf, mich heute Abend hineinzulegen.
Die Einführungsveranstaltung in das dritte Semester beginnt gleich. Ich hab die ganze Nacht gelernt und trainiert, obwohl in den heutigen Kursen vermutlich noch nichts Wichtiges abgefragt wird. Aber am ersten Tag des neuen Semesters will ich mich nicht blamieren, falls doch. Ich kann nicht.
Ob es Mae inzwischen besser geht? Wir haben uns während der freien Zeit und der Praktika zwischen den Semestern kaum gesehen. Und zwar nicht, weil ich mich nicht genügend bemüht hätte.
Gedankenverloren beginne ich, all die Notizbücher auf meinem Schreibtisch zu ordnen, die Bücher über Astraltheorie und chaotische Energien einzusammeln und sie in eins der überfüllten Regale an der gegenüberliegenden Wand zu stellen. Ich stelle sie zurück vor die Preise, die ich immer verstecke, bevor jemand mein Zimmer betritt. Ich will nicht noch mehr als Streberin bekannt werden als ohnehin schon. Ich habe sie nur mitgenommen, weil meine Eltern darauf bestanden haben.
Gerade als ich mein Lederetui in die Tasche packe, erklingt der tiefe Gong der Glocke von den Fluren aus.
Mein Herz macht einen aufgeregten Sprung.
Rasch greife ich nach meiner Ausrüstung, die schon neben dem Schreibtisch bereitliegt. Sie anzulegen ist inzwischen zu einem Ritual für mich geworden. Jede Bewegung ist einstudiert.
Der Hauptteil der Uniform besteht aus robustem Stoff, der jede Bewegung mitmacht, ohne einzuengen. Lederbesätze an Ellbogen und Knien schützen kritische Bereiche. Die Farben spiegeln die von Sartin wider: ein tiefes Schwarz mit goldenen Akzenten. Jeder Astral trägt das Staatsemblem auf der linken Brust – und an meiner Schulter prangt seit heute der zweite Stern.
Ich nehme mein Artefakt vom Tisch und schiebe den schwarzblauen Stein, in dem schwache Sterne glitzern, in meine Tasche. Ich habe ihn am Tag meiner Aufnahme an der Astralweber-Akademie von meinen Eltern geschenkt bekommen. Sein Gewicht gibt mir Sicherheit.
An meinem Gürtel befestige ich ein Messer, dann werfe ich mir den abnehmbaren Umhang über die Schultern. Der schwarze Stoff geht im Saum in ein dunkles Rot über. Die Farbe meiner Augen. Ich habe sie von meiner Mutter, obwohl ich sonst eher aussehe wie Vater. Die dunkle Haut und die dunklen Haare habe ich von beiden.
Die Gestaltung der Uniformen wurde vor ein paar Jahren geändert, weil sie wegen der Umstrukturierung des Landes aggressiver aussehen sollten. Erhabener. Den Krieg habe ich zwar nicht erlebt, aber er hat Sartin so destabilisiert, dass die Nachwirkungen noch immer spürbar sind. Die Regierung versucht alles, um nach innen und außen so sicher wie möglich aufzutreten, und ich werde mein Bestes geben, dazu beizutragen. Ich wünschte nur, ich würde mich auch wirklich so autoritär fühlen, wie diese Uniform mich aussehen lässt.
Doch wenn ich daran denke, Mae gleich wiederzusehen, schlägt mein Herz etwas höher – und zwar alles andere als selbstbewusst.
Ich ziehe die vielen dicken Zöpfe unter dem Umhang hervor, dann werfe ich einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel und verlasse eilig mein Zimmer.
Die Schritte meiner Stiefel hallen an den dunklen Steinwänden des Korridors wider. Die Studierenden der anderen Semester finden sich erst im Laufe des Tages ein, deswegen ist es noch ruhig.
Durch die offenen Fenster weht die morgendliche Frühlingsbrise herein und fängt sich in meinem Umhang. Am Ende des Ganges prangt das staatliche Emblem, dem man in diesem Gebäude nicht entkommen kann: drei goldene Tauben vor einer schwarzen Sonne.
Bei meinen Eltern im Haus hängt es auch überall. Es fühlt sich fast heimisch an.
Mit festem Schritt steuere ich auf Maes Zimmertür zu und klopfe an das dunkle Holz. Diese Bewegung ist ein weiteres Ritual für mich, obwohl es in den letzten Wochen des zweiten Semesters etwas schwerer geworden ist. Ich weiß nicht mal, ob es daran liegt, dass sie niemanden um sich haben will, oder daran, dass ich nicht gut genug bin, aber was früher die erste Freude jedes Tages war, beschert mir inzwischen ein unangenehmes Kribbeln in den Fingerspitzen.
Nach einigen Sekunden klopfe ich noch einmal. Ist sie noch nicht von ihrer Verabredung gestern Abend zurückgekommen? Nicht dass sie mit mir drüber gesprochen hätte, aber ich habe sie abends über den Innenhof gehen sehen. Oder schläft sie noch? Ihr ist nichts zugestoßen, oder? Nein, sie ist stark, sie kommt schon klar. Doch … Gerade als ich überlege, mich mit ihrem Ersatzschlüssel reinzulassen, um sie eventuell zu wecken, vernehme ich Stimmen und Schritte aus einem Nebengang.
Kurz darauf treten einige meiner Mitstudierenden um die Ecke. Ihre Gesichter hellen sich auf, als sie mich sehen und auf mich zukommen.
Verdammt. Ich kann mir gerade so ein Lächeln abringen, aber gelegen kommen sie mir nicht.
»Shina!« Jaros helle Augen funkeln unternehmungslustig, als er sich rasch die dunkelblonden Haare richtet. Dunkle Ringe zeichnen sich auf seiner hellen Haut ab. Im Gegensatz zu mir sicherlich nicht, weil er die ganze Nacht gelernt hat. »Guten Morgen.«
Erin und Lin, die bis eben noch in ein Gespräch über die neuen Anleiter vertieft waren, lächeln mir ebenfalls zur Begrüßung zu.
»Morgen«, erwidere ich und versuche zu verbergen, wie besorgt ich bin. Die drei sind ganz nett, sie interessieren sich allerdings vorrangig für mich, weil sie wissen, wer meine Eltern sind – und weil ihre Eltern ebenfalls irgendeinen politischen Einfluss haben. Ich gebe mich erst seit Ende letzten Semesters mit ihnen ab, weil ich nicht allein sein will. Meine Sorge um Mae verstehen sie nicht.
Und vielleicht haben sie sogar recht damit, immerhin wirkt sie alles andere als begeistert von meinen Versuchen, sie zu unterstützen. Aber wir waren immer füreinander da, das kann ich jetzt nicht einfach ändern.
»Habt ihr Mae gesehen?«, ringe ich mir also ab.
Lin hebt überrascht die Brauen. »Seit letztem Semester schon nicht mehr.« Sie hat ihr rotes Haar zu einem strengen Dutt gebunden. Er lässt sie diszipliniert und einschüchternd aussehen, dabei hat sie so einen freundlichen Charakter. »Hat sie wieder nicht auf dich gewartet?«
»Ich mach mir eher Sorgen, dass sie noch schläft.«
»Seid ihr denn verabredet?«, will Jaro wissen und stemmt die Hände in die Hüften. Er kennt die Antwort vermutlich schon.
Ertappt schlucke ich, dann schüttle ich den Kopf. »Nein, ich … ich hab sie auch in den Semesterferien nicht gesehen.«
»Na, siehst du.« Jaro kommt näher und legt seinen Arm um meine Schultern, um mich von Maes Tür wegzudrehen und sich zusammen mit mir durch den Gang in Bewegung zu setzen. »Wahrscheinlich ist sie schon auf dem Platz. Hör auf, dir solche Sorgen um sie zu machen, sie will das offensichtlich nicht.« Ich lasse mich von ihm mitziehen, weil ein zu großer Teil von mir befürchtet, dass er recht hat. »Mae ist komisch drauf, seitdem ihre Mutter gestorben ist, das ist nichts, in das du dich noch einmischen kannst.«
Seine Worte treffen mich härter als erwartet, dabei spricht er nur aus, was ich insgeheim befürchte. Kann ich wirklich nichts mehr tun, um ihr zu helfen? Habe ich alles versucht, was in meiner Macht steht? Muss ich mich damit abfinden, dass unsere Freundschaft vielleicht vorbei ist, weil ich es nicht geschafft habe, für sie da zu sein?
Nein, das kann ich nicht.
Ich presse die Lippen aufeinander und sage nichts, um keine Diskussion vom Zaun zu brechen. Das muss ich mit meinen Eltern schon oft genug tun, wenn es um Mae geht. Stattdessen löse ich mich von Jaro und werfe noch einen Blick zur Tür zurück. Ein Teil von mir hofft, dass Mae sie doch noch verschlafen öffnet. Dass sie mich sieht und ihr Gesicht sich aufhellt – wie früher immer. Manchmal träume ich davon; von ihrem Lächeln.
Aber nichts regt sich, also wende ich mich geschlagen dem Gang zu.
»Du könntest ruhig mal versuchen, etwas sensibler zu sein, Jaro.« Erin tritt ebenfalls einen Schritt näher, woraufhin Jaro spielerisch Abstand zwischen sich und ihn bringt. »Es geht ihr sicher gut«, sagt der junge Mann mit dem braunen Haar und dem überaus trainierten Körperbau dann an mich gewandt.
Ich wünschte, ich könnte ihm glauben. »Ja, vermutlich«, stimme ich trotzdem zu und unterdrücke ein Seufzen.
Hoffentlich geht es ihr gut.
3
MAL & SPLITTER
SHINA
Die Morgensonne kriecht über den Horizont und taucht die dunklen Steine des kreisförmigen Versammlungsplatzes in warmes Licht. Er ist groß genug, um alle Studierenden der Staatlichen Astralweber-Akademie zu fassen. Heute sind allerdings nur ich und meine 232 Kommilitonen aus dem dritten Semester hier versammelt.
Der Anleiter ist noch nicht zu sehen, während ich neben Jaro, Lin und Erin eilig über den gemusterten Boden auf die bereits anwesenden Studierenden zulaufe.
Die goldenen und metallenen Elemente des Staatswappens spiegeln den rosafarbenen Himmel wider. Am oberen Ende des Platzes, über den konzentrisch angeordneten Sitzstufen, thront das Monument aus schwarzem Stein, das mir jedes Mal einen Schauer über den Rücken jagt. Eine Statue der sieben Regierenden – die Gesichter von schmucklosen Masken verdeckt, die Körper unter simplen Einteilern verborgen. Bis auf die unterschiedlichen Symbole auf ihrer Brust haben sie keine Identifikationsmerkmale. Die Worte unter der Statue sind selbst von meiner Position aus zu lesen: Sicherheit, Kontrolle, Überlegenheit.
Mein Blick schweift über die Anwesenden, in der winzigen Hoffnung, Erin hätte recht und Mae sei schon hier. Und tatsächlich: Ein wenig abseits von all den uniformierten Studierenden, die bereits in Reihen Stellung beziehen, entdecke ich sie.
»Bis später«, sage ich zu den anderen. Bevor sie ihre üblichen Sprüche dazu machen oder mich aufhalten können, eile ich auf Mae zu. Warum ist sie schon hier? Wenn sie nicht wusste, ob ich komme oder nicht, hätte sie mich ja auch abholen können.
Will sie mir wirklich so sehr aus dem Weg gehen?
»Hey!«, sage ich mit trockenem Mund und dränge mich an zwei Studierenden vorbei, um neben Mae stehen zu können. »Ich wollte dich abholen, aber du warst schon weg.«
Mae betrachtet mich nur aus dem Augenwinkel, atmet tief durch und murmelt ebenfalls eine Begrüßung. Ihr Verhalten würde mich mehr verletzen, wenn es nicht schon zur Normalität geworden wäre. Ich würde sie gern umarmen, weil wir uns so lange nicht mehr gesehen haben, aber ich glaube sogar, dass sie sich ein wenig von mir abwendet.
Sobald ich Stellung bezogen habe, ertönt die zweite Glocke dunkel über dem Platz.
Mae trägt dieselbe Uniform wie ich und alle anderen hier. Ich hatte in den Semesterferien fast schon vergessen, wie fantastisch sie ihr steht. Ihr langes Haar fällt ihr in nachtschwarzen Wellen über die Schultern, und ihre blauen Iriden leuchten im Kontrast zu ihrem dunklen Haar. Sommersprossen heben sich von ihrer hellen Haut ab. Sie sieht etwas frischer aus als die letzten Male, bei denen wir uns begegnet sind, aber ihr Gesichtsausdruck ist noch genauso kühl.
»Wie geht es …?«, setze ich leise an, während die anderen um uns herum sich noch ordnen – doch dann fällt mir das Mal an ihrem Handgelenk auf. Tiefschwarz, mit verschlungenen Mustern, die sich fast bis auf ihren Handrücken ausbreiten. »Was?«, keuche ich und greife danach. »Was hast du wieder getrieben?«
»Nichts weiter«, flüstert sie düster, zieht ihre Hand zu sich und schiebt den Ärmel ihrer Uniform weiter hinab. »Ich brauchte nur einen klaren Kopf.«
Scheiße. Das ist chaotische Energie, die sich an ihrem Arm ausgebreitet hat. Wenn das der Anleiter oder jemand anderes sieht, geht es ihr an den Kragen. Wahrscheinlich würden sie sie sogar von der Akademie verbannen. Wo um alles in der Welt hat sie sich das zugezogen?
Wenn sie nur mit mir sprechen würde. Wir haben immer über alles gesprochen, schon seit wir uns im Kindergarten kennengelernt haben. Trotz der Wünsche meiner Eltern, die wollten, dass ich mich mit anderen Kindern einflussreicher Familien abgebe; trotz der Klassenkameraden, die unsere Freundschaft nicht verstanden haben. Es war immer wir gegen den Rest der Welt. Wie konnte sich alles so verändern?
»Du musst das läutern lassen, bevor es sich noch deutlicher manifestiert«, sage ich so leise, dass ich es kaum selbst hören kann. Niemand darf es mitbekommen.
»Das weiß ich selbst.«
»Ich kann dich in einen Tempel begleiten, wenn du …« Ich stocke, denn in diesem Moment betritt der Anleiter den Platz. Auf einen Schlag verstummt jedwedes Murmeln, und die letzten Studierenden beziehen Stellung. Frustriert strecke ich die Schultern durch, richte mich gerade nach vorn aus und recke das Kinn in die Luft. Das Gespräch werden wir später fortsetzen müssen.
Der Anleiter trägt eine schwarze Maske, die sein ganzes Gesicht verbirgt. Zusammen mit der lockeren schwarzen Trainingskleidung, unter der seine massive Statur und seine Muskeln klar zu erkennen sind, macht er einen nahezu bedrohlichen Eindruck. Er verschränkt die Arme hinter dem Rücken und stellt sich leicht breitbeinig hin. Ich spanne mich an, als er ruft: »Willkommen im dritten Semester, Studierende!«
»Guten Morgen!«, antworten wir alle im Chor. Laut und klar zu reagieren war eins der ersten Dinge, die uns beigebracht wurden. Es beschert mir noch immer eine Gänsehaut, Teil einer so großen Einheit zu sein. Über die Praktikumswochen hatte ich fast vergessen, wie es sich anfühlt.
»Heute beginnt Ihr zweites und damit vorletztes Jahr an der Akademie. Ab heute ist die Schonfrist vorbei, die wir Ihnen gewährt haben. Das echte Leben beginnt.«
Ich schlucke angestrengt. In den ersten beiden Semestern war ich eine der Besten des Jahrgangs, aber die Älteren haben mehr als einmal angedeutet, dass es im zweiten Jahr erst richtig ernst wird.
»Wie Sie wissen, hat sich die politische Situation Sartins in den letzten Jahren stabilisiert«, fährt der Anleiter fort. Er regt sich kaum, während er so spricht, dass alle auf dem Platz ihn klar und deutlich hören sollten. »Einige Astrale und Staatspolizisten ruhen sich darauf aus, dass wir uns seit zehn Jahren nicht mehr im Krieg und unter konstanter Belagerung befinden. Doch Sartin hat noch längst keine Stabilität erreicht. Die Grenzstadt befindet sich nach wie vor in Unruhen. Es ist an uns, der Bevölkerung absolute Sicherheit zu vermitteln. Wir sind der Fels in der Brandung.« Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass einige zustimmend nicken. »Was sind die Leitmotive unserer Einrichtung?«
»Sicherheit, Kontrolle, Überlegenheit!«, rufen alle wie aus einem Mund. Es ist wie ein Automatismus für mich geworden. Ein Reflex.
»Genau.« Seine Stimme nimmt einen düstereren Unterton an. Er hat uns noch gar nicht seinen Namen gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn bereits kennen. »Chaotische Energie zu kontrollieren erfordert vollkommene Disziplin und ein militärisches Befolgen der Anweisungen. Aus den genannten Gründen dulden wir keinerlei Verstöße gegen Regeln, Gesetze und den gesunden Menschenverstand.«
Mein Herz schlägt höher, denn ich ahne, was folgen wird.
»Kadetten 158, 231 und 247. Treten Sie nach vorn.«
Ich bin so nervös, dass ich keine Erleichterung darüber verspüren kann, dass meine und Maes Nummern nicht dabei sind. Unruhig schaue ich mich um, als die entsprechenden Studierenden nach vorn treten und sich mit durchgestreckten Schultern und geradem Rücken vor dem Anleiter positionieren.
Man sieht sein Gesicht nicht, aber seine Stimme reicht aus, um seine Unzufriedenheit zu verdeutlichen. »Sie gehen zurück in Ihre Schlafräume, packen Ihre Sachen und sind mit sofortiger Wirkung der Akademie verwiesen.«
Zwei der jungen Männer senken die Köpfe. Nur der Dritte scheint überrascht. »Wie bitte?«, fährt er auf. »Was habe ich denn getan?«
Innerlich spanne ich mich an, weil ich weiß, dass es nie gut geht, sich mit einem Anleiter anzulegen. Allein dafür, einen von ihnen infrage zu stellen, kann man in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Der Kerl sollte besser seinen Mund halten und einfach gehen.
Der Anleiter wendet sich ihm zu. »Es ist Studierenden nicht erlaubt, ihre Artefakte ohne direkte Anweisung oder Erlaubnis einzusetzen.« Seine Stimme ist ruhig, aber ich glaube, Ungeduld herauszuhören. »Das sollte Ihnen mehr als klar sein. Ihre Position als Sohn einer Adelsfamilie verschafft Ihnen keine Sonderstellung, 158.«
Der Student ballt seine Fäuste vor Wut. Obwohl er mehrere Meter von uns entfernt ist, glaube ich, ihn zittern zu sehen.
Oh nein. Hoffentlich tut er nichts Unüberlegtes.
Doch als der Anleiter sich ihm nähert, um sein Artefakt einzuziehen, greift der junge Mann fahrig in seine Tasche. Die Luft um ihn herum beginnt zu vibrieren.
Ich mache hastig einen Schritt zurück, genau wie die meisten anderen.
Mit einem Ruck zieht der Student sein Artefakt hervor, und die Luft um ihn herum explodiert in einem Netz aus scharfen, splitterartigen Rissen, die in einem unsteten violetten Licht flirren. Kleine Sterne flackern um sie herum, als spiegelte das Universum sich in den Scherben der Luft. Eine weitere Explosion folgt, aber der Angriff ist zu stark. Das geht weit über die Übungen hinaus, die wir bisher ausführen durften.
Mae greift nach meinem Handgelenk, als wollte sie sich dazu bereit machen, mich zu schützen oder gemeinsam mit mir zu fliehen. Und obwohl ich mir Sorgen um den Kampf machen sollte, macht mein Herz nun einen Sprung aus einem ganz anderen Grund.
Der Anleiter reagiert, ohne eine Sekunde zu zögern, und hebt sein eigenes Artefakt, um die chaotische Energie daraus zu befreien. Die Furchen, die sich von ihm ausbreiten, sind viel schneller und klarer als die des Studenten. Als sie aufeinandertreffen, zerreißt ein Dröhnen die Luft. Ich presse die Hände auf meine Ohren, während sich für einige Sekunden das Bild der Umgebung verzerrt wie durch einen zersplitterten Spiegel.
Der Student verstärkt seinen Angriff mit einem Schrei. Die Risse breiten sich aus, zerbersten den Boden zwischen ihnen, wirbeln den Staub der Trümmer auf. Ich halte den Arm schützend vor meine Augen, als der Anleiter mit einer mächtigen Welle kontrollierter Energie zurückschlägt. Er scheint sich nicht einmal besondere Mühe geben zu müssen.
Die Risse kollidieren und erzeugen eine Druckwelle, die uns noch ein Stück zurückdrängt. Wieder greift Mae nach mir, einige der Studierenden flüchten an die äußeren Ränder des Platzes.
Doch als ich wieder aufschaue und den Staub fortgeblinzelt habe, liegt der junge Mann am Boden. Der Anleiter fängt die chaotische Energie zwischen ihnen und schließt sie in seinem Artefakt ein. Die Risse verschwinden, aber die Sterne sind noch zu sehen. Die Luft knistert vor Spannung.
Obwohl das Artefakt des Studenten nun weit außerhalb seiner Reichweite liegt, setzt der Anleiter einen weiteren Angriff nach. Der Energiestoß trifft den jungen Mann unvermittelt und lässt ihn vor Schmerzen aufkeuchen. Dunkles Blut rinnt zwischen seinen Lippen hervor, als er sich zusammenrollt und sich so klein macht wie möglich.
Ich kralle mich in Maes Kleidung, während keiner auf dem Platz es wagt, auch nur eine Bewegung zu machen. Mir wird schlecht, und ich wage es kaum, zu blinzeln.
Die Stimme nicht mehr als ein gehauchtes Flehen, bittet der Student um Gnade. Das Blut mischt sich mit dem Staub unter ihm.
Der Anleiter beobachtet ihn einige Sekunden lang regungslos, dann schiebt er sein Artefakt weg und verschränkt die Hände hinter dem Rücken. Nur das Keuchen des Studenten durchbricht die Stille, die sich über den Platz gelegt hat – gefolgt von den Schritten einiger Assistenten, die auf den Platz eilen, um den Verletzten wegzubringen.
Der Anleiter erhebt wieder die Stimme. »Für Ihren Betrug an der Akademie und des Staates Sartin werden Sie zu drei Jahren Strafdienst verurteilt. Aussichten auf eine Karriere im Staatsdienst werden Ihnen für immer verwehrt bleiben.«
Ich glaube nicht, dass der Student ihn noch hören kann, während die Assistenten seinen regungslosen Körper an den Armen über den Platz davonschleifen. Die anderen beiden übergeben ihre Artefakte so schnell wie möglich, ohne einen Mucks zu machen.
Die beklemmende Stille hängt noch über dem Platz. Erst nach und nach wagen einige der Studierenden es, sich zu bewegen und wieder Stellung zu beziehen.
Mein Herz hämmert noch immer gegen meine Brust. Ich löse die Hand, mit der ich mich an Mae festgehalten habe, aber sie zittert noch ein wenig. Mae lässt ebenfalls los. Unsere Blicke treffen aufeinander, und ich sehe einen Anflug von Angst in ihren Augen, gegen die sie offenbar noch ankämpft.
Wir reihen uns schweigend bei den anderen Studierenden um uns herum ein, die so leise wie möglich wieder in Reih und Glied treten.
Warum schlägt mein Herz jedes Mal so schnell, wenn so etwas passiert? Ich weiß doch, dass ich nichts falsch gemacht habe. Ich weiß, dass es mich vermutlich nie treffen wird. Aber …
Erneut sehe ich Mae aus dem Augenwinkel an.
Was, wenn es sie eines Tages trifft?
»Morgen steht das alljährliche Stadtfest an«, sagt der Anleiter, als sei nichts gewesen. »Uns hat in den Morgenstunden die Nachricht erreicht, dass die Präsenz der Astrale aufgrund der Vorkommnisse der letzten Wochen dort verstärkt werden soll.«
Ich spanne mich ein wenig an, weil ich kurz befürchte, wir würden auch patrouillieren müssen. Die Erst- und Zweitsemester werden vor solchen Aufgaben verschont, ab dem dritten kann es allerdings durchaus vorkommen.
»Sie werden nicht eingezogen werden«, fährt er allerdings fort, »aber halten Sie sich bereit, und nehmen Sie Ihre Artefakte mit. Falls es zu einem erneuten Angriff kommen sollte, ist es Ihnen in Anwesenheit von ausgebildeten Astralen und Staatsdienern erlaubt, sie einzusetzen. Allerdings nur, wenn Sie entsprechend angewiesen werden.« Er senkt die Stimme ein wenig. »Sie wissen ja, was geschieht, sollten Sie sich nicht an diese Regel halten.«
Es fällt mir noch immer schwer, meine Atmung zu beruhigen. Der Staub legt sich gerade erst, aber trotzdem steht der Kerl unbeirrt da.
»Es ist Ihnen erlaubt, privat am Fest teilzunehmen. Sie werden dennoch Ihre Uniformen tragen«, sagt er. »Also verhalten Sie sich entsprechend.«
»Jawohl.«Dieses Mal ist meine Stimme rau, als ich mit allen anderen im Chor antworte. Mae macht einen noch bedrückteren Eindruck als sonst.
Obwohl ich weiß, dass es kindisch ist, enttäuscht mich die Ankündigung. Ich hatte mich so aufs Fest gefreut. Uniform tragen und auf der Hut sein zu müssen stand nicht auf der Liste der spaßigen Aktivitäten, die ich mir ausgemalt hatte. Aber an diesen Alltag werde ich mich wohl früher oder später gewöhnen müssen.
»Wenn Sie es noch nicht gehört haben sollten: Erst vor wenigen Minuten wurde eine Drachenschlange unschädlich gemacht, die für den Tod von etlichen Zivilisten und einigen Astralen verantwortlich ist.«
Mein Herz macht einen Hüpfer, als ich an meine Eltern denke.
»Die Astrale konnten sie neutralisieren, aber die Bevölkerung gerät immer mehr in Unruhe. Deswegen werden morgen bei einer Großversammlung die Vertreter der Regierung zu Ihnen sprechen.«
Was? Mein Blick huscht zu der Statue der sieben Personen, die über uns thronen. Sie werden persönlich kommen? Das kam, seitdem ich hier bin, noch nie vor. Ist das wirklich so eine riesige Sache?
Einige der Studierenden um mich herum regen sich. Mae runzelt die Stirn und sieht mich irritiert an, was ich ebenso verunsichert erwidere.
»Sie werden mit Ihnen Strategien besprechen, um einerseits auf diese Angriffe zu reagieren und andererseits das Vertrauen der Bevölkerung zu stärken. Jedwedes Aus-der-Reihe-Fallen wird aufs Härteste bestraft. Ich wurde dazu angehalten, Sie darauf hinzuweisen.«
Das hat er bereits mehr als deutlich gemacht.
Ich presse die Zähne aufeinander, um meine Aufregung zu unterdrücken, dann schlucke ich hart. Der Staub kribbelt noch immer in meiner Lunge.
»Verstanden?«
»Jawohl!«
»Sie dürfen jetzt zu Ihren Kursen aufbrechen.«
Er bleibt regungslos stehen, als ich in einer Reihe mit den anderen abtrete. Niemand sagt ein Wort. Nicht einmal ein Flüstern dringt über den Platz.
4
MÜNZEN & MARMOR
RAH
Der Staatstempel von Sartin ist ein prunkvolles Gebäude inmitten eines Wohnviertels. Seine weiße Fassade leuchtet im Kontrast zu den hohen Häusern aus dunklem Sandstein, aus denen die Hauptstadt vorrangig errichtet wurde. Während wir die vorbeifahrenden Straßenbahnen und Kutschen abwarten, schaue ich an den Treppenstufen hinauf und versuche, mich endlich an den Anblick zu gewöhnen.
An den Anblick eines Ortes der Ruhe, eingequetscht in eine überfüllte Metropole. Die harmonische Energie im Tempel selbst ist zwar recht stark, aber ich verstehe inzwischen, warum die Wächter der Städte nicht so viel von ihr ansammeln können wie wir in den Wilden Landen.
Oder liegt es am Ewigen Baum? Ich sehe hinüber zu der gigantischen Eiche, die vor dem morgendlichen Himmel über der Stadt thront. Ihr Geäst spendet einem Teil der Hauptstadt Schatten, während ihr Wurzelgeflecht sich wie Tentakel um die nächstgelegenen Gebäude schlingt. Ihre chaotische Energie, die über das Wurzelnetzwerk unter ganz Sartin verläuft, hält das Land in einem immerwährenden Frühling gefangen. Angezapft von Generatoren und Fabriken treibt sie die Maschinen hier an.
Ich war immer davon ausgegangen, dass die einzige Stadt Qayas, die eine göttliche Pflanze anstelle eines Gegenstands als Energiequelle nutzt, von einer ruhigeren, positiveren Aura durchdrungen wäre. Dass ich mich darin getäuscht habe, habe ich bereits in den ersten Tagen erkannt.
Als sich im Morgenverkehr auf den feuchten Backsteinstraßen endlich eine Lücke auftut, reiße ich mich von meinen Gedanken los und setze mich in Bewegung. Ich ignoriere die besorgten und neugierigen Blicke der anderen Wächter, als wir die etlichen Treppenstufen zum Eingangstor hinaufsteigen. Sie sind überschüttet von Haushaltsgeräten und Alltagsgegenständen, die die Menschen zur Reinigung herbringen. Schweigend winden wir uns zwischen den Küchenutensilien, Fahrrädern, Uhren und Pflanzen hindurch und treten durch die offene Doppeltür, die in die Eingangshalle des Staatstempels führt.
Ich kann es nicht erwarten, mich in einen stillen Raum zurückzuziehen und einige Minuten lang nur zu denken und zu atmen. Die Städte sind so endlos laut. Ich glaube manchmal, meine eigenen Gedanken nicht ganz hören zu können. Dabei ist der Tempel dem meiner Heimat nicht mal unähnlich. Bis zur golden verzierten Decke hinauf stapeln sich die persönlichen Gegenstände. Schmuck, abgenutzte Stofftiere, alte Münzen und polierte Fragmente liegen verstreut an allen Ecken und Enden, teils achtlos auf den Boden geworfen. Allein mit den Büchern könnte man eine Bibliothek füllen. Hunderte Windspiele klingen in der Brise, einige Haustiere streifen über den marmornen Boden und verschwinden in den anliegenden Räumen. Durch die gläserne Kuppel weiter im Inneren fällt das Licht des Morgens ein. Die Flammen der Kerzen, die überall verteilt sind, spiegeln sich schillernd im marmornen Boden und dem Krimskrams um uns herum. Die Halle ist durchdrungen vom Geruch nach Tee. Und von einer ruhigen Aura, die meine Nerven beruhigt.
Ich gehe einige Schritte tiefer hinein und atme mehrere Male bedacht ein und aus. Ich sollte mich längst beruhigt haben, doch die Bilder, die ich im Geist der Drachenschlange gesehen habe, verschwinden einfach nicht aus meinen Gedanken. Und dieses Wesen an sich war anders als alles, was mir je begegnet ist.
»Brauchst du etwas?«, fragt eine der Wächterinnen, die mich begleitet haben. »Soll ich mir deine Verletzungen ansehen?« Sie ist ein wenig älter als ich. Ihr braunes Haar fällt ihr in Wellen über die Schultern, als sie ihren Mantel abstreift und mir ein warmes Lächeln schenkt.
Bevor ich etwas erwidern kann, hat sie sich bereits gebückt, um mir die Schuhe auszuziehen und die kleinen Wunden an meinen Füßen zu überprüfen. Meine Knie sind auch aufgeschürft, und an einigen Stellen haben mich kleine Steine getroffen, aber … ich will jetzt allein sein. Nachdenken. Ich weiß noch nicht, ob ich einen Sinn hinter den Bildern finden werde oder eine Bedeutung in den Worten der Wölfe, aber ich muss es wenigstens versuchen. »Sind nur ein paar Kratzer«, sage ich also.
»Gut.« Die Wächterin richtet sich auf. Ich bemerke ihren forschenden Ausdruck genau, trotzdem schließt sie sich den anderen an und bringt meine Schuhe zusammen mit ihrer schillernden Robe in einen der Nebenräume.
Ich muss meine Kleidung waschen und ein Bad nehmen, also setze ich mich schwerfällig in Bewegung. Die Verletzungen sind wirklich nicht tief, aber sie brennen ziemlich. Der glatte Marmor unter meinen nackten Füßen ist wenigstens angenehm kühl.
»Du weißt, was du zu tun hast«, flüstert einer der Wölfe in meinem Inneren. Ein Kopfschmerz setzt hinter meiner Stirn ein, und ich hebe die Hand vor den Mund, um meine Lippen zu verbergen, als ich »Was denn?« flüstere. Nicht zu eilig gehe ich in Richtung des Bereichs mit den persönlichen Zimmern. Ich brauche ein paar Minuten, um mich zu sammeln.
»Du kannst nicht unbeteiligt sein«, sagt eine der anderen Stimmen.
»Du musst dich einmischen«, ergänzt eine weitere.
»Halt dich noch zurück«, widerspricht noch eine.
Ihr seid euch wieder nicht einig, denke ich mit zusammengebissenen Zähnen. In meiner Heimat, der Tempelgemeinde in den Wilden Landen, war ich so oft allein in den großen Wäldern oder auf den weiten Wiesen, dass ich einfach laut mit den Wesen in mir gesprochen habe. Obwohl ich schon seit zwei Wochen hier bin, fällt es mir noch immer schwer, meine Antworten nur zu denken. Das bringt mich nicht weiter.
»Wir sind uns einig«,grollt ein anderer Wolf, dieses Mal deutlich intensiver als zuvor.
Etwas Warmes rinnt aus meiner Nase, und ich ziehe sofort ein Taschentuch aus der Tasche, um die schwarze Flüssigkeit fortzuwischen. Eine weitere Unannehmlichkeit, die hier niemand bemerken sollte. Nicht einmal den Wächtern, die mich großgezogen haben, habe ich von dem erzählt, was seit Kindesalter in mir lauert. Es war allerdings auch leichter, diese Dinge vor ihnen zu verbergen. Hier, wo man immer unter so vielen Menschen ist, ist das eine größere Herausforderung.
Wie um meine Gedanken zu bestätigen, kommen mir weitere Wächter auf dem vollgestellten Gang entgegen. Ihre von den Wänden widerhallenden Schritte kündigen sie zum Glück an, sodass ich meine Nase sauberwischen und das Taschentuch eilig wegschieben kann, bevor sie um die Ecke biegen.
»Wir haben das Telegramm über den Angriff im Rathaus erhalten«, sagt Yoba und kommt eilig auf mich zu. Der junge Wächter ist vermutlich in meinem Alter. Sein Gesicht ist von Sorge durchzogen, als er mich mustert, aber sein braunes Haar und die braunen Augen lassen ihn sowieso immer so weich aussehen. »Zum Glück konntest du helfen.«
Caius hinter ihm hat den Rücken wie immer in absolut aufrechter Haltung durchgestreckt, als müsse er sich gegen das Gewicht der Welt auf seinen Schultern wehren. Der Wächter mittleren Alters strahlt mit seinen blassen Augen, dem von grauen Strähnen durchzogenen Haar und dem strengen Zug um die Lippen eine Erhabenheit aus, die mir nicht ganz geheuer ist. Seinen Gesichtsausdruck kann ich wie immer nicht deuten.
»Ja, es geht allen gut«, sage ich, als die beiden vor mir stehen bleiben. Hoffentlich haben sie keine weiteren Anfragen oder Aufgaben. Ich brauche nur kurz meine Ruhe.
»Haben wir gehört.« Yoba dreht sich zu Caius um, bevor er sich wieder mir zuwendet. Wie die meisten anderen tragen die beiden ein schwarzes, hochgeschlossenes Hemd mit goldenen Emblemen am Kragen, die sie als Wächter ausweisen. Nur die wenigsten Wächter hier im Staatstempel besitzen die traditionelle goldene Tätowierung am Unterarm, die in den Wilden Landen so gut wie alle haben. »Zum Glück ist dir nichts Schlimmeres passiert.«
Caius sagt nichts. Ich weiß nie, ob er mich skeptisch ansieht oder ob der Ausdruck auf seinem Gesicht immer so abwägend ist. So oder so gefällt es mir nicht. Er macht den Eindruck, als wüsste er etwas über mich; als hätte er etwas gesehen, was er nicht hätte sehen sollen.
Aber vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil ich tatsächlich etwas zu verbergen habe. Offiziell bin ich hier, um die Wächter von Sartin in die traditionellen Rituale und Bräuche der Wächter der Wilden Lande einzuweihen. Aber weder die Menschen hier noch die in meiner Heimat sind sich im Klaren darüber, dass ich meine eigenen Pläne habe.
Und das sollte bestenfalls auch so bleiben.
»Wie genau hast du diese Drachenschlange läutern können?« Yoba tritt neben mich und nimmt mir meinen Mantel ab. Besorgt mustert er meine leicht verletzten Hände.
Ich verberge sie in den Falten meines Kleides und setze mich langsam wieder in Bewegung. Er geht neben mir her, während Caius uns schweigend folgt. Wollen sie nur Informationen von mir? Oder geht es um etwas anderes?
»Ich habe es versucht wie bei einer ganz gewöhnlichen Läuterung.« Nachdenklich fahre ich mir mit der Zunge über die Lippen. Mein Blick bleibt an einer der Katzen hängen, die sich zwischen den hergebrachten Gegenständen hindurchwindet. »Durch Auflegung meiner Hand und harmonische Energie. Aber das Wesen hatte eine … seltsame chaotische Energie in sich. Eine gewaltige Energie. Hätte ich mich nicht daraus befreien können …«
›Das war nur der Anfang‹, haben die Wölfe gesagt. Wenn sie nur hin und wieder hilfreicher wären.
»Kann ich irgendwas für dich tun?« Yoba legt sich meinen Mantel um den Arm, macht allerdings keine Anstalten, von meiner Seite zu weichen.
Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass er mehr Fragen zur Art der Energie stellen würde, aber entweder er weiß nicht, wovon ich spreche, oder er möchte mir meinen Raum lassen. So oder so gibt mir sein Hilfsangebot ein angenehmes Gefühl, das ich seit meiner Ankunft in dieser Stadt vermisst habe. Vielleicht sollte ich ihn fragen, ob er Lust hat, mit mir auszugehen. Immerhin kenne ich hier bisher so gut wie niemanden.
»Danke«, lehne ich trotzdem ab. »Ich will erst mal meditieren. Dann nehme ich ein Bad und kann weiter bei den Vorbereitungen für das Stadtfest helfen.«
»Na gut.« Er nickt bestimmt. »Ich bereite gleich einen Raum für ein rituelles Bad vor.«
Ich verberge ein Lächeln, weil er so motiviert klingt. »Das schaffe ich auch allein. Aber vielen Dank.«
Er wiederum schmunzelt. »Aber du hast dich gerade erst in Lebensgefahr begeben und brauchst Ruhe, um deine Energien wieder zu sammeln. Ich helfe gern.« Die sanfte Stärke, die er ausstrahlt, lässt eigentlich keine Widerrede zu.
Und er hat recht. Das macht es leider schwer, mich sinnvoll herauszureden. Und Caius’ düstere Blicke machen es leider auch nicht besser.
Ich bin nicht nur neu in der Stadt, die meisten Wächter im Staatstempel sind auch älter als ich. Es sagt offensichtlich nicht allen von ihnen zu, dass die Jüngeren mir so zu Füßen liegen, weil meine harmonische Energie stärker ist als die der meisten anderen hier. Aber ich tue auch nichts, um das zu provozieren.
Die harmonischen Energien der Wächter Sartins werden von der immensen chaotischen Energie des Ewigen Baums blockiert, die durch jeden Winkel der Hauptstadt geleitet wird. Dass ich fernab von alldem aufgewachsen bin, ist nicht sonderlich bewundernswert – das ist mir bewusst.
»Ich wurde wirklich nicht schwer verletzt«, wehre ich weiter ab, als wir in den Bereich mit den Privatgemächern treten, an den direkt der große Innenhof grenzt. Insekten umschwirren die Pflanzen und Blumen bereits. »Aber leider viele andere. Hätte man uns früher mit einbezogen, wäre es gar nicht erst so weit gekommen.« Ich kann es kaum erwarten, meine staubige Kleidung abzulegen und barfuß im Moos neben den Bachläufen zu meditieren. »Ich verstehe die Regierung dieses Landes noch nicht.« Regierungen im Generellen. In meiner Gemeinde hatten wir nie viel mit politischen Dingen zu tun.
»Wir hätten gar