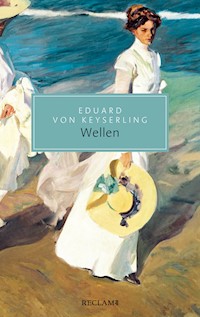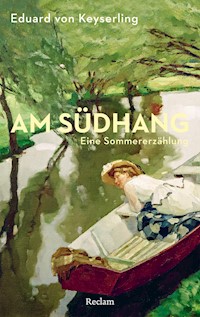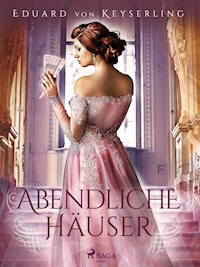Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reese Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Baron Felix von Bassenow kehrt von einer längeren Italienreise heim. Die Ehe mit seiner jungen Frau Annemarie – erst zwei Jahre zuvor begonnen – war mit einem Kind gesegnet gewesen. Annemarie hatte den Kindstod nicht verwinden können; war in ein Nervensanatorium gebracht worden. Etwa zum Zeitpunkt jener Einweisung hatte Felix die Flucht nach dem Süden angetreten – angeblich, weil er sich gegen Mitleid nicht wehren konnte. Daheim will Felix das Heft wieder in die Hand nehmen. Zwar gelingt ihm das mühelos als Gutsherr mit seinem alten Gutsinspektor Pitke und ebenso mit dem Gesinde, doch Annemarie hat sich inzwischen mit dem – bereits um die 45 Jahre alten – Onkel Thilo angefreundet. Erkenntnis: Wer Schwierigkeiten aus dem Wege geht, bekommt später die Rechnung für sein Ausweichen präsentiert.(Wikipedia) Eine Novelle über Eifersucht, Zurücksetzung, Haß und unerfüllte Liebe. Eduard von Keyserling (1855 - 1918), aus einer alten baltischen Adelsfamilie stammend, hat Romane und Erzählungen geschrieben, die zum Schönsten gehören, was die deutsche Literatur hervorgebracht hat. Man hat ihn einen baltischen Fontane genannt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 97
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
HARMONIE
Über den Autor
Impressum
Hinweise und Rechtliches
E-Books im Reese Verlag (Auswahl):
E-Books Edition Loreart:
Eduard von Keyserling
Harmonie
Novelle
Reese Verlag
HARMONIE
Die Station war zwei Stunden von dem Schloß entfernt. Als Felix von Bassenow sich dort in seinen Wagen setzte, war die Sonne im Untergehn. Felix drückte sich behaglich in die Wagenecke und zog die Reisedecke über die Knie hinauf. Die nordische Frühlingsluft fühlt sich ein wenig scharf an, wenn man von dort unten aus der Sonne kommt: »Sieh — sieh!« dachte er, »hier sind ja auch Farben!« Die Wolken am letzten Abend in Amalfi waren nicht blanker gewesen, als er auf der Hotelterrasse stand und die kleine Engländerin neben ihm immer wieder: O — luck — luck sagte und ihn mit ihren seltsam wassergrünen Augen ansah, als meinte sie nicht den Himmel, sondern sich selbst. Aber beruhigter war es hier, und der Duft! Teufel! Man wagte kaum seine Zigarre anzustecken.
Der Wagen fuhr durch Felder hin. Ebnes, grellgrünes Land, über das seidige, blaue Schatten hinschillerten. Leute kamen von der Arbeit. Sie mochten Gerste gesät haben. Langsam ging einer hinter dem andern her, graue Gestalten, denen das Abendlicht die Gesichter rot malte. Weiber standen am Wege in ihren farbigen Kamisolen, sehr bunt und schwer in all dem Grün. Sie schützten die Augen mit der Hand und schauten dem Wagen mit einem starren Lächeln nach.
Felix freute sich, das wiederzusehen. Aber es war unterhaltend, — wenn er die Augen schloß, war all das fort und ganz andere Bilder drängten heran, Stücke von Bildern, kleine, grelle Visionen, die nicht zur Ruhe kommen konnten, wie wirr durcheinanderfuhren, wie aufgescheucht. Immer viel tiefes Blau, gewaltsames Licht über großen, starren Linien. Ein roter Blütenzweig auf dem gelblichen Adas einer Felswand. Die Berührung eines Frauenkörpers, einer Haut, in die es sich wie Bernstein mischte. Der leidenschaftliche Mißton eines Kamelgeschreies in der Stille einer ganz blauen Nacht.
Wenn er dann wieder die Lider aufschlug, erschien das grüne Land, über das rote Lichter hinstrichen, in seiner Stille und Kühle fremd und unwahrscheinlich. Er mußte darüber lächeln, wie all diese Bilder in ihm stritten, um für ihn wirklich zu sein.
Die Abendlichter verblaßten. Der Weg führte jetzt durch den Wald. Unter den Bäumen war es finster. Hier und da leuchtete ein weißer Birkenstamm aus dem Schwarz des Nadelholzes, darüber wurde der Himmel farblos und glasig. Die bleiche Dämmerung der Frühlingsnacht sank auf die dunklen Wipfel nieder. Es war sehr ruhevoll. Dennoch schien es, als kämen sie im Walde, in dieser Luft, die erregend voll der bitteren Düfte von Knospen und Blättern hing, nicht recht zur Ruhe: ein Flügelrauschen, der verschlafne Lockton eines Vogels. Heimlich knisterte und flüsterte es im Dunkeln. Sehr hoch im weißen Himmel erklang noch das gespenstische Lachen einer Bekassine, und plötzlich begannen zwei Käuze einander zu rufen, leidenschaftlich und klagend.
Etwas wie heimliche Brunst atmete all das aus. Die beiden blonden Burschen auf dem Kutschbock, die abstehenden Ohren sehr rot unter den Tressenmützen, fingen an miteinander zu flüstern und zu kichern. Weit fort hinter dem Walde begann ein Mann zu singen, eine eintönige Notenfolge, ein langgezogenes, einsames Rufen.
Felix saß regungslos da. Die Lippen halb geöffnet, atmete er tief. Alles Fremde war fort. Er war zu Hause. Bei jeder Biegung der Straße wußte er, was nun kommen würde, und nun wußte er auch, daß er sich danach gesehnt hatte. Er hatte es satt, durch die Welt zu fahren, nur ein Gefäß für fremde Eindrücke, immer sich mit Schönheiten füttern zu lassen, die ihn nichts angingen, immer nur das zu haben, was alle andern auch hatten, nie die Hauptperson zu sein. Er wollte wieder Arbeit, Verantwortlichkeit — Befehlen, wieder Herr — etwas wie der liebe Gott sein, wollte es spüren, wie seine laute Stimme den großen, blonden Bauernjungen in die Glieder fährt.
Auf einer Waldlichtung stand der Waldkrug. Durch die kleinen Fensterscheiben schielte etwas unreines, rötliches Licht in die Mainacht hinaus. Die Krugsleute saßen vor dem Hause auf einer Bank, die Hände flach auf die Knie gelegt. Im Garten blühte der Faulbaum. Sein gewaltsamer Duft benahm fast den Atem.
Der Wagen hielt vor dem Krug. Hier sollten die Pferde sich verschnaufen. Der Kutscher und der Diener bekamen Bier. Das war alte Gerechtigkeit.
Die Wirtin brachte das Bier. Sie stand wartend neben dem Wagen, eine junge Frau, groß wie ein Mann. Sie legte die Hände flach auf ihren mächtigen, gesegneten Leib und schaute aus den blauen Augen Felix schläfrig und unverwandt an, als sei er eine Sache.
Der Wirt trat heran, im roten Gesicht viel blondes Bartgestrüpp. Er begrüßte den Herrn und berichtete. Ja, er hatte die Tochter des früheren Krügers geheiratet. Der Alte war gestorben. Die Mutter lebte noch, aber war zu nichts mehr nutze. Das Land war schlecht. Rehe kamen heraus und taten den Feldern Schaden. Was konnte man machen!
Zerstreut hörte Felix der knarrend forterzählenden Stimme zu und schaute dabei zu der hohen Werfschaukel hinüber, die neben dem Kruge aufragte. Auf dem schmalen Brett standen ein Mädchen und ein Bursche, Brust an Brust und schaukelten. Immer wieder flogen die beiden schwarzen Figürchen in den dämmerigen Himmel hinauf und fielen immer wieder in den Schatten zurück, rastlos und schweigend.
Als Felix weiter fuhr, wollte er an dieses Bild denken, das beruhigte und machte ein wenig schläfrig, allein jetzt kamen andere Gedanken, Gedanken, die die ganze Zeit über da in ihm gewartet hatten, daß sie an die Reihe kamen.
Solche Frühlingstage waren es gewesen, als er vor zwei Jahren seine junge Ehe begann. Die Ehe hatte er sich immer hübsch gedacht, aber er hatte es nicht gewußt, daß sie so unterhaltend sein konnte. Es war zu merkwürdig, dieses kleine Mädchen mit dem schmalen, geistreichen Gesicht immer bei sich zu haben, zuzusehn, wie selbstherrlich dieses halbe Kind das Leben für sich zurecht bog, alles ruhig fortschob, was ihm nicht recht war, genau wußte, wie es das Leben wollte: »Nein, ich danke, das ist nicht für mich.« Damit tat Annemarie alles ab, was nicht zu ihr stimmte. Der echte, letzte Sproß einer Rasse, die immer davon überzeugt gewesen war, daß für sie die Auslese des Lebens bestimmt sei. Annemariens Vater, die Exzellenz, hätte auch um keinen Preis einen Wein getrunken, der ein wenig nach dem Korken schmeckte, und ihm schmeckte ein Wein sehr leicht nach dem Korken. Auch von ihm, ihrem Mann, konnte Annemarie nur eine Auslese gebrauchen, sie sah das, was ihr an ihm gefiel, das andere wies sie ab mit dem leichten, ein wenig grausamen Zucken der Lippen, das er fürchtete. Gott! er hatte sich oft höllisch zusammennehmen müssen, um so zu sein, wie sie ihn sah.
Zwischen den hohen Föhren war es dunkel und feierlich still. In dieser Dunkelheit sah er Annemarie so deutlich wie eine Vision, das weiße Körperchen mit den abfallenden Schultern, den feinen Gelenken, den kleinen, spitzen Brüsten, diese Haut, die bleich und glatt war wie Blätter von Blumen, die im Schatten blühn.
Aus Bildern hatte er sich nie viel gemacht. Man steht einen Augenblick davor und dann ist es gut. Aber in Rom, in einer Galerie, war da ein Bild gewesen, zu dem er öfters gegangen war. Da saß auch solch ein kleines, schmales Mädchen, eine Danae, stand im Katalog, auf einem blauen Lager, und das hatte auch den kühlen Perlmutterglanz auf den schmächtigen Gliedern, und das nahm die Liebe des Gottes mit einer vornehmen Selbstverständlichkeit hin, wie etwas Hübsches, das ihm zukäme. Vor diesem Bilde hatte er an Annemarie gedacht.
Zwischen den schwarzen Wänden der Föhren schien es wärmer. Der Frühling duftete hier schwüler. Felix’ Lippen wurden heiß, in seinem Blute fieberte wieder das köstliche Gefühl, das ihn ergriff, wenn er Annemarie in die Arme nahm — das Gefühl, etwas sehr Erregendes und Kostbares zu halten.
— Aber, da war ja das Andere, das Schreckliche gekommen, das Kind und der Tod des Kindes und diese grausame Krankheit. Annemarie kauerte auf ihrem Bette, die Augen angstvoll weit aufgerissen, und horchte hinaus und hörte Dinge, die sie schreckten, vor denen sie geschützt sein wollte und er wußte nicht wie. Oder sie saß stundenlang teilnahmslos da und spielte mit kleinen, weißen, blanken Sachen, Perlmutterdöschen und Messerchen, die Sachen konnten nicht weiß Lind blank genug sein. Sie wurde in ein Nervensanatorium gebracht und Felix ging auf Reisen. Es war vielleicht herzlos, daß er reiste, aber er wollte von diesem Mitleid loskommen, das wie eine Krankheit an ihm zehrte. Selbst einen Schmerz ertragen, das ging, aber gegen Mitleid konnte er sich nicht wehren.
Jetzt war Annemarie gesund. Frau von Malten, ihre alte Freundin und Gesellschafterin, hatte geschrieben: »Sie ist ganz wieder unser lieber Engel wie sonst. Ein wenig zart und reizbar, aber wie gern schützen wir sie vor allem, was sie verletzen könnte.«
Die Lichter des Schlosses schimmerten schon durch die Parkbäume. Der frisch gestreute Kies knirschte angenehm unter den Rädern. Über der Haustür des Schlosses hing ein Transparent, auf dem »Willkommen« stand, und im Dunkel bewegten sich Gestalten und sangen einen Choral. Felix freute sich darüber. Ein angenehmes Herrengefühl kitzelte ihm das Herz.
Frau von Malten, in ihrem schwarzen Schleppkleide, das schwarze Spitzentuch um das scharfe, gelbe Gesicht, stand im weißen Türrahmen des Speisesaals und begrüßte Felix mit ihrer diskreten, ein wenig traurigen Stimme: »Willkommen! Gott segne Sie.« Hinter ihr war der Saal ganz hell. Die Goldborten flimmerten im weißen Getäfel.
»Und Annemarie?« fragte er.
»Annemarie schläft schon«, berichtete die diskrete Stimme, »sie darf noch nicht so lange aufbleiben. O! es geht ihr gut. Gott sei Dank!«
»— So — so.«
Während er auf das Essen wartete, ging Felix in der Zimmerflucht immer auf und ab. Überall war viel Licht und weiße Spitzenvorhänge. Es duftete nach Hyazinthen und Tazetten. Auf allen Tischen standen Schalen mit Frühlingsblumen. Und all das stand und wartete auf ihn. In einer Fensternische regte sich etwas. Da lehnte ein Mädchen, das ihn mit runden, grellblanken Augen neugierig ansah. Schweres, schwarzes Haar um ein erhitztes, bräunliches Gesicht, das gewaltsam errötete. Ein rotes Kleid, in dem sich volle Glieder ungeduldig regten.
»Ah«, sagte Felix, »Sie sind wohl Mila — Mila, Frau von Maltens Pflegetochter?«
Mila verbeugte sich hastig.
»Ja — ja! ich weiß«, fuhr Felix fort, »Sie sind die, welche die angenehme Stimme hat. Meine Frau schrieb mir davon. Sie lesen ihr vor. Ach! sprechen Sie etwas, damit ich die angenehme Stimme höre.« Mila lachte und legte dabei den Handrücken auf den Mund wie ein Dorfkind. »So — so«, meinte Felix und ging wieder auf und ab. Das war auch gut, daß dieses Mädchen in der Fensternische ihm zuschaute. Er rieb sich vergnügt sachte die Hände, ging elastisch, ließ das Parkett unter seinen Schritten knacken. Ihm war ordentlich feierlich zumute.
Während des Essens saß Frau von Malten bei ihm und unterhielt ihn: »Neapel, ach ja! das mußte schön sein, das würde Annemarie gut tun: Sie hat viel Licht nötig. So war das Getäfel hier ihr zu dunkel, es mußte weiß sein. Ich schrieb Ihnen davon. Der alte Heinrich? Ach, der wurde endassen. Die Augen wurden ihm rot und tränten ihm zuweilen, Annemarie mochte das nicht. O! er ist sehr glücklich. Er wohnt in dem Häuschen hinter dem Park. Meine Mila haben Sie gesehn? Ja, ein gutes Kind. Sie hat eine angenehme Stimme. Sie ist noch zuweilen etwas laut, das fällt Annemarie auf die Nerven. Gott! man möchte die ganze Welt für sie wattieren.« Frau von Malten zog die Augenbrauen ein wenig hinauf und sah Felix mit ihren trüben, grauen Augen ernst an. Ja, Felix kannte das, hinter den Elegien der guten Malten steckte immer eine Lehre. Sie betrachtete Annemarie wie eine Kirche, und sie war der Küster, der jeden an die Heiligkeit des Ortes zu erinnern hatte.