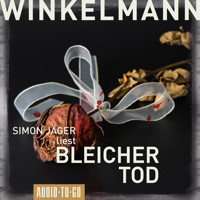9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Meisterhafte Hochspannung: der neue Thriller von Nr.-1-Bestsellerautor Andreas Winkelmann. Die Zeit – sie verrinnt uns zwischen den Fingern. Sie wird uns gestohlen. Wir verschwenden sie. Was, wenn jemand bereit ist, für dieses kostbare Gut zu töten? Meine Liste wird immer länger … Darauf stehen Menschen. Menschen wie du. Ihr alle habt mir etwas genommen. Ihr wisst es nicht, aber ich werde euch finden. Euch jagen, ohne Gnade. Du fragst dich, warum? Genau das ist das Problem. Ihr alle seid achtlos, rücksichtslos. Und dafür müsst ihr bezahlen. Mit dem Kostbarsten, was ihr habt. Auch du könntest auf dieser Liste stehen, ohne es zu wissen. Und deine Zeit läuft ab …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Andreas Winkelmann
Hast du Zeit?
Thriller
Über dieses Buch
Meine Liste wird immer länger …
Darauf stehen Menschen. Menschen wie du. Ihr alle habt mir etwas genommen. Ihr wisst es nicht, aber ich werde euch finden. Euch jagen, ohne Gnade. Du fragst dich, warum?
Genau das ist das Problem. Ihr alle seid achtlos, rücksichtslos. Und dafür müsst ihr bezahlen.
Mit dem Kostbarsten, was ihr habt. Auch du könntest auf dieser Liste stehen, ohne es zu
wissen.
Und deine Zeit läuft ab …
«Winkelmann. Freunde des Thriller-Genres wissen, dass sie es hier mit einem Meister seiner Zunft zu tun haben.» Kölner Stadt-Anzeiger
Vita
In seiner Kindheit und Jugend verschlang Andreas Winkelmann die unheimlichen Geschichten von John Sinclair und Stephen King. Dabei erwachte in ihm der unbändige Wunsch, selbst zu schreiben und andere Menschen in Angst zu versetzen. Heute zählen seine Thriller zu den härtesten und meistgelesenen im deutschsprachigen Raum. In seinen Büchern gelingt es ihm, seine Leserinnen und Leser von der ersten Zeile an in die Handlung hineinzuziehen, um sie dann gemeinsam mit seinen Figuren in ein düsteres Labyrinth zu stürzen, aus dem es scheinbar kein Entrinnen gibt. Die Geschichten sind stets nah an den Lebenswelten seines Publikums angesiedelt und werden in einer klaren, schnörkellosen Sprache erschreckend realistisch erzählt. Der Ort, an dem sie entstehen, könnte ein Schauplatz aus einem seiner Romane sein: der Dachboden eines vierhundert Jahre alten Hauses am Waldesrand in der Nähe von Bremen.
Sie möchten regelmäßig über Neuerscheinungen, Veranstaltungen und aktuelle Gewinnspiele von Andreas Winkelmann informiert werden?
Dann abonnieren Sie den Newsletter unter www.rowohlt.de/verlag/andreas-winkelmann/gefahrenzone, besuchen die Website www.andreaswinkelmann.com oder folgen dem Autor auf www.facebook.com/andreas.winkelmann.schriftsteller oder www.instagram.com/winkelmann.andreas.autor.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Zitat aus: «Lucius Annaeus Seneca, Des Philosophen Werke», Band 12, Briefe 1, übersetzt von August Pauly, Stuttgart: Metzler, 1832
William Earnest Henley, «Invictus», mit Dank an https://de.wikipedia.org/wiki/Invictus_(Gedicht) (Creative Commons 4.0)
Covergestaltung zero-media.net, München
Coverabbildung FinePic®, München
ISBN 978-3-644-01829-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Erst wenn wir begreifen, dass es kein weiterer Tag ist, sondern ein Tag weniger, beginnen wir, die wichtigen Dinge zu schätzen.
Autor unbekannt
Prolog
Ich liebe meine Wand.
Sie ist wunderschön.
Wie sich das Licht darin bricht und der Raum von einem grünen Schimmer beherrscht wird, der zu oszillieren scheint. So als hätte er Herzschlag und Puls. Und das hat er ja auch, in gewisser Weise.
Ich liebe meine Wand. Alles an ihr habe ich selbst erschaffen. Das rohe Walnussholz habe ich mühevoll in tagelanger Arbeit geschliffen, weil ich mir behandeltes Holz nicht leisten kann. Danach habe ich es so lange geölt, bis ich mit der Maserung zufrieden war. Und es ist nicht leicht, mich zufriedenzustellen. Ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich selbst. Niemand kann den erfüllen, nur ich, das macht mich zu einem einsamen, aber glücklichen Menschen.
Ich liebe meine Wand. Sie bietet ausreichend Platz für die nächsten, na ja, ich würde meinen, zehn Jahre. Das kommt darauf an, wie fleißig ich bin. Ich habe aber schon gemerkt, dass es schwierig werden wird. Denn es gibt zu viele von ihnen. Überall, jeden Tag, laufen sie mir über den Weg.
Meine Liste wird länger und länger.
Ich kann mir einen, zwei, vier oder sechs im Monat holen und in meine Wand einfügen und würde sie doch nicht abarbeiten können. Aber das spielt keine Rolle, denn die Zeit ist auf meiner Seite, und endlich hole ich mir zurück, was mir gehört.
Kapitel 1
1.
Januar 2020. Nachmittag. 17:45 Uhr.
«Tut mir leid. Ich habe keine Zeit.»
Mit dem Handy am Ohr stieß Maren Liefers die Hintertür des Bestattungsinstituts auf. Sie nannten sie die Tür der Toten, weil durch sie die Leichen ins Gebäude gebracht wurden.
«Und selbst wenn ich sie hätte, könnte ich Ihnen nicht weiterhelfen. So etwas unterliegt bei uns absoluter Diskretion.»
«Das verstehe ich», sagte die Anruferin. «Aber ich muss einfach wissen …»
«Hören Sie», unterbrach Maren Liefers sie, «hier wartet eine Leiche auf mich. Ich muss Schluss machen.»
«Können Leichen wirklich warten?», fragte die Anruferin.
«Wie bitte?»
«Wenn jemand Zeit hat, dann die Toten, oder nicht?»
«Wollen Sie mich verarschen?»
«Das liegt mir fern, aber ich muss …»
Maren Liefers beendete das Telefonat abrupt.
Die Frau ging ihr auf die Nerven. Bereits zum dritten Mal bedrängte sie sie, ihr bei der Suche nach einer verstorbenen Verwandten zu helfen. Maren hatte ihr gesagt, dass so etwas nicht am Telefon möglich war und sie sich an die entsprechenden Ämter wenden sollte.
Sie atmete seufzend aus, um diesen Druck auf ihrem Brustkorb loszuwerden. In letzter Zeit hatte sie häufig das Gefühl, nicht richtig durchatmen zu können, und das machte ihr Angst. Mit fünfundvierzig war sie in einem gefährdeten Alter, ein Herzinfarkt nicht ausgeschlossen, vor allem bei dem Stress, dem sie ausgesetzt war. Zudem achtete sie seit Längerem nicht mehr auf ihr Gewicht und aß zu viele Süßigkeiten.
Heute liefen vier Mahnfristen ab, und sie wusste nicht, wovon sie die Rechnungen bezahlen sollte. Zwar stimmte der alte Spruch «Gestorben wird immer», aber in schlechten Zeiten müsste es wohl heißen «immer billiger». Auch bei den Beerdigungskosten wurde gespart. Kaum jemand leistete sich noch die teuren Särge, von denen sie zu viele im Lager hatte.
Maren öffnete beide Flügel der Tür und hakte sie am Boden ein. Dann trat sie ein paar Schritte vom Gebäude weg.
Die Sonne war vor einer Stunde untergegangen, Dunkelheit lag auf den Feldern, hinter denen der Waldrand eine schwarze, undurchdringliche Wand bildete. Wehmütig betrachtete sie das flache Gebäude mit dem beleuchteten Schriftzug über dem Eingang. Bestattungen Liefers. Ein alteingesessener Betrieb, von ihrem Vater gegründet, der Tischler gewesen war und noch selbst Särge angefertigt hatte. Seit fünfzehn Jahren lagen die Geschicke des Betriebs in ihren Händen. Wie lange wohl noch?, fragte sie sich.
Ein Geräusch riss Maren aus ihren Gedanken.
Es klang wie ein brechender Ast irgendwo in dem kleinen Waldstück, das zwischen diesem und dem Nachbargrundstück lag. Sie lauschte, doch das Geräusch wiederholte sich nicht. Wahrscheinlich nur ein Reh, von denen gab es hier mehr als genug. Eine Gänsehaut bekam Maren dennoch, und ihr wurde bewusst, wie einsam es hier draußen war. Bis in den Ort fuhr man fünf Minuten mit dem Wagen. Früher hatte es nebenan eine Kneipe gegeben, doch die war längst pleite.
Plötzlich durchschnitt Scheinwerferlicht die Dunkelheit.
Das war ihr neuer Mitarbeiter Jörn, eine Aushilfskraft. Er brachte die Leiche, von der sie zu der Anruferin gesagt hatte, sie würde bereits warten. Eine kleine Lüge, um die Frau loszuwerden.
Viel zu schnell fuhr Jörn die sündhaft teure, schwarze Limousine vor das Gebäude. Maren hatte ihn mehrfach gebeten, langsam zu fahren, weil sie fand, dass sich das für einen Leichenwagen so gehörte, aber er schien sich nicht daran halten zu wollen. Früher hätte sie ihn gleich gefeuert, heute musste sie froh sein, überhaupt jemanden zu haben. Geschickt setzte Jörn den Wagen rückwärts vor die geöffnete Tür und stieg aus.
«Du sollst langsam fahren», erinnerte Maren ihn.
«Vielleicht will ich auch irgendwann Feierabend machen», erwiderte Jörn genervt.
«Wie bitte?» Maren konnte nicht glauben, was sie da hörte. Jörn hatte erst vor vier Wochen bei ihr angefangen und anfangs einen guten Eindruck gemacht, doch der hatte nicht lange angehalten. Jörn wurde zunehmend renitent und unhöflich.
«Wenn ich Heiko nicht am Bahnhof abgesetzt hätte, hätte ich schon Schluss», motzte er. In der Dunkelheit erschienen seine kleinen Augen noch kälter als sonst. Wie zwei Onyx-Steine, an denen alle Gefühle abprallten.
«Und Heiko wollte eigentlich heute freihaben, weil seine Frau Geburtstag hat, ist aber trotzdem gekommen, damit du die Leiche nicht allein holen musst. Da ist es ja wohl nur kollegial, ihn am Bahnhof abzusetzen.»
Maren sprach mit scharfer Stimme, um Jörn klarzumachen, dass er sich unfair verhielt.
«Ich habe auch keine Zeit. Aber mich fragt ja keiner», brummte Jörn in seinen Vollbart, den Maren nicht mochte, weil er so viel von seinem Gesicht verdeckte.
Schwungvoll öffnete er die Kofferraumtüren.
«Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass du flexibel sein musst», erinnerte Maren ihn.
«Jaja», erwiderte Jörn und zog unsanft die Überführungsliege heraus.
In dem grauen Spezialsack mit Reißverschluss befand sich ein dreiundneunzig Jahre alter Mann aus dem Ort, den seine Enkelin am Nachmittag tot im Lesesessel gefunden hatte. Der Arzt hatte einen Herzinfarkt diagnostiziert. Ein friedlicher Tod am Ende eines langen Lebens. Maren musste an ihr eigenes Herz denken, das schon jetzt Probleme bereitete.
«Park noch den Wagen, danach komme ich allein zurecht», sagte Maren und unterdrückte ein Seufzen.
Wortlos kam Jörn der Anweisung nach. Er stellte den Bestattungswagen in der Garage ab und brachte ihr die Schlüssel.
«Schönen Abend noch», sagte er mit einem merkwürdigen Ton in der Stimme.
«Dir auch», antwortete Maren und hatte Mühe, ihren Ärger unter Kontrolle zu halten. Sie brauchte Jörn und durfte ihn nicht vergrätzen.
Maren trat ans Kopfende der Überführungsliege und schob sie ins Gebäude. Als die Räder über eine Unebenheit rollten, schien es so, als würde sich in dem Leichensack etwas bewegen. Das kannte Maren schon, aber heute setzte es ihr zu. Ihr Nervenkostüm war gerade nicht das beste. Daher beschloss sie, sich erst morgen um den alten Mann zu kümmern, vorerst kam er in den Kühlraum. Der war leer. Leider, wie Maren fand. Ein paar Aufträge mehr wären wünschenswert – und nötig. Bevor sie die Kühlung betrat, überprüfte sie die Notöffnung. Jenen Griff an der Innenseite, der verhindern sollte, dass man sich selbst einsperrte – und der in dem höchst unwahrscheinlichen Fall eines fälschlich für tot Befundenen dem Wiederauferstandenen einen Ausgang sicherte. Das war noch nie vorgekommen, aber vor Jahren hatte Maren sich einmal eingesperrt, weil der Mechanismus versagt hatte. Grauenhaft war das gewesen, einfach nur grauenhaft, vor allem, weil die Kühlung damals voll gewesen war.
Nachdem der alte Herr untergebracht war, drückte Marens Blase – wie immer, wenn ihr kalt war.
Zwischen den rund ein Dutzend ausgestellten Särgen eilte sie durch die Halle zur Toilette.
Als sie auf der Schüssel saß, hörte sie ein Geräusch. Es klang wie das Schaben von Ledersohlen auf dem Parkett in der Ausstellungshalle.
«Jörn? Bist du das? Hast du etwas vergessen?»
Sie bekam keine Antwort, hielt den Atem an und lauschte.
Hatte sie sich getäuscht?
Offiziell war ab siebzehn Uhr geschlossen, über ihr Handy war Maren aber jederzeit erreichbar. Menschen starben schließlich nicht nur zu den Öffnungszeiten, und sie konnte es sich nicht leisten, sich irgendeinen Toten durch die Lappen gehen zu lassen. Es war unter anderem diese ständige Erreichbarkeit, die sie so stresste. Das Handy war zu einem Feind geworden, der ihr als Freund und Helfer getarnt Schlaf, Zeit und Lebensqualität raubte.
«Hallo?», rief Maren. «Ist da jemand?»
Plötzlich ging das Licht im Toilettenraum aus. Da es hier kein Fenster gab, nur eine Lüftungsanlage, war es sofort dunkel. Maren wagte kaum zu atmen und fühlte sich verletzlich in ihrer Position mit heruntergelassener Hose auf der Toilette. Sie traute sich aber nicht, sich zu bewegen, blieb still sitzen, lauschte.
Wieder leise Schrittgeräusche – und sie kamen näher. Auf die kleine Kabine zu, in der sie hockte. Die Wände, noch von ihrem Vater gebaut, bestanden aus leichtem Pressholz und taugten nicht als Schutz, dennoch wollte Maren glauben, hier drinnen sicher zu sein.
Die Schritte verharrten vor der Tür zur Toilette.
Dann pochte es dreimal an der Kabinentür. Langsam, vorsichtig, so als hätte die Person davor alle Zeit der Welt.
Maren presste sich eine Hand vor den Mund, um einen Schrei zurückzuhalten. Das war dumm, denn wer immer vor der Tür stand, wusste ja, dass sie hier drinnen war.
«Hast du Zeit?», fragte eine leise, weiche Stimme. Eine Stimme, die ihr vage bekannt vorkam, aber der Mann sprach flüsternd, sie war sich nicht sicher.
«Wer ist da?», rief Maren. Ihre Stimme klang panisch.
Eine Antwort bekam sie nicht.
«Ich habe mein Handy hier … ich rufe die Polizei, die ist in fünf Minuten hier.»
Das war gelogen, denn die nächste Dienststelle war eine halbe Stunde Autofahrt entfernt. So war das eben auf dem Land.
Plötzlich ein harter Schlag gegen die Tür. Die ganze Kabine erzitterte, und Maren schrie auf. Das Handy entglitt ihr, sie sprang von der Toilette, und als sie ihre Hose hochzog, erschütterte ein weiterer Schlag die Kabine. In der Nähe der Verriegelung barst das Holz. Maren zog sich an die hintere Wand zurück und kletterte auf die Schüssel. Sie wusste, sie war nicht beweglich genug, um über die Kabinenwand zu klettern, wollte es in ihrer Panik aber dennoch versuchen. Zwischen Wand und Decke gab es eine dreißig Zentimeter hohe Lücke.
Der dritte Schlag zerstörte die Verriegelung, und die nach außen öffnende Tür wurde aufgezogen. Panisch zog Maren sich an der Wand hoch, wuchtete sich mit dem Bauch auf die obere Kante und strampelte mit den Beinen, kam aber nicht weit.
Jemand packte ihre Unterschenkel. Maren schrie, kämpfte dagegen an, wurde aber von der Wand heruntergezogen. Sie verlor den Halt, schlug mit dem Oberkörper auf die Toilettenschüssel und spürte Rippen brechen. An den Beinen wurde sie aus der engen Kabine bis in den Ausstellungsraum für die Särge gezogen. Dort ließ der Angreifer sie los. Da Maren auf dem Bauch lag, konnte sie ihren Peiniger, der hinter ihr stand, nicht sehen, ohne ihren Hals zu verdrehen. Der höllische Schmerz in ihrem Oberkörper ließ das aber nicht zu. Er lähmte sie und raubte ihr den Atem. Einen Augenblick später spürte sie einen Einstich im Gesäß.
Für einen Moment konnte sie ihre Gegenwehr noch aufrechterhalten, dann wurde ihr schwarz vor Augen.
«Hast du Zeit?», fragte die Stimme abermals.
2.
Vier Jahre später. März 2024. Morgen. 05:07 Uhr.
Constanze Goldmann warf einen gehetzten Blick auf ihre Armbanduhr.
«Ich muss los, aber … ich traue mich kaum noch, da rauszugehen. Ich habe Angst, richtige Angst, verstehst du?»
Sie saßen auf den abgewetzten Holzbänken im Umkleidebereich des Krankenhauses. Um sie herum Spinde aus grün lackiertem Schichtholz, langweilige graue Fliesen an den Wänden und auf dem Fußboden.
Conny war Krankenschwester im Nachtdienst der Chirurgie. Davor war sie bereits Pflegerin für Wachkomapatienten und Arzthelferin gewesen, alles Berufe, die ihr einiges abverlangt hatten. Sie war immer tough gewesen, hatte sich nie die Butter vom Brot nehmen oder den Lebensmut rauben lassen. Sie war groß und kräftig und konnte zupacken. Nun aber wirkte sie eingeschüchtert und kleiner als sonst, ihr Rücken nicht mehr gerade, ihr Blick nicht länger fest, das Strahlen in ihren Augen nur noch ein Glimmen.
Michelle Burghardt machte sich Sorgen um ihre Freundin und Kollegin. Die Veränderungen waren nicht über Nacht eingetreten. Sie hatten sich im Laufe der letzten Wochen eingestellt, anfangs schleichend und kaum wahrnehmbar, dann aber schnell immer vehementer. Die Angst war eine Gegnerin, die unfair kämpfte und kaum einen Kampf verlor. Sie lauerte, beobachtete, befühlte, war ausdauernd und wartete auf einen Moment der Schwäche. Wenn die Menschen müde wurden zum Beispiel – so wie Conny jetzt am Ende ihrer Nachtschicht. Die Anspannung, der Stress, der Schlafmangel nisteten in den Augenhöhlen der Achtundzwanzigjährigen und verschatteten die Lachfalten. Sie lachten gern miteinander, aber auch das war weniger geworden.
«Hast du schon mit deinem Vater sprechen können?», fragte Conny, erhob sich und öffnete das Schloss an ihrem Spind.
«Hab ich», sagte Michelle Burghardt seufzend. «Und war überrascht, dass er so ablehnend reagierte. Ehrlich, ich dachte, der freut sich, gebraucht zu werden. Ist aber nicht so.»
«Also macht er es nicht», sagte Conny enttäuscht und zog den apfelgrünen Schlupfkasack aus, den sie hier alle während der Arbeit trugen. Dabei streifte sie das Haarband ab und ihr dunkles Haar fiel auf ihre nackten Schultern.
«Doch. Ich bin sicher, er macht es», sagte Michelle. «Er war nicht begeistert, als ich ihn gefragt habe, aber ich denke, ich muss ihn nur noch ein bisschen bearbeiten. Glaub mir, ich schaff das. Gleich morgen rede ich noch einmal mit ihm. Versprochen!»
Michelle war nicht so zuversichtlich, wie sie vorgab, aber es tat ihr weh, ihre Freundin so verzweifelt zu sehen. Sie wollte sie ein wenig aufmuntern.
Das kaltweiße Licht der LED-Röhren in der Decke fiel auf Connys nackte Haut und ihr Gesicht und ließ sie blasser wirken, als sie war. Abermals schaute Conny auf ihre Armbanduhr, und Michelle sah ihr an, was sie dachte. Sie hätte die Zeit hier in der Sicherheit des Umkleideraums gern angehalten, aber die Minuten verrannen gnadenlos. Wie sie es immer taten, ganz gleich, was Menschen sich wünschten.
«Ist denn irgendwas … vorgefallen?», fragte Michelle, während sie aus ihren Alltagsklamotten schlüpfte und sie in ihren Spind hängte.
Conny strich sich das Haar zurück und band es erneut zu einem Pferdeschwanz.
«Gestern Abend, da …», sie schüttelte den Kopf. «Du weißt doch, meine Terrassentür geht zum Bach raus …»
Michelle nickte. Sie kannte Connys Wohnung von einigen Besuchen.
«Ich mache immer den Vorhang zu, sobald es dunkel wird, und gestern … da war jemand, unten am Bach, zwischen den Büschen. Stand einfach nur da und starrte zu mir herauf. Ich hätte ihn gar nicht gesehen, wenn das Mondlicht nicht so hell gewesen wäre. Sein Gesicht hat es reflektiert.»
«Scheiße», flüsterte Michelle. Eine Gänsehaut lief ihr über den Körper. «Und dann?»
«Nichts. Ich bin vom Vorhang weg, um das Telefon zu holen, und als ich wieder zurückkam, war er fort.»
«Vielleicht ist er nur ein kleiner mieser Feigling, der sich gar nicht traut, dir etwas anzutun.»
«Aber das tut er doch schon! Weil diese Angst unerträglich ist. Weil ich nicht mehr richtig schlafen kann. Manchmal wünsche ich mir, er würde endlich zuschlagen, mich angreifen, mich … was auch immer, Hauptsache, diese Ungewissheit endet und …»
Conny brach ab, atmete tief ein und schloss die Augen. Als sie sie wieder öffnete, waren sie feucht. Es fiel ihr sichtlich schwer, die Tränen zurückzudrängen.
Michelle ging zu ihr, nahm sie in die Arme und drückte sie.
Doch sie hatten leider keine Zeit, sich lange in den Armen zu liegen, denn Michelles Schicht begann gleich. Sie kam, Conny ging, das war häufig so.
«Hast du es noch einmal bei der Polizei versucht? Die müssen doch irgendwas tun. Diese Liste mit Patienten zum Beispiel, die du erstellt hast, da waren doch welche dabei, die dich erfolglos angebaggert haben oder dir blöd gekommen sind … warum arbeiten sie die nicht ab!»
Conny schüttelte den Kopf. «Das bringt nichts. Die sagen mir sowieso wieder, dass sie nichts tun können, solange keine Straftat vorliegt. Schon gar nicht, wenn sie nicht wissen, gegen wen sie vorgehen sollen.»
Sie zog einen warmen gelben Rollkragenpulli an, während Michelle ihre Arbeitshose anzog.
«Weißt du, was ich mir von diesem überheblichen Polizisten anhören musste?»
«Was denn?»
«Geister verfolgen wir nicht. Und dann hat er mich angesehen, als hätte ich den Verstand verloren.»
«Arschloch!», stieß Michelle aus, obwohl sie den Polizisten ein wenig verstehen konnte. Conny hatte nichts vorzuweisen außer dem Gefühl, verfolgt und beobachtet zu werden.
«Glaubst du mir eigentlich?», fragte Conny unvermittelt, und es klang, als hätte sie sich die Antwort darauf schon selbst gegeben. Ein weiterer Mensch, der an ihrem Verstand zweifelte, ihr insgeheim eine Therapie anriet, sie früher oder später meiden würde, weil niemand so etwas allzu lange aushielt. Nicht nur Glück wuchs, wenn man es teilte, Angst ebenfalls. Michelle spürte, wie auch sie ihre Umgebung anders wahrnahm, nach Männern Ausschau hielt, die sie eventuell beobachteten.
Michelle nahm die Hand ihrer Freundin. Sie war kalt, außerdem rau von den Desinfektionsmitteln.
«Ich glaube dir. Sonst hätte ich nicht vorgeschlagen, meinen Vater um Hilfe zu bitten. Es ist echt schwierig zwischen ihm und mir, und es hat mich ganz schön Überwindung gekostet, ihn anzurufen. Ehrlich, er ist der seltsamste Mensch, den ich kenne.»
Michelle hörte selbst, wie angefasst sie klang. Sie war es aber nicht wegen des unausgesprochenen Vorwurfs ihrer Freundin, sondern weil es doch normal sein sollte für eine Tochter, den eigenen Vater um Hilfe zu bitten. Eigentlich sollte man sich dazu nicht überwinden müssen.
«Tut mir leid, das war nicht so gemeint», sagte Conny. «Ich würde nur gern mal wieder eine Nacht durchschlafen, ohne von jedem kleinsten Laut geweckt zu werden.»
«Schon gut, mach dir keine Gedanken. Ich verspreche dir, mein Vater wird dir helfen. Ich werde ihn davon überzeugen.»
«Ich bin dir wirklich dankbar … egal, ob es klappt oder nicht.»
«Das klappt schon.»
Conny stieg in ihre weißen Sneaker und stand mit einem Ruck von der Holzbank auf.
«Dein Dienst fängt gleich an, und ich muss los, sonst verpasse ich die Bahn.»
Michelle begleitete ihre Freundin bis zum Personaleingang und stieß die schwere Metalltür auf. Draußen war es noch dunkel, zudem lag Nebel über dem Land. Er dämpfte das Licht der Straßenlaternen und die Geräusche der langsam erwachenden Stadt. Es war eine unheimliche, bedrückende Stimmung, in die niemand gern einen Fuß setzte – nicht einmal ohne die Ängste, die Conny gerade ausstand.
Sie umarmten sich. «Du schaffst das», flüsterte Michelle ihrer Freundin zu. «Schick mir eine WhatsApp, sobald du zu Hause bist, okay? Du weißt ja, höre ich nach vierzig Minuten nichts von dir, setze ich Himmel und Hölle in Bewegung.»
Conny versprach es ihr und trat hinaus in den frühen Morgen. Schon nach wenigen Metern verschwand sie im Nebel.
Michelle fühlte sich furchtbar dabei, ihre Freundin mit all der Angst im Gepäck allein dort hinausgehen zu lassen. Mühsam kämpfte sie den Drang nieder, ihr hinterherzulaufen, denn sie hatte keine Zeit mehr.
Ihre Schicht begann.
In diesem Moment war sie so allein, wie ein Mensch nur sein konnte.
3.
Morgen. 05:38 Uhr.
Frühmorgens zwischen fünf und sechs trafen die ersten Berufspendler an dem kleinen Bahnhof der Kreisstadt ein. Die meisten schotteten sich mit Kopfhörern von ihrer Umwelt ab, einige starrten zusätzlich aufs Handy.
Constanze Goldmann aber hatte für ihr Handy keinen Blick übrig. Sie beobachtete ihre Umgebung, suchte nach Personen, von denen eventuell eine Bedrohung ausging. Dabei war das Quatsch. Er zeigte sich nicht. Er war der Schemen, der im Nebel dort entlanghuschte, wo die Sicht endete und das Ungewisse begann.
Conny fror. Klar, es war kühl jetzt Anfang März, aber nicht wirklich kalt, und sie trug einen warmen Parka. Als der Regionalzug einfuhr, brachte er einen zusätzlichen Schwall kalter Luft mit unter das stählerne Überdach. Rasch stieg Conny in den Waggon gleich hinter der Lok – so wie immer. Zwar gab es keine Verbindungstür zwischen Lok und Waggon, aber es fühlte sich besser an, nicht allzu weit von der Person entfernt zu sein, die den Zug steuerte.
Rationalität war der Hoffnung immer unterlegen. Fast ein Naturgesetz.
Mit ihr stieg rund ein Dutzend Pendler in den Waggon. Es gab genug freie Plätze, die Menschen verschwanden zwischen den Sitzen, jeder und jede für sich. Die Augen schließen, ein wenig Schlaf nachholen bis zum Zielort.
Conny setzte sich auf den freien Platz direkt an der Tür. Dort störten keine Rückenlehnen den Blick, sie konnte sehen, wer oder was auf sie zukam, und obwohl auch sie müde war, schloss sie die Augen nicht, sondern blieb wachsam. Es war anstrengend, ständig auf der Hut sein zu müssen, diese Anspannung veränderte ihren Körper. Machte die Muskeln in Rücken und Nacken hart, was zu Kopfschmerzen führte. Umklammerte den Magen, was in Bauchschmerzen resultierte. Und am allerschlimmsten: Es veränderte die Gedanken. Seitdem das alles angefangen hatte, war Conny nicht mehr dieselbe.
Sie konnte nicht einmal genau sagen, wann es begonnen hatte. Mal ein ungutes Gefühl hier, mal ein Zusammenzucken dort, wer kannte das nicht, gerade, wenn man wegen des Jobs auch abends und nachts unterwegs sein musste. Aber dabei war es nicht geblieben. Jemand verfolgte sie, und das schon seit einigen Wochen. Conny brauchte nicht die Bestätigung ihrer Sinnesorgane wie Augen und Ohren, um das zu wissen. Sie spürte ihn. Ihr kam es so vor, als spionierte er ihren Tages- und Lebensablauf aus. Als wollte er den perfekten Moment herausdestillieren, um zuschlagen zu können.
Aber wer war er? Und warum gab er sich nicht zu erkennen? Was wollte er von ihr? Die Polizisten, mit denen sie vor ein paar Tagen noch gesprochen hatte, tippten auf einen heimlichen Verehrer oder jemanden, den sie hatte abblitzen lassen. Dieser Liste, von der Michelle gesprochen hatte, wollten sie aber nicht nachgehen. Ehemalige Patienten, die vielleicht beleidigt waren, weil Conny nicht mit ihnen geflirtet hatte, nein, das erschien den Beamten dann doch etwas zu dünn.
Natürlich hatte sie an Mats gedacht, dessen Einladung zu einem Date sie abgewiesen hatte. Aber das lag anderthalb Jahre zurück, da hatte sie noch in der Betreuung von Wachkomapatienten gearbeitet. Mats hatte sich offenbar in sie verliebt, und obwohl er ein sympathischer Mann war, hatte sie Nein gesagt. Sich mit Patienten oder deren Angehörigen einzulassen war nicht gut. Sie hatte der Polizei von Matthias Kaminski erzählt, wusste aber nicht, ob die ihn aufgesucht hatte, und glaubte auch letztlich nicht, dass er dahintersteckte.
Der Zug hielt an der ersten Haltestelle.
Ein Dutzend weitere Fahrgäste stieg ein.
Jemand ließ sich in die Sitzbank auf der anderen Gangseite fallen, nur eine Armeslänge von Conny entfernt. Sie warf ihm einen Blick zu.
War er es? Die Kapuze des Hoodies verhinderte, dass sie sein Gesicht sehen konnte.
Wenn jede Person ein potenzieller Feind war, fühlte man sich gänzlich verlassen, und wer glaubte, der Tod sei schlimm, kannte dieses Gefühl nicht.
Zehn Minuten später stürzte Conny überhastet aus dem Waggon, und erst als der Zug weiterfuhr, konnte sie wieder frei atmen. Dies war nicht der Bahnhof des Ortes, in dem sie lebte. Sie war eine Station früher ausgestiegen, weil sie am Abend auch hier eingestiegen war. Normalerweise ging sie zu Fuß von ihrer Wohnung zum Bahnhof. Hierher war sie extra fünfzehn Minuten mit dem Auto gefahren, weil sie gelesen hatte, man solle keine Routinen offenbaren, wenn man einen Stalker am Hacken hatte.
Krank, das war einfach nur krank.
Conny lief los Richtung Parkplatz.
Da der Zug gerade eben abgefahren war, war der Bahnhof leer. Wasser tropfte von den Zweigen der Bäume, die ihre Äste in den Nebel streckten. Krähen, die Conny nicht sehen konnte, krächzten sich über ihren Kopf hinweg lautstark an. Sie konnte ihren kleinen grünen Wagen dort vorn auf dem Parkplatz schon sehen. Er stand zwischen einigen anderen, die erst kurz zuvor eingeparkt hatten und deshalb nicht komplett von winzigen Wassertropfen überzogen waren.
Ihrer schon, er stand ja bereits die ganze Nacht lang dort.
Aber was war das für eine Stelle an der Scheibe der Fahrertür?
Als Conny am Auto war, wusste sie es.
Jemand hatte einen kreisrunden Bereich auf der Scheibe frei gewischt, um in den Wagen schauen zu können.
Und das musste gerade eben passiert sein.
Ihr Herz begann zu rasen, hektisch schaute sie sich nach allen Seiten um, doch da war niemand. Sie wischte die Wassertropfen von der hinteren Scheibe, um einen Blick auf den Rücksitz zu werfen. Versteckte sich jemand dort? Es sah nicht danach aus, aber es war zu dunkel, um es ausschließen zu können.
Conny trat einen Schritt zurück.
Was sollte sie tun?
Die Polizei anrufen?
Nein, das konnte sie nicht bringen, nachdem sie die kleine Dienststelle ihres Wohnorts schon viel zu oft genervt und sich am Ende diesen Satz mit dem Geist eingehandelt hatte.
Den Bus oder ein Taxi nehmen?
Für einen Moment erschien ihr das vernünftig. Doch dann fand sich irgendwo in ihren Synapsen eine rationale Verbindung, und Conny fragte sich, zu was sie sich noch treiben lassen wollte. Würde sie sich bald zu Hause verstecken, nicht mehr zur Arbeit gehen, keine Freundinnen mehr treffen, sich aus dem Leben verabschieden? Wo sollte das enden? War es nicht genau das, was ihr Stalker beabsichtigte?
In diesem Augenblick beschloss Conny, das Spiel nicht mehr mitzuspielen. Schluss jetzt. Es reichte. Sie wollte die Kontrolle über ihr Leben zurück, konnte so nicht weitermachen. Also entriegelte sie den Wagen, schaute zuerst in den Fond, setzte sich dann hinters Steuer und fuhr los.
Und sah im Rückspiegel gerade noch, wie eine große Gestalt in dunkler Jacke aus der alten Bushaltestelle aus Waschbetonplatten trat und ihr hinterherschaute.
4.
Morgen. 06:17 Uhr.
In der hohlen Hand zündete er sich eine Zigarette an und ließ seinen Blick über den Vorplatz des kleinen Bahnhofs gleiten. Beobachtete ihn jemand? Er hatte sich alle Mühe gegeben, wie ein normaler Berufspendler zu wirken, und er würde dieses Bild vervollständigen, wenn er in den Bus stieg, der in wenigen Minuten hier eintreffen und ihn in dem Dorf ausspucken würde, wo die junge Frau lebte, der er eben noch beim Einsteigen in ihren kleinen grünen Wagen zugeschaut hatte.
Der Qualm der ersten Zigarette des Tages blieb in seiner Luftröhre hängen, er räusperte sich lautstark und spuckte einen Batzen Schleim in das farblose Gras neben der Bushaltestelle. Dort lag bereits Hundekot, gekringelt wie ein Kunstwerk, aber wegen der Feuchtigkeit in Auflösung begriffen. Hundehalter sahen alles zu jeder Zeit, niemand war sicher vor denen, die allermeisten Leichenfunde in irgendwelchen Wäldern gingen aufs Konto von Menschen, die ihre Hunde zum Kacken ausführten.
Sei’s drum.
Hier war keiner zu sehen.
Ihm fiel auf, dass die alte analoge Uhr am Bahnsteig ausgefallen war. Schwarze Zeiger auf weißem Grund, die sich entschieden hatten, das Ende der Zeit auf 15:22 Uhr festzusetzen. Warum nicht? War genauso gut wie jede andere Uhrzeit. Er musste daran denken, dass seine eigene innere Uhr schon vor mehr als dreißig Jahren stehen geblieben war.
Von der anderen Seite näherten sich zwei Autos, bogen auf die schmale Zufahrt zum Parkplatz ab und schreckten ihn auf. Vielleicht hätte er noch ein paar Sekunden gehabt, um sich ungesehen zu verstecken, aber warum? Er wartete auf den Bus. Daran war nichts Verdächtiges.
Scheißwetter, dachte er. Ein Wetter, das zum Töten einlud. In skandinavischen Krimis töteten die Mörder immer bei solchem Wetter. Die wussten schon, warum.
Als der Bus kam, suchte er sich drinnen einen Fensterplatz und starrte stur durch das schmutzige Glas hinaus.
Er spürte Trauer in sich, die keinen bestimmten Bezugspunkt hatte. Sie war allgegenwärtig, ein Weltschmerz epischen Ausmaßes. Die weisesten und klügsten Menschen litten daran, denn wie er hatten auch sie die eigene Machtlosigkeit erkannt und sich eingestanden, ein Niemand zu sein. Vielleicht fühlte er sich deshalb so einsam.
Der Bus hielt im nächsten Dorf, wo er als Einziger ausstieg. Er rammte die Hände in die Taschen seiner gefütterten Jacke und machte sich mit langen Schritten auf den Weg. Die Adresse kannte er.
Er war überrascht, als ihr kleines grünes Auto ihn überholte, während er mit gesenktem Kopf und runden Schultern den Gehsteig entlangmarschierte. Eigentlich hätte sie einige Minuten früher eintreffen müssen. Womit hatte sie die Zeit verbracht?
Sie parkte am Straßenrand vor dem zweigeschossigen Haus, das sein wahres Alter hinter einem weißen Dämmmantel versteckte. Hier bewohnte sie die rechte Seite des Erdgeschosses. Nach hinten hinaus hatte sie einen kleinen Garten mit Terrasse, nichts Besonderes, aber hübsch. Nach allem, was er durch die Fenster gesehen hatte, war auch ihre Wohnung so eingerichtet. Hübsch.
Er war fünfzig Meter entfernt, als sie ausstieg. Sie schaute sich um, sah ihn kommen, zögerte kurz, schien zu überlegen, ob sie wieder einsteigen und den Wagen verriegeln sollte. Sie entschied sich dagegen, nahm den kleinen Rucksack vom Rücksitz sowie eine Brötchentüte, womit geklärt war, warum sie länger gebraucht hatte. Sie schlug die Autotür zu und ging zum Haus hinüber, wobei sie sich immer wieder nach ihm umsah.
Wie einfach es wäre, sie jetzt zu überwältigen. Sie in ihre Wohnung zu drängen und ihr anzutun, wovor sie sich so fürchtete. Sicherheit gab es nicht, für niemanden. Es lebte sich entspannter, wenn man akzeptierte, dass der Tod nichts weiter war als ein Minussymbol. Subtraktion von der Stunde der Geburt an. Das Leben verging. Jede Sekunde, jede Stunde, jeden Tag. Und was verging, das starb. Die Menschen verschoben den Tod aufs Ende, weit nach hinten, wo sie ihn nicht sehen mussten, dabei tickte er an ihren Handgelenken, in ihren Handys, in ihren Genen. Immerzu. Immer lauter, je länger es dauerte.
War besser, es zu akzeptieren.
Er hatte das schon vor langer Zeit getan.
Ohne der Frau einen Blick zuzuwerfen, ging er an ihr vorüber. Eilig verschwand sie im Haus. An der nächsten Straßenecke bog er rechts ab, dann noch einmal rechts und lief den Trampelpfad an dem schmalen Bach entlang, der hinter den Grundstücken floss.
Von dort konnte er unbemerkt in ihre Wohnung schauen. Er schlug sich in den ungepflegten Grünstreifen aus Bäumen und Büschen, die noch kahl waren, streifte das Wasser von den Ästen und hockte sich schließlich hinter einen alten vermodernden Baumstumpf, der ihm Sichtschutz bot.
Im Inneren des Hauses ging das Wohnzimmerlicht an. Die Frau trat an die Terrassentür, schaute kurz hinaus, zog dann aber mit einem Ruck den Vorhang zu. Das war nur vernünftig und konsequent, schützte aber vor nichts und niemandem, auch wenn die Leute das gern glaubten.
Ein paar Minuten hielt er es mit seinem schmerzenden rechten Knie in der Hocke aus, dann musste er seinen Beobachtungsposten aufgeben. Er zog sich aus dem Grünstreifen zurück, holte die Schachtel Zigaretten hervor und wollte sich mit klammen, kalten Fingern eine anzünden, als er die Gestalt bemerkte, die ihm in den Weg trat.
«Polizei, was machen Sie hier?»
5.
Morgen. 07:30 Uhr.
«Kennen Sie den Mann?»
Conny Goldmann stand neben einem jungen Beamten auf der Seite der Guten des Polizeispiegels. Auf der Seite der Bösen saß ein älterer Mann, der sich zu langweilen schien. Er pulte Schmutz unter seinen Fingernägeln hervor, betrachtete ihn und schnippte den Krümel zu Boden.
Conny schüttelte den Kopf. Sie hatte den Mann nie zuvor gesehen, aber es war ohne Frage der, der in eine dunkle Jacke gekleidet am Bahnhof aus der Bushaltestelle getreten war, ihr nachgeschaut hatte und wenig später vor ihrem Wohnhaus aufgetaucht war. Noch aus dem Auto heraus hatte Conny die Polizei angerufen, und tatsächlich hatte der junge Beamte, der jetzt neben ihr stand, ihr Aufmerksamkeit geschenkt und sofort reagiert. Was wahrscheinlich daran lag, dass er neu war auf der Wache. Er hatte sich ihr als Polizeikommissar Holger Werth vorgestellt.
«Wie heißt er?», fragte Conny. «Wo wohnt er?»
«Sorry, das darf ich Ihnen nicht sagen. Es steht ja nicht fest, dass er … also … er streitet alles ab, behauptet, er habe dort nur pinkeln wollen, verstehen Sie?»
Conny verstand sehr wohl. Der Täter wurde besser geschützt als das Opfer. Dieser Mann wusste, wo sie lebte, arbeitete, mit wem sie ihre Zeit verbrachte, welche Interessen sie hatte. Nichts von alledem durfte sie über ihn wissen. Conny betrachtete ihn und fragte sich, ob das wirklich der Mann war, der ihr das Leben zur Hölle machte. Ein vollkommen Fremder, noch dazu nicht mehr der Jüngste. Was sollte ihn dazu getrieben haben? Conny war sich absolut sicher, ihn noch nie gesehen zu haben. Auch nicht im Krankenhaus. Ein Gesicht wie dieses hätte sie sich gemerkt. Es war hart und hager, die Nase schmal und lang, zudem sah er aus wie ein Obdachloser mit dem langen Haar und Bart.
«Werden Sie ihn gehen lassen?»
Holger Werth schob die Finger ineinander.
«Sobald wir ihn vernommen haben», antwortete er. «Es liegt ja nichts gegen ihn vor, außer, dass er nach eigenen Angaben in die Büsche gepinkelt hat. Aber keine Angst. Wenn er wirklich der Mann ist, von dem Sie sich verfolgt fühlen, wird er es von heute an nicht mehr versuchen. Er bekommt eine Gefährderansprache.»
«Was ist das?»
«Wir erklären ihm, dass wir die Gefahrenlage erkannt haben, informieren ihn über die geltende Rechtslage und die Maßnahmen unsererseits.»
«Das wird ihn sicher mächtig beeindrucken», sagte Conny sarkastisch. «Und werden Sie ihn danach beobachten?»
Conny sah dem jungen Beamten in die Augen, in die sich ein wenig Verzweiflung schlich.
«Tut mir leid …», begann er und zuckte mit den Schultern. «Dafür haben wir einfach nicht das Personal.»
Conny presste die Lippen zusammen und nickte. Was sollte sie auch sagen? Hier einen Aufstand zu machen änderte nichts an der Personalsituation der Polizei. Sie kannte das schon aus dem Krankenhaus, wo es nicht anders war. Dennoch war sie erleichtert. Auch wenn der Mann alles abstritt, wollte sie daran glauben, dass ihre Tortur heute ein Ende fand. Er war der Richtige, daran gab es nichts zu zweifeln. Was immer ihn antrieb, er war entdeckt und würde sich bestimmt nicht trauen, sein Tun fortzusetzen.
«Am besten gehen Sie jetzt nach Hause und ruhen sich aus», sagte der Beamte. «Wir behalten den Mann noch eine Weile hier und nehmen ihn mal so richtig ran.»
Er wollte Conny Mut machen, sie aufbauen, ballte sogar die Hand zur Faust bei seinen letzten Worten. Conny fand ihn süß, auch wenn ihr klar war, dass er übertrieb und nichts dergleichen tun würde. Immerhin musste er sich als Polizist an Recht und Gesetz halten.
Sie betrachtete den Mann auf der anderen Seite der Scheibe ein letztes Mal, und in diesem Moment hob er den Kopf und ihre Blicke begegneten sich.
Er kann mich sehen, trotz des Einwegspiegels, dachte Conny, auch wenn das unmöglich war.
Ihr lief ein kalter Schauer den Rücken hinab, und sie wusste, sie würde andere Hilfe als die der Polizei benötigen, wenn sie diesen Mann loswerden wolle.
Sie wandte sich ab, weil sie diesen Blick nicht länger ertrug.
6.
Morgen. 07:50 Uhr.
«Ihr Name ist Lars Erik Grotheer?», sagte der junge Polizist, der seinen Personalausweis in der Hand hielt und dennoch die dämliche Frage nach seinem Namen stellte. «Geboren am 05.12.62 in Liebenau?»
Der Blick des Beamten, auf dessen Uniform der Name Holger Werth stand, wechselte zwischen dem Ausweis und Grotheer hin und her. Er verglich das Foto mit dem Gesicht, das er vor sich sah, und Grotheer konnte den Zweifel nachvollziehen. Seitdem das Foto entstanden war, hatte er sich stark verändert. Sein Haar war grau geworden und länger, dazu der Bart, den zu stutzen er sich nur selten aufraffte.
«War das eine Frage? Wenn ja, war sie überflüssig. Sie können ja offensichtlich lesen.»
«Immer schön höflich bleiben, Herr Grotheer. Oder möchten Sie es unbedingt auf die harte Tour?»
«War das jetzt eine Frage oder eine Drohung?»
«Ich dachte, wir führen ein vernünftiges Gespräch», sagte der Beamte und sah Grotheer mit einem Blick an, der wohl Autorität suggerieren sollte. Doch dafür fehlten ihm Alter und Erfahrung.
«Na, dann fangen wir doch damit an. Warum halten Sie mich hier fest? Bin ich verhaftet? Wenn ja, warum?»
«Warum haben Sie das Haus beobachtet?»
«Ich habe gar nichts beobachtet, ich habe gepinkelt. Ist das verboten?
«Natürlich ist das verboten. Nach Paragraf 118 Ordnungswidrigkeitengesetz. Das Bußgeld liegt zwischen 35 und 5000 Euro. Noch Fragen?»
«Ich habe mich extra in die Büsche verdrückt.»
«Spielt keine Rolle, ist trotzdem verboten. Und jetzt hören wir auf mit dem Blödsinn …» Holger Werth seufzte und ließ sich auf den Stuhl gegenüber sinken. Sie befanden sich in einem kleinen Vernehmungszimmer, das immerhin mit einem Einwegspiegel ausgestattet war und auch ansonsten modern wirkte. Offenbar war vor nicht allzu langer Zeit Geld in diese kleine Provinzdienststelle geflossen.
«Was machen Sie beruflich, Herr Grotheer?»
«Ich bin in Frührente.»
«Und davor?»
«War ich Polizeibeamter.»
Der junge Mann hob die Augenbrauen.
«Sie sind Polizist?»
«Nein. Ich war Polizist.»
«Einmal ein Bulle, immer ein Bulle, oder nicht?»
«Das mag für ein Rindvieh stimmen, nicht aber für mich. Keine Ahnung, wie das bei Ihnen ist.»
Grotheer bemerkte, dass der junge Mann die versteckte Beleidigung nicht verstand, es wäre ihm aber auch egal gewesen, wenn doch. Die Zeiten, in denen er sich um Höflichkeiten geschert hatte, waren lange vorbei. Wenn man nicht zurückbekam, was man verteilte, stellte man das Verteilen irgendwann ein, so einfach war das. Die, die das nicht verstanden, saßen in den Wartezimmern der Therapeuten oder in der Psychiatrie.
«Und wo?», fragte Holger Werth.
«Wo was?»
«Polizist. Wo waren Sie Polizist?»
«Sagen Sie, haben Sie mich nicht längst überprüft? Ihr habt doch einen PC hier, oder nicht?»
«Ich warte noch auf meinen Vorgesetzten und wollte bis dahin mit Ihnen reden.»
«Bundestag.»
«Wie bitte?»
«Bundestag», wiederholte Grotheer.
«Ich verstehe nicht …»
«Ich war beim kleinsten Polizeibezirk Deutschlands, der Bundestagspolizei», klärte Grotheer den Mann auf.
«Aha», machte der und wusste offensichtlich nicht, was er davon halten oder dazu fragen sollte. Also fragte er das Nächstliegende.
«Und was wollen Sie von Frau Goldmann?»
«Sie entführen, töten und auf meinem weitläufigen Grundstück verscharren.»
Der Mund von Holger Werth blieb wortlos offen.
Grotheer schüttelte den Kopf und beugte sich vor.
«Was glauben Sie denn, was jemand, den Sie für einen Stalker halten, auf diese Frage antwortet? Die Wahrheit in der Form, wie ich es eben getan habe?» Grotheer ließ sich zurücksinken. «Ich habe Frau Goldmann verfolgt und beobachtet, um herauszufinden, ob sie verfolgt und beobachtet wird.»
«Haben Sie getrunken?», fragte Werth. Er musste den Whisky in Grotheers Atem gerochen haben. Den hatte er getrunken, kurz bevor er zu seiner nächtlichen Aktion aufgebrochen war. Zur Beruhigung. Aber das ging den Mann gar nichts an.
«Hören Sie», begann Grotheer, «ich gebe Ihnen die Handynummer meiner Tochter, rufen Sie sie an, sie wird Ihnen erklären und bestätigen, was ich eben gesagt habe.»
Holger Werth schüttelte den Kopf. «Erklären Sie es mir. Gern die lange Version.»
Grotheer seufzte. «Kann ich einen Kaffee bekommen?»
«Nein. Wer so unhöflich ist wie Sie, bekommt von mir keinen Kaffee.»
Innerlich musste Grotheer lächeln. Der junge Mann stieg in seiner Achtung. Als er selbst so jung gewesen war, hatte ihm diese Chuzpe noch gefehlt. Vor ihm saß einer mit Leidenschaft für seinen Beruf, die noch nicht von den Realitäten zurechtgestutzt worden war. Holger Werth sah gut aus. Jung, straff, trainiert, motiviert, mit wachen Augen und einem offenen Gesicht. Er war das genaue Gegenteil von Grotheer, erinnerte ihn aber an sich selbst, als er in den Polizeidienst eingetreten war. Das war vor der Katastrophe gewesen, die alles verändert hatte.
«Also gut», begann er. «Sie wissen sicher, dass Frau Goldmann sich seit einer Weile verfolgt fühlt, sie hat das meines Wissens mehrfach hier angezeigt.»
«Davon weiß ich nichts. Heute ist mein erster Tag hier.»
«Das erklärt einiges.»
«Was meinen Sie?»
«Zum Beispiel, dass Sie so schnell vor Ort waren und mich aufgestöbert haben. Ihre Kollegen hätten auf den Anruf von Frau Goldmann kaum reagiert.»
«Das halte ich für ausgeschlossen.»
«Wie auch immer … Frau Goldmann hat eine gute Freundin und Arbeitskollegin. Meine Tochter Michelle. Und weil Frau Goldmann sich von der Polizei im Stich gelassen fühlt, bat meine Tochter mich, ob ich nicht ein Auge auf Frau Goldmann haben und herausfinden könne, wer sie verfolgt. Damit habe ich heute begonnen.»
«Klingt ja richtig glaubwürdig.»
«Wie schon gesagt, meine Tochter wird Ihnen den Sachverhalt bestätigen.»
«Frau Goldmann sagte aber gerade noch, dass sie Sie nicht kennt.»
«Wir sind uns nie begegnet, insofern stimmt das.»
Holger Werth musste nachdenken, dann bat er um Michelles Handynummer. Grotheer schrieb ihm Namen und Nummer auf einen Notizblock. Er hatte die Nummer im Kopf, obwohl er sie so gut wie nie benutzte.
«Burghardt?», fragte Werth.
«Michelle ist die uneheliche Tochter aus einer kurzen Beziehung.»
«Und? Haben Sie etwas herausgefunden?», fragte Werth.
Grotheer schüttelte den Kopf. «Wie gesagt, ich habe Frau Goldmann heute zum ersten Mal beobachtet, aufgefallen ist mir aber nichts. Vielleicht täuscht sie sich, wer weiß.»
«Warum haben Sie vorher nicht mit ihr geredet und sie gewarnt, dass Sie in der Nähe sind? Wäre das nicht besser gewesen?»
«Ich wollte herausfinden, wie sie reagiert. Und Sie hat mich ja auch sofort bemerkt. Insofern scheint sie wirklich auf der Hut zu sein.»
«Sie dachten, sie täuscht diese Sache vor?»
Grotheer zuckte mit den Schultern. «Ehrlich gesagt, ja.»
«Okay …» Werth seufzte, schlug sich auf die Schenkel und stand auf. «Dann rufe ich Ihre Tochter jetzt an. Es ist fast acht. Sie wird aufgestanden sein, oder?»
«Sie hat gerade Schicht im Krankenhaus. Ist vielleicht doch besser, ich übernehme das mit meinem Handy und übergebe das Gespräch an Sie.»
Werth nickte, verließ den Raum, kehrte mit Grotheers Handy zurück und reichte es ihm. Zu einem Anruf kam es aber nicht. Plötzlich entstand auf dem Gang Tumult. Laute Stimmen, jemand lief hektisch vorbei, eine Polizistin streckte den Kopf zur Tür herein.
«Ein Überfall!», rief sie aufgeregt. «Jemand wurde verletzt! Wir brauchen alle Einheiten vor Ort!»
7.
Morgen. 08:10 Uhr.
Das Licht war nach wie vor grau, und daran würde sich heute auch nichts mehr ändern, aber Conny Goldmann hatte trotzdem den Eindruck, ihr Leben wäre heller geworden. Von einer Stunde auf die andere. So als hätte das Schicksal einen Vorhang zurückgezogen. Sie konnte noch nicht so recht glauben, dass es vorbei sein sollte.
Vom Polizeipräsidium aus machte sie sich zu Fuß auf den Weg zurück nach Hause. Man hatte angeboten, sie zu fahren, so wie auf dem Hinweg, aber Conny hatte dankend abgelehnt. Gab es einen besseren Moment als diesen, mit geradem Rücken zurück in ihr altes Leben zu gehen?
Ihr Stalker saß bei der Polizei, im Moment konnte er ihr nichts antun. Vielleicht würde er es später noch mal versuchen, aber dann, so nahm Conny es sich vor, während sie kräftig ausschritt, würde sie ihm mutig entgegentreten, sich nichts mehr gefallen lassen. Sie kannte ihn nun, und vor diesem mitleiderregenden alten Mann hatte sie keine Angst. Sie wusste nicht, was sie ihm getan hatte, wie er auf sie aufmerksam geworden war, und das waren Fragen, die sie ihm gern gestellt hätte. Ohne Antworten kein Verstehen, ohne Verstehen kein Abschließen. Das war schade, aber nicht zu ändern. Sie glaubte nicht, dass sie eine Chance bekommen würde, mit dem alten Mann zu sprechen. Vielleicht war es auch besser so.
Weil ihre Gefühle sie beinahe zum Platzen brachten und unbedingt hinausmussten, rief Conny ihre Freundin Michelle auf dem Handy an. Sie nahm jedoch nicht ab. Das war nicht weiter verwunderlich, schließlich hatte sie Dienst, und zu dieser Zeit war auf der Station immer viel zu tun. Conny sprach ihr eine Nachricht auf die Mailbox.
«Hey! Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Die Polizei hat den Typen geschnappt, als er hinter meinem Haus herumlungerte. Ich komme gerade von der Dienststelle. Ein alter Mann, mindestens sechzig, sieht aus wie ein Obdachloser, so mit ungepflegtem Haar und Bart. Oh Gott, ich bin so froh, dass das endlich vorbei ist. Ruf mich zurück, sobald du kannst. Hab dich lieb!»
Conny steckte das Handy weg und sah sich um. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte sie ihre Umgebung anders wahrgenommen, hatte sich angewöhnt, die Menschen kritischer zu betrachten, und überall Gefahren vermutet. Das legte man nicht von einem Moment auf den anderen ab, und sie erwischte sich dabei, wie sie in die Autos hineinstarrte, die an ihr vorbeifuhren.
Hör auf damit, sagte sie sich im Stillen.
Conny straffte die Schultern und spürte ihr Selbstbewusstsein zurückkehren. Die Sonne, soeben aufgegangen, fand ein winziges Loch in der grauen Wolkendecke, und ein warmer Lichtstrahl fiel ihr ins Gesicht. Conny lächelte und nahm es als Zeichen dafür, dass sie diese hässliche Episode ihres Lebens nun hinter sich lassen konnte.
Nach fünfzehn Minuten Fußmarsch erreichte Conny ihr Zuhause. Die anderen Bewohner des Hauses waren alle längst auf der Arbeit. Wieder einmal hatte einer von ihnen vergessen, die Haustür abzuschließen. Egal. Ab jetzt musste sie sich darüber nicht mehr aufregen.
Conny betrat den Hausflur. Links von ihr befand sich die Treppe in die erste Etage. Sie schloss ihre Wohnungstür auf. Durch die Terrassentür fiel Licht in den schmalen Flur. Sie bemerkte einen Schatten, eine Bewegung, wusste im ersten Moment nicht, ob vor oder hinter ihr, und bevor sie reagieren konnte, bekam sie einen heftigen Stoß in den Rücken, der sie geradewegs in ihre Wohnung katapultierte. Conny stürzte der Länge nach auf den Bauch und hörte hinter sich die Tür zuschlagen. Noch bevor sie aufschreien konnte, wurde sie von einem Körper zu Boden gepresst, der sich auf ihren Rücken fallen ließ.
Conny wollte um sich schlagen, konnte es aber nicht.
Ein Unterarm drückte auf ihren Nacken, die kleinste Bewegung schien auszureichen, ihre Wirbel zu brechen.
Es ist immer das Überraschungsmoment, das über Leben und Tod entscheidet.
Dieser eine Satz ihres Trainers für Selbstverteidigung schoss Conny durch den Kopf. Als ihr klar geworden war, dass die Polizei ihr nicht helfen würde, hatte sie mit dem Training begonnen. Zweimal die Woche, jeweils eine Stunde. Statt in Panik zu verfallen, nahm Conny alle Spannung aus ihrem Körper, erschlaffte unter dem Angreifer und irritierte ihn damit.
Er nahm den Arm von ihrem Nacken, griff nach ihrem Kinn, wollte wohl überprüfen, ob sie noch bei Bewusstsein war.
Conny bekam Spielraum. Plötzlich bockte sie auf wie ein wild gewordenes Pferd. Wieder und wieder. Und sie schaffte es, den Angreifer abzuwerfen. Er krachte seitlich gegen das Regal, in dem sie ihre Schuhe abstellte, die Schuhe purzelten heraus. Conny hätte fliehen können, aber wieder dachte sie an die einzige Regel, die ihr Trainer aufgestellt hatte. Überraschen, überraschen, überraschen. Also griff sie nach einem roten Pumps, der direkt vor ihr gelandet war, und nutzte den hohen schmalen Absatz als Waffe.
Wild und unkontrolliert schlug sie auf den Kopf des Angreifers ein, bis nach wenigen Schlägen der Absatz abbrach.
Weil der Mann sich schützend zusammengerollt hatte, sah Conny ihre Chance gekommen.
Sie krabbelte zur Wohnungstür, zog sich daran hoch, riss sie auf, stürzte hinaus und rief laut um Hilfe.
8.
Morgen. 08:30 Uhr.
Stille.
Die Uhr an der Wand tickte, der Zeiger schob sich mit einem Klacken vorwärts. Dort machte sich der Verlauf der Zeit bemerkbar, für Grotheer aber blieb sie stehen. Plötzlich saß er allein im Verhörraum, den Blick auf die Tür gerichtet, die sperrangelweit offen stand. Von einer Minute auf die andere hatte sich die Situation komplett verändert.
Sein Atem ging flach, sein Herz schlug ruhig, dennoch hatte er das Gefühl, demnächst von Aufregung überrollt zu werden. Die Ruhe vor dem Sturm. Am härtesten kam es immer dann, wenn man nicht damit rechnete. So wie damals, als eine Sekunde darüber entschieden hatte, wie er sein Leben leben würde – oder besser, wie er es verschwenden würde.
Da er nicht ewig verharren konnte, erhob er sich von dem Stuhl, auf dem er gesessen hatte, und folgte dem Beamten, der ihn vernommen hatte. Holger Werth hatte ihn mit den Worten zurückgelassen, man werde sich bei ihm melden. Nachdem in der kleinen Landdienststelle wegen eines Notrufs Hektik ausgebrochen war, achtete auch sonst niemand mehr auf Lars Erik Grotheer. Der Gang war leer. Vorn saß eine Beamtin in Zivil am Schreibtisch und telefonierte. Ein kurzer Blick, mehr war Grotheer ihr nicht wert, also drückte er die Tür auf und trat in den feuchten Morgen hinaus.
Auf dem Bürgersteig vor der Dienststelle sah er die beiden verfügbaren Streifenwagen unter Blaulicht davonrasen – in Richtung der Wohnung von Constanze Goldmann.
Grotheer rang mit sich.
Rechts oder links, das war die Frage. Die Richtung entschied darüber, ob Schluss sein würde mit seinem ruhigen Leben, ob er sich Probleme zu eigen machte, die nicht seine waren. Er musste sich entscheiden. Aber hatte er das nicht längst?
Vor wichtigen Entscheidungen, so meint man, wägt man im Kopf alle Argumente gegeneinander ab, um zu einem Entschluss zu kommen. Aber war das wirklich so? Grotheer empfand nur gedankliche Leere, die darauf wartete, gefüllt zu werden. Vielleicht war er zu sehr Bauchmensch und beherrschte dieses sachliche Taktieren einfach nicht.
Das Ringen dauerte fünf Sekunden.
Dann folgte Grotheer seinem Bauchgefühl und den Streifenwagen.
Er hatte lange Beine, schritt kräftig aus, beobachtet von Menschen, die wegen der ungewöhnlichen Polizeiaktivität aus den Fenstern schauten oder in ihre akkurat gepflegten Vorgärten liefen.
«Was ist denn passiert?», rief eine ältere Dame Grotheer zu. Er ignorierte sie. Er wusste es ja selbst nicht, und was er ahnte, wollte sein Kopf noch nicht wahrhaben. Natürlich gab es Zufälle im Leben, jeden Tag, jede Minute, das Leben war eben Chaos und keine Chronik, nichts war längst entschieden oder stand geschrieben, aber hier und jetzt glaubte Grotheer nicht an einen Zufall.
Zehn Minuten später bekam er den Beweis.
Vor dem Haus, in dem Constanze Goldmann lebte, parkten die beiden Streifenwagen quer auf der Straße und sperrten sie in beide Richtungen ab. Eine Beamtin telefonierte in der geöffneten Tür, während die anderen Kollegen damit beschäftigt waren, den Tatort zu sichern. Aus der Entfernung näherte sich ein weiteres Fahrzeug mit Sirene, wahrscheinlich der Rettungswagen.
Grotheer schlug sich in einem weiten Bogen seitwärts durch die Gärten der Nachbarhäuser am ersten Streifenwagen vorbei und dann an der Giebelseite des Vierfamilienhauses zurück Richtung Straße. Die Beamten bemerkten ihn zunächst nicht.
Er sah Holger Werth auf den Knien hocken. Vor ihm lag der ausgestreckte Körper von Constanze Goldmann, keine vier Meter von der Haustür entfernt. So, wie sie dalag, war sie wohl auf dem Weg vom Haus zur Straße gewesen. Auf der Flucht? Hatte ihr Verfolger in der Wohnung auf sie gewartet? Wenn ja, war sie nicht weit gekommen. Der rechte Arm war Richtung Straße ausgestreckt, eine verzweifelt anmutende Position, so als hätte sie in ihren letzten Sekunden nach Rettung gegriffen. Einer ihrer weißen Sneaker fehlte. Die weiße Socke war schmutzig.
Der Menge an Blut nach zu urteilen, war die junge Frau tot.
Ihr Oberkörper schwamm in ihrem Blut, es floss vom Gehweg über die Kante in die Rabatten. Holger Werth presste seine großen Hände auf eine Wunde am Hals der jungen Frau, versuchte verzweifelt, die Blutung zu stoppen, und Grotheer konnte das verstehen, auch wenn es längst zu spät war.
Zu viel Blut außerhalb des Körpers.
Ihm drehte sich der Magen um, aber da er nichts gegessen hatte, bestand nicht die Gefahr, dass er sich übergab. Ihm drehte sich aber auch der Kopf, und die Gefahr, nicht mehr Herr seiner Gedanken zu sein, bestand sehr wohl.
Keine zehn Meter entfernt lag die junge Frau verblutend auf dem Gehweg, für die er heute Nacht aufgestanden war. Die beste Freundin seiner Tochter, die ihn in ihrer Angst vor einem unbekannten Verfolger um Hilfe gebeten hatte. Die sich Hoffnung gemacht hatte, dass ein alter Mann, der seine Dienstzeit bei der Bundestagspolizei verbracht und dort nie einen Mord, nie eine körperliche Auseinandersetzung miterlebt hatte, der über keinerlei Ermittlungskompetenzen verfügte, ihr helfen könnte.
Konnte er nicht.
Schlimmer noch: Er hatte durch sein Handeln die Katastrophe erst herbeigeführt.
Holger Werth schrie: «Wo bleibt der verdammte Rettungswagen!», sah sich dabei um und entdeckte Grotheer an der Hausecke. Ihre Blicke trafen sich. Werth standen Tränen in den Augen, aber Grotheer bildete sich ein, darin auch einen Vorwurf zu erkennen.
Was hast du getan!
Kapitel 2
10 Tage später
1.
April 2024. Nachmittag. 15:32 Uhr.
«Darf ich dich anfassen? Meine Mama sagt, das bringt Glück, und Glück kann doch jeder brauchen, oder?»
«Da hast du recht. Natürlich darfst du mich anfassen.»