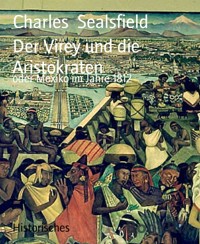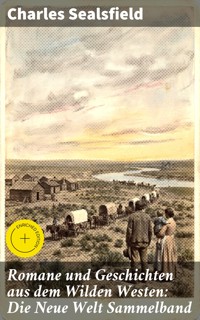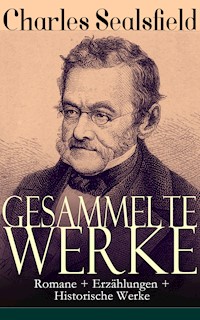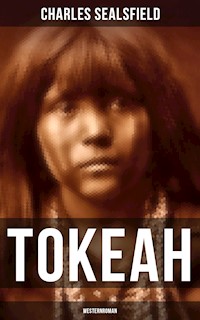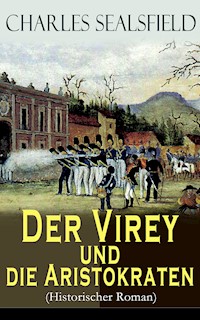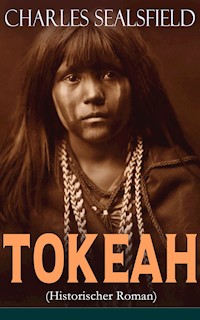9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der alte Häuptling Tokeah hat seinen Stamm der Oconee-Indianer schon tief in noch unbewohnte Gebiete geführt, weil die amerikanischen Farmer immer weiter vorrücken. Die Siedlung in der Lichtung am Fluss ist klein geworden, aber noch lebt der einst mächtige Stamm nach den Regeln der Vorfahren. Doch was ist das Geheimnis des hellhäutigen Mädchens Rose, das seit seiner Kindheit unter ihnen ist? Als James Hodge, der britische Seemann, verwundet beim Dorf auftaucht, überstürzen sich die Ereignisse. Charles Sealsfields genaue, mitfühlende Beobachtungsgabe vermittelte ihm, der sich in zahlreichen Berufen in aller Welt durchschlug, den Stoff zu einem reichen Werk, das zu den Bestsellern seiner Zeit gehörte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Die amerikanischen Farmer rücken immer weiter vor. Noch kann sich die Siedlung der einst mächtigen Oconee-Indiander behaupten. Doch was ist das Geheimnis des hellhäutigen Mädchens Rose, das seit seiner Kindheit unter ihnen ist? Als ein britischer Seemann verwundet beim Dorf auftaucht, überstürzen sich die Ereignisse.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Charles Sealsfield (eigentlich: Karl Anton Postl, 1793–1864) studierte Theologie und erhielt in Prag die Priesterweihe. Ab 1827 erschienen seine Romane und Streitschriften, die ihn zu einem der erfolgreichsten Schriftsteller der Zeit und zu einer Leitfigur der europäischen Demokraten machten.
Zur Webseite von Charles Sealsfield.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Charles Sealsfield
Häuptling Tokeah und die Weiße Rose
Roman
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die Erstausgabe erschien 1893 unter dem Titel Der Legitime und die Republikaner. Eine Geschichte aus dem letzten amerikanisch-englischen Krieg.
Die vorliegende Lesefassung wurde von Alex Bischoff erstellt und beruht auf der Ausgabe Stuttgart 1845.
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30255-6
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.05.2024, 14:39h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
HÄUPTLING TOKEAH UND DIE WEISSE ROSE
Erster Teil1 – An der Straße, die sich vom Städtchen Coosa …2 – Die ersten Strahlen der Morgensonne fanden unsern Kapitän …3 – Am nördlichen Ende des Sabinersees und mitten aus …4 – Nicht fern von dem Schauplatz des soeben erzählten …5 – Der Indianer hat neben vielen großartigen Zügen …6 – Die außerordentliche Geschicklichkeit der Indianer, Wunden und …7 – Wieder waren zwei Tage vergangen. Der junge …8 – Die betroffen staunende und halb verlegene Miene …9 – Die beiden Mädchen kamen ihm auf der …10 – Der unangenehme Auftritt hatte die Verhältnisse …11 – Der abenteuerliche Geist, der die anglonormannische Nation …12 – Der Morgen nach der Flucht des Briten …13 – Der Gemütszustand, in welchem wir unseren Briten …14 – Der Wigwam am Natchez bot die folgenden …15 – »Kapitän! Es ist eine ungewöhnliche Bewegung im …16 – Die Sonne hatte bereits ihre Mittagshöhe erreicht …17 – Die Vereinigung mit den neuen Brüdern wurde …18 – Mitternacht war vorüber und Dorf und Flur …19 – Keine Zunge wäre fähig, den jammervollen Anblick zu …Zweiter Teil20 – Die Natur hat Louisiana mit einem sonderbaren …21 – Das Countystädtchen Opelousas zählte zu der Zeit …22 – »Es freut mich für dich«, sagte der …23 – Das Hochland des linken oder östlichen Mississippiufers …24 – Die Nacht war schon hereingebrochen, als die …25 – Die drei Mexikaner gingen langsam dem Städtchen …26 – Es war Mitternacht, als die fünf Spanier …27 – Die vier Mexikaner hatten soeben ihr Boot …28 – Parkers Landsitz gehörte zu einer der vielen …29 – Das Mädchen hatte in den zwei Wochen …30 – »Willkommen, Captain!«, sagte die Frau des Obersten …31 – Eine Gruppe von fünf Männern vom jenseitigen …32 – Zwei Milizen kamen, Gewehr im Arm, vom Wachthaus …33 – Auch unsere Rosa schien etwas eingeschüchtert und unruhig …34 – »Ja, da wären wir«, stöhnte der Onkel …35 – Rosa kehrte ernst, beinahe feierlich nach Hause …36 – Grabesstille herrschte am folgenden Morgen im Speisesaal …37 – Acht Tage waren seit Tokeahs Verschwinden vom Bayou …38 – Auf einen Schlag wurde es hell. Rote …39 – Es war ein herrlicher, wenn auch für …40 – Wieder saßen dieselben drei Personen in derselben …41 – Am folgenden Morgen riefen die rollenden Trommeln die …42 – »Und nun, liebes Kind, stehe ich dir …43 – Eine Stunde darauf verließen die Indianer das …PostskriptWorterklärungenMehr über dieses Buch
Zu Charles Sealsfield und dieser Edition
Über Charles Sealsfield
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Abenteuer
Zum Thema USA
Zum Thema Schmöker
Zum Thema Indianer
»Ich zittere für mein Volk, wenn ich der Ungerechtigkeiten
gedenke, deren es sich gegen die Ureinwohner
schuldig gemacht hat.«
Jefferson
Erster Teil
1
An der Straße, die sich vom Städtchen Coosa nach der Hauptstadt von Georgia, Milledgeville, hinabwindet, und nahe dem Platz, wo gegenwärtig der Gasthof gleichen Namens den ermüdeten Reisenden zur Ruhe einlädt, stand vor ungefähr dreißig Jahren unter einem Felsenvorsprung, auf welchem einige Dutzend roter Zedern und Fichtenbäume wurzelten, ein rau aussehendes, mäßig großes Blockhaus. Davor erhob sich ein Gerüst, das aus zwei mannsdicken Balken bestand, verbunden durch Querpfosten, zwischen welchen ein ungeheures Schild hin- und herschwebte, das bei näherer Betrachtung eine groteske Figur in grellstem Farbenschmuck wahrnehmen ließ, deren Diadem von Federn, Tomahawk, Schlachtmesser und Wampum wahrscheinlich einen indianischen Häuptling bezeichnen sollte. Unter dem Schild war mit Buchstaben, ägyptischen Hieroglyphen nicht unähnlich, gekritzelt: »Einkehr für Mann und Tier«. Zur rechten Seite des Hauses oder vielmehr der Hütte und näher dem Fahrweg waren aus Balken gezimmerte Verschläge, vom Weg nur durch eine breite Schlammpfütze getrennt und mit Haufen von Stroh und Heu angefüllt, aus denen hier und da Überreste schmutzigen Bettzeugs hervorschauten. Sie ließen erraten, dass diese Gemächer nicht nur für das liebe Vieh, sondern auch für jene Reisenden bestimmt waren, die ihr Unstern bemüßigte, hier Ruhe und Nachtlager zu suchen. Ein paar Kuh- und Schweineställe ergänzten diese Hinterwäldlersiedlung.
Es war eine stürmische Dezembernacht. Der Wind heulte furchtbar durch den schwarzen Fichtenwald, an dessen Abhang die Hütte gelegen war. Das schnell aufeinanderfolgende Krachen der Baumstämme, die der Sturm mit donnerähnlichem Getöse zu Fall brachte, verkündete einen jener wütenden Orkane, die so häufig über die Blue Mountains von Tennessee und das flache Mississippiland ziehen. Mitten in diesem tobenden Sturm ließ sich ein leises Tappen am Fensterladen der Hütte vernehmen, dem bald darauf ein starkes Pochen oder vielmehr heftige Schläge folgten. Sie erschütterten die Balken, aus welchen die Hütte gezimmert war, in ihren Grundfesten. Nicht lange nach dieser Aufforderung öffnete sich die Tür zur Hälfte, ein Kopf tauchte auf, als wollte er die Ursache des Lärms ergründen, während im selben Augenblick der Schaft eines Karabiners vorrückte, zweifelsohne um dem Besitzer der Hütte die fernere Mühe des Öffnens zu ersparen. Zu gleicher Zeit trat eine lange Gestalt heran, riss die Tür weit auf und schritt mit starken Schritten in die Stube, wo sie sich vor dem Feuerplatz niederließ. Hinter ihr her eine Gruppe von Wesen, die halb schreitend, halb trabend ihrem Führer in einer Linie und in tiefstem Schweigen folgten.
Es dauerte ziemlich lange, bis ungefähr zwanzig dieser Nachtgestalten in die Hütte eingedrungen waren. Als der Zug sein Ende erreicht hatte, schloss sich die Tür wieder; ein kolossaler Mann näherte sich dem Feuerplatz, wo noch ein dicker Klotz glimmte, warf einige Scheite darauf und zündete einen der Pechspäne an, die in einem Haufen in der Nähe lagen. Dann, gemessenen Schrittes auf den Schanktisch zutretend, ergriff er ganz ruhig ein Talglicht, zündete es an und stellte es auf den Tisch.
Das kunstlose, beinahe rohe Innere der Hütte, so ganz dem Äußern entsprechend, ließ sich nun im düstern Schein des Lichts und des allmählich auflodernden Feuers deutlicher erkennen. Auf einem Stuhl vor dem Feuerplatz saß der Mann, der zuerst eingetreten war, eine blutbefleckte Wolldecke über den Leib geworfen, sodass Gesicht und Gestalt verhüllt waren. Hinter ihm auf dem Lehmboden kauerte eine Gruppe von zwanzig Indianern auf ihren Hüften, ihre Schenkel ineinander verschlungen, die Gesichter gleichfalls in nasse Wolldecken gehüllt. Die großen Blutflecken darauf schienen anzudeuten, dass der Charakter der Expedition, von der sie kamen, ziemlich grausam gewesen sein musste.
Gegenüber dem Feuerplatz stand in der Ecke der Schanktisch, hinter dessen Gitterwerk ein Dutzend schmutziger Flaschen und noch schmutzigere Gläser und Krüge aufgestellt waren. Drei blau angestrichene Fässchen mit der Aufschrift »French Brandy, Gin, Monongehala« standen eine Stufe tiefer. Ein Haufen von Hirsch-, Biber-, Bären- und Fuchsfellen zur linken Seite reichte beinahe bis zum Geländer und zeugte von lebhaftem Verkehr mit der kupferfarbigen Rasse. Daneben erhob sich ein ungeheures Himmelbett, umringt von drei niedrigeren Bettstellen und einer Wiege oder vielmehr einem Trog, einem Stück eines hohlen Baums, an dessen Ende Bretter genagelt waren. In diesen verschiedenartigen Behältnissen genoss die Familie des Gastgebers, den lauten Lungentönen nach zu urteilen, eine unerschütterliche und vollkommene Ruhe. Die Wände der Stube zeigten die rohen und unbehauenen Baumstämme, deren einziger Schmuck breite Streifen von Lehm waren, die die Zwischenräume ausfüllten.
In dieser Stube nun, die, nach ihren mannigfaltigen Bestimmungen zu schließen, der Leser sich ziemlich geräumig vorstellen muss, sah man den Wirt beschäftigt, die Stühle und Bänke, die die Eindringlinge ohne Weiteres über den Haufen geworfen hatten, wieder in Ordnung zu bringen. Seine stoische Ruhe hätte einen vermuten lassen können, seine Gäste seien eher Nachbarn als soeben von einer blutigen Expedition zurückgekehrte Wilde, vielleicht gekommen, seinen und der Seinigen Bälge als Zugabe zu ihrer Expedition mit sich zu nehmen. Nachdem er den letzten Stuhl an seinen Ort gestellt hatte, setzte er sich selbst zu dem Mann, der als Führer der Bande den Platz im Vordergrund eingenommen hatte.
Einige Minuten mochten so beide gesessen haben, als der Letztere sich aufrichtete und einen Teil seines Hauptes entblößte. Die andere Hälfte war mit einem Stück Kaliko verbunden, an dem wie Fransen kleine Knoten geronnenen Blutes hingen. Der Hinterwäldler warf einen Seitenblick auf den Indianer, wandte jedoch sein Auge gleich wieder dem knisternden Feuer zu.
»Hat mein weißer Bruder keine Zunge?«, ergriff endlich der Indianer das Wort. »Oder lässt er sie warten, um sie desto besser zu krümmen?« Die letzten Worte sprach er in einem tiefen, höhnischen Kehlton.
»Er will hören, was der Häuptling sagen wird«, erwiderte mürrisch trocken der Amerikaner.
»Geh und ruf dein Weib«, sprach der Indianer in demselben tiefen Basston.
Der Wirt erhob sich, wandte sich gegen das gewaltige Ehebett und sprach, nachdem er die Vorhänge auseinandergezogen hatte, mit seiner Frau, die sich im Bett aufgerichtet und, wie es schien, eher neugierig als ängstlich der kommenden Dinge geharrt hatte. Nach einem kurzen Zwiegespräch kam sie aus ihrem Hinterhalt. Sie war eine derbe Frau, breitschultrig und vollgewichtig, mit einem Zug in ihrem nicht eben sehr zart geformten Gesicht, der deutlich machte, dass sie nicht leicht aus der Fassung gebracht werden konnte. Ihr Überrock von Linsey-Woolsey, für täglichen und nächtlichen Gebrauch bestimmt, betonte ihre gewaltige Gestalt noch, als sie festen Schrittes und beinahe aufgebracht neben ihren Ehemann trat. Die drohende Ruhe ihrer Besucher jedoch, ihre blutigen Köpfe und Wolldecken, nun erhellt durch die hoch aufschlagende Flamme, schienen so üble Vorzeichen, dass sie sichtlich zusammenschrak. Ihre ersten Schritte, die rasch und zuversichtlich auf die Indianer gerichtet waren, begannen zu wanken, und mit einem unwillkürlichen Schauder drehte sie sich zur Seite, wo ihr Mann wieder Platz genommen hatte. Eine Minute verging in düsterem Schweigen.
Der Indianer erhob nun sein Haupt, ohne jedoch aufzublicken, und sprach im strengen Ton: »Höre, Frau, was ein großer Krieger dir sagen wird, dessen Hände offen sind und der den Wigwam seines Bruders mit vielen Hirschhäuten füllen wird. Dafür wird er bloß wenig von seiner Schwester verlangen, und dieses wenige mag sie leicht geben. Hat meine Schwester«, fragte der Indianer mit erhöhter Stimme, einen Blick auf sie richtend, »hat sie Milch für eine kleine Tochter?«
Sie sah den Indianer verwundert an.
»Will sie«, fuhr dieser fort, »ein wenig von ihrer Milch einer kleinen Tochter geben, die sonst wegen Mangels sterben würde?«
Die Züge der lauschenden Frau erhellten sich, als ihr klar wurde, dass der Indianer etwas von ihr wollte und es also in ihrer Gewalt stand, eine Gunst zu gewähren oder zu versagen. Sie neigte sich von der Seite ihres Ehemanns dem Indianer zu und wartete gebannt auf nähere Erklärungen über eine so sonderbare Zumutung.
Der Indianer, ohne sie eines Blickes zu würdigen, öffnete die weiten Falten seiner Wolldecke und zog ein wunderschönes, in kostbare Pelze gehülltes Kind hervor.
Die Frau stand einige Augenblicke wie erstarrt über die liebliche Erscheinung; Verwunderung und Erstaunen schienen sie gefesselt zu haben. Neugierde jedoch, dieses Wesen näher zu besehen, und vielleicht Muttergefühl lösten nun auf einmal ihre Zunge.
»Guter Gott!«, rief sie, während sie beide Arme ausstreckte, das Kind zu empfangen. »Was für ein wunderlieblich kleines Ding, und guter Eltern Kind muss es auch noch sein. Ihr könnt Euch drauf verlassen. Ich schwörs. Schaut nur einmal die Felle und die feinen Spitzen. Habt Ihr in Euerm Leben so etwas gesehen? Wo habt Ihr das Kind her? Armes, kleines Ding! Jawohl, ich will es füttern. Es ist ja kein rotes Kind.«
Die Frau hätte ihrer Verwunderung noch eine Weile freien Lauf gelassen, doch ein bedeutsamer Wink ihres Mannes schloss ihr den Mund. Ohne sie zu beachten, entfaltete der Häuptling das blaue Fuchspelzchen, streifte es dem Kind ab und schickte sich an, es aus dem Überröckchen zu ziehen. Es war ihm nach einiger Mühe gelungen, dem Kind auch dieses abzuziehen; allein ein drittes, viertes und fünftes erschien, in welche die Kleine gleich wie ein Seidenwurm in seine Kokons gehüllt war. Der Indianer verlor mit einem Mal die Geduld und, sein Schlachtmesser ergreifend, schnitt er dem Kinde die drei noch übrigen Kleidchen vom Leibe und hielt es dann nackt der Wirtin hin.
»Eingefleischter Satan!«, kreischte sie, indem sie ihm das Kind mit Gewalt aus den Händen riss.
»Halt!«, sprach der Indianer, kalt und unbeweglich auf den Hals des Kindes blickend, von dem ein goldnes Kettchen mit einer kleinen Medaille hing. Das Weib streifte, ohne ein Wort zu sagen, dem Kind die Kette über das Köpfchen, warf sie dem Indianer ins Gesicht und eilte ihrem Bett zu.
»Der Teufel ist in dem Weib«, brummte der Wirt, nicht wenig, wie es schien, über ihre Heftigkeit beunruhigt.
»Der rote Krieger«, sprach der Indianer in unerschütterlicher Ruhe, »wird mit Biberfellen die Milch seiner kleinen Tochter bezahlen; aber er will behalten, was er aufgelesen hat, und die Türe muss sich öffnen, wenn er kommt, das Kind zu holen.«
»Aber«, versetzte der Wirt, dem es nun zu dämmern schien, dass eine nähere Erklärung fällig war, »aufrichtig gesagt, ich gebe nicht viel darum und behalte das Kind, obwohl ich, Gott sei Dank, deren selbst erklecklich habe. Aber sollten nun die Eltern kommen oder der weiße Vater von dem Kind hören, was dann? Der rote Häuptling weiß, seine Hände reichen weit.«
Der Indianer hielt kurz inne und sprach dann in bedeutsamem Ton: »Des Kindes Mutter wird nie wiederkommen … Die Nacht ist dunkel, der Sturm braust stark, morgen wird nichts von den Fußstapfen der roten Krieger zu sehen sein … Es ist weit zu den Wigwams des weißen Vaters. Hört er von dem Kinde, dann hat mein weißer Bruder ihm davon gesagt. Nimmt er es, so wird der rote Häuptling die Kopfhäute der Kinder seines weißen Bruders nehmen.«
»Dann nimm dein Kind wieder zurück, ich will nichts damit zu tun haben«, sprach der Hinterwäldler in entschlossenem Ton.
Der Indianer zog sein blutiges Messer und warf einen Blick zum Bett, hinter dessen Vorhängen das Kind verschwunden war.
»Wir werden dafür Sorge tragen, niemand soll etwas davon erfahren«, kreischte die Frau erschrocken.
Der Indianer steckte sein Schlachtmesser wieder ruhig in den Gürtel und sprach: »Die Kehlen der roten Männer sind trocken.«
Vom Bett herüber ließ sich ein Gemurmel hören, das dem christlichen Wunsch nicht unähnlich klang, jeder Tropfen möge den Bluthunden zu Gift werden. Der Wirt jedoch, weniger von der rachedürstenden Menschlichkeit seiner Ehehälfte beseelt, eilte schnell dem Schanktisch zu, um den Forderungen seiner Gäste Genüge zu leisten. Der Häuptling trank sein halbes Gillglas Whisky sitzend und in einem Zug aus, dann ging es in der Runde herum. Nachdem die sechste Flasche geleert war, erhob er sich plötzlich, warf ein spanisches Goldstück auf die Tafel, öffnete die Vorhänge des Bettes und hängte dem Kind eine Halskette aus Korallen um, die er aus seinem Wampumgürtel gezogen hatte.
»Die Muscogees werden die Tochter eines ihrer Krieger erkennen«, sprach er, seinen Blick auf das Kind heftend, das nun in seinem neuen Flanellröckchen ruhig am Busen der Wirtin lag. Noch einen zweiten Blick warf er auf das Kind und die Frau, und dann wandte er sich stillschweigend der Tür zu und verschwand mit seinen Gefährten in der finstern Nacht.
»Der Windstoß ist vorüber«, sprach der Wirt, der den Indianern durch die Tür nachgesehen hatte, als sie sich zu ihren Birkenkanus im Coosa-Fluss hinunterstahlen.
»Um Himmels willen! Wer ist dieser eingefleischte rote Teufel?«, unterbrach ihn sein Weib, tief Atem holend.
»Still! Halt dein Maul. Es ist kein Spaß. Ich versichere es dir.« Mit diesen Worten schloss er die Tür und näherte sich mit dem brennenden Licht dem Bett, wo sie dem Kind die Brust gab.
»Armes Ding«, sprach er, »könntest du, du würdest wahrlich eine Geschichte kundtun, von der einem die Haare zu Berge stehen. Ja, und sie mag uns auch unsere Haut kosten. Es ist nicht alles, wie es sein sollte. Diese roten Teufel waren auf einer Skalpexpedition. Aber wo sie waren, das weiß der Himmel. Wären sie über die Spanier hergefallen«, fuhr der Mann fort, wechselweise den Säugling und das Goldstück betrachtend, »hätt ich mich den Henker drum geschert, aber so …« Mit diesen Worten warf er sich wieder aufs Bett. Aber es verging eine lange Stunde, ehe der Schlaf über ihn kam. Der Vorfall schien ihm Ruhe und Rast geraubt zu haben.
Kapitän John Copeland, dies war der Name und Charakter des Schenkwirtes Zum Indianischen Häuptling, war einer jener befugten Zwischenhändler, die sich seit zwei Jahren in dem Land der Creeks unter dem Patronat der Zentralregierung und unter dem unmittelbaren Schutz des unter den Indianern residierenden Agenten niedergelassen hatten. Er hatte sich mithilfe von fünfzig Dollar die Sammlung oben genannter Branntweinfässer angeschafft, seine Familie um zwei neue Sprösslinge, seine Habe aber bereits um das Zwanzigfache vermehrt und befand sich nun, ein Mann zwischen dreißig und vierzig, so wohl, wie es nur einer sein konnte, der, um in der Landessprache zu reden, breitschultrig und vierschrötig in seinen eigenen Schuhen stand. Niemanden über sich, jeden, der nicht Bürger war, unter sich achtend, verband er klugermaßen gerade so viel Kneipenwitz mit seiner Kapitänswürde, als seinen ernsten Gästen und ihren scharfen Falkenaugen zuzusagen schien. Obgleich das ganze Sinnen und Trachten John Copelands darauf gerichtet war, sich die Bälge der Indianer auf gute Art anzueignen – und dabei die Bälge seiner Familie zu erhalten, welche, die Wahrheit zu gestehen, nicht viel besser daran waren, gewiss nicht sicherer, als die der hart zu erlangenden Biber. Nichtsdestoweniger war in ihm ein zwar dunkles, instinktartiges, aber desto festeres Pflichtgefühl, das nicht zögern würde, Biber- und andere Felle aufzuopfern, wenn das Wohl seines Landes oder seiner hinterwäldlerischen Mitbürger auf dem Spiel stand. Die Verhältnisse dieser Hinterwäldler aber mit ihren reizbaren wilden Nachbarn waren von jeher gespannt gewesen. Zwar hatten die Creeks viele Jahre hindurch mit den Amerikanern, den Bewohnern des Staates Georgia, in gutem Einvernehmen gestanden. Sie hatten nicht nur den Agenten, den die Zentralregierung gesandt hatte, mit allen Zeichen der Achtung aufgenommen und so die Oberherrschaft des großen weißen Vaters, wie sie den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu nennen pflegen, anerkannt, sie hatten sich sogar willig gezeigt, jenen Absichten entgegenzukommen, die die Regierung und ihr Agent zur Förderung ihrer bürgerlichen und moralischen Kultur zu verwirklichen angefangen hatten. Aber trotz dieser Anzeichen wechselseitigen Zutrauens gab es hundert unangenehme Berührungspunkte, die zu Samen künftiger oder naher Zwietracht werden konnten und mussten und die dem scharfen Auge unseres Kapitäns nicht entgehen konnten.
Die verschiedenen Friedensschlüsse, die diesen Indianern von den Weißen abgenötigt worden waren, hatten sie allmählich des größeren und besseren Teils ihres angestammten Besitztums beraubt. Dieses Besitztum hatte sich einst über weite Teile von Georgia und Florida, die heutigen Staaten von Alabama und Mississippi, erstreckt. Sie hatten sich mit diesen Abtretungen mit Gleichmut abgefunden, obwohl sie Beraubungen nicht unähnlich sahen – in der Hoffnung, wenigstens dasjenige, was ihnen übrig blieb, in Frieden zu genießen. Einige Zeit, besonders während des Revolutionskriegs und der ersten zehn darauffolgenden Jahre, hatte man sie auch in Ruhe gelassen. Die Bürger Georgias, die kaum imstande gewesen waren, sich der auswärtigen Feinde zu erwehren und ihre eigenen Felder zu pflügen, hatten sich weislich gehütet, die schlummernden Indianer zu wecken. Die achtzehn Jahre jedoch, die seit dem Ende des Freiheitskampfes verflossen waren, hatten allmählich die tiefen Wunden geheilt, die Krieg und Verheerung diesem Staat geschlagen hatten; mit der Verdopplung der Bevölkerung war auch das Bedürfnis gestiegen, sich im üppigen Westen auszubreiten. Die rüstige Jugend begann daher, sehnsüchtige Blicke auf die fetten Walnuss- und Ahornniederungen zu werfen, die sich in den herrlichen Talweiten der Coosa- und Oconeeflüsse erstrecken. Nicht lange währte es, und die Siedler kamen immer häufiger mit Wagen und Pferden, Weibern und Kindern, ihren Rindern und ihrer Habe, um sich die besten Stellen des Landes auszusuchen, ohne sich im Mindesten um Rechtstitel oder Besitztum zu kümmern. Dieser rechtlose Zustand hatte nur wenige Monate vor dem nächtlichen Ereignis Veranlassung zu einem ernsten Streit gegeben. Zwar wurde er noch durch die Vermittlung der Zentralregierung beigelegt, aber der Vergleich, weit entfernt, die Gemüter zu beruhigen, hatte einen giftigen Stachel in den Herzen der Indianer zurückgelassen. Derselbe Häuptling der Creeks, der sich hatte verleiten lassen, diesen herrlichen Landstrich abzutreten, war seiner Abstammung nach gemischter Rasse und seine Mutter eine Amerikanerin. Dieser Umstand hätte allein schon genügt, das Misstrauen der Indianer zu erregen, selbst wenn sich nicht ein bedeutender Stamm dieses Volkes durch den Vertrag beeinträchtigt gefühlt haben würde. Letzteres war jedoch wirklich der Fall gewesen. Gerade der Hauptstamm dieses ausgezeichneten Volks, mit einem Abkömmling der alten Mikos oder Könige der Oconees, war durch diesen Vertrag mit seinem ganzen Stamm land- und heimatlos geworden. Dieser Miko nun hatte den Ruf, der bitterste Feind der Weißen zu sein. Seine Unbeugsamkeit und seine Hartnäckigkeit waren sprichwörtlich geworden. Sein Einfluss, hieß es, sei unbeschränkt in seinem Stamm und bestimmend im Rat der ganzen Nation, die sich nun mit Recht um den Besitz des ihr noch verbliebenen Gebiets sorgte.
Gekränkt und gedrückt in seinen Rechten, wie der heimatlose, stolze Indianer sich fühlen musste, bedurfte es nur wenig, um die glimmende Flamme der Unzufriedenheit zum Lodern zu bringen. Ein Krieg, so hoffnungslos er für die Unterdrückten am Ende auch sein musste, war jedoch eine fürchterliche Geißel für die verstreuten weißen Siedler. Der Tod war das Geringste, was sie von Menschen zu erwarten hatten, deren Rache und Blutdurst durch eine lange Reihe von Unterdrückungen so furchtbar angestachelt waren. Der Kapitän hatte daher guten Grund, vorsichtig zu sein. Vertraut mit dem Charakter des Volkes, unter welchem er lebte, musste ihm die Ruhe, die seit einiger Zeit herrschte, mehr verdächtig erscheinen. Die Nachtszene erschien ihm wie ein Vorzeichen, und seine Besorgnis war in voller Stärke erwacht. Welches der Entschluss war, den er gefasst hatte, werden wir bald sehen.
2
Die ersten Strahlen der Morgensonne fanden unsern Kapitän mit Reisevorbereitungen beschäftigt, die darin bestanden, dass er statt der Linsey-Woolsey-Hosen lederne anzog, seine Mokassins hervorsuchte, an den rechten Fuß einen verrosteten Sporn schnallte, über beide ein Paar Leggings oder Schenkeltücher warf, die einzeln einem mittelgroßen Manne sehr wohl als Mantel gedient haben könnten, und sich schließlich an die wohlbesetzte Tafel niederließ, alles mit der systematischen Ruhe des Hinterwäldlers: Leute, die bekanntlich langsam zu einem Entschluss kommen, aber wenn dieser gefasst ist, ihn ebenso besonnen wie unbeugsam verfolgen, weder Hindernisse scheuen noch Furcht kennen und in der größten Gefahr noch immer ein Mittel sehen, den Witz zu schärfen, anstatt sich davon abschrecken zu lassen.
»Sende Tomba mit den Fellen hinauf zu den Cherokees«, sagte er zu seiner Frau. »Ihr Ik-wan Sa geht hinab zu den Spaniern; er hat mir versprochen, die Felle mitzunehmen. Ich hoffe, der Deputy Agent ist daheim. Vielleicht muss ich auf einige Tage oben bleiben. Komme ich nicht innerhalb von zwei Tagen zurück, dann gehst du zu den Cherokees. Du weißt, die in Pennsylvanien sind auf – gegen den alten Adams. Soll der Teufel den Tory holen! Wenn die Rothäute es erfahren, so verlass dich darauf, dass sie sich die allgemeine Verwirrung zunutze machen und es hier losgeht. Tu auf alle Fälle, wie ich dir gesagt habe. Sie sind rege, und wir müssen uns sputen, sonst hängen unsere Bälge nächste Woche in ihrem Councilwigwam.« Mit diesen Worten nahm er seine schwere Reitpeitsche, mit der er einmal einen Damhirsch zu Boden geschlagen hatte, von der Wand, steckte eine gewaltige Pistole in seine lange Rocktasche und bestieg seinen Gaul.
Der Pfad, den unser Kapitän nun einschlug und der zur Wohnung des Deputy Agenten Kapitän Mc Lellan führte, zog sich zunächst durch einen weiten Fichtenwald. Der Boden war bedeckt mit einer leichten Schicht Schnee, der nach dem Hagelsturm gefallen war. Die tiefe Ruhe, die über die ganze weite Landschaft hingebreitet war, die schwarzen, schlank sich erhebenden Fichtenstämme, deren dunkelgrüne Zweige, mit prachtvollen Schneegirlanden behangen, in der Morgensonne gleich Millionen von Brillanten blitzten, die kalte, scharfe Morgenluft, die durch den Wald blies – all das begann auf ihn einzuwirken. Noch immer brütete er über der nächtlichen Szene und brachte sie mit verschiedenen Äußerungen früherer Besucher in Verbindung – eine Geistesarbeit, die ihn häufig in ein Brummen ausbrechen ließ, aus dem die Worte »Hol sie der Teufel!« zu entnehmen waren.
So mochte er einige Stunden dahingetrabt sein. Das Hochland senkte sich allmählich in eine breite Talweite, überwachsen mit Walnussbäumen, zwischen denen sich hie und da ein lichter Punkt zeigte, aus dem einzelne Hütten, aus Baumstämmen aufgezimmert, hervorschauten. Kleine Getreidefelder und Tabakpflanzungen schlossen sich im Hintergrund an die Häuschen und bildeten nicht unangenehme Ruhepunkte. Kapitän Copeland hatte sich dem Oconee genähert, an dessen Ufern die Wigwams immer häufiger erschienen. Diese Landschaft hatte bereits damals einen ziemlichen Anstrich von Kultur. Die Hütten waren hier geräumiger und den Wohnhäusern der westlichen Grundbesitzer nicht unähnlich. Man sah Ställe für das Vieh und große Flächen von Getreide- und Tabakpflanzungen, die zum Teil von Obstgärten umringt waren. Die Stirn unsers Hinterwäldlers fing sich an zu runzeln, als er seitwärts nach den Pflanzungen und Wohnhäusern schielte, von denen mehrere seines an Umfang und Wohnlichkeit übertrafen.
»Der Teufel weiß, was Oberst Hawkins im Sinn hat mit seinen Zimmerleuten, Webern, Schmieden und den tausend andern Leuten, die er diesen Rothäuten zuführt. Er wird doch nicht diese roten Teufel für immer in Georgia behalten wollen? Verdammt, es sieht ganz danach aus«, murmelte er nach einer Weile, während der er scheelsüchtig auf ein Wohnhaus hinabblickte, das nahe an seinem Weg lag.
»Sie haben ihre komfortablen Wohnungen und Anpflanzungen, als wären sie freie Männer. Selbst Hanf brechen sie«, fuhr er in demselben mürrischen Ton fort, als sein Blick einer Gruppe von Mädchen begegnete, die hinter dem Haus an offenen Feuern lustig ihren Hanf schwenkten. »Ich vermute, in einigen Jahren werden sie auch versuchen, ihren Whisky zu brennen. Immer zu, mein Oberst Hawkins. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Rothaut bleibt Rothaut, und ich könnte genauso gut versuchen, meine Neger weiß zu waschen, wie diese verräterischen Seelen zu ordentlichen Menschen zu machen.«
Dies waren die Ansichten, die bei den westlichen Siedlern allmählich vorherrschend wurden. Bereits in diesen früheren Zeiten begann man, mit unfreundlichem Auge auf die natürlichen und legitimen Besitzer dieses Landes zu sehen; man gewöhnte sich an, sie als einen Auswurf zu betrachten, dessen man sich nicht früh genug entledigen könne. Ihre Fortschritte in den verschiedenen Zweigen der Landwirtschaft und im mechanischen Gewerbe sah man mit Missgunst, da ebendiese den festen Entschluss zu beurkunden schienen, im Lande zu verbleiben.
Auf Oberst Hawkins war der Kapitän also keineswegs gut zu sprechen, der neben vielen guten Eigenschaften auch mehrere zweideutige in sich trug und unter den Letzteren eine tief sitzende Abneigung gegen die rote Rasse hatte, die er, seinen eigenen Worten nach, grimmiger hasste als die Iltisse. Diese Meinung behielt er jedoch, was nicht erstaunt, für sich, und selbst gegenwärtig entschlüpfte sie ihm nur in abgebrochenen Flüchen.
So hatte er etwa zwanzig Meilen zurückgelegt und war an den Abhang eines Bergrückens gekommen, von dem er eine weite Aussicht zurück auf die Niederung hatte. Noch einmal warf er einen Blick über die liebliche Gegend, als wollte er seine Erbitterung kräftigen, und gab dann seinem Klepper den Sporn. Ein dichtes Gebüsch von Hundsholz, Hickory und wilden Lorbeeren lag vor ihm, deren weit um sich greifende Zweige ihm beschwerlich ins Gesicht schlugen.
Er hatte bereits ein Dutzend Mal den Schnee, der auf ihn herabfiel, abgeworfen, als sich plötzlich ein leichtes Rauschen im Lorbeergebüsch hören ließ, das ihn stutzen machte. Er hielt einen Augenblick inne, seine grauen Augen auf das verdächtige Gebüsch gerichtet; dann zog er sich behutsam zurück, und mit der einen Hand in seine Tasche nach der Pistole fühlend, mit der andern die gewichtige Reitpeitsche ergreifend, harrte er der Dinge, die da kommen würden.
»Ja, sie sind mir auf der Fährte, darauf könnte ich wetten«, brummte er mit einem zweiten Blick auf das Dickicht, das seine buschigen Augenbrauen sträuben machte.
Die letzten Silben waren ihm kaum über die Lippen gekommen, als das Gebüsch sich öffnete und eine lange, schreckenerrregende Gestalt aus dem Gezweig trat und sich vor ihm auf eine Art aufrichtete, die ein besserer Christ als er unfehlbar für ein Gespenst gehalten hätte. Sein Pferd wich zurück, und der Reiter wäre fast aus dem Sattel geworfen worden. Es war der Häuptling von gestern, der vor ihm stand, die Hälfte seines Hauptes noch immer mit dem Tuch verbunden, sodass nur ein Auge zu sehen war, dessen starrer Blick sich mit dem Ausdruck der tiefsten Verachtung auf den Kapitän heftete.
»Ein mächtiger Krieger«, so sprach der Indianer nach einer langen Pause im Ton bittersten Hasses, »hat seine Rede einem Hund vorgeworfen, der nun geht, Unkraut in den Pfad zu säen, der zwischen den weißen und den roten Männern liegt. Hat er auch die Häupter derjenigen gezählt, die er in seinem Wigwam zurückgelassen hat? Wenn er zurückkehrt vom weißen Zwischenhändler, dürfte er es geleert und die Kopfhäute seines Weibes und seiner Kinder bereits getrocknet im Rauch der roten Männer finden.« Ein Hohngelächter erschallte zugleich aus dem Gebüsch, dessen Zweige sich öffneten, um zwei Reihen von drohenden Gestalten hindurchzulassen, die sich zu beiden Seiten dem Häuptling anschlossen.
Gegenwart des Geistes war eine Tugend, die zu üben unser Hinterwäldler in den zwei Jahren hinlänglich Gelegenheit gehabt hatte. Mit einem Gesicht, dem der vollendeteste Diplomat unserer Zeit kaum deutlicher den Stempel naiverer Verwunderung hätte aufdrücken können, wenn er auf Abwegen ertappt wird, erwiderte unser Kapitän: »Was ist denn? Darf ein ehrlicher Mann nicht einmal einige Ellen Flanell für ein Nachtröckchen besorgen, wenn ein großer Häuptling sein Pflegekind völlig ausgezogen hat, gleich einem Straßen …« … räuber wollte er sagen, verschluckte jedoch das Wort klugerweise.
Des Häuptlings Auge schien den Mann durchbohren zu wollen. »Braucht die Tochter des Kriegers Kleider?«, fragte er endlich.
»Alberne Frage!«, erwiderte der Kapitän mit derselben gleichgültigen Miene. »Betsi hat bloß einen Überrock, und den braucht sie selbst. Ich gebe eine Gill Whisky, wenn das arme Ding bis zu meiner Heimkehr nicht erfroren ist.«
»Der rote Krieger wird Kleider senden«, erwiderte der Häuptling, wandte sich sofort zum nächststehenden Indianer und flüsterte ihm einige Worte in die Ohren, worauf dieser mit einem Satz im Gebüsch verschwand.
»Gut, wenn ihr das Zeug, weshalb ich ausgeritten bin, schicken werdet, so erspare ich mir Mühe und Geld. Vergesst aber nicht die Schuhe und Strümpfe, oder Mokassins, ganz wie ihr wollt«, schloss Kapitän Copeland und wendete seinen Gaul, um aus der gefährlichen Nachbarschaft zu kommen.
Der Indianer gab jedoch ein Zeichen, das ihn halten machte. »Der Pfade«, sprach er, »die von dem Wigwam des weißen Mannes zu seinen Brüdern führen, gibt es viele, und seine Zunge ist sehr gekrümmt; aber die Augen und Ohren des roten Häuptlings sind weit offen. Dass nicht er oder sein Volk auf diesen Pfaden von den roten Männern gefunden werde; sonst nehmen sie seine und seiner Leute Kopfhäute.«
»Zum Teufel«, lachte der Kapitän, »ihr werdet mich doch nicht mit Weib und Kindern zum Gefangenen in meinem eigenen Hause machen wollen, wenn so viel auswärts zu tun ist, Rum einkaufen, Felle abliefern und tausend andere Dinge?«
»Der weiße Mann mag Rum holen, um den roten Mann zu betrügen und seine Kraft zu töten«, versetzte der Indianer mit bitterem Lachen, »aber er wird seinen weißen Bruder, zu dem er nun wollte, nicht sehen, bis der Mond dreimal gewechselt. Auch dann vergesse er nicht, seine Zunge zu bewahren.«
Der Indianer kehrte ihm nun den Rücken und verschwand im Gebüsch. Der Kapitän blickte ihm einige Sekunden nach, murmelte einige Flüche und gab, nachdem er aus voller Brust Atem geholt hatte, gleich einem, der einer drohenden Gefahr entgangen ist, bedächtig seinem Gaul den Zügel – um unverrichteter Dinge wieder nach Hause zurückzukehren.
Auf dem Heimwege hatte er viel Zeit, über den sonderbaren Häuptling nachzudenken. Dass die Indianer etwas im Schilde führten, schien außer Zweifel. Aber wo der Donnerschlag einfallen sollte und wie er zu verhindern war, war mehr, als er sagen konnte.
Im Laufe einiger Wochen erfuhr er zu seiner Beruhigung, dass der Sturm ausgebrochen war, aber glücklicherweise nicht seinen Mitbürgern, sondern ihren eigenen Bundesgenossen – der Choctaws der sechs Gebiete – gegolten habe, die näher dem Mississippi zu wohnten und von den vereinigten Stämmen der Creeks überfallen und beinahe vernichtet worden waren. Kapitän Copeland schloss die Lektüre der Zeitungsnachricht mit dem Wunsch: »Mögen die Rothäute sich alle einander den Hals umdrehen; dann bleibt für uns umso weniger zu tun übrig!« Ein Wunsch, der zum Leidwesen unseres Wirtes von der Zentralregierung nicht genehmigt wurde. Auf ihren Befehl und ihre Vermittlung wurde bald darauf der Friede zwischen den beiden Stämmen wiederhergestellt.
Die wiedergekehrte Ruhe gab dem Kapitän auch seine vorherige Freiheit zurück und mit dieser zugleich die Gelegenheit, von dem sonderbaren Nachtereignis den Schleier zu lüften. Doch alles, was man von ihm erfuhr, war die Vermutung, dass sein Pflegekind wahrscheinlich einer spanischen oder französischen Pflanzerfamilie am Mississippi angehöre. Mehr konnte oder wollte er nicht sagen, und das mürrische »Verdammt!«, mit dem er alle Fragen beantwortete, schreckte jeden Neugierigen von weiteren Versuchen ab, sich für das Schicksal eines Kindes zu interessieren, das ohnehin allem Vermuten nach von den Spaniern abstammte, die zu sehr im Ruf passiven Gehorsams standen, um die Achtung der freiheitsstolzen Hinterwäldler zu genießen, selbst wenn die ewigen Zwistigkeiten mit den spanischen Behörden eine nähere Berührung möglich gemacht hätten. Unser Kapitän schenkte weiterhin Rum und Whisky aus, nahm dafür Hirsch-, Elch- und Biberbälge ein, und, einen frischen Familienzuwachs jedes Jahr ausgenommen, ereignete sich weiter nichts, das besonderen Aufzeichnens wert gewesen wäre.
So waren beinahe sieben Sommer verstrichen. Die oben beschriebene Hütte hatte sich in der Zwischenzeit in ein geräumiges Haus verwandelt. Von dort aus hatte man die Aussicht über den sich sanft durch üppige Niederungen dahinschlängelnden Coosa, dessen Ufer bereits, mit aufblühenden Pflanzungen besetzt, der Gegend einen gewissen Anstrich von Sicherheit und Wohlstand gaben. Der Wirt war inzwischen ein gewichtiger Mann geworden.
Es war an einem herrlichen indianischen Sommerabend, als unser Kapitän mit seiner Familie und seinen Nachbarn an der Abendtafel saß, die, der Anzahl der Schüsseln nach zu schließen, einen feierlichen Anlass hatte. Der Tisch bot eine Mannigfaltigkeit von hiesigen Delikatessen dar, die auch ein feinerer Gaumen nicht verschmäht hätte. Wilde Truthühner, die deliziöse Bärentatze mit Fasanen, Wachteln und Hirschschenkeln, Kuchen aller Art und zahllosen Konfitüren, machten die Auswahl schwer. Obenan saß eine dünne, schmächtige Gestalt, deren jugendlich blasse Gesichtszüge und deren enthusiastisch frommer Blick einen methodistischen Prediger verrieten. Ihn hatte sein Eifer für die Verbreitung des Evangeliums in diese Gegend gebracht, und er verband nach dem Beispiel seiner Glaubensgenossen das Lehramt der Kanzel mit dem der Schule. Der fromme Eiferer hatte während der zwei Jahre seiner Mission regelmäßig vier Monate hindurch bei den drei Hauptstämmen der Creeks zugebracht. Die Zeit, die er für die Obercreeks bestimmt hatte, war nun verflossen, und er war soeben im Begriff, seinen Nachbarn und Mitbürgern Lebewohl zu sagen und die nahe indianische Niederlassung Coosa, wo er sich aufgehalten hatte, für immer zu verlassen.
An seiner Seite saß das kleine Mädchen, das sechs Winter vorher auf eine so seltsame Weise ein Mitglied dieser Familie geworden war. Es lag etwas ungemein Zartes und zugleich Edles und Verständiges in den Zügen dieses Mädchens, dessen klare Augen nachdenklich und, wie es schien, wehmutsvoll an dem leidend hektischen Gesicht des Predigers hingen. Der Prediger selbst war sichtlich eingenommen von ihrem Wesen und hatte sich schon während des Essens viel mit ihr beschäftigt. Bereits einige Mal hatte er zu sprechen versucht, immer aber war Kapitän John Copeland ihm ins Wort gefallen. Er schien etwas auf dem Herzen zu haben. Er winkte endlich dem Mädchen, sich zu entfernen, und es verließ Hand in Hand mit ihrer Spielgefährtin die Stube.
»Wollt Ihr denn nicht meinen Vorschlag hören, Kapitän?«, begann der Prediger. »Ich kann Euch nicht sagen, wie tief mir das Schicksal des armen Wesens zu Herzen geht. Sie hat sich seit den vier Monaten, die sie meine Schule besucht, in mein Herz eingenistet. Die Trennung von ihr wird mir wirklich schwer. Ich will sie gerne in meine Obhut nehmen. Ohnehin ist sie zu zart gebaut, um jemals eine rüstige Arbeiterin zu werden, und es wäre ja schrecklich, wenn sie den Indianern in die Hände fallen sollte.«
»Alles wahr«, sprach der Kapitän, »aber der Indianer hat jedes Jahr regelmäßig seine zehn Biber- oder Bärenfelle für Kost und Wohnung gesandt, nebst der Kleidung, und Ihr seht, ihr Anzug ist nicht der schlechteste. Er ist bloß ein Roter, aber ich kann nicht einfach über sein Eigentum verfügen.«
»Und Ihr habt nie wieder von ihm gehört?«, fragte der Missionär.
»Ich sah ihn noch zweimal«, erwiderte der Kapitän in einem Ton, dem man anhörte, dass er mit der Sprache nicht recht herauswolle. »Beide Male war er in seine blaue Wolldecke gehüllt, und ein drittes Mal sah ich sein Gesicht, jedoch nur in der Ferne. Lieber wäre ich hundert Meilen weit von ihm gewesen. War just so eine Weiberneugierde«, fuhr er fort, seine Worte mit einem bedeutsamen Blick auf seine Frau gerichtet. »Ich wollte hinüber zum Obersten Hawkins, um mit ihm wegen des Mädchens zu sprechen und es vielleicht in die Zeitungen zu setzen. Obwohl ich hinab nach New Orleans, hinauf nach Nashville und überallhin frei gehen durfte und, meine Frau ausgenommen, keine Seele ein Sterbenswörtchen von meinem Vorhaben erfahren hatte, wusste der Rote, obgleich ich einen bedeutenden Umweg nahm, genau, wo ich hinzielte. Er ließ mich vierzig Meilen auf der Straße nach Milledgeville forttraben und schoss dann meinen Gaul nieder wie einen Hund. Ja, ich habe Mistress Copelands Neugierde teuer bezahlen müssen.«
»Und keiner von den Indianern vermochte Euch je Aufschlüsse zu geben? Ihr sagt, er selbst habe dem Kinde die Korallen umgehängt. Ist kein geheimes Zeichen an der Schnur?«
»Je weniger davon gesprochen wird, desto besser«, erwiderte der Kapitän. »Das Kind ist eine Französin oder Spanierin, verlasst Euch darauf. Wenn Ihr aber Lust habt, mehr zu erfahren, so ist soeben die Gelegenheit da. Einer der Creeks liegt draußen im Schuppen.«
»Ich muss ihn sehen«, erwiderte der Prediger, verließ sogleich seinen Sitz und trat mit einem Glas Rum vor die Tür. Der Indianer lag im tiefen Schlaf auf dem Stroh, neben ihm sein Karabiner. Kaum war der Prediger vor ihn hingetreten, als er die Augen aufschlug und auf die Beine sprang. Der Prediger winkte, ihm in den Garten zu folgen, und nahm das Mädchen, dem er liebevoll einen Kuss auf die Stirn drückte, in seine Arme. Einen Blick warf der Indianer auf das Mädchen, einen zweiten auf die Glaskorallenschnur, und dann begann ein fieberartiges Zittern durch seine Glieder zu beben. Allmählich zog er sich erschrocken vor dem Kind zurück und flog endlich mit dem Schreckensruf »Hugh!« wie ein Pfeil über die Hecke. In wenigen Sekunden war er im Wald verschwunden.
Der Missionar kehrte betroffen ins Haus zurück.
»Wohlan, Mister Lovering!«, sprach der Kapitän mit gerunzelter Stirn. »Habt Ihr noch immer Interesse am Kind?«
»Jawohl«, erwiderte der Prediger. »Und wenn Ihr einverstanden seid, so will ich mit dem Agenten sprechen.«
»Nein, damit bin ich nicht einverstanden«, erwiderte der Kapitän trocken. »Wenigstens nicht, solange ich hier bin. Mein Wort muss ich halten, so lange nämlich, als ich noch am Coosa bin. Aber meine Zeit hier geht zu Ende. Ich sehne mich nach einem ruhigen Platz, und wenn mich nicht alles trügt, so sind die Creeks wieder in Bewegung. Es wird stürmisch hergehen, verlasst Euch darauf. Man sagt, der Häuptling der Oconees sei wieder einmal rege und daran, sich mit dem schrecklichen Tecumseh zu verbünden. Zwei solche Menschen könnten die Welt in Flammen setzen.«
»Ja, das sind beide gefährliche Männer«, erwiderte der Prediger.
»Wenn ich unten am Mississippi bin, der nun, Gott sei Dank, uns und nicht dem jämmerlichen Spanier gehört, dann mögen sie tun, was sie wollen.«
»Jawohl!«, bekräftigte Mistress Copeland. »Das arme Ding, sie wird nie zur Arbeit taugen. Sie ist so linkisch, als wenn sie nicht dazu geboren wäre. Sie wäre vielleicht eine gute Hilfe beim Nähen und dergleichen, oder für eine Mädchenschule, denn sie schreibt und liest wie ein Schulmeister.«
Die gute Frau war soeben im Begriff, sich ausführlichst über die Fähigkeiten ihrer Milchtochter auszulassen, als ein durchdringender Angstruf vom Garten her erschallte. Im nächsten Augenblick rannte das Mädchen, von dem soeben gesprochen wurde, bleich und zitternd in die Stube, und auf den Prediger zueilend, fiel sie vor ihm hin und umfasste seine Knie mit jammernden Klagelauten.
Die Angst des Kindes hatte die Anwesenden mit Verwunderung und Bestürzung erfüllt. Sie blickten mit starrem Auge und offenem Mund nach der Tür, als das Kind mit dem Ausruf: »Da ist er!« zusammensank. Ein langer, hagerer Indianer trat im selben Augenblick in die Stube, warf einen durchdringenden Blick auf die Anwesenden und ließ sich dann auf einen Stuhl nieder. Seinem Anzuge nach zu schließen, war er ein Häuptling ersten Ranges. Seine Gestalt, obwohl sichtlich abgemagert, war kolossal und verriet ungemeine Stärke. An seinen Schläfen und nackten Armen lagen beinahe fingerdick Muskeln, die ihn mehr wie eine bronzene Statue als wie ein Lebewesen aussehen ließen. Das Merkwürdigste an diesem imposanten Mann war jedoch das nach der alten Weise der Mikos oder Könige der Oconees mit einem Diadem von Federn gekrönte Haupt. Seine Stirne war äußerst schmal, endete jedoch zu beiden Seiten in zwei ungeheuren Backenknochen, die zwischen dem dünnen Kinn und den äußerst schmalen Lippen zwei tiefe Höhlen bildeten, die den trockenen, beinahe verwitterten Zügen des fleischlosen Gesichts einen Ausdruck von Tücke, Starrsinn und Intelligenz gaben. Der Anzug dieses merkwürdigen Mannes bestand in einer Weste von gegerbter Hirschhaut, die seine ungemein breite Brust vollkommen bedeckte, einem Jagdhemd aus Kaliko, welches darüber geworfen war, und dem Lendentuch, das in bunten Farben gewirkt vom Wampumgürtel herabhing und die Schenkel und Knie entblößte. Seine Mokassins waren reichlich verziert. In seiner Rechten hielt er einen Karabiner, und in seinem Gürtel stak ein Schlachtmesser, reichlich mit Silber eingelegt.
»Tokeah!«, rief der Missionar aus, den seine Wanderungen im Gebiet der Indianer mehr mit den verschiedenen Stämmen und ihren Häuptlingen bekannt gemacht hatten, als der stationäre Schankwirt Zum Indianischen Häuptling es werden konnte.
Der Letztere wollte soeben sein Glas zum Mund heben; aber seine Trinklust schien plötzlich verschwunden, als ein Name genannt wurde, der mit dem des tödlichsten Feindes seiner Landsleute gleichlautend geworden war. Er setzte das Glas auf den Tisch und musterte den Häuptling vom Kopf bis zu den Füßen.
»Sechs Sommer und sechs Winter«, sprach dieser nach einer langen Pause, »sind gegangen und wiedergekommen, seit der Miko der Oconees seine Tochter bei seinem weißen Bruder gelassen hat. Er ist nun gekommen, sie in seinen Wigwam aufzunehmen.«
»So seid Ihr es denn, der uns in jener bangen Nacht die arme Rosa hinterlassen hat, wie sie unser Prediger hier nennt? Warum habt Ihr mich Euern Namen nicht wissen lassen oder das Kind abgeholt? Es hat uns manch bange Stunde verursacht. Wenn es nun abhandengekommen wäre?«
»Die weißen Männer verlangen bloß nach den Tierfellen und den Ländereien des roten Mannes; wenig ist ihnen an einem Häuptling und seinem Wohlgefallen gelegen«, erwiderte der Indianer mit einem bitteren Lachen. »Wenn das Kind verloren gegangen wäre, so würden Eure Kinder mit ihren Schöpfen dafür bezahlt haben. Und nun will der rote Häuptling nehmen, was ihm gehört.«
»Ihr nennt doch nicht Rosa, deren Eltern Ihr wahrscheinlich ermordet habt, Euer Eigen?«, sprach der Prediger mit einem Mut, der selbst den Schankwirt staunen machte.
Der Indianer warf einen Blick der tiefsten Verachtung auf ihn. »Wo würde nun die weiße Rose, wie du sie nennst, sein, wenn die Hand Tokeahs nicht den Arm aufgehalten hätte, der ihren Schädel an einem Baumstamme zerschmettern wollte? Wer hat für sie gejagt, als sie noch auf ihren Händen und Füßen herumkroch? Wer hat für sie die Biberfelle gesandt und hat selbst Wasser getrunken? Geh«, fuhr er mit steigendem Abscheu fort, »Ihr seid Hunde! Eure Zunge spricht von Dingen, von denen Euer Herz nichts weiß. Ihr sagt uns, wir sollen unsere Nächsten lieben, während diese uns unsre Felle, unser Vieh, unser Land nehmen, uns in die Wüste treiben.«
»Der Miko der Oconees«, erwiderte der Missionar unerschrocken, »wird sicherlich nicht eine arme, christliche Waise ihren Pflegeeltern entreißen wollen? Der weiße Vater würde böse sein, und er wird gern bezahlen.«
»Nicht nötig«, rief Mistress Copeland, »wir wollen sie gerne umsonst behalten. Wo zwölf Mäuler essen, wird auch das dreizehnte nicht verhungern.«
»Ja, sicher nicht«, fügte Kapitän Copeland hinzu, hielt jedoch inne, als er bemerkte, dass der Indianer ihm stolz Zeichen des Stillschweigens gab.
»Der Miko der Oconees«, sprach der mit würdevollem Ton, »wird nie wieder den weißen Vater sehen. Sein Pfad ist lang, sein Herz sehnt sich nach Freiheit; er will sie suchen, da wo der Weiße noch nie seinen Fuß hingesetzt hat. Er braucht seine Tochter, sein Wild zu kochen und sein Jagdhemd und seine Mokassins zu nähen.« Nach diesen Worten öffnete er die Tür, und eine Anzahl Indianer traten mit zwei Mädchen in die Stube.
»Canondah!«, rief der Missionar und streckte dem indianischen Mädchen die Hand entgegen. Die Indianerin näherte sich dem Prediger, kreuzte ihre Hände über ihrem Busen und senkte demütig das Haupt.
»Du willst uns also wirklich verlassen?«, fuhr der Missionar fort.
Das Mädchen gab keinen Laut von sich. Der Häuptling machte ein Zeichen, worauf das zweite Mädchen die bebende Rosa auf ihre Arme nahm und ihr einen Teppich umwarf, dessen untere Zipfel sie dem anderen Mädchen in die Hand gab, während sie die oberen über ihre Schultern zog und verknüpfte. Zugleich wand sie ein breites Band um die Hüften des Kindes, das, so emporgehoben, seine Arme um den Hals seiner Trägerin zu winden genötigt und zum Aufbruch bereit war.
Der Missionar und die Frau des Kapitäns hatten mit Tränen in den Augen zugesehen, wie die vor Schrecken erstarrte Kleine gleich einem Schlachtopfer sich lautlos binden ließ. Der Missionar trat nun zu der Indianerin heran: »Canondah, du bist immer ein edles Mädchen gewesen; eine Perle. So empfehle ich denn deiner schwesterlichen Liebe und Sorge dieses Kind. Willst du ihr Mutter sein?«
Sie nickte.
»Und dieses Buch«, der Prediger überreichte ihr eine Taschenbibel, »sei dir und Rosa ein Andenken an euern Lehrer. Trage ihn, der dich erlöset hat, stets in deinem Herzen.« Dann legte er seine Hände auf ihre Häupter und gab ihnen den Segen.
Beide verließen mit ihrer Bürde und den Indianern nun die Stube; der Häuptling war allein zurückgeblieben.
»Der Miko der Oconees«, sprach er mit Würde, sich von seinem Platz erhebend, »hat bezahlt für die Milch, die das weiße Weib seiner Tochter gegeben. Er geht nun. Sein Pfad ist lang, sein Weg rau; aber sein Herz ist müde der Weißen. Möge er sie nie wiedersehen.« Nachdem er diese Worte gesprochen hatte, wandte er den Anwesenden den Rücken und verließ die Stube.
Ein langer Atemzug entfuhr den Gästen gleichzeitig. Kapitän Copeland war der Erste, der den Gebrauch seiner Zunge wiederfand und sich von seinem Erstaunen erholte. Im Ganzen genommen war er nicht ganz unzufrieden, einer Sorge enthoben zu sein, die ihm, nach seiner Versicherung, mehr schlaflose Nächte verursacht hatte als irgendetwas anderes in seinem Leben.
Wir selbst verlassen nun Georgia und die Familie unseres Tauschhändlers, um den Faden unserer Geschichte in einem fernen Land und nach Verlauf von mehreren Jahren wieder anzuknüpfen.
3
Am nördlichen Ende des Sabinersees und mitten aus den Rohr- und Zypressensümpfen, die sich von dieser Seite her dem See zu senken, erhebt sich zwischen den beiden Flüssen Sabine und Natchez eine schmale Landzunge, die in dem Maß, in dem die beiden Flüsse sich voneinander entfernen, eine sanft ansteigende Anhöhe bildet, zu deren beiden Seiten die zwei Flüsse ihre klaren und lieblichen Gewässer dem dunkelgrünen Versteck der Zypressen und des Palmetto und dann dem oben erwähnten See zuführen, der sich selbst dem Busen von Mexiko öffnet.
Beinahe scheint es, als ob die Natur in ihrer Laune den Einfall gehabt hätte, die Grenzscheidung der beiden mächtigen Staaten, die der Sabine-Fluss bildet, recht deutlich zu setzen. Ein schwarzer, undurchdringlicher Wald bedeckt sein rechtes Ufer, so dicht verwachsen von ungeheuren Dornen, dass selbst der gejagte Damhirsch oder Savannenwolf nur selten tiefer einzudringen vermag. Der Grund ist überzogen von einem undurchdringlichen Teppich aus Schlingpflanzen, unter deren verräterischer Hülle sich gefleckte und schwarze Klapperschlangen, Kingsheads und Copperheads winden, auf wilde Tauben, Spottvögel, Papageien oder schwarze Eichhörnchen lauernd. Nur selten ist dieses undurchdringliche Dunkel von einer Lichtung unterbrochen, und wo sich eine solche findet, ist es ein Chaos modernder Baumstämme, entwurzelt durch einen der häufigen Tornados und übereinandergeschichtet, als ob sie zu einem künstlichen Festungswerk bestimmt wären. Diese wilde Üppigkeit erreicht ihren höchsten Grad in der Nähe der Zypressenniederung, nimmt aber auf der andern Seite des Sumpfes einen sanfteren Charakter an, und der verirrte Schiffer sieht sich wie durch einen Zauberschlag in eine der entzückendsten Landschaften Mexikos versetzt, wo die hängende Myrte, der prachtvolle Tulpenbaum und die Palma Christi mit der dunkeln Mangrove wechseln und auf der Anhöhe der Kottonbaum und die Sykomore ihre grünlich silbernen Zweige über einen Wiesengrund des zartesten Grüns ausbreiten. Der ganze Wald ist gleich einem ungeheueren Zelt mit Jasmin und wilder Rebe durchwirkt, die vom Grund aufschießt, sich am Stamm aufhängt, zum Gipfel hochrankt und wieder herabsteigt, um sich dem nächsten Stamm zuzuwenden, und so, von der Mangrove zur Myrte, von der Magnesie zum Papaw, vom Papaw zum Tulpenbaum kriechend, eine große, endlose Laube bildet.
Der breite Gürtel selbst, auf welchem der Natchez seine Gewässer dem See zusendet, bietet dem Auge ein üppig wallendes Feld säuselnder Palmettos, das vom Wald ungefähr eine halbe Meile dem Ufer zuläuft, wo Mangrove und Zypresse ihre trauernden Zweige tief in die Fluten tauchen. Der Winter nähert sich diesem entzückenden Versteck nie; aber lang anhaltende schwere Regengüsse füllen während der sogenannten Wintermonate Flüsse und Sümpfe und bereiten so für die heiße mittägliche Sonne ein furchtbares Tagewerk. Dann hört man ein Gebrüll aus dem erstickenden Dunstmeer, dessen grauenerregender Ton Tiere und Menschen fernhält.
Der Herbst jedoch ist eine prachtvolle Jahreszeit in dieser paradiesischen Gegend und besonders jener Spätherbst, »indianischer Sommer« genannt, der auch im Norden der großen Republik, gleich dem Abschiedslächeln einer holden Schönen, mit Wonne empfangen wird.
Es war einer dieser herrlichen Indianer-Herbstnachmittage. Die Sonne, so golden, wie sie nur in dieser Gegend und zu dieser Jahreszeit zu sehen, neigte sich bereits hinter die Gipfel der Bäume, welche das westliche Ufer des Natchez umgürten. Ihre Strahlen spielten in jener Mannigfaltigkeit von Farben, die im Westen so sehr bewundert werden und vom Hellgrünen in die Gold-, von der Purpur- in die Orangefarbe verschmelzen, je nachdem, wie die Strahlen von der Myrte, Magnesie, der Palma Christi oder einem der hundert anderen Prachtgewächse zurückgeworfen werden. Kein Wölkchen war am Himmelszelt zu sehen, balsamische Düfte wehten durch die Luft und füllten die Atmosphäre mit einer zitternd elastischen Wollust, die die Sehnen zum üppigen Leben spannt. Die leise Stille war nur selten durch einen plappernden Papagei oder einen pfeifenden Spottvogel unterbrochen oder durch das Geräusch vom Auffliegen einer Schar Wasservögel, die zu Tausenden am breiten Wasserspiegel des Natchez ihr Wesen trieben und zum Winterzug ihr Gefieder putzten.
Auf dem schmalen Pfad, den die Natur sich zwischen dem Wald und dem erwähnten Palmettofeld selbst gebahnt zu haben schien, sah man eine weibliche Gestalt einem offenen Waldplätzchen zutanzen, das, gebildet durch eine entwurzelte Sykomore, sich am äußersten Ende des Pfades befand. Als sie vor dem Baumstamm angelangt war, lehnte sie sich an einen der Äste, um Atem zu holen. Ihre Hautfarbe verriet indianische Abstammung. Sie war ein gereiftes Mädchen von etwa zwanzig Jahren mit einem äußerst interessanten, ja edlen Gesicht. Die wohlgeformte Stirn, das schwarze, beinahe schelmische Auge, die fein geschnittenen Lippen sowie die Umrisse der beweglichen Züge überhaupt verrieten eine freie, muntere Stimmung, während die Adlernase ihr einen Anstrich von Entschlossenheit gab, mit der Haltung und Kleidung übereinzustimmen schienen.
Ihre Kleidung unterschied sich deutlich vom gewöhnlichen Kostüm indianischer Mädchen und zeichnete sich ebenso durch Einfachheit als Geschmack aus. Sie trug ein ärmelloses Kleid von Kaliko, das ihr bis zu den Knöcheln reichte. Ihre Haare, statt lang und straff herabzuhängen, wie es bei Indianerinnen der Fall ist, waren in einen Knoten geschlungen, den ein eleganter Kamm am Scheitel festhielt. Ein Paar goldene Ohrringe und Armbänder vom selben Metall, Halbstiefel aus Scharlachstoff und Alligatorhaut vollendeten das zierliche Äußere. Von ihrem Gürtel herab hing ein langes Taschenmesser, und in ihrer Hand trug sie einen großen, leeren Handkorb. Ihr Gang konnte nicht Gehen noch Laufen genannt werden; es war ein drolliges Hüpfen oder vielmehr Springen. Immer nach zehn oder zwölf Sätzen hielt sie inne, blickte auf den zurückgelegten Pfad zurück und hüpfte wieder vorwärts, um wieder auf dieselbe Weise zurückzuschauen.
Keuchend stand sie nun am Kottonbaum, während ihr Auge auf den Pfad spähte.
»Aber Rosa«, rief sie zuletzt in der indianischen Sprache und leichter Ungeduld, während sie wieder zehn oder zwölf Schritte zurücktanzte und sich einem zweiten Mädchen näherte, das nun auf den Windungen des Pfades auftauchte. »Rosa«, wiederholte sie, »wo bleibst du denn?« Und mit diesen Worten sprang sie auf das Mädchen zu, sank auf ihre Schenkel und umschloss, so sitzend, mit beiden Armen das vor ihr stehende Mädchen mit einer Schnelligkeit und Gelenkigkeit, die den Windungen einer Schlange abgelernt zu sein schienen.
»Ach, die weiße Rose«, klagte sie, »ist nicht mehr dieselbe. Sieh, wie das Gras auf dem Pfad wächst, den dein Fuß so oft betreten hat. Warum ist meine weiße Rose betrübt?« Die klagende Stimme der Indianerin war so rührend, ihr ganzes Wesen, als sie ihre Arme liebkosend um ihre Freundin schlang, so flehend, die Ängstlichkeit so unverhohlen in ihrer Miene zu lesen, dass niemand hätte sagen können, ob diese Liebe näherer Verwandtschaft oder der Zuneigung und Freundschaft entsprang.
Das schwarzbraune Auge, das feurig und doch wieder so kindlich zart, von seidenen Augenwimpern beschattet, nun auf der Indianerin ruhte, dann wieder aufblickte und in die Ferne schweifte, als suche sie etwas Namenloses, das Erbeben des zarten Busens, die von einem rosigen Hauch angehauchten Wangen, die zarte und doch so elastische Luftgestalt – all das schien der verjüngten Liebesgöttin anzugehören. Der ruhige Blick wiederum, die edel geformte Stirn, der rosige Saum am Mund, der ein Paar Korallenlippen eher anzudeuten als zu zeigen schien, gaben dieser Gestalt einen Anstrich würdevoller Besonnenheit, der auch den leisesten sinnlichen Gedanken verscheuchte und einen unwillkürlich mit achtungsvollem Entzücken erfüllte. Ihr dunkelblondes Haar fiel in langen Locken um einen schneeweißen, herrlich geformten Nacken. Ein grünseidenes Kleid umhüllte ihre Glieder. An den Füßen trug sie Scharlachmokassins wie die Indianerin. Um ihren Hals war ein weißes Seidentuch in einen Knoten geschlungen, und in der Hand trug sie einen Strohhut.
Dieses Kind war jene Rosa, deren Bekanntschaft wir sieben Jahre zuvor in der Schenke Zum Indianischen Häuptling gemacht haben. Ihr Blick ruhte sinnend und wehmütig auf ihrer Freundin; eine Träne trat in ihr Auge, und ihr Haupt neigend, presste sie einen Kuss auf die Lippen des indianischen Mädchens.
Eine Weile hörte man die beiden Mädchen schluchzen. Dann klagte die Indianerin: »Canondahs Herz ist offen für Rosas Weh. Sage deiner Canondah, was dein Herz betrübt.« Ihre Stimme nahm nun einen melodisch wehmütigen Ton an. »Sieh, diese Arme haben die weiße Rosa getragen, als sie noch sehr klein war. Auf diesen Schultern hing sie, als sie über den großen Fluss setzte. Canondah ist der Spur der weißen Rosa Tag und Nacht gefolgt wie die Hirschmutter ihren Jungen, sie vor Schaden zu bewahren. Nun ist sie groß geworden und will ihr Herz verschließen. Oh, sage deiner Canondah, was dich zittern lässt!«
Rosa sah einen Augenblick ihre Freundin an und sprach dann leise: »Was mir am Herzen liegt und mich bang und ängstlich macht? Weiß es Canondah nicht?«
»Ist es der große Häuptling der Salzsee, der ihr diesen Schmerz verursacht?«
Rosa erblasste, trat zurück und bedeckte schluchzend ihr Gesicht mit beiden Händen.
Die Indianerin zog das weinende Mädchen sanft unter einen Kottonbaum, an dessen Stamm sich eine Rebe bis zum Gipfel emporgewunden hatte, von der zahlreiche Girlanden üppig herabhingen.
»Traurig ist der Pfad eines Oconeemädchens«, stieß die Indianerin nach einer langen Pause hervor, während der sie Trauben einsammelte. »Wenn die Krieger auf die Jagd gehen, verseufzen wir Ärmsten in den Wigwams unsere Tage oder pflügen Korn. Oh! Wäre doch Canondah ein Mann.«
»Und El Sol?«, flüsterte Rosa mit einem melancholischen Lächeln. »Canondah sollte nicht klagen.«
Die Indianerin hielt ihr mit der einen Hand den Mund und drohte ihr mit der andern. »Ja«, erwiderte sie, »El Sol ist ein großer Häuptling, und Canondah verdankt ihm ihr Leben, und sie will sein Wildbret bereiten und seine Jagdhemden weben und ihm mit leichtem Herzen folgen, und die weiße Rosa wird horchen, was ihre Schwester ihr in das Ohr singen wird. El Sol wird bald im Wigwam der Oconees sein, und dann will ihm Canondah sanft ins Ohr flüstern. Er ist ein großer Häuptling, und der Miko wird seine Rede anhören: Er wird die Geschenke, die der Häuptling der Salzsee geschickt hat, zurücksenden, und dann wird die weiße Rosa seinen Wigwam nie sehen.«