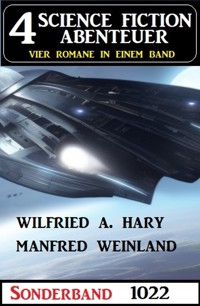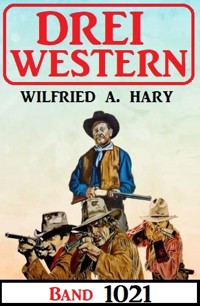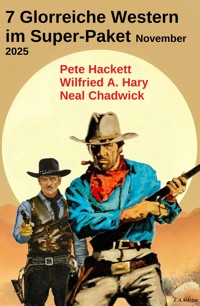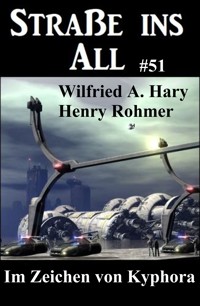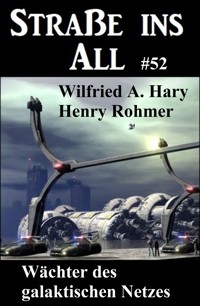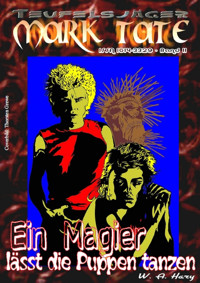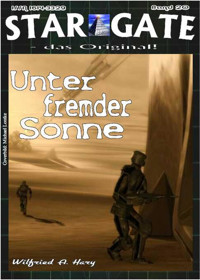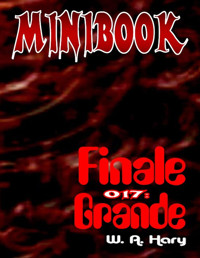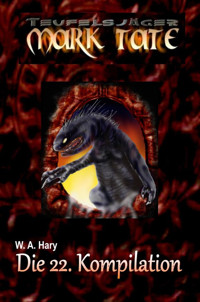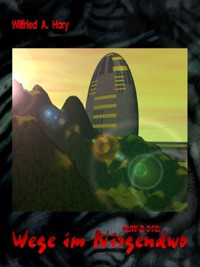
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
HdW-B 010: Wege im Nirgendwo
Wilfried A. Hary: „Das Experiment - und seine unvorhersehbaren Folgen!“
John Willard, der Diener des Sternenvogts, des Herrn der Welten, erfährt, daß der Sternenvogt einst ein... Mensch gewesen ist mit Namen Professor Richard Spencer.
Und der Sternenvogt läßt ihn virtuell Zeuge davon werden, was damals mit ihm geschah: Im Rahmen eines verrückten Experimentes verschlug es ihn in eine andere - eine offensichtlich jenseitige! - Welt.
Es gelang ihm die Rückkehr, sogar schon zweimal, doch seine Experimente lockten Zaungäste an...
________________________________________
Impressum:
Die Bände 30 bis 32 von HERR DER WELTEN hier in einem Buch zusammengefasst!
ISSN 1614-3302
Copyright neu 2015 by HARY-PRODUCTION, Canadastraße 30, D-66482 Zweibrücken, Telefon: 06332 48 11 50, HaryPro.de, eMail: [email protected]
Sämtliche Rechte vorbehalten!
Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung von
HARY-PRODUCTION!
Coverhintergrund: Anistasius
Titelbild: Gerhard Börnsen
Nähere Angaben zum Autor siehe hier: de.wikipedia.org/wiki/Wilfried_A._Hary
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
HdW-B 010: Wege im Nirgendwo
Die Bände 30 bis 32 von HERR DER WELTEN hier in einem Buch zusammengefasst!
Nähere Angaben zum Autor siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Wilfried_A._HaryBookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenHdW-B 010:
Wege im Nirgendwo
Wilfried A. Hary
»Das Experiment
- und seine unvorhersehbaren Folgen!«
Impressum
ISSN 1614-3302
Copyright neu 2015 by HARY-PRODUCTION
Canadastraße 30 * D-66482 Zweibrücken
Telefon: 06332 48 11 50 * Fax: 01805 060 343 768 39
www.HaryPro.de
eMail: [email protected]
Die Bände 30 bis 32 der Serie HERR DER WELTEN hier in einem Buch zusammengefasst!
Sämtliche Rechte vorbehalten!
Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung von
HARY-PRODUCTION!
Lektorat: David Geiger
Covergestaltung: Anistasius
Copyright Titelbild: Gerhard Börnsen,
Steinruther Str. 13, D-58093 Hagen
Einführung
Irgendwann in fernster Zukunft: Viele tausend Welten sind von Menschen besiedelt. Überlichtschnelle Flüge sind verboten, weil es sich erwiesen hat, dass diese auf Dauer das energetische Gleichgewicht des Universums und somit das Raum-Zeit-Gefüge stören, was in manchen Bereichen des Universums in der Vergangenheit zu schrecklichen Katastrophen führte.
Die von Menschen besiedelten Welten haben keinen direkten Kontakt miteinander, da es keine überlichtschnellen Kommunikationsmöglichkeiten gibt. Dennoch entstand im Verlauf der Jahrtausende ein funktionierendes Handelssystem: Riesige Container-Schiffe sind im Unterlichtflug unterwegs zu ihren Zielwelten, mit mannigfaltigen Waren bestückt. Sie sind teilweise Jahrtausende unterwegs, um ihr Ziel zu erreichen, aber da der Strom der Handelscontainer niemals abreißt, werden die Planeten untereinander reibungslos versorgt.
Die Erde beispielsweise ist eine gigantische »Zuchtanstalt für Menschenmaterial« - dem wichtigsten »Exportartikel« für die Erde. Die Betreffenden werden in Tiefschlaf versetzt, bevor sie auf den Weg gehen. Ein übriges tut die Zeitdilatation, so dass sie unbeschadet den langen Flug überstehen.
Dieses komplizierte Handelssystem ist natürlich hochempfindlich - und muss überwacht werden. Dafür zuständig ist der Sternenvogt - der HERR DER WELTEN! Nur ein Sternenvogt besitzt das Monopol des Überlichtfluges, um seiner Aufgabe auch gerecht werden zu können. Aber dieser verhältnismäßig minimale Einsatz des Überlichtfluges hat keine negativen Auswirkungen auf die universale Ordnung.
Es gibt mehr als nur einen Sternenvogt, doch das Universum ist groß genug für alle - und so begegnen sie sich untereinander nur, wenn es unbedingt nötig erscheint...
1
Der Dachlandeplatz auf der Villa von Professor Richard Spencer wurde von einer halbhohen Mauer umgeben. Man konnte die in seinem Dienste stehenden Detektive Hapkins und Jussuf von unten nicht sehen. Wenigstens so lange nicht, bis sie über die Mauer hinwegspähten.
Prüfend sah Jussuf zum Himmel. Die Sonne stand knapp über dem Horizont. Noch mindestens eine Stunde bis zum Einbruch der Dunkelheit. Er wünschte sich, es wäre bereits soweit. Sie hätten es wesentlich leichter gehabt.
Hapkins betrachtete seine Uhr. Der Trupp mußte die Villa fast erreicht haben. »Jetzt!« zischte er und richtete sich auf. Sein Strahler zeigte in die Richtung, in der er den Trupp vermutete. Es war niemand zu sehen. Doch, da bewegte sich das Gestrüpp! Hapkins feuerte blindlings.
Zwei Gestalten tauchten auf. Sie hoben ihre Waffen und wollten das Feuer erwidern. Hapkins hatte sie nicht richtig getroffen. Deshalb torkelten sie weiter.
Das Gestrüpp gab zwar Sichtdeckung, schützte jedoch kaum vor den Schockstrahlen. Dort, wo sie auftrafen, begannen die Pflanzen in einem geisterhaften Licht zu glühen. Pflanzen waren gegenüber den Schockstrahlen unempfindlich. Aber sie gaben die Energie weiter an die Männer, die sich dahinter verborgen hielten.
Hapkins brauchte nicht mehr zu schießen, denn Jussuf schaltete sich ein. Die beiden Agenten dort unten brachen getroffen zusammen.
»Das hätten wir«, murmelte Hapkins schadenfroh. »Jetzt kommt der zweite Trupp an die Reihe. Nur gut, daß die nicht alle drei zur gleichen Zeit hier anlangen.«
»Spencer hat unsere Möglichkeiten dennoch überschätzt«, sagte Jussuf pessimistisch.
»Ich denke, du hältst nichts vom Einschalten der Polizei?«
»Darin habe ich meine Meinung nicht geändert! Na los, worauf warten wir noch? Von wo kommen sie?«
Geduckt liefen sie die Mauer entlang bis zur linken Seite der Villa. Hapkins richtete sich als erster auf.
Der Hof an der Seite der Villa war leer. Soeben verließ ein Trupp von vier bewaffneten Männern das Gestrüpp und wollte über den Hof rennen. Hapkins schoß. Jussuf setzte seine Waffe fast gleichzeitig ein. Die vier hatten mit diesem plötzlichen Angriff überhaupt nicht gerechnet. Sie stürzten zu Boden und rührten sich nicht mehr.
»Der dritte Trupp!« zischte Hapkins und lief auch schon davon. Jussuf war dicht hinter ihm, als sich Hapkins an der entsprechenden Stelle aufrichtete und feuerte. Sein Orientierungssinn sprach Bände. Jussuf hatte dem Partner die Überwachungsanlage überlassen, weil sich Hapkins besser damit auskannte.
An dieser Seite reichte die Wildnis bis hart ans Haus heran. Das Gestrüpp war ungewöhnlich hoch. Die beiden sahen nichts und niemanden. Der einzige Beweis dafür, daß sie trotzdem getroffen hatten, lag im Fehlen von Gegenfeuer.
Hapkins hetzte zum Gleiter, um sich zu überzeugen. Tatsächlich, die Ortung zeigte genau die Stelle, auf die sie geschossen hatten.
Schweratmend lehnte sich Hapkins gegen die Außenwandung des Fluggefährts. »Uff, das wäre geschafft!«
Jussuf schüttelte den Kopf. »Ich sehe keinen Grund zur Euphorie. Es ging einfach zu leicht. Außerdem wissen wir noch immer nicht, um wen es sich handelt. Um konkurrierende Gruppen? Oder wollten die nur nachsehen, wo ihre beiden Kollegen bleiben?«
»Ich tendiere zu letzterem, denn Konkurrenten hätten sich schon außerhalb des Areals gegenseitig ausgeschaltet.«
Hapkins kletterte wieder in den Gleiter und widmete sich der Kontrolleinrichtung. Die drei Energieortungen tastete er aus.
»Was sollen wir mit den Bewußtlosen denn machen?« beschwerte er sich. »Die Polizei muß her und sie abtransportieren.«
»Nur mal langsam!« mahnte Jussuf. »Wir müssen erst mit Professor Spencer Rücksprache halten, ehe wir etwas in dieser Richtung unternehmen.«
»Und in der Zwischenzeit kommen die nächsten Kommandotrupps und rennen uns über den Haufen. Mein Gott, wir sind zwei Irre auf verlorenem Posten. Außerdem ist das überhaupt nicht unser Krieg, sondern der von Spencer.«
Jussuf ließ Hapkins schimpfen. Karl Hapkins benötigte das jetzt als Ventil. Während der Schimpfkanonade beendete er seine Arbeit.
Jussuf überprüfte seine Strahlwaffe und sagte halblaut: »Wir halten es solange aus, wie es geht. Dann erst lassen wir die Polizei hierher, um die Bewußtlosen einzusammeln. Was die getan haben, ist zumindest unbefugtes Betreten eines privaten Grundstücks. Da die Kerle bewaffnet sind, kann man ihnen sogar den Versuch eines bewaffneten Überfalls unterschieben.«
»Was war das denn sonst, he? Ein Spaziergang im Grünen?«
»Nun laß mich doch erst einmal ausreden, Karl! Wir können den Polizisten das alles erzählen und brauchen auf die Arbeit von Spencer überhaupt nicht einzugehen. Aber bevor wir die Polizei rufen, müssen wir den nächsten Angriff abwarten.«
»Wie bitte? Habe ich mich vielleicht verhört?«
»Nein, Karl, du hast dich nicht verhört. Es ist doch so: Wenn wir jetzt die Polizei anfordern, wissen wir nicht mehr zu unterscheiden zwischen Freund und Feind, zwischen Angreifern und Polizisten, die uns helfen wollen.«
»Mann, hast du eine komplizierte Art. Warum kannst du das nicht gleich sagen und mußt einen ganzen Vortrag daraus machen?«
Jussuf grinste nur, während Hapkins mal wieder in den Gleiter kletterte und die Überwachungseinrichtung kontrollierte. »He!« rief er erschrocken, »die spannen uns gar nicht auf die Folter. Vielleicht hatten die Trupps Funkgeräte dabei? Jedenfalls rückt die nächste Front näher!«
Jussuf kletterte ebenfalls hinein und blickte seinem Partner über die Schulter.
»Diesmal kommen sie sogar mit Gleitern«, ächzte er.
»Das erinnert mich an deine Polizisten. Und wenn das nun Beamte von der wissenschaftlichen Behörde sind? Wenn sie einfach keine Geduld mehr haben und selbst nachsehen wollen?«
Jussuf zuckte nur mit den Schultern. Es waren rund zwanzig Gleiter. Vergeblich suchte der Agent nach einem Ausweg aus dem Dilemma. Spencer hatte sich tatsächlich geirrt, als er damit rechnete, mit zwei Bewachern auszukommen.
»Wir werden trotzdem kämpfen«, sagte Jussuf zähneknirschend.
»Ja, willst du denn zum Mörder werden?« begehrte Hapkins auf. »Wenn du einen Piloten betäubst, stürzt sein Gleiter ab. Später wirst du dann vor Gericht stehen und deine Motive begründen müssen.«
»Ich begreife einfach nicht, wie die ein solches Risiko eingehen können. Du mußt bedenken, daß ein solcher Aufwand nicht unbeobachtet bleiben kann. Die Beamten der wissenschaftlichen Behörde werden es bemerken und sich einschalten.«
»Und wenn die nur Spencer kidnappen wollen? Die Anlage können sie ja sprengen. Die wird nicht mehr benötigt. Nur Spencer und vor allem seine Aufzeichnungen sind wichtig.«
Ein Argument, das sehr einleuchtend klang.
Jussuf winkte seinem Partner zu und zog sich gemeinsam mit ihm zur Dachluke zurück. »Nein, Karl, ich werde keineswegs zum Mörder, sondern warte hier erst mal ab, bis die gelandet sind. Wir haben einen strategisch günstigen Punkt, von dem aus wir die Villa verteidigen können. Geh du erst mal hinunter und schließe alles ab, damit sie uns nicht in den Rücken fallen können.«
»Zwanzig Gleiter - und Jussuf will kämpfen - allein, versteht sich!« Hapkins lachte lästerlich, gehorchte jedoch.
Zunächst ging er zur Haustür und verriegelte diese. Dann überprüfte er sämtliche Fenster. Unterwegs kam er am Visiphon vorbei und zögerte. Sollte er nicht doch die Behörde in Kenntnis setzen? Er blieb stehen. Jussuf war dagegen und Spencer würde wahrscheinlich ebenfalls ablehnen, aber war das nicht unvernünftig?
Jussuf hatte nur in einem Recht:
Die würden sich jetzt überhaupt nicht mehr um die Anlage kümmern, sondern einfach Spencer kidnappen. An einem geheimen Ort mußte Spencer dann seine Arbeit wieder aufnehmen. Die Agenten gingen dabei natürlich ein großes Risiko ein. Von den zwanzig Gleitern konnten zehn von der Polizei aufgebracht werden. Aber vielleicht kamen sie deshalb so zahlreich? Sie brachten ihre Opfer gern, weil sie sich einen großen Erfolg von der Aktion versprachen.
2
Spencer war wieder »drüben«!
Er wurde vom Chaos getrieben und wehrte sich nicht mehr dagegen. Er gab sich hin. Nicht wie ein Opfertier, das zur Schlachtbank geführt wird, sondern ähnlich dem Unterlegenen, der sich in die Unabänderlichkeit fügt.
Sein Schädel dröhnte, und seine Lungen versuchten noch immer, Luft zu pumpen. Er nahm es nur noch am Rande wahr. Selbst die wahnsinnige Pein, die seinen Körper marterte, kümmerte ihn nicht mehr. Das Chaos trieb ihn, und er ließ sich treiben.
Erst als er spürte, daß das befürchtete Ende nicht kam, daß er aus unbegreiflichen Gründen überlebte, wurde er wieder aktiv. Er nahm das Chaos in sich auf und begann es zu sezieren. Inzwischen konnte man fast sagen, daß Richard Spencer darin »Routine« entwickelt hatte.
Sein Verstand geriet in Einklang mit dem Chaos. Nur sein Körper schaffte diesen entscheidenden Schritt nicht im gewünschten Maße. Deshalb rauschte das Blut in seinen Adern und war er dem Tode näher als dem Leben.
Der Zwang zum Atmen ließ sich nicht unterdrücken. Deshalb pumpten seine Lungen auch weiterhin, obwohl es nichts gab, was sie zu füllen vermochte. Das erzeugte den verzweifelten Wunsch in seinem Unterbewußtsein, zumindest die Vorstellung zu schaffen, daß er von einer atembaren Atmosphäre umgeben wurde.
Ein vollkommen paradoxes Verhältnis. Spencer konnte nicht atmen, weil es keine Luft gab, aber er starb auch nicht daran, weil er sich mit der Umgebung im Einklang befand und von der Fremdartigkeit erfüllt wurde. Er hätte sterben müssen, doch Mikro, wie er die fremdartige Dimension nannte, zwang ihn zum Leben - aus ungewissen Gründen.
Spencers Verstand hatte es längst akzeptiert. Nur sein Instinkt war dazu nicht in der Lage. Dieser Instinkt konnte einfach nicht akzeptieren, daß der Körper überlebte, ohne zu atmen. Weil das Atmen eine fundamentale Voraussetzung für das Überleben war. Es war die irreale Situation wie in einem schrecklichen Alptraum, in dem man verzweifelt nach Atem rang und von Todesangst erfüllt war, während der Körper in Wirklichkeit ungefährdet im Bett lag und genügend Luft in sich aufnehmen konnte. Die Todesangst konnte Wahnsinn erzeugen, doch sie führte nicht selber zum Tod.
Spencers Unterbewußtsein klammerte sich allein an der Vorstellung fest, daß der Körper ideale Bedingungen vorfand, weil das die logische Voraussetzung für das Überleben war. Und die Vorstellung wurde so eindringlich, daß sie zu einem bedeutenden Teil empfundener Realität wurde.
Der Mensch Spencer schuf mit seiner Phantasie ein reduziertes Spiegelbild von Mikro und begriff es als Realität. Nach dem Gedanken von Plato, der nichts anderes besagte, als daß die Kapazität des menschlichen Gehirns außerstande war, die viel zu komplexe Wirklichkeit als Ganzes zu erfassen und deshalb eine Scheinwirklichkeit schuf, die das Gehirn überschauen konnte.
Als Spencer aus der Hölle der Anpassung erwachte und sich keuchend am Boden liegen sah, wußte er genau, daß ihm sein Gehirn und seine Sinne eine scheinbare Wirklichkeit vorgaukelten, aber er kam nicht dagegen an. Er wollte auch gar nicht! Es gehörte zum Überlebensprinzip, das Scheinbare als gegeben hinzunehmen, um den Intellekt nicht zu überfordern und daran zu zerbrechen.
Ist Wahnsinn nichts anderes als die Unfähigkeit, eine akzeptable Scheinwirklichkeit zu schaffen, in der man sich zurechtfindet? fragte er sich unwillkürlich. Und er bedauerte es wieder, sich nicht eingehender mit Psychologie beschäftigt zu haben. Aber hätte ihm das fundamentierte Wissen um die inneren Vorgänge nicht die Fähigkeit geraubt, unbelastet und unbeschwert über die Zusammenhänge nachzudenken?
In Wirklichkeit ist es nicht allein ein psychologisches und verhaltenstechnisches Ergebnis, daß ich noch lebe. Grundbedingung dafür ist in erster Linie die Eigenschaft von Mikro, alles auf seine Ebene herabzuziehen und sich anzupassen. Der größte Schritt wurde bereits bei meinen ersten Besuchen getan. Was ich jetzt erlebt habe, war nur die Vollendung des Werkes. Ich bin zu einem Kind von Mikro geworden!
Richard Spencer war nicht mehr der Mensch, der er vorher gewesen war. Er hatte sich in ein neues Wesen verwandelt, das den speziellen Bedingungen auf Mikro gewachsen war.
Mühsam richtete er sich auf. Je länger ich mich auf Mikro aufhalte, desto mehr werde ich zu einem Fremdkörper für das Universum, in dem ich entstanden bin. Ist die Anpassung bereits so weit fortgeschritten, daß es unmöglich für mich ist, auf der Erde zu überleben?
Eine Frage, die Spencer zur Zeit noch nicht beantworten konnte. Es würde sich zeigen. Vielleicht würde ihn Mikro wieder zurückschicken. Dann war er eine Art Zwitterwesen, das weder in das eine noch in das andere Universum gehörte. Oder Mikro würde ihn behalten? Dann hatte sich das Schicksal von Richard Spencer endgültig entschieden.
*
Abermals waren Stunden vergangen, in denen sich Spencer auf Mikro befand. Er überwand allmählich seine Erschöpfung und stand vollends auf. Die Umgebung erschien ihm vertraut. Es war die gleiche Wüste mit dem sandigen Boden und den hügelähnlichen Dünen. Spencer sah sich um und machte eine Feststellung, die ihn zutiefst erschreckte. Er war innerhalb des Kraters materialisiert, der durch die Explosion seines Strahlers entstanden war.
Inzwischen war auf Mikro wohl eine Menge Zeit verstrichen. Der Krater, den er durch die unbeabsichtigte Explosion während seines letzten Aufenthaltes verursacht hatte, hatte sich mit feinkörnigem Sand gefüllt. Aber das war es nicht, was sein Entsetzen verursachte, sondern das Monstrum, das am Rand des Kraters hockte und ihn mit seinen Ringaugen beobachtete.
Es war dasselbe Monstrum, das er nun schon zum dritten Mal sah! Ja, es beobachtete ihn, und Spencer war plötzlich überzeugt davon, daß dieses unbegreifliche Wesen die ganze Zeit nichts anderes getan hatte. Es hockte nur da und starrte auf ihn herab.
Spencer bekämpfte die Panik in seinem Innern. Es war sinnlos, die Flucht antreten zu wollen, denn die Wände des Kraters waren so steil, daß er nur mit Mühe den oberen Rand erreichen konnte. Dieses Monstrum würde auf jeden Fall schneller sein.
Auf der anderen Seite: War es überhaupt notwendig, Furcht zu empfinden? Richard Spencer war in den letzten Stunden so hilflos gewesen, daß es der Bestie leicht gefallen wäre, ihn zu töten. Und auch jetzt machte sie keinerlei Anstalten, ihm zu nahe zu kommen.
Was ist das bloß für ein Geschöpf? fragte sich Richard Spencer. Gewiß ist es kein Zufall, daß ich ihm jedesmal begegne. Mein erstes Erscheinen muß das Wesen aufmerksam gemacht haben. Es kam hierher, um zu sehen, was geschehen war. Und es traf auf mich. Zunächst erschien es recht aggressiv. Eigentlich ein normales Verhalten, denn schließlich war ich der unbekannte Eindringling. Im letzten Augenblick verschwand ich spurlos. Das muß dieses Wesen irritiert haben. Es blieb in der Nähe und war auch gleich zur Stelle, als ich zum zweiten Mal erschien.
Tja, und dann hat es diese Katastrophe gegeben. Die Neugierde des Wesens war enorm gestiegen. Es ist noch immer da und hat irgendwie begriffen, daß ihm keine Gefahr durch eine neue Katastrophe droht. Und es beobachtet mich mit der Neugierde einer Intelligenz, die lernen will, zu verstehen.
Intelligenz?
Spencer betrachtete das monströse Geschöpf und versuchte, seinen natürlichen Widerwillen zu überwinden.
Nein, er hatte nicht das Recht, Ekel zu empfinden. Dies hier war ein Geschöpf von Mikro, und er war der Fremdartige. Aber war es nun wirklich intelligent, oder handelte es nach seinem Instinkt? Es gab nur eine Möglichkeit, das herauszufinden: Durch die direkte Konfrontation!
Spencer machte sich daran, den Kraterrand zu erklettern. Noch immer sah ihm das Monstrum ungerührt zu. Bis er sich in Reichweite befand. Plötzlich löste sich auf der Unterseite, zwischen den zusammengefalteten Flügeln, ein Tentakel und schoß auf Spencer zu. Es ging so schnell, daß Spencer nicht ausweichen konnte.
Der Tentakelarm begann, vorsichtig seinen Körper zu ertasten. Er strahlte Kälte aus und wirkte schleimig. Spencer würgte unwillkürlich. Verdammt, dachte er, hoffentlich gewöhne ich mich noch daran, sonst wird doch noch Feindschaft zwischen uns entstehen.
Die Untersuchung dauerte nicht lange. Dann packte der Tentakelarm zu, wickelte sich um Spencers Taille und hob ihn hoch. Spencer strampelte verzweifelt mit Armen und Beinen. Der Tentakelarm bog sich unter seinem Gewicht und seinen wilden Bewegungen durch. Spencer erkannte, daß er sich ruhig verhalten mußte, um nicht den Absturz zu riskieren.
Das Monstrum hob ihn zum Kraterrand und öffnete gleichzeitig sein riesiges Maul mit den messerscharfen Knochenreihen. Mein Gott, es will mich doch fressen! dachte Spencer entsetzt. Es hat nur darauf gewartet, bis ich endlich nahe genug war, daß es mich erreichen konnte. Seine Geduld wird jetzt belohnt
Tatsächlich sah es so aus, als würde ihn das Monstrum als willkommene Beute betrachten. Aber das Ziel seines halb unfreiwilligen Fluges war nicht das aufgerissene Maul: Spencer wurde direkt neben dem Wesen abgesetzt. Es zog seinen Tentakelarm zurück. Das Maul klappte mit einem dumpfen Geräusch zu. Die Ringaugen starrten.
»Jetzt müßten wir uns verständigen können«, sagte Spencer laut.
Das Wesen zeigte keine Reaktion.
Spencer spürte ein Schaudern, als er seinen Blick über den monströsen Körper gleiten ließ. Ihm fielen wieder die zusammengefalteten Flügel auf.
Flügel?
Ja, dann gab es hier auch eine gasförmige Substanz. Sonst wären sie unsinnig gewesen.
Spencer wurde wieder bewußt, daß er die ganze Zeit atmete, als würde er sich auf der Erde befinden. Ja, meine Lungen füllen sich mit etwas. Es entspringt nicht allein meiner Phantasie. Spencer schüttelte den Kopf. »Ich muß lernen, alles zu akzeptieren und nicht ständig darüber nachzudenken. Das bringt nämlich nichts, wie? Philosophie kann faszinierend sein, aber man sollte darüber die Praxis nicht vergessen. Du und ich - wir sind die Praxis. Und ich muß mir überlegen, was ich mit dir anfangen kann. Begreifst du das überhaupt?«
Die Ringaugen starrten. Richard Spencer verglich das Wesen mit einem treuen Hund, der seinen Herrn anerkennt und ihm zuhört, ohne die Worte zu begreifen.
Nein, der Vergleich gefiel ihm ganz und gar nicht. Das Wesen hatte deutlich genug gezeigt, daß es zu mehr in der Lage war. Vielleicht besaß es überhaupt keine Sprechwerkzeuge oder auch nur Ohren, um seine Worte zu hören?
Spencer war es egal. Er sprach weiter: »Was soll nun werden? Wir können doch nicht ewig hier herumstehen und über das Wesen von Mikro philosophieren, oder?«
Er kämpfte mit sich, bis er es schaffte, die Rechte auszustrecken und das Monstrum zu berühren. Riesig groß ragte es vor ihm auf. Die Haut fühlte sich an wie kaltes Leder, über das jemand Wasser gegossen hatte. Angenehm war die Berührung nicht gerade.
Da öffnete das Monstrum sein Maul und stieß einen durchdringenden Laut aus, der so aufdringlich war, daß Spencer unwillkürlich die Hände gegen die Ohren preßte. Und dann geschah etwas, was Spencer niemals erwartet hätte: Das Monstrum kippte langsam um. Die Ringaugen brachen. Kaum lag das Monstrum auf der Seite, schnaubte es ein letztes Mal.
Mit geweiteten Augen beobachtete Richard Spencer, was hier geschah. Offensichtlich verendete das Geschöpf von Mikro. Es sah sogar so aus, als hätte Spencer das mit seiner Berührung verursacht!
Nein, das war zu fantastisch. Spencer konnte und wollte es nicht glauben. Ein schrecklicher Zufall! War das Wesen etwa gar nicht seinetwegen hier? War es in diesen Landstrich gekommen, um sein Ende zu finden?
Der Gedanke fesselte Richard Spencer. Er trat zurück und betrachtete schaudernd den riesigen Kadaver. Da war kein Leben mehr. Davon war er überzeugt.
Plötzlich hörte Richard Spencer ein schabendes Geräusch. Sein Kopf flog herum. Am Bauch des Wesens passierte etwas, was sich seinen Blicken entzog. Die Flügel waren teilweise entfaltet. Sie wiesen Löcher auf. Das Tier war verletzt gewesen. Deshalb war es gestorben. Vielleicht eine Folge der Explosion? Das war nicht auszuschließen.
Spencer hätte zwar lieber das Weite gesucht, doch seine Neugierde siegte. Vorsichtig trat er näher. Ein Flügel begann, sich zu bewegen. Ja, da war etwas am Bauch des Geschöpfes. Unwillkürlich stellten sich Spencers Haare auf. Es bedurfte unendlicher Überwindung, die Hände auszustrecken und den schlaffen, löchrigen Flügel zu berühren, der über der Stelle hing. Er zog daran. Der Flügel war wesentlich schwerer, als er geglaubt hatte. Spencer mußte mehr Kraft einsetzen.
Durch eines der ausgefransten Löcher konnte er die Bauchdecke sehen. Im nächsten Augenblick platzte die warzige Lederhaut auf! Der Rest ging so schnell, daß Spencer nicht zu reagieren vermochte. Ein Gliedmaß schob sich aus dem Bauch, zerfetzte weiter die unglaublich stabile Lederhaut. Und dann kam ein Kopf zum Vorschein.
Spencer vergaß zu atmen. Er wollte es nicht glauben, und doch war es so: Ihn starrte die verkleinerte Ausgabe des Riesenmonstrums an! Spencer erlebte soeben eine Geburt!
Aus den Wunden sickerte schleimiger Saft. Das Biest kümmerte sich nicht darum. Mit einer wütenden Gebärde schaffte es sich mehr Platz und krabbelte ganz ins Freie. Es war zwar wesentlich kleiner als die »Mutter«, aber immer noch so groß wie ein ausgewachsenes Pferd.
Spencer wich ächzend zurück. Doch das Tier machte keinerlei Anstalten, ihm zu nahe zu treten. Es hatte anderes zu tun. Kaum war es vollends im Freien, als es sich von dem Kadaver entfernte und probeweise einen Flügel entfaltete. Der Flügel hatte eine Spannweite von mindestens zehn Metern. Trotzdem erschien es Spencer zu wenig. Konnte das Wesen wirklich fliegen?
Noch immer hockte in ihm die Angst und wollte ihn zur Flucht zwingen. Aber wie weit würde er kommen?
Das Wesen brauchte nur einmal mit den Flügeln zu schlagen und hätte ihn eingeholt.
Das Geschöpf, das dem Aussehen nach der Hölle entronnen schien, kontrollierte auch noch den zweiten Flügel. Anscheinend war es mit dem Ergebnis zufrieden, denn es watschelte direkt auf Spencer zu.