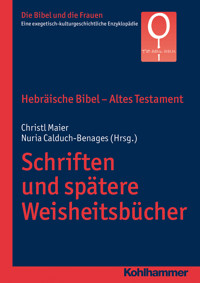
Hebräische Bibel - Altes Testament. Schriften und spätere Weisheitsbücher E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der vorliegende Band befasst sich mit dem dritten Kanonteil der Hebräischen Bibel, den sogenannten Schriften, sowie mit zwei weiteren Texten, die thematisch eng mit dem Sprüchebuch verbunden sind: Jesus Sirach, die griechische Übersetzung einer hebräischen Schrift, und das ursprünglich griechisch verfasste Buch der Weisheit. Mehrere Beiträge gehen den Lebensrealitäten von Frauen in persischer und hellenistischer Zeit nach, ferner wird die israelitische Weisheitstradition mit ihren zahlreichen weiblichen Charakteren beschrieben: Frau Weisheit und die "fremde" Frau, die Königsmutter und die "starke" Frau, die "gute" und die "schlechte" Ehefrau. Beiträge zu den Psalmen, den Klageliedern und dem Hohelied erschließen weibliche Stimmen und Erfahrungen oder zeigen Verbindungen zwischen Texten und ikonographischen Traditionen auf. Schließlich kommen die Erzählungen über Rut, Ester und Susanna in den Blick, deren weibliche Hauptfiguren in Konfliktsituationen Weisheit und Stärke zeigen und deshalb als Vorbilder an Tugend und Glauben dienen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 657
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der vorliegende Band befasst sich mit dem dritten Kanonteil der Hebräischen Bibel, den sogenannten Schriften, sowie mit zwei weiteren Texten, die thematisch eng mit dem Sprüchebuch verbunden sind: Jesus Sirach, die griechische Übersetzung einer hebräischen Schrift, und das ursprünglich griechisch verfasste Buch der Weisheit. Mehrere Beiträge gehen den Lebensrealitäten von Frauen in persischer und hellenistischer Zeit nach, ferner wird die israelitische Weisheitstradition mit ihren zahlreichen weiblichen Charakteren beschrieben: Frau Weisheit und die 'fremde' Frau, die Königsmutter und die 'starke' Frau, die 'gute' und die 'schlechte' Ehefrau. Beiträge zu den Psalmen, den Klageliedern und dem Hohelied erschließen weibliche Stimmen und Erfahrungen oder zeigen Verbindungen zwischen Texten und ikonographischen Traditionen auf. Schließlich kommen die Erzählungen über Rut, Ester und Susanna in den Blick, deren weibliche Hauptfiguren in Konfliktsituationen Weisheit und Stärke zeigen und deshalb als Vorbilder an Tugend und Glauben dienen können.
Dr. Christl M. Maier ist Professorin für Altes Testament an der Philipps-Universität Marburg. Dr. Nuria Calduch-Benages ist Professorin für Altes Testament und biblische Anthropologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana Rom.
Die Bibel und die Frauen
Eine exegetisch-kulturgeschichtliche Enzyklopädie
Herausgegeben von Irmtraud Fischer, Christiana de Groot, Mercedes Navarro Puerto, Jorunn Økland, Adriana Valerio
Altes Testament
Band 1.3
Christl M. Maier Nuria Calduch-Benages (Hrsg.)
Schriften und spätere Weisheitsbücher
Alle Rechte vorbehalten © 2013 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Reproduktionsvorlage: Sebastian D. Plötzgen, Marburg Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
Print: 978-3-17-023413-0
E-Book-Formate
pdf:
epub:
978-3-17-027210-1
mobi:
978-3-17-027211-8
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I. DEN LEBENSREALITÄTEN VON FRAUEN AUF DER SPUR
Tamara Cohn Eskenazi Das Leben von Frauen in der nachexilischen Zeit
Sara Japhet Frauennamen und Genderperspektiven in der Chronik
II. „GUTE“ UND „SCHLECHTE“ FRAUEN? FRAUENBILDER IN ISRAELS WEISHEITSTRADITION
Gerlinde Baumann Die Weisheitsgestalt Kontexte, Bedeutungen, Theologie
Christl M. Maier Gute und schlechte Frauen in Proverbien und Ijob Die Entstehung kultureller Stereotype
Vittoria D’Alario Zwischen Frauenfeindlichkeit und Aufwertung Blicke auf die Frauen im Buch Kohelet
Nuria Calduch-Benages Gute und schlechte Ehefrauen im Buch Jesus Sirach – eine harmlose Unterscheidung?
III. FRAUENSTIMMEN UND WEIBLICHE METAPHERN IN POETISCHEN TEXTEN
Silvia Schroer Altorientalische Bilder als Schlüssel zu biblischen Metaphern
Donatella Scaiola Weibliche Symbole und Metaphern im Psalter
Ulrike Bail On Gendering Laments Eine genderorientierte Lektüre der Klagepsalmen
Nancy C. Lee Klagelieder und Gender im kulturellen Kontext der Bibel
Gianni Barbiero Schulamit, die „befriedete“ Frau im Hohelied
IV. AMBIVALENTE VORBILDER: FRAUEN IN ERZÄHLENDEN TEXTEN
Miren Junkal Guevara Llaguno Rut und Noomi fordern Leben und Erinnerung zurück
Susan Niditch Die Interpretation von Ester Kategorien, Kontexte und kreative Vieldeutigkeit
Isabel Gómez-Acebo Susanna Tugendhaftes Vorbild und weibliche Gegenfigur zu Daniel
Bibliographie
Stellenregister
AutorInnen
Einleitung
Christl M. Maier – Nuria Calduch-Benages
Der vorliegende Band gehört zu einem ambitionierten internationalen Projekt mit dem Titel „Die Bibel und die Frauen“. Es geht um die Erstellung einer exegetisch-kulturgeschichtlichen Enzyklopädie. Ziel des Projekts ist es, eine ökumenische, geschlechtergerechte Auslegung und Rezeptionsgeschichte der Bibel mit einem Schwerpunkt auf der europäischen theologischen Forschung und der Religionsgeschichte des Westens vorzulegen.1
Als wir die Aufgabe übernahmen, im Rahmen dieser Enzyklopädie einen Band zur Hebräischen Bibel herauszugeben, fanden wir die Idee sehr vielversprechend und zukunftsweisend. Erst im Laufe der Arbeit wurde uns bewusst, welche Herausforderung darin liegt, Texte von AutorInnen aus vier verschiedenen Sprachgebieten zusammenzutragen, die zugleich unterschiedliche Auslegungstraditionen und Forschungskontexte spiegeln. Wir freuen uns, dass wir BibelwissenschaftlerInnen aus fünf verschiedenen europäischen Ländern, Israel und den Vereinigten Staaten zur Mitarbeit an diesem Band gewinnen konnten. Jede und jeder Einzelne von ihnen ist als Fachfrau oder Fachmann in dem entsprechenden Forschungsgebiet ausgewiesen. Die Beiträge sind ursprünglich auf Englisch, Deutsch, Italienisch oder Spanisch verfasst worden. Sie repräsentieren verschiedene gesellschaftliche Kontexte, die sich im Blick auf Geschlechterbeziehungen und Gendertheorien unterscheiden, und unterschiedliche religiöse Traditionen.
1. Umfang und Aufbau des Bandes
Die in diesem Band versammelten Aufsätze befassen sich mit dem dritten Teil des hebräischen Bibelkanons, den sog. Schriften (Hebräisch ). Außerdem wurden die weisheitlichen Traditionen der Bücher Jesus Sirach und Weisheit (Weisheit Salomos) aufgenommen. Die biblische Weisheitstradition, die ein fester Bestandteil der altorientalischen Tradition ist, erzeugte während des ganzen 1. Jt.s v. Chr. und bis in die christliche Zeit hinein einen beständigen Strom von Texten. Dieser Zusammenhang wurde durch die historischen Entscheidung, nur die Bücher Sprichwörter (Proverbien), Ijob und Kohelet (Prediger Salomo) in den hebräischen Kanon aufzunehmen, unterbrochen. Jesus Sirach – seit langem als griechische Übersetzung eines hebräischen Originals bekannt, das freilich erst in neuerer Zeit in Fragmenten wiederentdeckt werden konnte – und das ursprünglich griechisch geschriebene Buch der Weisheit gehören dem Kanon der Septuaginta, der griechischen Bibel, an; sie könnten daher auch im Band 3.1 des Projekts (Pseudepigraphen und Apokryphen) behandelt werden. Wir haben Nuria Calduch-Benages’ Aufsatz über ‚gute‘ und ‚schlechte‘ Ehefrauen bei Jesus Sirach in den vorliegenden Band aufgenommen, weil dieses Weisheitsbuch die kulturellen Stereotype, die sich im Buch der Sprichwörter herausbilden, wiederholt und einem jüdisch-hellenistischen Publikum vorstellt. Mit Blick auf geschlechtsspezifische Gottes- wie Menschenbilder wäre die Deutung der personifizierten Weisheit, die zuerst in Spr 1–9 begegnet, unvollständig, würde man nicht ihre Weiterentwicklung in der späteren Weisheitstradition mit bedenken. Das zeigen der Beitrag von Gerlinde Baumann zur Weisheitsgestalt und ein Abschnitt in Silvia Schroers Artikel zum ikonographischen Hintergrund von Frau Weisheit.
Aufgrund seiner Entstehung im 2. Jh. v. Chr. wurde das prophetische Buch Daniel nicht mehr dem Kanonteil „Prophetie“ zugerechnet, sondern gelangte in die „Schriften“. Im Blick auf Daniel konnten wir Isabel Gómez-Acebo dazu gewinnen, auch die griechischen Zusätze über Susanna zu behandeln, um den ersten Schritt der Rezeptionsgeschichte des Buches aufzuzeigen, der eine weibliche Hauptfigur und Geschlechterfragen einbringt. Diese weisheitlichen Traditionsstränge sind der Grund dafür, dass wir die biblischen Schriften nicht strikt getrennt nach jüdischem und christlichem Kanon behandeln.2
Die Aufsätze des vorliegenden Bandes sind in Gruppen unter vier Überschriften sortiert. Eine erste Gruppe von Beiträgen begibt sich auf die Spur der Lebensrealitäten von Frauen, sei es anhand sozialgeschichtlicher Rekonstruktion des Lebens im perserzeitlichen Juda oder durch die Untersuchung von Familien- und Stammesbeziehungen in nachexilischen Genealogien.
Die nächste Gruppe von Aufsätzen behandelt die israelitische Weisheitstradition mit ihren zahlreichen weiblichen Charakteren: Frau Weisheit und die ‚fremde‘ Frau, die Königsmutter und die ‚starke‘ Frau, die ‚gute‘ und die ‚schlechte‘ Ehefrau. Alle vier Aufsätze unterstreichen nicht nur die überaus wertende Darstellung der Frauen und ihrer Rollen in der Weisheit, sondern erörtern auch die gesellschaftliche Funktion von Frauen und machen deutlich, dass einige Texte nicht so androzentrisch sind, wie gemeinhin angenommen wird.
Der dritte Teil des Bandes versammelt Beiträge zu Frauenstimmen und weiblichen Metaphern in poetischen Büchern. Es geht einerseits um die Möglichkeit, aus den poetischen Texten weibliche Erfahrung und Lebenskontexte zu erschließen und andererseits darum, die Bedeutung spezifisch weiblicher Metaphern zu entfalten. Beispielsweise sprechen die Psalmen und die Klagelieder meist nur implizit oder sehr allgemein über Frauen. Deren geschlechtsspezifische Bilder tragen jedoch zur Gottesmetaphorik ebenso bei wie zur weiblichen Personifikation der Gemeinschaft bzw. der Stadt.
Die Beiträge des vierten Teils untersuchen Erzählungen mit starken weiblichen Hauptfiguren – Rut, Ester und Susanna –, die in Konfliktsituationen ihre Klugheit und Stärke unter Beweis stellen. Manche Beiträge interpretieren diese Protagonistinnen als Vorbilder an Tugend und Glauben; sie machen aber auch deutlich, dass deren Vorbildfunktion für heutige LeserInnen durchaus ambivalent ist.
2. Inhalte und Textgattungen der „Schriften“
In Bezug auf Inhalt, literarischen Stil und Textgattung versammeln die „Schriften“ sehr verschiedene Texte, die auf unterschiedliche Weise eingeteilt werden können. Einige enthalten Poesie wie die Bücher Psalmen, Hohelied, Klagelieder des Jeremia und Kohelet; zu ihnen kann auch Ijob trotz seiner kurzen Rahmenerzählung gerechnet werden. Während das Buch der Sprichwörter, Ijob und Kohelet (mit Jesus Sirach und dem Buch der Weisheit) deutlich zur Weisheitstradition gehören und eine lehrhafte Absicht haben, enthalten die Psalmen, das Hohelied und die Klagelieder Gebete, Lieder und liturgische Texte, allerdings mit sehr unterschiedlichem Ton und Inhalt. Rut, Ester und Dan 1–6 erzählen von mutigen Frauen und Männern in der Diaspora, die durch Glauben und Aufrichtigkeit trotz ungünstiger Bedingungen Erfolg haben. Daniel 7–12 umfasst prophetische Visionen, die in symbolischer Verschleierung das gewaltsame Ende aufeinanderfolgender griechischer und hellenistischer Herrscher ankündigen. Esra-Nehemia ist eine historiographische Erzählung über den Wiederaufbau Jerusalems und die Wiederherstellung der judäischen Gemeinschaft nach dem Exil. Die Chronikbücher erzählen die Geschichte des judäischen Königtums noch einmal aus einem nachexilischen Blickwinkel, beginnend mit Genealogien „ganz Israels“ über neun Kapitel.
Betrachtet man diese Sammlung unterschiedlicher Texte, die überwiegend in der persischen und frühen hellenistischen Zeit geschrieben oder bearbeitet wurden, so ist offensichtlich, dass sich die in ihnen enthaltenen Geschlechterbeziehungen sehr unterscheiden. Allerdings wird auch deutlich, dass alle Texte in einer patriarchalen Gesellschaft der Antike entstanden sind, in der eine Person zunächst durch ihren sozialen Status bestimmt wird, d. h. frei oder versklavt ist, danach durch die soziale Schicht und innerhalb derselben Schicht durch Geschlecht, Alter und weitere Faktoren geprägt wird.3 Während die biblischen Texte diese Pyramide gesellschaftlicher Hierarchie, die Patriarchat genannt wird, spiegeln, enthalten einige von ihnen zugleich Stimmen der an den Rand Gedrängten oder kritisieren vorherrschende Machtdiskurse. Aufgrund der faszinierenden Eigenschaft der biblischen Texte, verschiedenartige Stimmen und Perspektiven in sich aufzunehmen, können je nach hermeneutischem Standort des oder der Auslegenden viele verschiedene Deutungen aus ihnen hervorgehen.
Die Schriften, die den dritten Kanonteil der Hebräischen Bibel ausmachen, entstanden vom 5. bis zum Beginn des 2. Jh.s v. Chr. in Jerusalem und Umgebung, in einer Zeit politischer und wirtschaftlicher Krisen, in denen Juda von verschiedenen Weltreichen beherrscht wurde. Aufgrund unterschiedlicher Entstehungsorte und -zeiten der Schriften kannten sich die meisten ihrer VerfasserInnen wohl nicht und standen auch nicht im direkten Austausch miteinander. Da ihre Texte jedoch nun in derselben Sammlung vereint sind, können ihre verschiedenen Ansichten über Frauen und Geschlechterfragen als ein schriftlicher Gedankenaustausch über Geschlechterhierarchien, gesellschaftliche Werte und Machtbeziehungen wahrgenommen werden. Wenn heutige BibelwissenschaftlerInnen jedes Buch mit einer bestimmten Zeit und einem Entstehungskontext verbinden, was manchmal mehr, manchmal weniger plausibel begründet werden kann, können sie eine Entwicklung von Standpunkten und Argumenten oder auch andauernde Vorstellungen entdecken. Mit ihren zahlreichen starken Frauengestalten bieten die Schriften heutigen LeserInnen ein beeindruckendes, bildhaftes Gewebe der Lebensentwürfe und Rollen von Frauen, wie es die antiken VerfasserInnen wahrgenommen haben.
3. Verschiedene methodische Zugänge zu den Texten
Die Vielfalt der Texte in diesem Band wird mit einer Vielfalt von Methoden erschlossen, die von unterschiedlichen ForscherInnen ausgewählt wurden. Deshalb haben wir jede und jeden unserer AutorInnen gebeten, zu Beginn des Aufsatzes ihren bzw. seinen hermeneutischen und methodischen Zugang kurz zu erläutern.
Tamara Cohn Eskenazi unternimmt es, das Leben von Frauen in der nachexilischen Zeit durch biblische und außerbiblische Quellen sozialgeschichtlich zu rekonstruieren, und stellt den LeserInnen die wirtschaftliche und soziale Situation in der Provinz Jehud in persischer Zeit vor, die für einige der Schriften einen prägenden Zeitraum darstellt. Sara Japhets Auslegung der Chronikbücher als einer Geschichte Israels, die sowohl auf früheren Erzählungen der Samuel- und Königebücher als auch auf lokalen judäischen Traditionen der frühen hellenistischen Zeit gründet, zeigt auf, wie eine historiographische Erzählung von den Interessen ihrer VerfasserInnen geformt wird. Mit ideologiekritischer Perspektive versteht Japhet die knochentrockenen Genealogien der Chronik, die von heutigen RezipientInnen gerne überlesen werden, als Gegenstimme zur starken Ablehnung von Ehen mit fremden Frauen, die in Esra-Nehemia und Spr 1–9 vertreten wird.
Die Beiträge zur Weisheitstradition legen den Schwerpunkt auf die Darstellung weiblicher Figuren, wobei sie die Ideologien solcher Charakterisierungen kritisch analysieren. Aus einem geschlechtersensiblen Blickwinkel ist eine solche Darstellung von Frauen und ihren Rollen in der Gesellschaft weder neutral noch einfach beschreibend; vielmehr gibt sie häufig Rollenmodelle für die antiken LeserInnen, Männer und Frauen, vor. Wie Gerlinde Baumann ausführt, bereichert die Gestalt der personifizierten Weisheit die Gottesmetaphorik, wird aber auch dazu benutzt, in den führenden Kreisen der persischen und hellenistischen Zeit eine bestimmte ethische Haltung und bestimmte Handlungsweisen anzupreisen.
Demgegenüber entwerfen die kulturellen Stereotype der ‚fremden‘ und der ‚starken‘ Frau im Buch der Sprichwörter (Proverbien) sowie der ‚guten‘ und ‚schlechten‘ Ehefrau in Jesus Sirach Rollenmodelle für Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft und in einem Oberschichtsmilieu. Christl Maier und Nuria Calduch-Benages erörtern sowohl den Nutzen als auch die Gefahren solcher Typisierungen. Ähnlich deutet Vittoria D’Alario Bemerkungen über Frauen im Koheletbuch als wechselnde Urteile, die zwischen Frauenfeindschaft und einer Idealisierung von Frauen schwanken. Sie zeigt jedoch auf, inwiefern weisheitliche Texte, die lange Zeit als „frauenfeindlich“ galten, erstaunliche Einblicke in das Durchsetzungsvermögen und die Macht von Frauen bieten können.
Wie auch in den anderen Bänden zum hebräischen Kanon zeigt Silvia Schroer Verbindungen zwischen Texten und ikonographischen Traditionen auf, die aus einem gemeinsamen kulturellen Motivschatz herrühren. Die altorientalischen Bilder von Schöpfung und Weltordnung, von Göttern und Göttinnen, die sich auf Artefakten der syrisch-palästinischen Kunst finden, tragen dazu bei, viele der Metaphern in poetischen Texten wie Psalmen, Hohelied, Ijob und Proverbien besser zu verstehen.
Weil die Datierung von Psalmen aufgrund einer langen Überlieferungsgeschichte unmöglich ist, legt Donatella Scaiola den Schwerpunkt auf weibliche Symbole wie die Muttermetapher, die sowohl zur Gottesmetaphorik als auch zur Charakterisierung der heiligen Stadt Jerusalem beiträgt. Ulrike Bail und Nancy Lee verwenden die von Athalya Brenner und Fokkelien van Dijk-Hemmes vorgeschlagene Methode des „Gendering“ von Stimmen im Text, um verschiedene Klagelieder zu interpretieren. Indem sie intertextuelle Bezüge zwischen Ps 55 und der Geschichte von Tamar (2 Sam 13) aufzeigt, liest Bail diesen individuellen Klagepsalm als ein Gebet, das Opfern sexueller Gewalt hilft, ihr Leid zum Ausdruck zu bringen. Im Buch der Klagelieder entdeckt Lee eine starke weibliche Stimme, die die Führung übernimmt, indem sie eine Klage über Gottes gewalttätiges und strafendes Handeln formuliert. Diese Stimme repräsentiert Lee zufolge die Erfahrung von Frauen, und sie könnte sogar einer Verfasserin gehören. Gianni Barbiero arbeitet heraus, dass die Ermächtigung der weiblichen Hauptfigur im Hohelied nicht im Widerspruch zu einer erfüllenden Liebesbeziehung stehen muss, und liest Schulamit durch die Brille der Weisheitstradition in Gen 2–3.
Die Beiträge über weibliche Hauptfiguren in erzählenden Texten untersuchen deren Charakterisierungen im Blick auf ausdrückliche oder stillschweigende Geschlechterhierarchien und auf die Möglichkeiten von Frauen, in einer patriarchalen Welt ihren Platz zu finden. Miren Junkal Guevara Llaguno interpretiert Rut und Noomi als Frauen, die ihr Leben und ihren Platz in der Erinnerung einfordern und so für Leserinnen, die um ihr Überleben kämpfen, eine Quelle der Ermächtigung werden. Susan Niditch erörtert eine Reihe feministischer Auslegungen des Esterbuches und zeigt, dass die Erwartungen und die Weltanschauung der Auslegenden ein Schlüssel zur Rezeption Esters sind. Indem die Auslegenden die Feinheiten der biblischen Figur herausarbeiten, wird deutlich, dass die verschiedenen Interpretationen Esters auf durchaus ambivalenten Frauenbildern gründen. Isabel Gómez-Acebo deutet die Figur der Susanna, deren Geschichte dem ursprünglichen Text zugefügt wurde, als weibliche Gegenfigur zu Daniel, deren Kampf gegen die Geschlechterhierarchie der Idee den Weg bereitet, dass die Befreiung eines Volkes nur dann vollständig ist, wenn Männer und Frauen dafür kämpfen.
Die Aufsätze dieses Bandes erheben nicht den Anspruch, die Schriften vollständig auszulegen und verstehen sich auch nicht als die einzig möglichen Interpretationen. Ihr gemeinsames Merkmal ist es, den Fokus auf Geschlechterfragen, Machtbeziehungen und Ideologien innerhalb der Texte und in Auslegungen zu legen. Diese Auslegungen sind Teil der Rezeptionsgeschichte der Texte in akademischen Kreisen des Westens, in denen bis vor kurzem männliche Bibelwissenschaftler bestimmend waren und die deshalb oft die ererbte androzentrische Tradition weitergeführt haben. Obwohl die meisten Beiträge nicht ausdrücklich auf die Rezeptionsgeschichte der hebräischen Schriften eingehen, bieten viele eine Kritik einseitiger oder im Blick auf das Geschlecht vorurteilsbeladener Interpretationen, indem sie entweder gegen eine normierende Auslegung argumentieren oder Gegentraditionen herausschälen, die zu einer neuen, geschlechtersensiblen Leseweise der Texte führen.
Die Übersetzung italienischer, spanischer und englischer Beiträge ins Deutsche ist keine einfache Aufgabe, da sich nicht nur die Forschung zu einzelnen biblischen Büchern, sondern auch zu feministischen Fragestellungen in den unterschiedlichen Sprachgebieten ausdifferenziert hat. Wir haben uns bemüht, die Beiträge in verständliches Deutsch zu übertragen und durch zusätzliche Anmerkungen Eigenheiten des Originals sowie die Vorgehensweise bei Übersetzungen biblischer Passagen zu erläutern. Die etwas ausführlicheren biographischen Angaben in der Liste der AutorInnen sollen auch dazu dienen, diese unterschiedlichen Forschungstraditionen sichtbar zu machen.
4. Dank
Das Forschungskolloquium, das im Juli 2011 in Marburg stattfand und bei dem die meisten Beitragenden ihre ersten Thesen einer kritischen Diskussion ausgesetzt haben, wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft großzügig finanziell gefördert. Der Fachbereich Evangelische Theologie der Philipps-Universität Marburg hat das Kolloquium durch die Bereitstellung von Räumen, Sekretariatsdiensten und studentischen Hilfskräften unterstützt. Wir danken beiden Institutionen für die Förderung unserer Forschung. Für ihre tatkräftige Hilfe bei der Durchführung des Kolloquiums danken wir Mareike Schmied, Andrea Schönfeld de Weigel und Maurice Meschonat.
Im Jahr 2011 erhielt unser Projekt den Leonore-Siegele-Wenschkewitz-Preis, benannt nach der deutschen Kirchenhistorikerin Leonore Siegele-Wenschkewitz (1944–1999). Mit dieser Auszeichnung ehren der Verein zur Förderung Feministischer Theologie in Forschung und Lehre e. V., die Evangelische Kirche von Hessen und Nassau und die Evangelische Akademie Arnoldshain Studien oder Projekte, die die Feministische Theologie oder Geschlechterstudien in theologischen Kontexten voranbringen. Wir sind dankbar für diese Anerkennung unserer Arbeit und haben das Preisgeld für die Übersetzung einiger Aufsätze verwendet. Für einen namhaften Betrag für eine Übersetzung danken wir auch PD Dr. Valentine Rothe, Bonn.
Besonderer Dank gilt unseren geschätzten AutorInnen für ihre Bereitschaft, zu diesem Band beizutragen, ihre Mitarbeit am Kolloquium, ihre Offenheit für all unsere Fragen zu ihren Aufsätzen und ihre Geduld, die Veröffentlichung in vier verschiedenen Sprachen abzuwarten und zu unterstützen. Wir sind sehr dankbar für die Arbeit unserer ÜbersetzerInnen, von denen uns einige ihre Fähigkeiten unentgeltlich zur Verfügung gestellt haben. Außerdem danken wir Dr. Michaela Geiger für die sorgsame Durchsicht und Überarbeitung der Übersetzungen sowie Mirjam Tabea Kraaz und Sebastian Plötzgen für die tatkräftige Mithilfe bei der Erstellung des Manuskripts und des Registers.
Den Hauptherausgeberinnen des Projekts „Die Bibel und die Frauen“, insbesondere Irmtraud Fischer, danken wir, dass sie unsere Arbeit in allen Phasen mit Rat und Tat begleitet haben. Schließlich danken wir dem Kohlhammer Verlag für die gute Zusammenarbeit bei der Drucklegung dieses Bandes.
Marburg – Rom, Januar 2013
1 Zu Umfang, Hermeneutik und Zielen des Projekts vgl. Irmtraud Fischer, Jorunn Økland, Mercedes Navarro Puerto und Adriana Valerio, „Frauen, Bibel und Rezeptionsgeschichte: Ein internationales Projekt der Theologie und Genderforschung“, in Tora (hg. v. Irmtraud Fischer et al.; Die Bibel und die Frauen: Eine exegetisch-kulturgeschichtliche Enzyklopädie 1.1; Stuttgart: Kohlhammer, 2010), 9–35. Eine Kurzform findet sich auch auf der Internetseite des Projekts, online: http://www.bibleandwomen.org/DE/description.php (28.09.2012).
2 Zum ursprünglichen Plan der Kanon-Aufteilung vgl.Fischer, Økland, Navarro Puerto und Valerio, „Frauen, Bibel“, 21–26.
3 Vgl. Fischer, Økland, Navarro Puerto und Valerio, „Frauen, Bibel“, 16–18.
Das Leben von Frauen in der nachexilischen Zeit
Tamara Cohn EskenaziHebrew Union College – Jewish Institute of Religions, Los Angeles, CA (USA)
Einer der bedeutendsten Schriftsteller, der über das Leben im 4. Jh. v. Chr. schreibt, schildert den Haushalt in erster Linie als produktive wirtschaftliche Einheit, in der der Frau die Verantwortung dafür zukommt, Rohmaterial zu Nahrungsmitteln, Textilien und anderen Gütern zu verarbeiten. Der Wohlstand des Haushaltes hängt von der gelingenden Haushaltsführung der Ehefrau ab.
Ich glaube aber, daß eine Frau, die eine gute Partnerin bei der Leitung des Haushalts ist, dem Mann gleichwertig ist im Streben nach dem Guten. Die Besitztümer kommen zwar meist durch die Tätigkeiten des Mannes in das Haus, ausgegeben werden sie aber größtenteils nach der haushälterischen Einteilung der Frau, und wenn diese gut ist, vergrößern sich die Häuser, wenn sie aber schlecht vorgenommen wird, nehmen die Häuser ab. (Gespräch über die Haushaltsführung, III.14–15)1
Diese Worte stammen nicht von einem oder einer feministischen Gelehrten des 21. Jh.s (wobei sie das durchaus könnten), sondern von Xenophon, der im 4. Jh. v. Chr. schrieb. Sein Werk Οἰκονομικός beschreibt in detaillierter Weise die Haushaltsführung als das Rückgrat der griechischen Gesellschaft. Die Hälfte des Buches widmet Xenophon der Ehefrau und ihren Aufgaben. Solche umfangreichen Informationen über den Haushalt und dessen Verwaltung einschließlich der Arbeitsteilung ist einzigartig. Einzigartig ist auch, dass der Autor einen Dialog zwischen Ehemann und Ehefrau entwirft, in dem die namenlose Ehefrau die Möglichkeit hat, über sich selbst und ihre Wünsche zu sprechen.
Xenophons Bericht zufolge hatte die Ehefrau in einem wohlhabenden landwirtschaftlichen Haushalt die volle Verantwortung über die Verwaltung und Autorität über alles, was im Haus geschah. Ihre Arbeit und die ihres Ehemannes wurden als voneinander abhängig verstanden. Ihr ökonomischer, emotionaler und körperlicher Beitrag wurde als gleichwertig mit dem ihres Ehemannes anerkannt, und beiden Partnern wurden potentiell dieselben geistigen und moralischen Tugenden zuerkannt. Das Gelingen des Haushaltes hing vom gemeinsamen Einsatz beider Ehepartner ab. Wenn die Fähigkeiten und die Bildung der Ehefrau die des Ehemannes überstiegen, übertrug er ihr bereitwillig die größere Autorität und Verantwortung.2 Allerdings macht Xenophon auch deutlich, dass die Ehefrau, die er beschreibt, diese erforderlichen Eigenschaften nicht bereits besaß, als sie mit fünfzehn Jahren heiratete, sondern von ihrem Ehemann darin unterrichtet wurde. Ihre einzigen Qualifikationen, die sie bereits bei ihrer Hochzeit besaß, waren Weben und die Fähigkeit, ihren Appetit zu zügeln.
Obwohl Xenophon einen Athener Haushalt am Stadtrand Athens beschreibt, gibt es einige Faktoren, die das Buch für die Frage nach Frauen im nachexilischen, perserzeitlichen Juda relevant werden lassen. Zum Ersten beschreibt Xenophon aus erster Hand, wie jemand in der zu untersuchenden Perserzeit über Frauenleben reflektiert. Zum Zweiten ähnelt die landwirtschaftliche Welt, die er darstellt, Juda in Bezug auf Geografie und Klima, werden z. T. dieselben Nutzpflanzen angebaut (Weinstöcke, Olivenbäume, Dattelpalmen). Zum Dritten stimmt seine Beschreibung mit dem überein, was moderne ForscherInnen auf der Grundlage anderer Quellen für Frauen in der Antike annehmen. Zum Beispiel entsprechen die Aufgaben, die Xenophon Frauen zuschreibt, in vielem dem, was Carol Meyers in ihrem Artikel „Archäologie als Fenster zum Leben von Frauen in Alt-Israel“ aufzeigt.3 Übereinstimmungen gibt es auch mit Hennie Marsmans Studie über Israel und die umliegenden Kulturen.4 Zum Vierten korrespondiert die Beschreibung Xenophons größtenteils mit jener der „Frau von Stärke“5 in Spr 31,10–31, der ausführlichsten biblischen Beschreibung einer idealen Ehefrau, ihrer Pflichten, Fähigkeiten und ihres Wertes.
Die vielen Parallelen zwischen Xenophon und dem Sprüchebuch (Proverbien) lassen erahnen, wie viele Gemeinsamkeiten in der Wahrnehmung von Frauen in der zeitgenössischen antiken Welt bestanden. Sie weisen darauf hin, dass die Untersuchung zeitgenössischer Quellen helfen kann, Licht auf das Leben von Frauen in der nachexilischen Zeit zu werfen und ihre Darstellung in der Bibel angemessen zu interpretieren. Solange sie kritisch und mit Sorgfalt rezipiert werden, ermöglichen es die zahlreichen und verschiedenartigen Quellen aus dem klassischen Griechenland und anderen Nachbarkulturen, wissenschaftliche Hypothesen über mögliche Ähnlichkeiten und Entwicklungen aufzustellen und so die Lücken in den biblischen Quellen zu schließen.
Aus diesem Grund werde ich zunächst (1) kurz die nachexilische Zeit beschreiben, dann (2) repräsentative außerbiblische Quellen (aus Griechenland, Ägypten und Mesopotamien) durchgehen, um die größeren kulturellen Entwicklungslinien der nachexilischen, persischen Zeit zu entwerfen. Schließlich (3) werde ich den Beitrag der biblischen Quellen in diese Kontexte einordnen, um das Leben von Frauen in der nachexilischen Zeit verständlich zu machen.
1. Die nachexilische, persische Zeit (6. bis 4. Jh. v. Chr.)
Üblicherweise wird der Beginn der nachexilischen Zeit auf 539/538 v. Chr. datiert. Damit fällt er mit der aufkommenden Perserherrschaft zusammen, die den Alten Orient bis 333 v. Chr. dominierte. Biblischen und archäologischen Befunden zufolge wurde Juda 587/6 v. Chr. von den Babyloniern verwüstet. Jerusalem und sein Tempel wurden zerstört und wichtige Teile der Bevölkerung deportiert (597 sowie 587 v. Chr. und danach). Neuere archäologische Studien legen nahe, dass die Bevölkerung in Juda auf zwanzig, höchstens dreißig Prozent ihrer vorherigen Größe reduziert wurde.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























