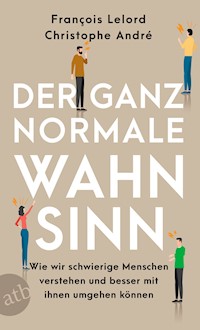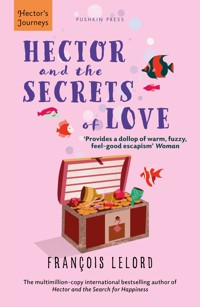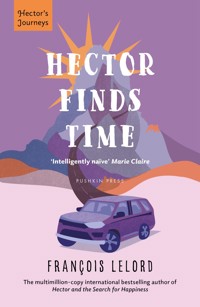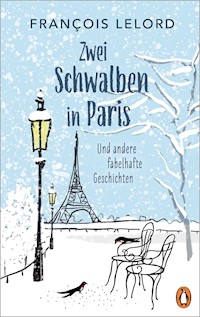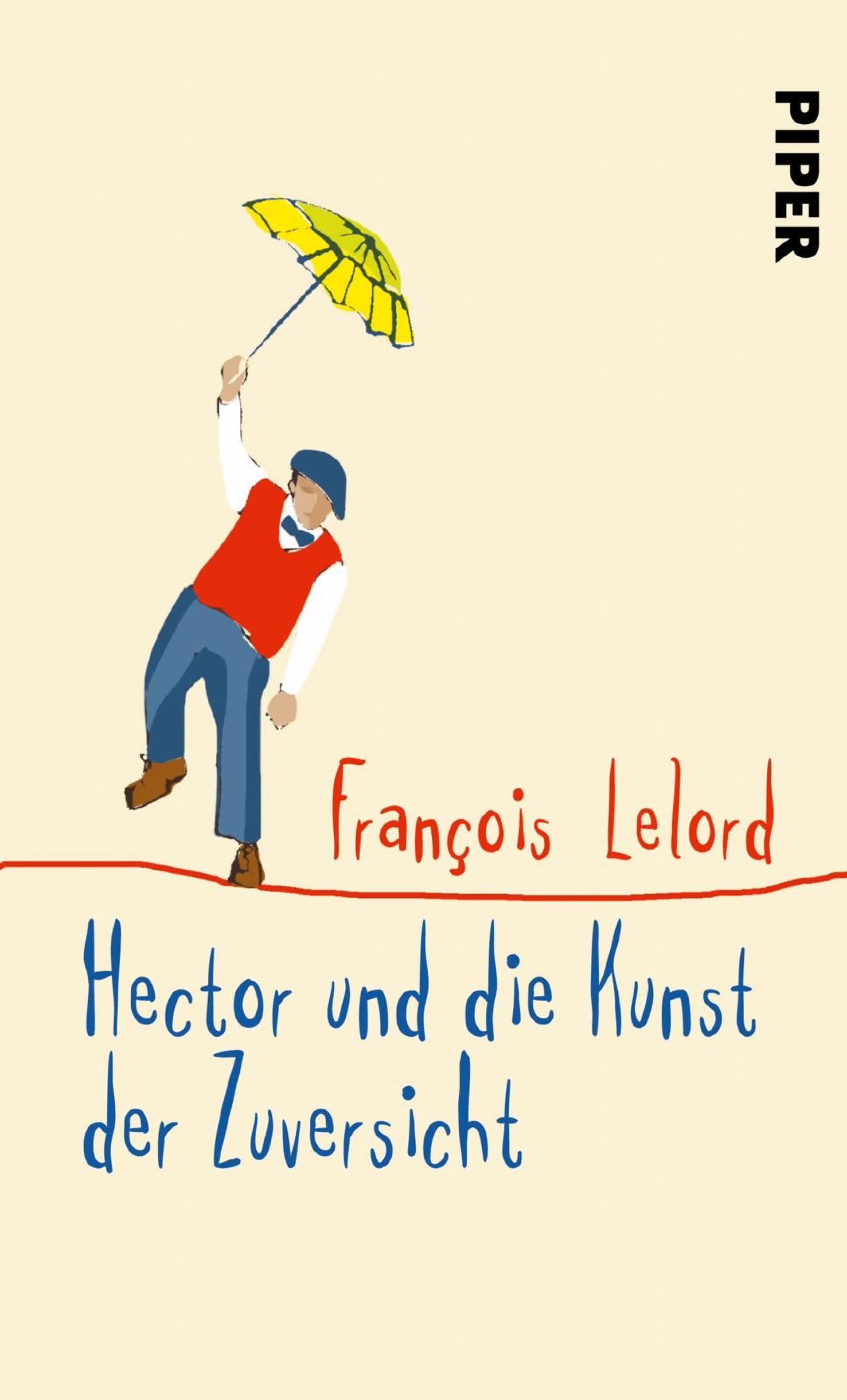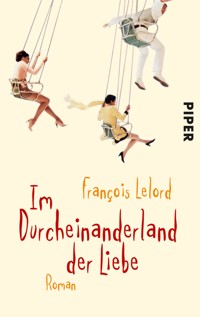10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hector ist irgendwie unzufrieden. Die Kinder sind groß, Clara geht ganz in ihrem Beruf auf, die Patienten langweilen ihn ein bisschen, und auch sonst fühlt er sich nicht wohl. Hat er die berühmte Midlife-Crisis? Gerade hat er begonnen, seinen Freund und Kollegen, den alten François deshalb zu konsultieren, da erreicht ihn die Nachricht von dessen Tod. Ein Schock - doch kurz darauf mehren sich die Anzeichen, dass François noch am Leben ist - nur dass er rätselhafterweise immer jünger zu werden scheint. Hector beginnt ihn überall in Paris zu suchen. Er besucht Fremde und alte Freunde - eine gute Gelegenheit, zu beobachten, wie die anderen sich mit ihren »besten Jahren« arrangieren. Und eine Chance für den Fernreisenden Hector, seine eigene, wunderbare Stadt neu zu entdecken. Seine Führerin auf dieser Erkundungstour: François' zauberhafte Enkelin Amandine. Kein Wunder, dass Clara ihre ganz eigene Midlife-Crisis entwickelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Sammlungen
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Französischen von Ralf Pannowitsch
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-96379-4
© Piper Verlag GmbH, München 2013 Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München Umschlagillustration: Mehrdad Zaeri, Agentur Susanne Koppe, Hamburg Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Es war einmal ein Psychiater, der hieß Hector, und so richtig jung war er leider nicht mehr.
Aber auch wenn er nicht mehr richtig jung war, richtig alt war er auch noch nicht: Wenn er spät dran war, konnte er noch die Treppen hochsprinten, und an einen neuen Computer gewöhnte er sich schnell. Am Wochenende guckte er zu Hause manchmal noch Musiksendungen für junge Leute, und wenn ihm ein Lied gefiel, dann tanzte er ganz allein danach, sehr zur Freude seiner Frau Clara.
Aber trotzdem merkte Hector, dass er nicht mehr richtig jung war: Seine jungen Kollegen duzten ihn nur zögernd, morgens beim Aufstehen tat ihm oft der Rücken weh, im Restaurant konnte er, wenn das Licht ein bisschen schummrig war, die Speisekarte nicht mehr lesen, und überhaupt fand er, dass die Kellner und die Polizisten immer jünger wurden.
Die meiste Zeit war Hector recht zufrieden mit seinem Leben. Er hatte einen interessanten Beruf, der ihm den Eindruck vermittelte, nützlich zu sein; mit Clara war er glücklich verheiratet; seine beiden Kinder waren schon groß und begannen allem Anschein nach ein normales Leben zu führen, und schließlich hatte er auch Freunde, mit denen er schöne Augenblicke erlebte.
An manchen Tagen jedoch fand er seinen Beruf zusehends beschwerlicher; für sein Empfinden arbeitete Clara zu viel; es fiel ihm auf, dass sie bisweilen mufflig und erschöpft waren (zum Glück nur selten beide zur gleichen Zeit); sein Sohn und seine Tochter fehlten ihm; er sah seine alten Freunde nicht mehr so oft und fragte sich manchmal, ob er nicht lieber in einer anderen Weltstadt leben würde, auch wenn er wusste, dass die Menschen aus allen Ländern herbeiströmten, um seine eigene Stadt anzustaunen – Paris.
Hin und wieder kamen ihm auf der Straße Frauen entgegen, die er ungewöhnlich verführerisch fand, und dann träumte er einen Augenblick lang davon, mit ihnen ein Abenteuer zu beginnen. Aber das war nur wie ein flüchtiges Fünkchen auf einem noch nicht ganz erloschenen Radarschirm. Er wusste ja, dass er seine Clara liebte, und diese einzigartige Liebe wollte er nicht für etwas aufs Spiel setzen, das bestimmt ziemlich banal wäre. Also drehte Hector sich noch nicht einmal nach diesen verführerischen Frauen um, denn das hätte er erbärmlich gefunden.
Wenn Sie ihn danach gefragt hätten, hätte Hector Ihnen geantwortet, dass er mit seinem Leben im Großen und Ganzen recht zufrieden sei und sich vor allem wünsche, dass alles so weiterlaufe wie bisher. Und das war nun leider wirklich ein Zeichen dafür, dass er nicht mehr jung war.
Dennoch träumte er von Zeit zu Zeit, ohne es sich einzugestehen, von einem anderen Leben, was wiederum bewies, dass er eben auch noch nicht richtig alt war.
Olivia möchte ein neues Leben anfangen
»Doktor, ich würde so gern ein anderes Leben haben!«
Das sagte Olivia, Kunstlehrerin an einem guten Pariser Gymnasium – einem von denen, wo die Eltern mehr verdienen als die Lehrer, die gewöhnlich in den Vorstädten wohnen. So auch Olivia, die in einer Freistunde in Hectors Sprechzimmer kam.
Olivia sah immer noch jung aus, sie war, wie man so schön sagt, rank und schlank. Mit ihren funkensprühenden blauen Augen schien sie auch immer noch bereit, auf die Barrikaden zu gehen, wenn es um die Verteidigung der Kunst und überhaupt um die großen Weltprobleme ging. Sie war ziemlich sexy und immer noch unverheiratet; dabei glaubte Hector nicht, dass es ihr an Kandidaten gefehlt hatte, die ihr ein Leben zu zweit vorgeschlagen hatten.
Allerdings hatte man Olivia schon früh beigebracht, eine Frau müsse vor allem unabhängig sein und ihr eigenes Leben leben, und die Ehe sei bloß ein altmodischer bürgerlicher Zopf, den man abschneiden müsse. Und wenn sie sich die Ehen ihrer Freundinnen anschaute – egal, ob diese geschieden waren oder immer noch mit ihrem Mann zusammenlebten –, bekam sie tatsächlich selten Lust, einen eigenen Versuch zu wagen.
»Ein anderes Leben welcher Art?«
Hector war ein wenig überrascht. Er hatte Olivia während einiger Konsultationen kennengelernt, nachdem sie bei einer etwas stürmischen Flugreise in Zentralasien Panikattacken bekommen hatte, die sie hinterhältigerweise nicht mehr aus den Fängen lassen wollten, als sie längst wieder festen Boden unter den Füßen hatte. (Olivia gab einen Großteil ihres Geldes für ziemlich abenteuerliche Reisen aus.) Mit einer geschickten Mischung aus Medikamenten und Psychotherapie hatte Hector ihr schnell helfen können, zumal Olivia psychisch ansonsten in einem sehr guten Zustand war.
Er vergrößerte also, wie üblich bei Patienten, denen es besser ging, die Zeitabstände zwischen den Terminen. Bei Olivia hatte er es ein bisschen bedauert, denn eine hübsche Patientin, die man geheilt hat, sieht man viel lieber wieder als ein Monster, dem es immer schlechter geht und das im Sprechzimmer zu ächzen und zu wimmern anfängt. Aber so läuft es nun mal in diesem Beruf: Man ist dafür da, die Leute dann zu behandeln, wenn es ihnen schlecht geht.
»Ich habe das Gefühl, dass ich von Anfang an auf dem Holzweg war«, sagte Olivia, »und dass es jetzt zu spät ist.« Und dabei schaute sie Hector mit einem dramatischen Gesichtsausdruck an.
»Wie meinen Sie das?«
Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass Hector eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten pflegt. Das ist eine Grundtechnik in seinem Beruf – zunächst einmal, um den Patienten zu verstehen, aber vor allem auch, um ihm zu helfen, sich selbst zu verstehen.
»Nun, alles, woran ich geglaubt habe – Freiheit, Unabhängigkeit, Kunst, Einsatz für die Gesellschaft!«
»Die Ideale Ihrer Jugendjahre also?«
»Genau«, sagte Olivia mit einem charmanten Auflachen.
Sie konnte sich über sich selbst lustig machen, was ein Zeichen geistiger Gesundheit ist.
»Aber glauben Sie denn nicht mehr an diese Ideale?«
»Doch, natürlich. Aber ich frage mich, was sie mir gebracht haben.«
»Sind Sie mit Ihrem gegenwärtigen Leben nicht zufrieden?«
Olivia sagte ein paar Sekunden lang nichts; zuerst schaute sie Hector an, dann spielte sie nervös mit ihrem exotischen Armband herum, das, wie Hector festgestellt hatte, aus Tibet kam.
»Verdammt noch mal, ich rede nicht gern darüber, aber schauen Sie sich doch mein Leben mal an!«
»Ich habe den Eindruck, dass Sie es sich genau so ausgesucht haben …«
»Das ist es ja gerade!«, rief Olivia aus.
Und als hätte man ein Ventil geöffnet, sprudelte es plötzlich aus ihr heraus: »Verstehen Sie denn nicht? Ich habe mich für den Lehrerberuf entschieden, weil ich dachte, den Kindern die Kunst nahezubringen sei das beste Mittel, um bessere Erwachsene aus ihnen zu machen – gerade hierzulande, wo die Kunsterziehung in den Schulen ein Schattendasein fristet.«
»So ist es«, sagte Hector, »aber gefällt Ihnen diese Idee nicht mehr?«
»Heute verbringe ich meine Zeit vor Bürgersöhnchen und Bürgertöchtern, die wiederum ihre Zeit damit verbringen, heimlich ihre Smartphones zu checken.«
»Gibt es denn keine Ausnahmen?«
»Doch, aber weil ich an einem feinen Gymnasium unterrichte, stehen diesen Ausnahmen schon zu Hause Kunst und Kultur offen! Was kann ich denn da noch bewirken?«
Hector sagte sich, dass Olivia wahrscheinlich mehr bewirkt hatte, während sie als ganz junge Lehrerin an den sozialen Brennpunkten unterrichtet hatte.
Sie hatte seine Gedanken erraten: »Natürlich könnte ich um meine Versetzung in einen Problemvorort bitten (meine Kolleginnen würden mich für übergeschnappt halten), aber dieses Opfer habe ich doch schon mal gebracht, und überhaupt wäre es heute dort das Gleiche in Grün – die gleichen Smartphones …«
»Und haben Sie schon mal ins Auge gefasst, den …«
Aber Olivia war nicht mehr zu bremsen: »… und außerdem ist mir mittlerweile klar, wie wichtig Geld ist!« Sie erklärte, dass man sich mit fast vierzig (genau genommen war sie 42Jahre alt) ein komfortableres Leben zu wünschen beginne. Inzwischen sei sie ungeschminkt und in Jeans nicht mehr besonders hinreißend; sie habe jetzt Lust auf Kosmetika und elegante Kleidung, aber mit einem Lehrergehalt könne sie sich das alles nicht leisten, es sei denn, sie verzichte auf ihre Reisen, aber wofür solle sie dann überhaupt noch leben, und schließlich halfen ihr die Reisen, den Rest des Jahres zu überstehen.
»Haben Sie schon darüber nachgedacht, ob …«
Ihre Redeflut war nicht aufzuhalten: »Und mein Liebesleben erst! Ja, ich werde noch immer angebaggert – natürlich nicht mehr so oft wie früher –, aber die Männer, die mich interessieren, sind meistens schon unter der Haube. Und kommen Sie mir bloß nicht mit Ihrem Psychozeugs über meinen neurotischen Hang zu Männern, die nicht mehr zu haben sind! Es stimmt leider einfach, dass die guten Männer in meinem Alter alle schon einen Ehering tragen! Davor hat mich früher meine Mutter immer gewarnt, und damals fand ich das total lachhaft! Heute habe ich den Eindruck, dass für mich nur noch die Schürzenjäger übrig geblieben sind (und die sind sowieso meist auch verheiratet), die total Verklemmten oder die Geschiedenen, die Angst haben, sich erneut zu binden! Ich könnte ein ganzes Buch über die Typen schreiben, die mich am Tag danach wieder anrufen, aber die ich lieber nicht wiedersehen möchte!«
Hector saß ein wenig verdattert da, als sich diese Flut von Vertraulichkeiten über ihn ergoss, obwohl er eigentlich wusste, dass es sein Job war, sich so etwas anzuhören.
»Und wissen Sie, was am schlimmsten ist?«, fragte Olivia.
»Nein …«
»Dass ich manchmal von einem fürsorglichen Mann träume. Der mich mit auf Reisen nimmt und mit mir shoppen geht. Für den Geld nie ein Problem ist und der mich zu alledem noch fragt, wie ich mich fühle. Ein fürsorglicher Mann! Von so etwas zu träumen! Schauderhaft, nicht wahr?«
Und Olivia musste lachen, was einmal mehr ihren guten Gesundheitszustand bewies. »Ich mache Witzchen darüber, Doktor, aber es ist wirklich ernst. Ich habe das Gefühl, dass mein Leben bisher ein einziger Irrtum war.«
»Darüber werden wir genauer sprechen müssen«, sagte Hector, denn die Konsultation war zu Ende, und auch wenn er sich gern länger mit Olivia unterhalten hätte, durfte er nicht noch etwas Zeit dranhängen, weil die dann dem nächsten Patienten gefehlt hätte.
Er griff zu Olivias Krankenakte, zögerte ein wenig und schrieb dann: »Midlife-Crisis«.
Hector und die Midlife-Crisis
Eigentlich wusste Hector nicht recht, ob er an die ominöse Midlife-Crisis glaubte, von der in den Zeitschriften so oft die Rede war. Einige seiner Kollegen hatten sogar Bücher darüber geschrieben und traten zu diesem Thema im Fernsehen auf.
Er hatte im Übrigen genau recherchiert und herausgefunden, dass es den Forschern selbst nach zahlreichen Untersuchungen schwerfiel, die Existenz dieser berühmten Krise nachzuweisen. Krisen konnten sich nämlich in jedem Moment des Lebens ereignen, und außerdem gab es viele Menschen mittleren Alters, die keine solche Krise durchmachten.
Aber wenn sich jemand so um die vierzig, fünfzig schlecht fühlte, wenn er seine Arbeit oder seinen Ehepartner nicht mehr so gut ertragen konnte oder sogar gleich ganz auswechseln wollte, dann fragte er sich natürlich, ob es nicht vielleicht die Midlife-Crisis war. Hector erklärte diesen Patienten dann oft, dass es sich eher um eine Krise handelte, die von den Sorgen ausgelöst wurde, die typischerweise in der Lebensmitte auftreten: Scheidung, Überlastung, berufliche Enttäuschungen oder, was noch trauriger war, der Verlust eines geliebten Menschen – all die Dinge, die passieren, wenn die Jahre ins Land gehen.
Aber er wusste auch, dass die Ankunft in der Mitte des Lebens (er selbst war ja gerade dort angekommen) eine sehr spezielle Sache war, denn wie Olivia bemerkt man dann plötzlich, dass man nicht mehr jung ist, auch wenn man noch nicht zu den Alten gehört. Also sagt man sich, dass man lieber jetzt damit beginnen sollte, etwas zu ändern, denn später würde es noch schwieriger werden: Man hätte dann weniger Energie, und vor allem würden die anderen denken, dass man zu alt sei, um ein neues Leben anzufangen. Sie würden einem keine Chance mehr geben – weder in der Liebe noch für eine neue Karriere.
Die Midlife-Crisis war ein bisschen wie die Lautsprecheransage: »Liebe Kunden, unser Geschäft schließt in wenigen Minuten, bitte beeilen Sie sich, Ihre Einkäufe für ein neues Leben zu erledigen, denn sonst wird es zu spät dafür sein.«
Und vielleicht vernahm Hector, wenn ihm eine hübsche Passantin über den Weg lief, selbst so eine innere Stimme, die ihm sagte: »Noch hast du Zeit, aber beeil dich, denn bald ist es zu spät.«
Der Nächste bitte!
Sabine möchte ein neues Leben anfangen
»Doktor, ich möchte ein neues Leben anfangen!«
Jetzt saß ihm Sabine gegenüber, eine verheiratete Frau, die eine eindrucksvolle Karriere hingelegt hatte, und das, ohne vorher groß studiert zu haben. Sie war zur regionalen Verkaufschefin einer großen Firma für Frühstücksflocken aufgestiegen. Hector sagte sich, dass sie wohl mindestens doppelt so viel verdiente wie Olivia.
»Ich habe die Nase so voll«, meinte Sabine.
»Wovon?«
»Von diesem permanenten Stress. Immer starrt man wie gebannt auf die Verkaufszahlen. Man muss die Vorgaben erfüllen und setzt auch noch das ganze Team unter Druck. Und wofür das alles?«
»Ja, wofür?«
»Um die Kinder mit ungesundem Zeug vollzustopfen, von dem sie fett werden!«
»Aber solche Getreideprodukte …«
»Viel Getreide ist da nicht mehr drin, dafür umso mehr Zucker und Fett! Versuchen Sie doch mal, richtige Haferflocken mit nichts als ein wenig Milch zu essen!«
»Das nennt man Porridge«, warf Hector ein.
»Ja, aber wer isst das heute noch? Nicht mal meine eigenen Kinder kriege ich dazu überredet!«
Denn Sabine hatte nicht nur Erfolg im Beruf, sondern auch zwei Kinder und einen Ehemann, der Tennislehrer war. An manchen Tagen aber hätte sie am liebsten ihren Koffer gepackt und sie alle sich selbst überlassen.
»Ich habe den Eindruck, dass mein Leben auf eine Weise verläuft, die mir nicht gefällt, und ich will einfach nicht so weitermachen!«
»Wie weitermachen?«
Sabine hatte sich ereifert, Tränen waren ihr in die Augen gestiegen.
»Im Grunde reagiere ich die ganze Zeit nur auf die Bedürfnisse der anderen. Meiner Vorgesetzten, meiner Kinder, meines Mannes, meiner Eltern! Manchmal frage ich mich, wo ich denn eigentlich bleibe, worauf ich wirklich Lust habe. Darf ich nicht auch mal darüber nachdenken? Was meinen Sie?«
»Nun«, sagte Hector, »dann mal los!«
»Doktor, könnte das nicht die Midlife-Crisis sein?«
»Was bedeutet das für Sie – Midlife-Crisis?«
»Na ja, zunächst mal, dass ich den Eindruck habe, in der Mitte meines Lebens angekommen zu sein. Dass ich mehr darüber nachdenke als sonst.«
»Warum ist das Ihrer Meinung nach so?«
»Da reicht schon ein Blick auf mein Geburtsjahr. Unlängst bin ich vierzig geworden.«
»Sonst ist da nichts?«
»All die Scheidungen um mich herum … Und dann ist eine Freundin von mir krank geworden und …« Sabine konnte den Satz nicht beenden, sie zog ein Papiertaschentuch hervor und wischte sich die Augen.
Hector begriff, dass sie erlebt hatte, wie eine gleichaltrige Freundin gestorben war. Eine solche Erfahrung bereitet uns nicht nur viel Kummer, sondern lässt uns auch sehr nachdrücklich an unsere eigene Sterblichkeit denken und an die verrinnende Zeit.
»Also, Doktor, sieht das einer Midlife-Crisis nicht sehr ähnlich?«
»Ja, zumindest dem, was man landläufig Midlife-Crisis nennt.«
Hector empfahl Sabine, eine Liste mit allem zu machen, was ihr bei der Arbeit nicht gefiel, und außerdem eine zweite Liste, auf der stand, was ihr Mann an seinem Verhalten ändern sollte.
Was die Arbeit betraf, so hatte er schon verstanden, welchem Stressfaktor Sabine ausgesetzt war: einem Konflikt zwischen ihren eigenen Wertvorstellungen und denen der Firma – es war ein bisschen so, als würde sie als Pazifistin für ein Rüstungsunternehmen arbeiten.
In den letzten Jahren hatte Sabine immer stärker auf eine Ernährung mit Naturprodukten geachtet, und das stand wirklich im Widerspruch zu den bunten Packungen, deren Verkaufszahlen sie steigern musste. Vielleicht konnte sie ja ihre Sicht auf die Dinge ein wenig ändern – Cornflakes zu verkaufen war immerhin noch besser, als für einen Zigaretten- oder Alkoholfabrikanten zu arbeiten.
»Und es ist nicht nur meine Arbeit, die mich so belastet. Manchmal ist es auch mein Mann …«
Was den Mann anging, so gab es zwei gängige Methoden, um Sabine zu helfen – entweder sie lernte, sich so auszudrücken, dass ihr Mann künftig mehr Verständnis zeigte, oder sie akzeptierte, dass er das blieb, was er immer gewesen war: ein reichlich fauler Bursche, der nur Eifer an den Tag legte, wenn es um Sport ging oder darum, mit seinen Kumpels um die Häuser zu ziehen. Am Anfang hatte Sabine das sogar anziehend gefunden, aber inzwischen fand sie es längst nicht mehr so bestrickend, vor allem wenn sie sich klar machte, dass sie nicht nur den anstrengenderen und besser bezahlten Job hatte, sondern außerdem noch den Großteil des Haushalts schmeißen musste.
(Sie werden jetzt vielleicht denken, dass Hector nicht besonders ehrgeizig ist, aber wenn Sie spektakuläre Ergebnisse wollen, wenden Sie sich lieber an einen Chirurgen – der löst Probleme manchmal einfach, indem er sie entfernt.)
Mit einem Mal fühlte sich Hector sehr müde. Als er Sabines erwartungsvollem Blick begegnete, musste er sich sehr zurückhalten, um ihr nicht zu sagen: »Werfen Sie Ihre Arbeit hin! Geben Sie Ihrem Kerl den Laufpass! Sie werden sehen, dann wird alles viel besser!«
Aber nein. Wenn das vielleicht auch die richtigen Entscheidungen für Sabine waren, musste er ihr doch helfen, selbst dorthin zu gelangen, indem er ihr erst die richtigen Fragen stellte. Doch wenn er an all die richtigen Fragen dachte, die er ihr würde stellen müssen, wurde er plötzlich schon im Vorhinein müde. Und das bei einer so sympathischen Patientin!
Hector vermerkte in Sabines Krankenakte: berufliches Burn-out + Erschöpfung als Mutter + »Midlife-Crisis«.
Wollen sogar die Nonnen ein neues Leben anfangen?
Nachdem Hector Sabine zur Tür gebracht hatte, legte er eine kleine Pause ein.
Er machte sich in der winzigen Küche seiner Praxis einen Kaffee und trat mit der Tasse ans Fenster des Sprechzimmers, von dem aus man einen schönen Blick auf den Turm der Kirche Saint-Honoré-d’Eylau hatte. Sie lag genau gegenüber, und das war praktisch, denn die Kirchenglocke markierte jede abgelaufene halbe Stunde mit einem leisen Bimmeln, sodass Hector immer wusste, wie lange er schon überzogen hatte, auch ohne auf seine Armbanduhr schauen zu müssen. Das sollten Sie nämlich vermeiden, wenn Ihnen gerade jemand erzählt, dass er nicht mehr so weiterleben kann oder dass seine Mutter ihn nie geliebt hat.
Es war eine Kirche aus dem 19.Jahrhundert, an der weiter nichts Bemerkenswertes war, als dass ein Kloster dazugehörte. Dort lebten Nonnen, deren Ordensregeln es verboten, das Kloster jemals zu verlassen.
Hector konnte sich ja noch vorstellen, eines Tages als Mönch in einer abgeschiedenen Abtei mitten im Grünen zu leben (dann riskierte er nicht mehr, dass ihm hübsche Frauen über den Weg liefen) – aber hier, eingeschlossen inmitten einer Metropole? Wenn einem die ganze Zeit das geräuschvolle Großstadttreiben in den Ohren klang? Er fragte sich, ob nicht auch manche der Nonnen bisweilen Lust bekamen, ein neues Leben anzufangen oder wenigstens mal den Klosterbezirk zu verlassen, um in der vorzüglichen Patisserie auf der anderen Seite der Place Victor Hugo ein Eis zu essen.
Er wusste, dass es in jeder Ordensgemeinschaft Bestimmungen für den Fall gab, dass jemand sich nicht mehr berufen fühlte – aber wie sollte man ins Leben zurückfinden, nachdem man Jahre hinter Klostermauern verbracht hatte? Vielleicht sollte er dem Orden für solche Lebenslagen seine Hilfe anbieten? Er brauchte ja nur über die Straße zu gehen. So würde er wenigstens mal aus seinen Praxisräumen kommen …
Das nämlich war ein anderes Problem von Hector: Mehr und mehr fühlte er sich eingesperrt in seinem Sprechzimmer.
Roger will kein neues Leben anfangen
»Vielleicht sehen wir uns heute zum letzten Mal, Doktor.«
Roger war ein Patient, den Hector schon lange kannte. Er wirkte ziemlich Furcht einflößend mit seinen Möbelpackerschultern, seinen buschigen Augenbrauen und seinen etwas schiefen Zähnen. In einem Kinderfilm hätte er gut den Menschenfresser spielen können, aber eigentlich war er nett, zumindest so lange, wie man ihn nicht in Sachen Gott ärgerte.
Seit seiner Jugend hörte Roger, wie Gott zu ihm sprach; eine Zeit lang hatte er sogar geglaubt, von Ihm ausgesandt worden zu sein, um die Welt zu retten. Und weil dazu noch die Neigung kam, schnell in Rage zu geraten, wenn die Leute über seine Worte lachten, war das eine gefährliche Mischung, die ihn schon oft in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht hatte – und manche der Spötter in ein normales Krankenhaus.
Etliche Psychiater hatten sich an Roger die Zähne ausgebissen, aber dann war es Hector gelungen, eine recht gute Beziehung zu ihm aufzubauen. Vielleicht lag es daran, dass Hector einst eine kirchliche Schule besucht hatte? Und auch wenn er heute nicht richtig wusste, ob er noch gläubig war, wusste er, wovon Roger redete, wenn er vom Allerhöchsten sprach oder von der kniffligen Frage, ob man der göttlichen Gnade nur durch gute Werke teilhaftig wurde oder auch ohne gute Werke. Früher haben sich die Leute wegen dieses Problems gegenseitig umgebracht, aber leider ist nie jemand wiederauferstanden, um den anderen zu berichten, wer letztendlich recht hatte.
Und dann fand Hector auch, dass Roger trotz seiner Wahnvorstellungen oft sehr interessante Überlegungen zum Leben anstellte, und manchmal notierte Hector sie sich sogar.
Und dank dieses guten Verhältnisses zwischen ihnen beiden hatte er Roger sogar überzeugen können, täglich seine Medikamente einzunehmen.
Und die Stimme des Ewigen war so zu einer kleinen Hintergrundmusik geworden, die Roger nicht daran hinderte, ein beinahe normales Leben zu führen.
Und Hector hatte Roger beigebracht, über diese Stimme nur mit seinem Psychiater oder dem Pfarrer zu sprechen und nicht mit allen möglichen Leuten, denn die glaubten meistens nicht mehr so richtig an Gott und noch weniger an die spezielle Beziehung, die Roger zu Ihm unterhielt.
Und es kam vor, dass der Pfarrer bei Hector anrief und ihm sagte, dass man die Dosierung von Rogers Medikamenten vielleicht erhöhen sollte.
Und Hector schämte sich dann ein wenig für diesen kleinen Verrat, aber es war ja nur zu Rogers Bestem – ein Quäntchen Böses, um ein viel größeres Gutes zu bewirken, wie es der heilige Augustinus so schön gesagt hat. Aber seien Sie vorsichtig mit diesem Argument, denn man hat sich seiner schon bedient, um ganze Städte in Schutt und Asche zu legen samt all ihrer Bewohner, die Babys inbegriffen.
»Aber weshalb sollten wir uns heute zum letzten Mal sehen?«, fragte Hector ziemlich überrascht.
Er fürchtete, dass Roger ihm gleich verkünden werde, er könne künftig ohne Medikamente oder Psychiater auskommen, und bereitete sich schon auf eine schwierige Sitzung vor.
Aber darum ging es ganz und gar nicht. »Man hat mich aus meiner Wohnung geschmissen«, sagte Roger.
Bisher hatte Roger es immer geschafft, die Miete für seine Einzimmerwohnung zu bezahlen, denn er hatte Sozialhilfe und eine Rente von der Stadt bekommen, aber nun war eine dieser Hilfszahlungen zusammengestrichen worden, und gleichzeitig hatte man Roger die Miete erhöht.
»Und kann Ihnen die Sozialarbeiterin nicht helfen, eine neue Wohnung zu finden?«
»Das versuchen wir schon seit Monaten«, meinte Roger, »aber es klappt nicht. Es ist offenbar kein Geld mehr da.«
Wie allgemein bekannt, lebte das Land seit vielen Jahren auf Pump. Dabei hatten die Leute immer weniger Stunden gearbeitet, und die Firmen hatten immer weniger Produkte ins Ausland verkauft. Es war schwer zu sagen, wessen Schuld das war, aber jedenfalls war derzeit weniger Geld in der Kasse, um Menschen wie Roger die Wohnung zu bezahlen.
»Sie schlagen mir vor, nach irgendwo weit draußen in die Vororte zu ziehen. Aber ich mag die Vorstädte nicht. Was ich liebe, das ist Paris. Und außerdem hätte ich dann einen weiten Weg bis zu Ihnen.«
Hector konnte Roger gut verstehen; auch er liebte Paris, und schon in einem der schöneren Vororte leben zu müssen, wäre ihm wie ein Exil vorgekommen. Was man aber Roger anbot, waren gewiss nicht die netten Vorstädte.
Roger brachte seine Tage damit zu, allein durch die Straßen von Paris zu streifen; er ging von einer Kirche zur nächsten und kannte sie fast alle.
»Natürlich gäbe es da eine Lösung«, sagte Roger.
Hector freute sich, dass Roger sich selbst eine Lösung überlegt hatte; es zeigte ihm, dass seine Arbeit als Psychiater nicht vergeblich gewesen war.
»Ich nehme einfach die Medikamente nicht mehr, und im Handumdrehen lande ich wieder in der Klapse«, sagte Roger und lachte.
Das Traurige daran war, dass Roger nicht unrecht hatte. Wenn er in seinen Wahnzuständen ein paar große Dummheiten anstellte, konnte es gut sein, dass er sich in einer Klinik wiederfand und monatelang dort bleiben musste – was die Gesellschaft zehnmal mehr kosten würde, als wenn er in seiner Einzimmerwohnung geblieben wäre.
»Aber darauf habe ich keine Lust, Doktor. Die Klinik, das ist nicht mein Ding. Vielleicht, wenn alles noch so wäre wie früher …«
Als Roger ganz jung gewesen war, hatte es sie noch gegeben, die altmodischen psychiatrischen Krankenhäuser, die man ›Anstalten‹ nannte – mit Innenhöfen, Bäumen, Tischler- oder Schlosserwerkstätten und sogar kleinen Bauernhöfen, damit die Kranken eine Beschäftigung hatten, denn diese Krankenhäuser waren zu einer Zeit erbaut worden, in der man wusste, dass man die Patienten lange dabehalten würde: über Jahre hinweg, vielleicht sogar lebenslang.
Heute aber hatte man neue Medikamente und sperrte die Kranken nicht mehr so lange weg, und die modernen Architekten hatten psychiatrische Abteilungen entworfen, die wie ein ganz gewöhnliches Krankenhaus aussahen und in denen man außerhalb seines Zimmers nur wenig Platz hatte. Wenn man nur kurz dablieb, war das ganz in Ordnung, aber es wurde schnell belastend, wenn man dort Monate verbringen musste, und genau das konnte Roger passieren, wenn er seine Tabletten nicht mehr nahm und damit zuließ, dass die Krankheit sich verschlimmerte. In gewisser Weise trauerte Roger den alten Heilanstalten nach. Hector, der in jungen Jahren dort noch gearbeitet hatte, erinnerte sich gut, dass manche Patienten gar nicht wieder fortwollten, auch wenn man ihnen erklärte, dass sie jetzt wieder gesünder seien und die Zeit gekommen sei, in ein Leben jenseits des Anstaltstores zurückzufinden.
»Auf jeden Fall habe ich nicht die Absicht umzuziehen«, sagte Roger in einer plötzlichen Zorneswallung. »Sie werden mich mit Gewalt vor die Tür setzen müssen.«
Hector fand das Aufblitzen von Zorn in Rogers Augen ziemlich beunruhigend.
»Und haben Sie Ihre Medikamente immer ordnungsgemäß genommen?«
»Ja, ja, machen Sie sich keine Sorgen.«
Aber Hector machte sich dennoch Sorgen. Die Medikamente waren so etwas wie eine Stoßstange zum Schutz gegen Stress, aber wenn der Stress anwuchs wie gerade eben bei Roger, konnte es passieren, dass sie nicht mehr ausreichten.
»Ich denke, dass wir die Dosis ein wenig erhöhen müssten. Sie machen gerade eine anstrengende Phase durch.«
»Aber nein, Doktor!«, sagte Roger, der das aus einem leicht anderen Blickwinkel sah als Hector. »Erst wollen die mich rauswerfen, und nun wollen Sie auch noch die Dosis erhöhen – das ist doch nicht gerecht!«
Hector dachte einen Moment daran, fest zu bleiben, aber er wusste, dass Roger sowieso machen würde, was er wollte, und außerdem war eigentlich längst der nächste Patient dran.
»Nun, dann belassen wir es heute dabei, aber ich würde Sie gern bald wiedersehen. Sagen wir, übermorgen?«
»Einverstanden, gerne.«
Und so zog Roger von dannen und ließ Hector einigermaßen beunruhigt zurück.
Es war Roger gelungen, sich ein relativ stabiles Leben aufzubauen (was bei seiner Krankheit an ein Wunder grenzte), und nun kamen andere daher und wollten ihn zwingen, ein neues Leben zu beginnen!
Tristan möchte ein neues Leben anfangen
»Doktor, ich habe dieses Leben satt!«
So sprach Tristan, ein ziemlich langweiliger, wenn auch eher gut aussehender und stets elegant angezogener Mann, der in der Verwaltung von Dachfonds arbeitete. Dachfonds waren Fonds von Fonds, und Hector hatte Tristan gefragt, ob es auch Fonds von Fonds von Fonds gebe – aber nein, so weit ging es nun doch nicht. Diese Dachfonds jedenfalls brachten nicht mehr so viel ein wie früher, Tristans Bonus war zusammengeschmolzen, und überhaupt war er seines Berufes allmählich überdrüssig geworden und konnte den Anblick von Kollegen wie Kunden immer weniger ertragen.
»Und wissen Sie, Doktor, manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass es mir völlig schnurz ist, ob unsere Kunden damit Geld verdienen oder nicht. Das ist doch der Gipfel, oder?«
»Ja, natürlich«, meinte Hector und fragte sich, ob es Leute wie Tristan womöglich auch in der Bank gab, bei der er seine paar Ersparnisse angelegt hatte. Er wusste, dass es ein Anzeichen von beruflichem Burn-out war, wenn es einem relativ gleichgültig wurde, welche Früchte die eigene Arbeit trug.
»… und dann treffe ich manchmal frühere Kollegen, die es wirklich geschafft haben. Sie haben Posten mit einer Menge Verantwortung, sie werden bald richtig reich sein …«
In Hectors Augen war auch Tristan schon reich, aber gleichzeitig verstand er, dass sich sein Patient arm fühlte, wenn er sich mit ehemaligen Kameraden verglich, die beruflich den Jackpot geknackt hatten. Das war das Problem, wenn man in riesigen Unternehmen arbeitete, in einer Großbank beispielsweise: Man wurde in ein Wettrennen hineingezogen (das Rattenrennen, wie es böse Zungen nannten), und so um die vierzig merkte man plötzlich, dass andere einen Vorsprung gewonnen hatten, den man unmöglich mehr aufholen konnte, selbst wenn man doppelt so schnell strampelte. Aber auch für jene, die ganz vorn im Rennen lagen – etwa Sabine in ihrem Sektor –, war das nicht unbedingt eine Glücksgarantie. Denn zunächst einmal hat, wie man so sagt, alles seinen Preis, und wenn man pausenlos strampeln muss, um an der Spitze zu bleiben, erzeugt das eine Menge Stress. Und dann wusste Hector auch, dass man sich sehr schnell an seinen Platz auf der Erfolgsleiter gewöhnt und dass manche Menschen es sich einfach nicht verkneifen können, auf jene zu schauen, die ein paar Sprossen höher geklettert sind. So verhielt es sich auch mit Tristan, den man von frühester Jugend an auf Wettbewerb getrimmt hatte, denn sein Vater war vom selben Kaliber gewesen und hatte jedes Tennismatch unter Freunden als Kampf auf Leben und Tod betrachtet.
Offensichtlich hatte Tristan in der Karriere, die er sich erträumt hatte, eine Leitersprosse nicht richtig erwischt. Vielleicht war er zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht am richtigen Ort gewesen, auf jeden Fall fuhr er nicht mehr in der Spitzengruppe mit.
»Man hat mir gerade meinen Mitarbeiterstab zusammengestrichen«, verkündete Tristan jetzt, und er sagte es so, als hätte er eben erfahren, dass er an einer unheilbaren Krankheit litt.
In Europa fuhr die Bank einen Sparkurs, während sie ihre Präsenz in Asien ausbaute – dort, wo in letzter Zeit ganz außergewöhnlich reiche Leute aufgetaucht waren, die andere für fast nichts arbeiten lassen konnten und sehr niedrige Steuern zahlten. Diese Reichen mussten ihr Geld gewinnbringend anlegen, und so brauchte die Bank in Asien recht viele Leute wie Tristan. Aber er selbst hatte nicht den richtigen Lebenslauf, um dorthin geschickt zu werden; er hatte das Pech gehabt, immer nur in der westlichen Welt zu arbeiten – dort, wo der unersättliche Appetit der Reichen allmählich durch Steuern gezügelt worden war und wo die Armen ein bisschen besser bezahlt wurden als anderswo.
Diese geopolitische Analyse hatte Tristan aber schon selbst vorgenommen.
»Andere behalten ihren Mitarbeiterstab. Schon wieder trifft es ausgerechnet mich! Mein Chef kann mich einfach nicht ausstehen!«
Ende der Leseprobe