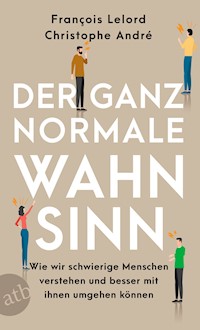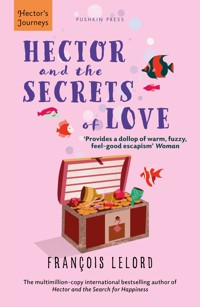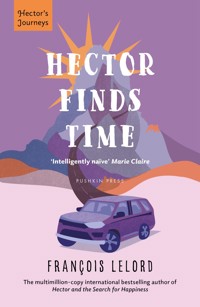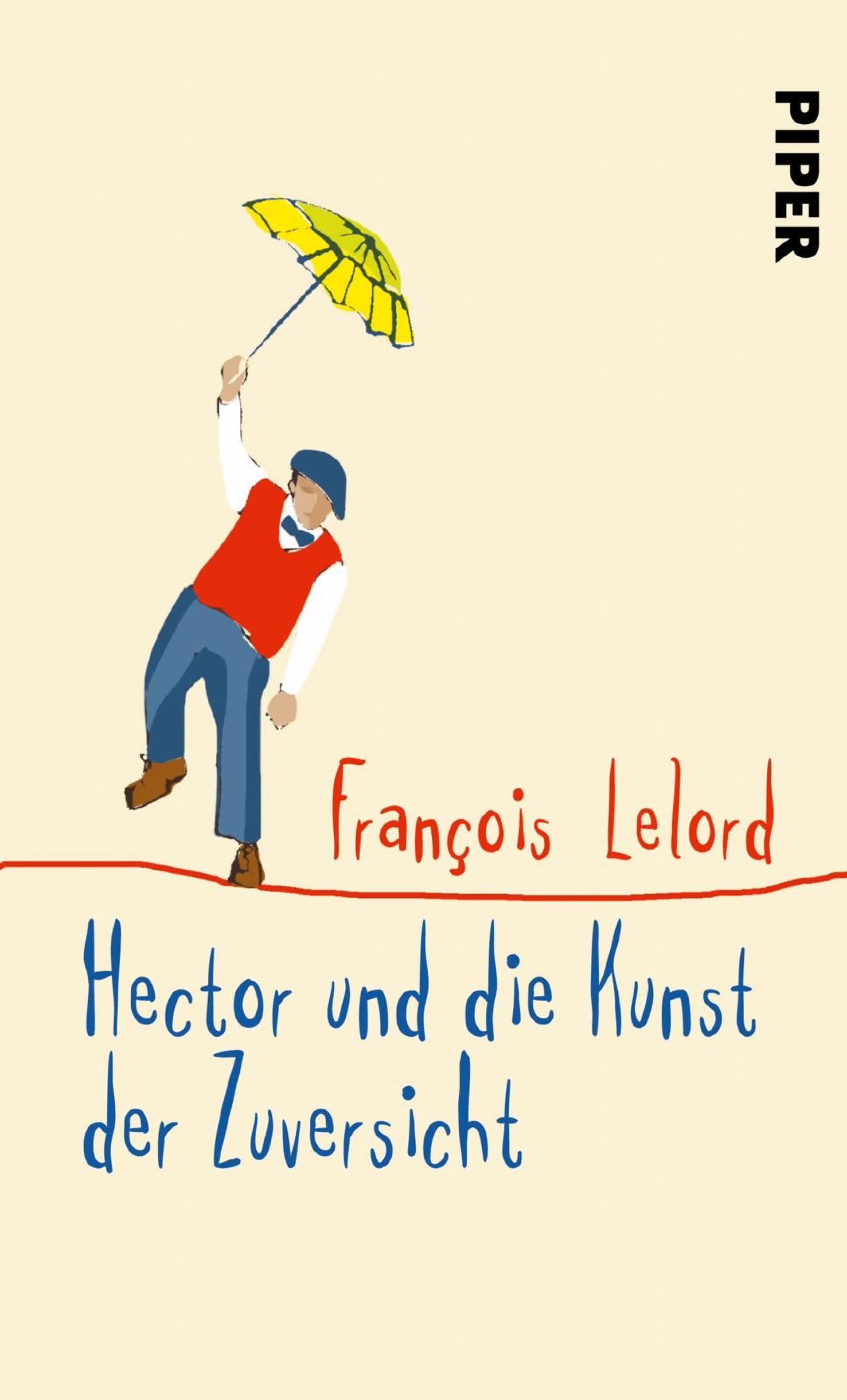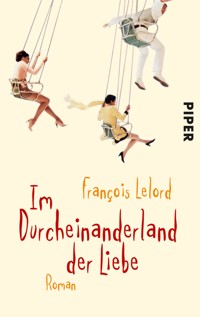10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hector ist ein ziemlich guter Psychiater in Paris. Oft kommen Menschen in seine Praxis, weil sie keine Freunde mehr haben. Was ist bloß aus der Freundschaft geworden, fragt Hector sich gerade, als er erfährt, dass sein allerbester Freund unvorstellbar viel Geld gestohlen haben soll. Und weil Hector nicht nur ein ziemlich guter Psychiater ist, sondern auch ein erstklassiger Freund, steckt er schon kurz darauf mittendrin in einem großen Abenteuer. Das führt ihn nicht nur durch zahlreiche Länder Südostasiens, sondern auch zu der Frage, was Freundschaft ihm eigentlich bedeutet – und warum sie für alle Menschen so überaus wichtig ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
François Lelord
Hector und das Wunder der Freundschaft
Aus dem Französischen von Ralf Pannowitsch
Impressum
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.deVollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 1. Auflage 2010 ISBN 978-3-492-95030-5 © Piper Verlag GmbH, München 2010 Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München Umschlagabbildung: © Simona Petrauskaite, Huglfing
Vorpann
Der Oberkörper des Leibdieners war in einen weißen Spencer gezwängt, seine Beine jedoch umhüllte ein traditionelles Seidengewand. Er gab ihr ein Zeichen, und die junge Frau trat in das Halbdunkel.
Am anderen Ende des Saales konnte sie die Umrisse einer Person erkennen, die unter einem Baldachin saß. Der Raum war fast leer, ganz nach den alten Gebräuchen, denn selbst bei den Königen hatten zum Sitzen, Essen und Schlafen stets Matten ausgereicht– bis die britischen Invasoren den Geschmack an Möbeln mitgebracht hatten.
Nachdem sie einige Schritte getan hatte, kniete sie auf dem Rosenholzboden nieder, denn sie wusste, dass es sich nicht schickte, wenn sie auf ihren Gastgeber herabschauen konnte. Er war zwar kein König, verfügte aber über genügend Macht, um diese Geste der Unterordnung einfordern zu können, und außerdem war er zu alt, um noch zu merken, dass die Welt sich wandelte.
Er machte ihr kein Zeichen, dass sie sich erheben durfte.
Sie grüßte ihn, indem sie die Hände faltete und den Kopf senkte.
»Und?«, fragte er.
Sein Gesicht konnte sie nicht erkennen, nur seine goldgerahmte Brille blitzte im Schein der einzigen, bei der Tür aufgehängten Lampe schwach auf. Es hieß, dass seine kranken Augen das Licht nicht mehr vertrugen.
»Wir arbeiten daran, mein Gebieter. Wir folgen der Spur des Geldes.«
Sie vernahm einen verächtlichen Seufzer. Dann fuhr sie fort: »Wir haben einen Informatiker von der Harvard University eingestellt, der auch für die amerikanische Regierung arbeitet.«
»Was soll das nützen? Dafür ist er zu clever.«
Die junge Frau verspürte Genugtuung. Auch sie hielt das für unnütz. Wer imstande war, einer Bank solche Summen zu stehlen, wusste auch, wie man die Spuren hinter sich verwischt.
»Ich verfolge aber noch einen anderen Weg, mein Gebieter.«
Er schwieg. Schließlich sprach sie weiter.
»Dieser Mann hat Freunde. Ich werde der Spur der Freunde folgen.«
Diesmal konnte sie sein Lächeln ausmachen, das ebenfalls golden aufblitzte.
»Freunde«, sagte er, »Freunde sind eine Schwäche.«
Sie dachte daran, wie viele seiner alten Freunde der General ins Gefängnis hatte werfen lassen, und sagte sich, dass ihm bestimmt kaum noch Schwächen blieben.
Außer seinem Alter natürlich und dem unbändigen Gefallen, den er an Gold fand.
Hector hat keine Zeit für seine Freunde
Ohne Freunde möchte niemand leben, auch wenn er alle übrigen Güter besäße.Aristoteles
Es war einmal ein junger Psychiater namens Hector, der keine Zeit mehr hatte, seine Freunde zu sehen.
Dass Hector keine Zeit für seine Freunde hatte, lag zunächst mal daran, dass er viel arbeitete und abends oft zu müde zum Ausgehen war. Außerdem war er inzwischen verheiratet und Vater eines kleinen Jungen, und da hat man nur noch selten die Gelegenheit, jemanden einfach so anzurufen und zu fragen: »Wollen wir nicht einen trinken gehen?« Ganz davon abgesehen, dass unglücklicherweise auch die meisten seiner Freunde verheiratet waren– und manchmal waren ihre Frauen bezüglich Männerabenden, die bis tief in die Nacht gingen, nicht so verständnisvoll wie seine wunderbare Clara.
Und außerdem war Hector noch eines aufgefallen: Je weiter man im Leben vorankommt, desto häufiger muss man zu Abendeinladungen mit Leuten gehen, die man nicht unbedingt zu seinen Freunden zählt. Solange man jung ist, kann man es so einrichten, dass man nur seine besten Freunde trifft und jede Menge Zeit mit ihnen verbringt– ein Glück, über das man sich übrigens genauso wenig im Klaren ist wie über das Glück, jung zu sein!
Hector hatte auch festgestellt, dass das Thema Freundschaft, das für ihn eine Quelle des Glücks war, vielen seiner Patienten Kummer bereitete.
So beispielsweise auch Julie. Julie war eine sympathische und aufgeschlossene junge Frau, die Freunde und vor allem Freundinnen hatte. Weshalb kam sie also zu Hector in die Sprechstunde? Julie war einfach ein bisschen zu sensibel. Sie war groß gewachsen und hatte einen rosigen Teint und kastanienbraunes Haar, auf ihrer Nase saßen ein paar Sommersprossen, ihre Augen hatten denselben Farbton wie die Haare, und sie sah immer melancholisch aus. Wie Hector fand, hätte Julie durchaus attraktiv sein können, aber sie wusste es nicht. Nicht nur, dass sie es vermied, sich zur Geltung zu bringen, sie versuchte sogar, den Blicken auszuweichen. (Es fing schon damit an, dass sie Komplexe wegen ihrer Sommersprossen hatte, obwohl Hector dachte, dass viele Männer die bestimmt reizend fanden.)
Bei der Arbeit bekleidete Julie eine Position, für die sie eigentlich zu kompetent war, denn sie hatte schon mehrere Gelegenheiten verpasst, sich im rechten Moment ins Spiel zu bringen, und überhaupt hätte es ihr schlaflose Nächte bereitet, anderen Menschen Anweisungen erteilen zu müssen. Weil sie aber so nett und oft auch witzig war, weil sie immer ein offenes Ohr hatte und stets bereit war zu helfen, hatte Julie Freunde und Freundinnen. Aber ganz so einfach war das für sie nicht.
»Ich stelle mir dauernd Fragen«, sagte sie zu Hector.
»Was für Fragen?«
»Das kommt auf die Freundin an. Bei manchen frage ich mich, ob die Freundschaft für sie genauso wichtig ist wie für mich.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Wenn zum Beispiel meistens ich anrufe, um etwas auszumachen, und nicht umgekehrt.«
»Haben Sie das überprüft? Und wenn es wirklich stimmen sollte: Könnte das nicht noch andere Gründe haben?«
»Einmal«, fuhr Julie fort, ohne Hectors Einwand zu beachten, »hatte ich den Eindruck, dass ich einer Freundin ziemlich nahestand, aber dann hat sie sich mit einer anderen Frau angefreundet, und die mag mich, glaube ich, nicht besonders. Und seitdem habe ich den Eindruck, dass wir uns nicht mehr so nahestehen.«
»Und das macht Ihnen Kummer?«
»Ja«, sagte Julie, und Hector sah, wie ihr die Tränen in die dunklen Augen stiegen.
Warum wurden manche Menschen mit einem Herzen geboren, das so zerbrechlich war wie ein Schmetterlingsflügel? Hector spürte, dass er Julie helfen musste, eine unbewusste Denkweise freizulegen, so etwas in der Art von »Wenn man mich nicht liebt, dann bin ich nichts wert«, aber wie Sie schon ahnen werden, lassen sich solche unbewussten, tief sitzenden Gedanken und die Emotionen, die mit ihnen verbunden sind, nicht einfach mit dem Finger wegschnipsen.
Andere Leute, die in Hectors Sprechstunde kamen, hatten keine Freunde, weil sie ganz einfach unausstehlich waren– eine Persönlichkeitsstörung hatten, wie die Psychiater das nennen, denn sie wollen sich höflich ausdrücken. Diese Leute gingen sogar Hector auf die Nerven, der es doch schon mit ganz anderen Kalibern zu tun gehabt hatte. Das Amüsante daran war (oder das Traurige, wenn Sie so wollen), dass diese Leute, die ihre Mitmenschen oft ziemlich schlecht behandelten, trotzdem Freunde haben wollten, und zwar echte Freunde.
Ein Gegenpol zu Julie war beispielsweise die Lady. Hector war ihr zum ersten Mal begegnet, nachdem sie schon etliche seiner Psychiaterkollegen an verschiedenen Enden der Welt zur Erschöpfung gebracht hatte. Die Lady reiste viel umher, sie sang in allen großen Hauptstädten der Welt in Fußballstadien voller zu Tränen gerührter Fans und war auf allen Musiksendern zu sehen– mal im Lederkorsett, mal im Ballkleid für Debütantinnen. Die Lady war mal blond, mal braun; sie war Jungfrau gewesen, dann verruchter Vamp, dann von Neuem Jungfrau, die Lady trank zu viel. Sie hatte Drogen genommen und nahm wahrscheinlich immer noch Drogen (was sie Hector verschwieg), sie schluckte zu viel Schlafmittel (womit sie vor Hector angab), sie verließ ihre Liebhaber, wenn sie sie schlugen– und irgendwann taten sie es alle–, die Lady machte eine Entziehungskur, sie sagte ihre Konzerte ab, sie ließ ihrem Agenten und dem Chef der Plattenfirma graue Haare wachsen, heimste aber weiter reichlich Preise und Goldene Schallplatten ein. Vergangenes Jahr hatte sie ihre erste Filmrolle gehabt, und als Schauspielerin hatte man sie noch berührender gefunden; in letzter Zeit aber kam sie häufiger zu Hector in die Sprechstunde, denn die Aussicht auf die in Asien bevorstehenden Dreharbeiten machte ihr Angst. Der erste Film war für die Produzenten ein Albtraum gewesen, da es der Lady so unglaublich schwerfiel, zu einer festen Uhrzeit aufzuwachen. Die Lady war wirklich sehr anstrengend, am meisten wohl für sich selbst.
Aber an jenem Tag in Hectors Sprechzimmer war sie ganz ruhig, mit einem blassen, hinter einer schwarzen Sonnenbrille verborgenen Gesicht, und ihr zierlicher und unverwüstlicher Körper war in einen großen Regenmantel gehüllt, den sie nicht ausgezogen hatte. Durchs Fenster konnte Hector ihren imposanten schwarzen Schlitten warten sehen: Der Fahrer saß hinterm Lenkrad, und der Leibwächter rauchte auf dem Gehweg eine Zigarette.
»Wie geht es Ihnen?«, fragte Hector.
»Ach wissen Sie, das kommt ganz auf den Moment an…«
Hector wusste das und warf der Lady seinen mitfühlenden Blick Nr. 2 zu– den, derIch weiß sehr gut, was Sie empfinden und wie sehr Sie leiden; Sie können mir alles erzählenausdrücken sollte.
»Ich fühle mich immer gut, wenn ich zu Ihnen komme.«
»Das freut mich«, sagte Hector, »und wir werden versuchen zu erreichen, dass das gute Gefühl länger anhält.«
Dabei musste er an seine erste Begegnung mit der Lady denken. Sie war nach einem Selbstmordversuch in eine Klinik für reiche Leute eingeliefert worden, und man hatte Hector nur herbeigerufen, weil der Kollege, der sich gewöhnlich um die Lady kümmerte, gerade nicht erreichbar gewesen war. Sie war außerordentlich aufgewühlt gewesen, und als Hector das Zimmer betrat, um sich ihr vorzustellen, hatte sie ihm ihr Frühstückstablett ins Gesicht geschleudert.
»Gute Beziehungen beginnen häufig mit einem Konflikt«, hatte er gedacht, als er die Lady dann mithilfe eines Pflegers aufs Bett drückte und eine Krankenschwester ihr ein Beruhigungsmittel spritzte. Und tatsächlich konnten sie danach miteinander reden, und anschließend hatte die Lady den Wunsch geäußert, weiterhin zu Hector zu gehen.
Das hatte Hector ein gewisses Gefühl der Befriedigung verschafft, aber zur gleichen Zeit hatte er sich vor diesem Gefühl in Acht genommen, denn wenn man sich von der Berühmtheit seiner Patienten beeindrucken lässt, ist man schon auf dem besten Wege, kein guter Arzt mehr für sie zu sein, und falls sie sich irgendwann umbringen, wird man schlimme Schuldgefühle haben. So war es bei dem Psychiater von Marilyn Monroe gewesen, und von der Persönlichkeit her erinnerte die Lady Hector manchmal tatsächlich an Marilyn.
»Mein Leben kommt mir so leer vor«, sagte die Lady.
»Was möchten Sie damit sagen?«
»Nichts… ich meine, diese Konzerte, dieses Umherreisen, diese Aufnahmen… das ist doch immer dasselbe.«
»Auch in dem Augenblick, in dem Sie singen?«
»Nein, natürlich nicht, da spüre ich etwas.«
»Also ist Ihr Leben nicht ganz und gar leer.«
»Nein, nicht das ganze. Aber ich habe das Gefühl, dass niemand mich liebt… Es gibt in meinem Leben keine Liebe!«, resümierte sie und runzelte dabei die Stirn, als wäre ihr das eben erst klar geworden.
Hector musste nun gleich zwei Dinge verhindern: dass die Lady in Zorn geriet und dass sie ihre selbstzerstörerischen Phrasen ewig wiederholte.»Gibt es denn niemanden, der Sie mag?«
»Meine Fans, meinen Sie?«
»Ja, aber nicht nur die.«
»Freunde, meinen Sie«, sagte die Lady und stieß ein leises verächtliches Lachen aus.
Hector sagte sich, dass er sich gerade auf heikles Terrain manövriert hatte: Für die Lady war es sehr schwer herauszufinden, ob sie Freunde hatte. Sie war dermaßen reich und berühmt, dass es um sie herum immer eine Schar von Leuten gab, die sich Freunde nannten. Und was die betraf, die wirklich ihre Freunde hätten sein können– wie sollten die mit jemandem befreundet bleiben, dessen Stimmungen so schnell umschlugen wie das Wetter im April?
»Im Grunde benutze ich die anderen«, sagte die Lady, »und die anderen benutzen mich. C’est la vie.«
Die Lady hatte als Kind nicht viel Liebe bekommen, und so fiel es ihr im Erwachsenenleben schwer, Liebe zu finden, denn wie Sie wissen, lernt man das Lieben zunächst einmal bei seiner Mama oder seinem Papa oder besser noch bei beiden. Die Lady benutzte die anderen tatsächlich, aber gleichzeitig hätte sie gern die wahre Liebe kennengelernt und nicht bloß dieses kurze Aufblitzen von Liebe für die Menschenmenge ihrer Fans oder für Liebhaber, die am Ende zuschlugen, wie es auch manche ihrer vielen Stiefväter getan hatten. Ihre Geschichte war sehr stimmig, aber deswegen noch längst nicht leicht zu entwirren. Hector fühlte sich von der Lady häufig überfordert, beruhigte sich allerdings wieder, wenn er an all seine Kollegen dachte, die sie hatte fallen lassen– manche von ihnen waren älter und erfahrener gewesen als er. Wenn sie es alle nicht eben toll hinbekommen hatten, brauchte auch er sich nicht dauernd vorzuwerfen, dass er sich seiner Aufgabe nicht gewachsen fühlte.
Und dann sagte die Lady genau das, was er befürchtet hatte: »Und im Übrigen– auch Sie benutzen mich nur!«
Hector sagte sich, dass er das mit seinem mitfühlenden Blick Nr. 2 provoziert hatte und dass so etwas in ihrem Leben immer wieder vorkam– sobald jemand zeigte, dass er sich ihr nahe fühlte (was sie sich ja auch wünschte), konnte sie nicht anders, als ihn zu verabscheuen. Das war schönes Material für die Sitzung, sofern die Lady nicht mittendrin in die Luft gehen würde.
»Gerade eben haben Sie noch anders darüber gedacht«, sagte er. »Sie haben mir gesagt, dass Sie sich gut fühlen, wenn Sie in meine Sprechstunde kommen. Wie kommt es, dass Sie Ihre Meinung geändert haben?«
Als die Lady entschwunden war, hatte Hector das Bedürfnis, sich ein wenig zu entspannen, und er ging in die Küche der Praxis, um einen Kaffee zu trinken.
Keine Freunde zu haben, war ganz sicher ein Fluch und ein Anzeichen dafür, dass etwas nicht richtig lief. Deshalb träumten alle Menschen davon, Freunde zu haben– zunächst einmal, weil sie sich geliebt fühlen wollten, aber auch, um zu spüren, dass sie normal waren. Schon die Kinder malen sich imaginäre Freunde aus, um diesen Hunger nach Freundschaft zu stillen, der in jedem von uns steckt.
Die Lady würde auf jeden Fall erst einmal für ein paar Wochen bei ihren Dreharbeiten in Südostasien sein, wo sie die Rolle einer Missionsschwester spielen sollte, die im vergangenen Jahrhundert bei einer ethnischen Minderheit in den Bergen tätig gewesen war. Hector fragte sich, ob der Rollenwechsel, zu dem die Lady durch ihren Beruf gezwungen wurde, ihre Persönlichkeit letztendlich ganz und gar durcheinanderbringen würde oder sie im Gegenteil stabilisieren könnte.
Hector schwor sich, niemals den Fehler des Psychiaters von Marilyn Monroe zu machen– der hatte seiner illustren Patientin auch Ratschläge fürs Berufsleben erteilen wollen. Wenn die Lady doch nur ein paar richtige Freunde hätte, dachte er; es hätte ihm bei seiner Arbeit mit ihr helfen können.
Schon seit geraumer Zeit bat er seine Patienten stets, ihm ihre Freunde zu beschreiben, und wenn sie kaum welche hatten, machte er sich darauf gefasst, dass seine Arbeit ganz besonders schwierig werden würde. Für Leute, die gerade mitten im Leiden steckten, waren Freunde so etwas wie ein Sicherheitsnetz, ein Rettungskommando, ein Obdach im Orkan, und als Psychiater war man froh zu wissen, dass sie da waren, wenn der Patient das Sprechzimmer verließ.
Freundschaften bedeuten Gesundheit, dachte er bei seinem Kaffee nach dem Abgang der Lady. Aber, Moment mal, konnte das nicht der Beginn einer kleinen Reflexion über die Freundschaft sein? Er schlug ein neues Notizbüchlein auf und schrieb auf die erste Seite:
Beobachtung Nr. 1: Deine Freundschaften sind deine Gesundheit.
Das funktionierte in beide Richtungen: Freunde helfen uns, bei guter Gesundheit zu bleiben– das hatten viele höchst seriöse Studien nachgewiesen–, aber umgekehrt zeugt die Fähigkeit, Freunde zu gewinnen und zu behalten, auch von einer guten Gesundheit. (Wenn Hector von Gesundheit spricht, meint er vor allem die geistige Gesundheit, schließlich ist er ja Psychiater, vergessen wir das nicht.)
Hector hört zu
Allerdings wohnte der Wunsch, Freunde zu haben, vielleicht nicht in jedem von uns, dachte Hector, als er Karine zuhörte, der nächsten Patientin: Sie schien ziemlich froh darüber zu sein, im Leben allein dazustehen.
Karine war eine Forscherin auf dem Gebiet der Mathematik, und sie forschte zu einem Thema, bei dem Hector nicht einmal verstand, worum es eigentlich ging. Am Ende hatte er aber so halbwegs mitbekommen, dass es mit Zahlen und mit Gesetzen zu tun hatte und mit solchen Fragen wie »Kann man jede gerade Zahl, die größer ist als 2, als Summe zweier Primzahlen schreiben?«. Karine hatte ihr Mathematikstudium mit den bestmöglichen Noten abgeschlossen, und danach hatte sie ein paar Forschungsaufenthalte an den besten Universitäten gemacht. Jetzt hatte sie eine Stelle als Forscherin und musste hin und wieder zu anderen Forschern sprechen, aber nicht so oft. Ihre Chefs hatten sie von allen Sitzungen befreit, und Hector konnte gut verstehen, warum, wenn er Karine zuhörte, wie sie mit monotoner Stimme jeden Gesprächsgegenstand bis zum letzten Zipfel durchkaute.
Hector hatte begriffen, dass Karine ein sehr schlichtes Leben führte, das sich zwischen ihrer kleinen Wohnung und ihrem Büro an der Universität abspielte. Als er sie gebeten hatte, über ihre Freunde zu sprechen, hatte er erfahren, dass sie eigentlich nur eine einzige Freundin besaß– eine Treppenhausnachbarin, die Ordensschwester war und mit der sie von Zeit zu Zeit eine Tasse Tee trank und über Aristoteles und den heiligen Thomas von Aquin sprach, denn das waren Themen, die Karine über die Mathematik hinaus auch noch interessierten. Hector erinnerte sich, dass Aristoteles etwas über die Freundschaft geschrieben hatte, aber die beiden Freundinnen diskutierten nicht nur über diesen Teil seines Werkes, sondern auch, wie Karine ihm erklärt hatte, über den Versuch des heiligen Thomas von Aquin, die christliche Doktrin mit der aristotelischen Philosophie zu versöhnen. Die Ordensschwester stand eher aufseiten des heiligen Thomas von Aquin, was ja auch nicht weiter erstaunlich war, während Karine Aristoteles den Rücken stärkte, was zu Gesprächen führte, die äußerst interessant waren, zumindest für die beiden Frauen. Karine hatte gesagt, dass sie noch andere Freunde hatte, aber Hector hatte schnell begriffen, dass es sich nur um Personen handelte, die sie noch nie zu Gesicht bekommen hatte, denn sie stellten sich im Internet gegenseitig mathematische Rätsel.
Übrigens war Karine auch nicht in seine Sprechstunde gekommen, weil es ihr an Freunden mangelte oder an Liebe, sondern weil sich ein Forscherkollege für sie zu interessieren begonnen hatte. Er schlug ihr vor, zusammen Kaffee zu trinken oder ins Kino zu gehen, und das stresste sie beträchtlich.
»Aber würde es Ihnen Freude machen, ihn näher kennenzulernen?«, fragte Hector.
»Ich fühle mich auch ohne das sehr gut«, antwortete Karine mit ihrer leicht roboterhaften Stimme.
Man muss dazu sagen, dass Karine trotz ihres verunglückten Haarschnitts (den die fromme Schwester ihr verpasst hatte) und trotz ihrer Jungskleidung einen gewissen Charme hatte; mit ihrem schönen blauen Blick, der ein wenig leer, aber schrecklich intelligent war, hätte sie eine ziemlich reizende Androidin abgeben können. Aber wie auch immer– Karine ging es gut, wenn sie allein war oder wenn sie über abstrakte Dinge diskutieren konnte.
Eines Tages hatte Hector sie gefragt, wie sie sich fühlte, wenn sie gelegentlich doch zu der einen oder anderen Zusammenkunft gehen musste, zu einem kleinen Empfang im Institut beispielsweise oder zum Abendessen auf einen Mathematikerkongress.
»Wie fühlen Sie sich dann, so inmitten der anderen?«
Karine hatte einen Moment überlegt und dann gesagt: »Ich habe eher den Eindruck, dass die anderen mitten in mir sind.«
Und Hector hatte sich gesagt, dass sie beide noch einen weiten Weg würden zurücklegen müssen, damit Karine besser verstand, was sie auszuprobieren bereit war und was nicht. Dass Karine in Hectors Sprechstunde gekommen war, statt ihrem Kollegen einfach die Tür vor der Nase zuzuschlagen (wie sie es sonst zu tun pflegte), mochte vielleicht schon etwas heißen, aber Hector dachte, dass es auch für Karines Kollegen ein weiter Weg sein würde und dass er nicht unbedingt zu dem Ziel führen musste, das er sich erhoffte.
Dann empfing Hector in seiner Sprechstunde mit Roger noch einen Patienten, der nicht eben viele Freunde hatte. Aber in gewisser Weise brauchte Roger die auch nicht wirklich, denn er hatte eine direkte Leitung zum lieben Gott, und welch besseren Freund hätte man sich schon wünschen können? Roger hatte gute Gründe für seine Annahme, zwischen Gott und ihm gebe es ein besonderes Verhältnis: Er hörte, wie Gott zu ihm sprach, und also antwortete er ihm auch, und Gott wiederum hatte darauf immer etwas extrem Intelligentes zu entgegnen, und das war ja wohl ein guter Beweis dafür, dass es sich tatsächlich um Gott handelte.
Roger kam schon seit Jahren zu ihm, und Hector freute sich jedes Mal, ihn zu sehen: Er mochte Rogers Holzfällerstatur, seine buschigen Augenbrauen, die stets ein wenig gerunzelte Stirn und seine Art, die Augen zuzukneifen, wenn er über Gott sprach. Rogers Hauptproblem war, dass er mit den anderen Leuten ein bisschen zu viel über Gott sprach und vor allem, dass er schnell ärgerlich wurde, wenn sie nicht an seine persönliche Beziehung zu unserem Herrn glaubten– oder schlimmer noch, wenn sie ihm sagten, dass es Gott sowieso nicht gebe, oder wenn sie sich über Roger lustig zu machen begannen. Das kam zwangsläufig schlecht bei ihm an, und schon mehrmals hatten sich alle Beteiligten hinterher im Krankenhaus wiedergefunden. Wer Roger widersprochen hatte, landete im normalen Krankenhaus und Roger selbst in der Psychiatrie, wo man ihm solche Massen an Medikamenten verabreichte, dass es ihm immer weniger gelang, Gottes Wort zu vernehmen, noch nicht einmal dann, wenn er seine Ohren ganz doll spitzte, und dabei hatte er wirklich große und auch ein bisschen haarige Ohren.
Nach und nach hatte Hector ihm klarmachen können, dass er von diesen kleinen Gesprächen mit Gott nicht aller Welt zu erzählen brauchte, dass die Sache vielmehr unter Gott, Roger und Hector bleiben konnte und vielleicht noch unter ein paar wohlwollenden Leuten, die bereitwillig mit ihm darüber redeten. Zu denen zählte beispielsweise Rogers Gemeindepfarrer, der Hector bisweilen anrief, wenn er fand, dass Roger gerade wieder ein bisschen zu sehr in Wallung geriet.
»Roger«, hatte ihm Hector oft gesagt, »im Leben gibt es Kämpfe, die man besser nicht ausficht.« Im Laufe der Jahre hatte Roger auch eingesehen, dass man sich nicht vor aller Welt mit Gott schmücken sollte, und irgendwann hatte er zu Hector gesagt: »Sie beraten mich wie ein wahrer Freund, Doktor.«
An diesem Tag war Roger ausgeglichen, und Hector fragte ihn, ob im Moment alles glatt laufe in seinem Leben.
»Ja, es läuft alles gut. Der Herr ist mein Hirte.«
»Haben Sie in letzter Zeit gute Gespräche geführt?«
»Ja, mit dem Pfarrer. Und auch mit anderen Leuten aus der Gemeinde. Sie spenden mir Licht in diesem Jammertal…« Und bei diesen Worten verfiel Roger in einen leichten Singsang.
»Haben Sie in der Pfarrgemeinde Freunde gefunden?«
Roger musste ein paar Augenblicke lang nachdenken. »Wissen Sie, Doktor, ich glaube, ich habe keine Freunde. Leute, die nett zu mir sind– das ja, aber Freunde… nein.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Ich empfange mehr, als ich gebe.«
»Ähm… Vielleicht geben Sie ja mehr, als Sie denken«, meinte Hector und dachte dabei, dass er selbst schon ein Beweis dafür war– Roger verschaffte ihm das Gefühl, nützlich zu sein, und half ihm damit, in diesem ziemlich schweren Beruf durchzuhalten.
»Mag sein«, sagte Roger. »Auf jeden Fall stehe ich voll und ganz in der Freundschaft Gottes, und die ist ohne alle Grenzen. In der Freundschaft Gottes, der die Niedrigen erhöht und den Betrübten emporhilft…«
Und dann begann RogerDer Herr ist mein Hirtezu summen, und die Konsultation war zu Ende. Hector fragte sich, ob er ihn vielleicht dazu ermuntern sollte, sich einem Chor anzuschließen. Dann dachte er an die vier Personen, die er heute in seinem Sprechzimmer empfangen hatte, an Julie, die Lady, Karine und Roger. Er sagte sich, dass er selbst wirklich von Glück reden konnte, Freunde zu haben. Schade nur, dass er sie nicht häufiger sah.
Weil ein Patient seinen Termin abgesagt hatte, schickte sich Hector an, in der Küche noch einen Kaffee zu trinken und dabei die Zeitung zu lesen. Aber da klingelte das Telefon, und die Sprechstundenhilfe teilte ihm mit, dass sie den frei gewordenen Termin einer anderen Patientin gegeben hatte: »Sie hat erst gestern angerufen, aber sie meinte, es sei sehr dringend, und da habe ich sie vorgezogen.« Und schon war es um das Kaffeetrinken und Zeitungslesen geschehen! Hector hatte das gleiche Gefühl wie damals in der Schule, wenn ein Lehrer nicht kam und alle sich schon sagten: »Ah, prima, er ist krank, die Stunde fällt aus!«– aber Mist hoch drei, plötzlich tauchte er doch noch auf!
Hector bekommt Besuch
»Eigentlich bin ich nicht als Patientin zu Ihnen gekommen«, sagte Leutnant Ardanarinja in perfektem Englisch und mit strahlendem Lächeln, »das muss ein Missverständnis mit Ihrer Sprechstundenhilfe gewesen sein.«
Während sie sprach, passte Hector gut auf, dass er nicht in das idiotische Grinsen verfiel, das man oft bei Männern sieht, die sich einer sehr verführerischen Frau gegenüberfinden. Leutnant Ardanarinja trug ein strenges marineblaues Kostüm, das ihre Kurven diskret zur Geltung brachte und den Blick auf die langen und schlanken Beine einer Frau freigab, die wahrscheinlich regelmäßig lief– manchmal vielleicht in jenen eleganten Ballerinas mit flachem Absatz, die sich auch für einen Polizeieinsatz eignen mussten. Sie war unbestreitbar eine Asiatin und hatte jenen karamellfarbenen Teint, den man in den Ländern südlich von China so oft antrifft. Ihre Haare waren zu einem schlichten Pferdeschwanz zusammengebunden, und auf ihrem Gesicht war kein Make-up auszumachen.
Leutnant Ardanarinja hatte Hector einen Plastikausweis von Interpol gezeigt, und auf dem Ausweisfoto lächelte sie nicht. Sie wollte mit Hector über Édouard reden, der sein Freund und sogar sein allerbester Kumpel war. »Haben Sie ihn in letzter Zeit gesehen?«
»Ist das eine offizielle Befragung?«
Leutnant Ardanarinja lächelte: »Im Grunde ja. Wir haben gedacht, dass es schneller und praktischer wäre, zu Ihnen in die Praxis zu kommen, als Sie in unsere Büros zu bestellen. Wir haben gedacht, es wäre vielleicht nicht notwendig…«
Hector begriff, dass es notwendig werden könnte, falls er sich nicht kooperativ verhielt. Wie weit musste man gehen, um einem Freund zu helfen? War man verpflichtet, Termine abzusagen oder sich gar in Polizeigewahrsam nehmen zu lassen? Allerdings wusste Hector über Édouard sowieso nichts, was versteckt zu werden verdiente.
»Hören Sie, das letzte Mal habe ich Édouard in einem Kloster nicht weit von Tibet gesehen. Damals wollte er sich dorthin zurückziehen.«
»Darüber sind wir auf dem Laufenden.«
»Später hat er das Kloster verlassen und wieder für eine Bank zu arbeiten begonnen. Aber wir haben uns seither nicht gesehen, sondern nur ein paar E-Mails ausgetauscht.«
»Könnten Sie diese E-Mails an mich weiterleiten?«
»Ich weiß nicht…Verstehen Sie, es sind persönliche Nachrichten. Es geht darin viel um sein Lieblingsthema, die Frauen…« Und bei diesen Worten lächelte Hector Leutnant Ardanarinja zum ersten Mal an.
»Ich glaube nicht, dass mich das erschrecken kann«, entgegnete sie und lächelte ihrerseits.
»Vielleicht sagen Sie mir erst einmal, weshalb Sie sich überhaupt für meinen Freund Édouard interessieren?«
Leutnant Ardanarinja setzte mit einer anmutigen Bewegung die Füße wieder unter den Stuhl. Ihr perfektes Englisch hatte sie wahrscheinlich an einer guten britischen Universität gelernt, an der sie vielleicht gleichzeitig auch Benimmkurse besucht hatte.
»Eigentlich sollte ich Ihnen das nicht sagen«, meinte sie.
»Ach so? Und ich, sollte ich ohne meinen Anwalt mit Ihnen sprechen?«
Leutnant Ardanarinja lächelte, als hätte Hector etwas ganz besonders Witziges gesagt.
»Wenn wir Sie vorladen würden, könnten Sie natürlich die Anwesenheit eines Rechtsanwalts verlangen… jedenfalls nach vierundzwanzig Stunden…«
Schöner hätte man es nicht sagen können, dachte Hector.
»… aber im Geiste des gegenseitigen Einvernehmens und vor allem, um die Prozedur abzukürzen, werde ich es Ihnen trotzdem sagen.«
Währenddessen hatte Hector sich die ganze Zeit gefragt, weshalb sich Interpol für seinen alten Freund interessieren könnte. Ja, Édouard war immer ein bisschen extrem gewesen, er hatte so seine Schwächen– er trank gerne guten Wein, liebte es, die Frauen zum Lachen zu bringen, er hatte einen unstillbaren Hunger auf Neues in allen Bereichen, und seine Intelligenz war ebenso beeindruckend wie seine Sprachbegabung, die er vor allem nach Einbruch der Dunkelheit einsetzte. Aber in alledem sah Hector nichts, was aus Édouard einen Fall für die Justiz hätte machen können, Édouard mit seiner Großzügigkeit, seiner lustigen Art, seinen schönen rosigen Wangen und seinem etwas kindlichen Blick– alles Dinge, die seit Schulzeiten unverändert an ihm waren. Was also konnte er angestellt haben, um zum Tatverdächtigen zu werden?
»Ihr Kumpel hat einen tüchtigen Batzen Kohle geklaut«, sagte Leutnant Ardanarinja, die offensichtlich auf mehreren Stilebenen zu Hause war.
Hector fuhr zusammen. Er hatte die vage Vorahnung, dass seineBeobachtung Nr.1–Deine Freundschaften sind deine Gesundheit– für ihn künftig nicht mehr so ganz zutreffen könnte.
Hector gerät aufs Glatteis
Hector musste daran denken, wie Édouard ihm eines Tages in einem Café in Hongkong die Telefonnummer einer Frau gegeben hatte, in die sich Hector verliebt hatte, ohne dass er es sich hatte eingestehen wollen. Danach war Édouard in sein Büro zurückgekehrt, um sich weiter jenem Dollarmillionenbetrag anzunähern, den er auf seinem Konto anhäufen wollte, um nie mehr arbeiten zu müssen.
Hector musste auch daran denken, wie Édouard ihn in der Polarnacht eines der letzten traditionellen Eskimodörfer begrüßt hatte. Er lebte dort seit einigen Monaten, um den Eskimos beizubringen, wie man Handel betreibt, ohne sich ausbeuten zu lassen. Auch ohne die geplanten Dollarmillionen hatte er aufgehört, den Reichen zu dienen, denn nun wollte er den Armen helfen, ein bisschen weniger arm zu sein.
Hector musste daran denken, wie Édouard ihm vor der Kulisse der höchsten Berge der Welt gesagt hatte, dass er nicht mit ihm zurückkehre, sondern in diesem abgeschiedenen Kloster bleiben wolle, um den Sinn des Lebens und die Worte des Buddha besser zu begreifen.
All das passte nicht zu einem Édouard, der drei Millionen stahl– wie Hector zuerst verstanden hatte–, aber nein, es ging sogar um dreihundert Millionen Dollar, wie ihm Leutnant Ardanarinja eben erklärte, wobei sie ihre reizenden Brauen missbilligend hob.
»Nach der Zeit in Tibet hat Ihr Freund, wie Sie wissen, wieder bei einer Bank gearbeitet.«
»Bei einer asiatischen Bank, nicht wahr?«
»Nein, er war für die Zweigstelle einer ausländischen Bank tätig.«
Und sie nannte Hector den Namen der Bank, deren Hauptsitz sich auf einer jener berühmten fernen Inseln befand, bei denen man sowohl an Kokospalmen am Lagunenstrand als auch an friedlich schlummerndes Geld denkt. Ein Steuerparadies, wie manche seiner Patienten sagten, ehe sie mit betrübter Miene hinzufügten, dass es immer schwieriger werde, wirklich sichere zu finden. Hectors Mitleid hielt sich in Grenzen, aber in der Psychiatrie und in der Medizin überhaupt ist es ja so, dass man einen Eid geschworen hat, alle Patienten nach besten Kräften zu behandeln, selbst die, die einem mächtig auf die Nerven gehen.
»Stehlen…«, sagte Hector, »das sieht Édouard ganz und gar nicht ähnlich.«
»Wissen Sie, so etwas bekomme ich in meinem Beruf sehr oft zu hören.Das sieht ihm gar nicht ähnlich…Glauben Sie, dass die Menschen immer täten, was ihnen ähnlich sähe?«
»Im Allgemeinen schon.«
»Aber schauen Sie sich doch mal Ihren Freund an: Er war lange Zeit Banker und Lebemann, wurde dann zum Menschenrechtsaktivisten bei den Eskimos und schließlich buddhistischer Mönch. Übrigens scheint er sich in dieser letzten Rolle hervorragend gemacht zu haben, die anderen Mönche schätzten ihn sehr. Passt das alles vielleicht zusammen?«
Hector sagte sich, dass Leutnant Ardanarinja schon verdammt gut informiert war über Édouard. »Ja, in gewisser Weise passt das schon zusammen. In allen drei Rollen lässt sich dieselbe Persönlichkeit wiederfinden. Aber nirgendwo sehe ich Hinweise darauf, dass aus ihm ein Dieb werden könnte. Er verfolgt seine Interessen, und ich glaube, dass er in Geschäftsdingen knallhart sein kann, aber solange ich ihn kenne, hatte er auch immer ein Gewissen.«
»Manchmal kommt den Leuten das Gewissen abhanden…«
Hector spürte, dass in Leutnant Ardanarinjas Stimme eine Spur Gefühl lag, eine winzige Spur nur. Vielleicht hätte er es unter anderen Umständen gar nicht bemerkt, aber wenn er so in seinem Psychiatersessel saß, weckte das in ihm Sinne, über die er im Alltagsleben nicht immer verfügte. Es hatte ganz so geklungen, als wäre es für sie eine traurige Erinnerung, dass eine bestimmte Person ihr Gewissen verloren hatte. Vielleicht hatte es damit zu tun, dass diese brillante junge Frau zur Polizei gegangen war.
»Und bei Ihnen beispielsweise, passte es zu Ihrer Persönlichkeit, dass Sie sich für die polizeiliche Laufbahn entschieden haben?«
Leutnant Ardanarinja musste lachen: »Also wirklich, ich glaube, mit den Psychiatern ist es wie mit den Polizisten– der Beruf lässt einen niemals los.«
Hector verkniff es sich, ihr zu sagen, dass er selbst schon ein wenig für die Polizei gearbeitet hatte. So wie die Dinge lagen, wollte er zu Leutnant Ardanarinja keine Bindung aufbauen; sie würde es sicher ausnutzen, um an Édouard heranzukommen, und das wollte er selbstverständlich verhindern.
»Ich würde Ihnen gern helfen«, sagte Hector, »aber die letzte E-Mail, die ich ihm geschickt habe, ist wieder zurückgekommen. Die Mail-Adresse gab es nicht mehr. Ich habe auch versucht, ihn anzurufen, aber die Nummer war nicht mehr gültig. Sie können diese Dinge überprüfen, nehme ich an.«
»In der Tat haben wir sie bereits überprüft.«
»Ist das denn legal?«
»Dies ist ein informelles Gespräch, und ich habe Ihnen natürlich nichts gesagt. Ich möchte es uns und Ihnen doch bloß einfacher machen. Ich wollte lediglich wissen, ob Sie seitdem irgendwie Kontakt zu Ihrem Freund hatten, irgendwelche Neuigkeiten von ihm.«
»Nein, nichts, kein Lebenszeichen.«
»Wirklich nicht?«
»Ich versichere es Ihnen«, sagte Hector.
Leutnant Ardanarinja schwieg einen Augenblick.
»Ich glaube Ihnen fast, dass Sie die Wahrheit sagen… und doch, ich weiß selbst nicht, warum, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich mich täusche.«
»Dafür kann ich nichts.«
»Ich glaube, dass Sie dank Ihrem Beruf Ihre nonverbalen Botschaften gut unter Kontrolle haben. Hätte ich Sie auf Video aufgenommen und den Film dann in Zeitlupe ablaufen lassen, dann hätte ich vielleicht etwas erkennen können…«
»Na, dann machen Sie es doch«, sagte Hector.
»Nein, das würde nichts bringen. Sie haben beschlossen, Ihren Freund Édouard zu beschützen, und sehen nicht den geringsten Anlass, uns mehr zu verraten.«
»Aber mehr könnte ich Ihnen auch gar nicht verraten…«
Leutnant Ardanarinja schien zu überlegen. Würde sie Hector zu dieser so interessanten Videoaufzeichnung tatsächlich einbestellen? Er fragte sich schon, ob er diese Prüfung mit Erfolg bestehen würde.
»Und eine Idee?«
»Pardon?«
»Haben Sie eine Idee, was Ihren Freund betrifft? Warum könnte er so etwas getan haben? Sie kennen ihn doch seit Jahren.«
»Und Sie sind vollkommen sicher, dass er es gewesen ist?«
»Ich kann Ihnen keine Einzelheiten nennen, aber er war ohne jeden Zweifel der Dieb. Ihr Freund ist ein bemerkenswerter Gauner. Es fällt schwer zu glauben, dass er zum ersten Mal…«
»Vielleicht, weil er jemandem helfen wollte«, sagte Hector plötzlich.
Sofort bereute er seine Worte. Er hatte Édouard verteidigen wollen, aber zu spät gemerkt, dass er Leutnant Ardanarinja damit womöglich auf eine Spur brachte.
»Sein Gewissen, nicht wahr?«
»Ja«, meinte Hector, »oder… ich weiß doch auch nicht.«
»Eine interessante Idee.«
»Ich habe es nur so dahingesagt…«
»Jetzt würden Sie den Videotest nicht bestehen«, sagte Leutnant Ardanarinja und lächelte. »Vielen Dank, Doktor, vielen Dank für Ihre Hilfsbereitschaft.«
Und dann ging sie hüftschwingend und immer noch lächelnd auf ihren flachen Absätzen von dannen und ließ Hector ziemlich unzufrieden mit sich selbst zurück.
Hector und die Big Five
Hector versuchte sich auf die nächsten Patienten zu konzentrieren, aber es fiel ihm sehr schwer. An diesem Tag lief es wirklich seltsam– wie ein trauriger Reigen, bei dem fast alle dasselbe Problem hatten: Die Leute waren völlig normal (oder jedenfalls beinahe), aber an ihre Umgebung schlecht angepasst. Sie erinnerten Hector an Pinguine im Dschungel oder an Pandabären in der Wüste. Er sagte sich, dass er ihnen nicht nur helfen musste, sich selbst zu verändern, sondern auch ihre Arbeit, ihre Familie, vielleicht sogar das Land, in dem sie lebten, zu ändern, um sozusagen die passende ökologische Nische für sich zu finden.
Da gab es die viel zu Netten, die ständigem Wettbewerbsdruck ausgesetzt waren– Julie beispielsweise.
Da waren die allzu Gewissenhaften, von denen man verlangte, dass sie ihre Arbeit hinpfuschten und dann auch noch gut verkauften…
Da plagten sich Menschen, die Neuheit und Veränderung liebten, in monotonen Jobs ab.
Und da mussten die eher Einzelgängerischen an einer Konferenz nach der anderen teilnehmen.
Im Hinterkopf hatte Hector dabei jene kleine Analyse der Persönlichkeit nach fünf Komponenten, die im Augenblick den Sieg über alle anderen Klassifikationsversuche der Psychologie davongetragen hatte und die lustigerweise wie das Großwild in AfrikaBig Fivegenannt wurde. DieseBig Fivewaren:
erstensconscientiousness, also Gewissenhaftigkeit im Gegensatz zu Unordnung und Ungenauigkeit;
zweitensagreeableness, also eine angenehme Art, statt dass man den anderen gegenüber Härte zeigte;
drittensneuroticism, also Neurotizismus im Gegensatz zu innerer Ruhe und positiver Gestimmtheit;
viertensopenness to experience, die Offenheit für neue Erfahrungen, statt dass man stets das Wohlbekannte und Gewohnte vorzog;
fünftensextraversion– wenn man die Aufregung und den Trubel der Außenwelt der Einsamkeit und Ruhe vorzog.
Jeder Mensch hat seine Punktzahl zwischen den beiden Extrempolen der jeweiligen Dimension, und natürlich ist es besser, wenn Ihre Persönlichkeit Ihrem Beruf entspricht– oder auch nur dem historischen Moment, in dem Sie leben: Beispielsweise sollte man in Zeiten, wo Krieger an der Spitze der Gesellschaft stehen, lieber kein allzu netter Kerl sein.
Hector musste an Leutnant Ardanarinja denken; er sagte sich, dass sie eine ganz schön hohe Punktzahl in Sachen Härte hatte: Sie hatte ihm mit Polizeigewahrsam gedroht und ihn mit der Tatsache konfrontiert, dass er vielleicht log– und all das in einem scheinbar ganz entspannten Gespräch! Hector wäre es nicht so leichtgefallen, andere Menschen derart unter Druck zu setzen, aber das war ja auch normal: Als Psychiater sollte man lieber seine Punkte aufseiten deragreeablenesshaben. Für einen Polizisten wiederum wären zu hohe Freundlichkeitswerte unpassend; der Zeiger sollte etwas mehr in Richtung Härte ausschlagen. Hector war zufrieden, dass er sich mit seiner Berufswahl nicht geirrt hatte– wohl genauso wenig wie Leutnant Ardanarinja…
Dann musste er wieder an Édouard denken. Sein Freund erzielte eindeutig extrem hohe Werte in »Offenheit für neue Erfahrungen« und »Extraversion«. Seit jeher hatte er sich schnell gelangweilt; immer hatte es ihn nach Neuem verlangt. Dass er sich so rasch langweilte, wurde wahrscheinlich noch dadurch verschärft, dass er die meisten Dinge schneller kapierte als alle anderen: Im Schulunterricht hatte er immer als Erster die Lösung einer Aufgabe gehabt, und später war er sehr schnell durchs Studium gekommen. Sobald er sich zu langweilen begann (und das war oft), hatte er den Beruf gewechselt, die Frau, das Land und die Sprache; immer drängte es ihn, die nächste Herausforderung zu finden, und »Endlich mal was Neues!« war sein Lieblingsspruch.
Ende der Leseprobe