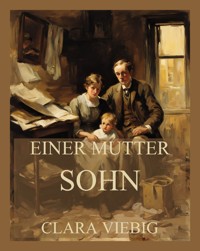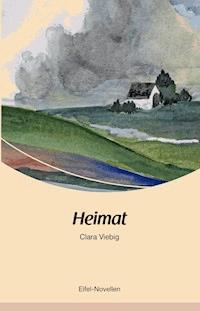
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In sieben Novellen schildert Clara Viebig das Leben der Menschen aus dem Eifelraum um Bad Bertrich und von der Mosel, das Leben der einfachen Bauern und Winzer auf dem Dorf. Im Mittelpunkt ihrer Erzählungen stehen oft die Randfiguren der dörflichen Gemeinschaft: die alte Witwe, der zum Knecht bestimmte Zweitgeborene auf dem großen Bauernhof, der armselige, aber körperlich starke Geistesschwache, die arme Botenfrau oder der schrullige alte Tagelöhner, der schließlich stirbt, als man ihn aus seiner Not, aber auch aus seiner geliebten Heimat fort ins Altersheim nach Trier bringt. Ausgehend von diesen Figuren beschreibt die Autorin nicht nur die ländliche Gesellschaft, sondern auch in oft überschwenglicher Sprache die von ihr so geliebte Eifel- und Mosellandschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clara Viebig
Heimat
Eifel-Novellen
Inhalt:
Das Heiligenhäuschen
Der Vater
Mutter Clara
Josepha Seweneich
Der Depp
Die Hotte
Die Heimat
Frau Thea Wolf zu eigen
Das Heiligenhäuschen
Auf der Hontheimer Flur steht ein Heiligenhäuschen. Es schaut hinüber zur Falkenlay, die jenseits der Schlucht, vom Üßbach durchrauscht, sich schwarz und finster aufrichtet; ein düsterer Lavabrocken am Rand des grünenden Hochplateaus. Aus schwarzen Lavasteinen ist auch das Heiligenhäuschen erbaut, rund wie ein Bienenkorb, mit einem Schieferdächelchen darüber; aber innen sind die Wände weiß getüncht, und ein Bänkchen zum Knien steht vor dem Heiligenbild. Dieses Fußfällchen stifteten Elisabeth Haidweiler und die Witwe Anna Maria Conzen von Hontheim. Es war der Schmerzhaften Mutter Gottes von Klausen geweiht.
Die beiden waren miteinander wallfahren gewesen nach Eberhardsklausen, das unten in dem gelinden Vorland liegt, wo die besonnten Rebberge der Mosel von den rauhen Eifelhöhen scheiden.
Hier unter den Bäumen, die im Herbst wie beschüttet sind mit dem leuchtenden Rot ihrer Äpfel, hatte einst der fromme Bruder Eberhard, der nur ein einfacher Landmann gewesen war, dessen Herz aber überfloß von der Liebe zur Heiligen Mutter Maria, vor vielen hundert und hundert Jahren, als nur ödes Wildland hier war, sich eine Klause erbaut und hatte vorerst in einen oben ausgehöhlten Pfahl ein aus Holz gefertigtes Bildchen gestellt: das Bild der betrübten Mutter Jesu, die den Leichnam des Sohnes im Schoße hält. Aber nicht nur der fromme Eberhard kniete davor und betete es an, auch andere eilten herzu, die der Klang von des Klausners Glöckchen lockte. Und siehe, wer vor dem Bild der lieben, betrübten Mutter recht inbrünstig sein Anliegen vortrug, wurde erhört. Ein Lahmer konnte wieder gehen; eine Frau, deren Arm steif gewesen war wie Stein, konnte ihn rühren zu emsigem Tun. Und so waren es viele, viele, die Wunder erfuhren. Da hingen sie ihre Krücken und Schienen, alle die Zeichen ihrer Gebreste, froh beim Gnadenbild auf, und der Ruhm desselbigen wurde getragen Mosel-auf, Mosel-ab. Und noch viel weiter.
Aus der kleinen Klause ist eine große Kirche geworden, von den Schenkungen und Stiftungen der frommen Gläubigen erbaut. In der Gnadenkapelle steht Kerze bei Kerze, oft dick wie ein Arm, oft so schwer wie ein Kind, denn die Schmerzhafte Mutter Gottes ist besonders den Weibern gnädig, die Mutter werden sollen; eine Wallfahrt nach Eberhardsklausen schafft ihnen leichte Geburt. Und auch den Mädchen, die gerne Mutter werden möchten, die liebenden Herzens sich um einen Mann mühen, ist sie besonders hold.
In der Oktave des Festes Mariä Geburt, im Monat September, zieht Prozession auf Prozession unter den Apfelbäumen dahin. Weiber, gleich den Fruchtbäumen schwer beladen, oft gestützt von dem Ehemann, denn das Gehen fällt ihnen sauer. Mädchen, junge, behende, mit munteren Blicken; und auch schon ältere Jungfrauen mit niedergeschlagenen Augen. Und alle lassen sie die Perlen des Rosenkranzes durch die Finger rinnen, und ihre Lippen murmeln unausgesetzt das Wallfahrtsgebet: »Sei mir gegrüßt, Maria, liebe, Schmerzhafte Mutter! Zeige, o Mutter, Deinem göttlichen Sohn für mich Dein siebenfach durchbohrtes Herz! Mildreiche Trösterin aller Betrübten, sei tausendmal gegrüßt, geehrt und gebenedeit!«
So waren auch die Haidweilersch Lies und die Witwe Conzen aus Hontheim nach Klausen gegangen; die Conzen trotz ihres offenen Beines, das sich nicht mehr schließen wollte seit der letzten Geburt. Aber war sie nicht die Mutter des Hieronymus, den die Lies sich erbitten wollte vom Gnadenbild? Denn wenn die Conzen es sich recht überlegte, so konnte sie ja gar keine bessere Schwiegertochter bekommen, als die Haidweilersch Lies. Die war acht Jahre bei einem geistlichen Herrn zu Ürzig im Dienst gewesen, hatte da tüchtig gewirtschaftet und nur Gutes gelernt. Es gab wohl andere, ganz nette Mädchen, die der Hieronymus hätte kriegen können, aber frömmere gab es nicht. Die Lies konnte man mitten in der Nacht aus tiefstem Schlaf wecken mit dem Anfang der Litanei vom süßen Namen Jesu, sie wäre gleich eingefallen, so am Schnürchen hatte sie’s. Und das tat dem Hieronymus not, so ein Weib. Seit der bei den Soldaten gewesen war, hatte er seine Frommheit ganz verloren. Er war sonst so ein ordentlicher Bursche, aber er ging lieber ins Wirtshaus zum Kartenspielen als in die Messe zum Beten. Ach, ach, der Junge vergaß eben ganz, daß ein armer Mensch, der ein mühseliges Leben hat, nur seine Last leichter werden fühlt zu Füßen der lieben Heiligen! Die Witwe Conzen seufzte oftmals: wie hätte sie denn sonst ihr Leben ertragen sollen?!
Sie hatte es schwer gehabt; man sah es an ihrem gebeugten Rücken und den vielen Runzeln in ihrem Gesicht, und sie seufzte bang, wenn sie bedachte, was der Hieronymus ihr wohl einmal für eine Schwiegertochter ins Haus bringen würde. O je, so ein junges, lustiges Ding, das nicht wußte, wie einer alten Seele zumute ist! Das würde ihr nun und nimmer taugen. Aber mit der Lies – o, mit der war das etwas ganz anderes! An deren Hand wurde der Hieronymus zum Himmel geführt, und sie, die Schwiegermutter, sie hätte schon den Himmel auf Erden bei der! Eine Hoffnung glänzte auf in der Conzen müdem Gesicht.
»Et es esu en fromm Mensch,« pries sie dem Sohn das Mädchen an.
Aber der wollte nichts davon wissen. »Duh leit mer neist dran! Ech sein aach zum Heiroaden noch vill zu jong.«
Er sagte es lachend, aber wenn sie ihn dann bedrängte, mit erhobener Stimme von dem Mädchen posaunte, das ihr so gut gefiel – Jesses, wenn sie ein Mannsbild wäre, die würde sie gleich heiraten, so fromm, so ehrbar, so rechtschaffen, so wirtschaftlich! – wenn sie gar kein Ende finden konnte mit Lobpreisungen, dann wurde der sonst so gelassene, ein wenig verschlafene Hieronymus ärgerlich. Verdrossen stand er auf, schlorrte zur Tür und warf sie hinter sich zu: »Laoß mer mein Ruh!«
So kam sie nicht ans Ziel, das sah die Mutter ein. Und sie konnte dem Mädchen, das oftmals kam, der vertrauten Freundin allerlei zutrug – ein Pfündchen Kaffee, ein Stückchen Speck, ein Fläschchen Wein und Zigarren für den Sohn, von derselben Sorte, wie ihr geistlicher Herr sie geraucht hatte – nichts Verheißungsvolles sagen.
Die Lies klagte: hätte sie doch den Hieronymus nicht gesehen voriges Jahr, als sie ihren Vater daheim besuchte und er gerade vom Militär kam! Wie keck ihm die Mütze gesessen, und wie gut ihn das Sträußchen gekleidet hatte mit dem langflatternden Band! Ach, hätte sie ihn doch niemals gesehen, dann hätte sie ihr Herz nicht an ihn verloren auf den ersten Blick und hätte ihren Platz nicht aufgegeben beim Herrn Pastor, wo sie gesessen hatte wie in Abrahams Schoß! So oft war sie nun schon den Stationsweg hinaufgestiegen zur Marienburg, war halb gebraten an dem sonnenbeprallten Moselweinberg, auch nach Kloster Springiersbach war sie beten gegangen durch den einsamen Kondelwald – es hatte alles nichts genützt.
Die herben Lippen der Lies zuckten, das beschämte Rot unerwiderter Liebe brannte in zwei großen Flecken auf ihren Wangen, sie würgte an ihren Tränen: sollte sie denn wirklich ledig bleiben? Nun war nur noch das eine unversucht – Eberhardsklausen!
Daselbst vor dem Gnadenbild in der Wunderkapelle hatte die Lies gelobt, der Schmerzhaften Mutter Gottes ein Häuschen zu bauen auf Hontheimer Feld; dafür sollte die ihr aber auch dann den Hieronymus zum Manne geben.
Auf dem Heimweg von Klausen hatte die Lies zwischen dem Beten des Rosenkranzes gerechnet: solch ein Bau kostete viel. »Wat lägt Ihr derzu?« hatte sie zur mühsam nachhumpelnden Conzen gesprochen.
Die Conzen war anfangs verdutzt gewesen: warum sollte sie denn zulegen zum Heiligenhäuschen? Aber als das Mädchen ihr’s klar machte, daß auch sie alle Ursache hätte, ein Opfer zu bringen, denn wo würde sie’s bei einer anderen Schwiegertochter je halb so gut kriegen – man weiß ja, wie die Alten in den Ecken herumgestoßen werden, es ist eine Schande, überall sind sie zuviel, man gönnt ihnen den Löffel Suppe nicht mehr – da sagte sie geschwind und erschrocken: »Ech lägen derzu!«
Die Conzen hatte ihren heimlichen Schatz hervorgeholt, den sie unter dem Strohsack gehütet, den Schatz, an dem sie gespart zwanzig Jahre, Pfennig auf Pfennig gelegt hatte und Groschen auf Groschen. »Fünnef on dreißig Dahler,« sagte sie langsam mit zitternder Stimme zur Lies, als die das Geld abholen kam.
Fünfunddreißig Taler legte die Lies noch dazu, und dafür baute der Maurer ihnen das Häuschen und besorgte auch das Dachdecken und die Tünche der Wände. Er ließ sich noch so und so viele Schnäpse besonders zahlen, die nicht mit auf der Rechnung standen. Das Heiligenhäuschen kam sehr teuer.
Aber die Conzen klagte nicht mehr ihrem Schatz nach, den sie sich erspart hatte für ein anständiges Begräbnis mit Glockenläuten und Leichenschmaus; ihre Taler waren gut angelegt. Und die Lies hatte ihr’s ja auch heilig versprochen: »Modderche, Ihr krieht doch en schön Leich!«
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Haidweilersch Lies ließ es sich angelegen sein, ihr Heiligenhäuschen immer aufs neue zu schmücken. Ein Bild der Schmerzhaften Mutter Gottes von Klausen, schön bunt in Farben – die Mutter Gottes in Blau und Rosa und Gold mit weißem Schleiertuch, das Lendentüchlein des göttlichen Leichnams reichlich beträuft mit blutigem Rot – hatte sie in einer der Buden vor der Kirche gekauft. Nun hing das unter Glas und Rahmen in der Nische der hinteren Häuschenwand, und rechts und links davon auf herausgemauerten Steinen standen zwei Engelchen aus echtem Porzellan mit goldenen Flügeln, die betenden Hände erhoben; ganz so wie sie am Gnadenaltar zu Klausen stehen. Und Kränze von Tannenreis und korallenen Ebereschen wand die Fromme ums Bildnis, steckte Sträuße von bunten Blättern und Herbstzeitlosen hinter die Engelchen und legte auch die letzten Ähren des Feldes davor nieder.
Es kam hier selten jemand vorbei, der Weg führte nur zum Conzenschen Acker, aber ging einmal einer den Rain entlang, so schlug er gewiß sein Kreuz, froh überrascht und erstaunt ob solcher Pracht. Oft, sehr oft aber ging die Lies hinauf, betete emsig auf ihren Knien und zögerte dann noch lange, steckte den Kopf zum Eingang heraus und spähte sehnsüchtig den sich schlängelnden Weg hinab, den der Hieronymus Conzen kommen mußte. Aber sie hatte nur selten Glück.
Sollte die Mutter Gottes von Klausen ihr Opfer nicht annehmen wollen? Doch, doch, die hatte ja noch nie ein Opfer verschmäht! Hoffnung zog wieder ein in der Lies sehnendes Herz: noch stand ihr Heiligenhäuschen ja nicht lange, noch war es gute Zeit, noch brauchte sie nicht zu fürchten, wiederum einen Winter zu liegen im einsamen Bett.
Die Lies putzte sich. Zu jedem Gange hinauf zog sie ihr Bestes an, denn es war ein Hoffen in ihrer Seele, das ihr ein Fest verhieß. Ordentlich hübscher und jünger sah sie aus mit der Erwartung auf ihrem Gesicht.
Aber als der Holzbirnbaum, der beim Häuschen stand, nicht nur seine kleinen sauren Hutzeln fallen ließ, sondern auch einen Regen von goldenen Blättern auf ihren Scheitel niedergoß, da wurde ihr doch wieder bange. Wie weit war sie denn mit dem Hieronymus? Dreimal war er vorübergekommen, sie hatte ihn angerufen, ein paar Worte von ihm erhascht, aber aufhalten hatte sie ihn nicht können.
Die lange Peitsche schwingend, war er mit seinem langsamen und doch stetig fördernden Schritt hinter seinem Mistkarren zur Ackerhöhe hinaufgestampft.
Wie sie eigentlich mit ihm stand, das konnte ihr auch die Conzen nicht sagen. Die wartete fromm, ganz in Zuversicht: hatten sie denn nicht das Heiligenhäuschen erbaut?
Die Lies stampfte ungeduldig mit dem Fuß auf: die Alte, die dachte ja nur an ihr wehes Bein! Das war schlimmer geworden seit Eberhardsklausen. Wenn die wüßte, wie es in ihr aussah! Die Lippen der Lies verzogen sich: wenn das Heiligenhäuschen umsonst erbaut wäre? Nein, das durfte nicht sein, das durfte nicht sein! Immer ungeduldiger wurde die Erwartende, immer begehrender der Blick ihrer Augen.
Nun ging es doch auf den Winter zu. Die Buchen in der Schlucht der Üß hatten alle rostfarbene Kronen, in ein Meer von Braun und Rot sah man von Hontheim nieder; und drüben die Falkenlay hob sich noch schwärzer in Feuchte und Dunst aus entfärbtem Anger. Bald würden die ersten Schneeflocken im Eifelwind treiben.
Aber vorerst kam noch einmal ein Tag, so leuchtend von Sonnengold, so gebadet in linder Luft, daß die Seele sich täuschte und meinte, nun fange es an zu lenzen. Die Vögel, die längst geschwiegen hatten, versuchten noch einmal einen Gesang, jedes Blatt, das schon gilbte, schien wieder grüner zu werden am sich hebenden Stengel; von den Äckern, die der Atem des toten Kartoffelkrautes schon nach Verwesung durchhaucht hatte, stieg ein Duften auf von noch lebendiger Lebenskraft. Um Mittag wurde es sommerwarm.
Die zum Militär ausgehobenen Burschen von Hontheim, die heute abzogen, hatten heiße Köpfe, als sie sich nach dem Mittagläuten auf den Weg machten, um noch vor Dämmern die Eisenbahn zu erreichen. Auch dem Hieronymus, der dann erst auf seinen Acker ging, war es heiß, und der Schädel war ihm benommen. Sie hatten tüchtig Abschied gefeiert. Unter den Rekruten waren viele gute Bekannte des Hieronymus, und alle hatten wissen wollen, wie es eigentlich zuging beim Militär. Hieronymus hatte sich trocken im Halse geschwätzt; beim Militär war seine liebste Zeit gewesen, er hatte sich berauscht in froher Erinnerung und dazu noch manchen Schoppen geleert.
Nun hantierte er auf seinem Acker ganz wie im Traum. War es Herbst, war es Frühjahr? Er wußte es nicht. Säte er Winterroggen, oder bestellte er Sommersaat? Er wußte es nicht. Ein wenig im Zickzack schritt er durch die Furchen des Ackers, und der Armschwung, mit dem er die Körner auswarf, hatte nicht die sonstige gleichmäßige Sicherheit. Aber vergnügt war er.
»Kreizknippchen!« War das heiß, puh! Er riß sich das Hemd auf der Brust voneinander: ein Wetterchen war das, ein Wetterchen! Er lachte laut. Wie Feuer rollte ihm das Blut durch die Adern und klopfte in allen Pulsen. Er kam sich selber ganz unternehmend vor. Mit der jungen Wirtstochter hatte er vorhin angebändelt – ein hübsches Mädchen das! Es war doch eigentlich etwas arg Nettes um die ›Mädercher‹! Das wurde dem Hieronymus erst heute recht klar. Wenn er jetzt so eins hier hätte, weiß Gott, er nähm’s in den Arm; ein Schmätzchen kriegte das Schätzchen. Vergnügt pfiff der junge Mann.
Es war keine Melodie, die er pfiff, dazu wäre er nicht mehr imstande gewesen; nur einzelne laute, langgezogene Pfiffe schrillten über den Acker und weckten ein mißtönendes Echo am nächsten Hang. Aber einem Ohr dünkten sie schöne Musik.
Im Heiligenhäuschen war die Lies angelangt. Sie lag auf den Knien, sie erhob die Hände, sie wand sich förmlich in ihrem Gebet: »O Schmerzhafte Mutter Maria, nach Gott meine einzige Zuflucht, ich bitte dich, sei meine Fürsprecherin!« So oft, so oft schon hatte sie hier vergeblich gelauert. Der Winter war nahe – bald lagen Acker und Häuschen ganz tief zugeschneit – der Hieronymus pfiff – er war lustig gewesen – die Stunde war günstig! Er lachte jetzt noch. »Liebe, Schmerzhafte Mutter, ich bitte dich, hilf mir!«
Die Verliebte atmete hastig und sprang auf die Füße. Sie strich sich das Kleid glatt. Sie zupfte an der schwarzen Schürze und steckte den Pfeil fester durchs Haar. Sie stellte sich auf die Zehen und machte den Hals lang. Sie lauschte zum Häuschen heraus mit allen Sinnen.
Wollte es dämmern? Noch lag draußen viel Sonnenglanz. Nur drüben hinter der Falkenlay düsterte eine Wolke; tiefschwarz stand die runde Schutzhütte, aus Lava gebaut, gegen den nur um weniges helleren Himmelsgrund. – – – – –
Wollte es denn gewittern, jetzt, so spät noch im Jahr? Heiß genug war es freilich dazu! Der Sämann wischte sich den quellenden Schweiß ab. Einen fragenden Blick sandte er zum Himmel auf, aber dieser Blick sah nicht mehr scharf. Dem jungen Mann fielen die Augen fast zu, alles vernebelte ihm, er gähnte laut: wenn es doch Bettzeit wäre! Gut, daß es schon dunkel wurde – da – auf einmal alles ganz schwarz.
Krach! Ein Donnerschlag, vor dem der Hieronymus einen Satz machte wie ein scheuendes Pferd.
Ein gewaltiger Regen rauschte urplötzlich nieder. Tropfen, prasselnd wie Hagel, mit Wut das letzte Laub peitschend, das Erdreich aufwühlend. Hontheimer Flur, drüben die Falkenlay, oben der Himmel, unten die Erde, alles verschwimmend in Wasser und Nacht.
Der Erhitzte riß sich das Sätuch vom Leibe, warf es sich über den Kopf und setzte sich eilig in Trab. Jetzt galt es laufen. Aber die Füße gehorchten nicht.
»Heiligkreizgewieder noch ehs!« Der Bursche fluchte laut. Konnte er heute denn gar nicht rennen? Wie Blei waren die Füße, wie Klumpen hing es sich ihm an die Sohlen. Vergeblich strebte er zu entrinnen. Hart schlug ihm der Regen gegen die blöden Augen und machte ihn blind. Er sah nichts, er strauchelte, er stolperte – da hörte er seinen Namen rufen. Eine Hand faßte nach ihm.
* * *
Der Conzen war es lieb, daß der Sohn und die Haidweilersch Lies noch kurz vor Schluß des alten Jahres Hochzeit machten. Gern trat sie der Lies ihren Platz in der Stube ab; wo ihr Bett gestanden hatte, kam nun das der Schwiegertochter hin. Sie selber schlug ihr Lager auf oben in der Kammer, wo sonst der Roggen geschüttet lag und die Mäuse tanzten. Die Kälte da oben fühlte sie gar nicht in ihrer Freude. Also doch, also doch! Die liebe Mutter Gottes von Klausen hatte ihr Wunder getan! Was all ihr eigenes langes Zureden nicht beim Sohne vermocht, das hatte die geschafft, so im Handumdrehen. Oh, wie gut würde sie’s von nun ab haben, sprach doch die Lies alleweil: »Modderche, legt Eich noren hin, Ihr hatt et eweil schön kommod!« Ja, bequem hatte sie’s, die Schwiegertochter nahm ihr alles aus der Hand; sie sollte sich um nichts kümmern.
Durch tiefen Schnee stapfte die Alte mit ihrem schmerzenden Bein hinauf zum Heiligenhaus. Es war ein mühseliges Gehen, aber es drängte sie allzusehr, sich bei der Heiligen zu bedanken. Mit betrübtem Gesicht sah die Schmerzhafte Gottesmutter aus ihrem Schleiertuch herab auf die Conzen; aber der andächtig Emporblickenden schien es, als lächle sie. Mit hingebender Dankbarkeit sah die Betende inbrünstig auf: ach, das hatte sie ja nie im Leben erfahren, wie’s tut, wenn einem die Hände unter die Füße gebreitet werden!
Sie kniete so lange in Andacht versunken auf dem niederen Bänkchen, bis sie ganz steif geworden war, kaum fähig mehr, sich zu rühren. Der Wintersturm pustete den Schnee durch den offenen Eingang bis mitten hinein ins Heiligenhaus; dreiste Raben flatterten windgejagt dicht vorüber und mischten ihr kreischendes Gekrächz in das murmelnde Beten. – – – – –
Es war für lange Zeit das letzte Mal, daß die Conzen beten gegangen war ins Heiligenhäuschen; der Winter war streng, und sie erfror sich die Füße in ihrer Kammer. Ach ja, wenn nur erst wieder die Sonne warm schien, dann konnte sie auch wieder hinauf beten gehen!
Aber als der Sommer da war, die Sonne die verklammten Glieder wärmte, da kam die Conzen doch nicht hinauf, denn nun mußte sie tagsüber und auch oft Nacht für Nacht das schreiende Kind wiegen, das schon im Juli geboren war. Die Conzen war nicht wenig erstaunt gewesen: wie konnte das nur zugehen, bei einer so frommen Jungfrau? Aber sie sagte es nicht laut, sie dachte es bloß.
Auch der Hieronymus sagte nichts, er war still und ein wenig verdrossen, so wie er immer gewesen war; vielleicht jetzt noch stiller. Aber er schien doch ganz zufrieden. Die Lies führte ihm die Wirtschaft auch ordentlich, setzte ihm zur Zeit das Essen auf den Tisch, war sauber und sparsam und brachte was vor sich. Eine bessere konnte man sich gar nicht wünschen.
Und doch fühlte die Conzen keinen Trieb, zum Heiligenhäuschen hinaufzugehen, selbst wenn sie besser hätte laufen können. Und wenn sie draußen in der Sonne saß, wurde ihr doch nicht warm; sie mußte immer denken: es kommt wieder der Winter.
Und als es nun Herbst wurde und die Lies zur Fröstelnden sprach: »Kriecht noren hinner dän Ofen, Ihr hatt et eweil schön kommod!« da wurde ihr auch davon nicht warm. Es klang ihr aus der Schwiegertochter Rede wie ein Vorwurf heraus. Ach, du liebe Zeit, was konnte sie denn dafür, daß sie alt war und müde und nicht mehr recht vorankonnte! Die Conzen tat viele Stoßseufzer, aber nur für sich, nur ganz heimlich – daß ja die Lies es nicht merkte! –
Zum zweiten Mal kam der Winter ins Land. Sankt Martinus auf seinem Pferd brachte ihn mit; es war schon kalt Mitte November.
An seinem Tisch saß Hieronymus Conzen und schnitt sich vom Riesenbrotlaib einen tüchtigen Kanten ab und auch einen gehörigen Happen vom Rauchspeck. Er war gegen Dämmern vom Acker gekommen, er konnte draußen nichts schaffen mehr, das Wetter tat gar zu ungestüm.
Die alte Frau saß auch am Tisch, sie hielt das Kleine auf dem Schoß; sie fütterte es mit Semmelbrocken, die sie in ihrem Kaffee aufweichte, an denen das Kind dann lutschte. Was vorbeilief am Mäulchen, das aß sie auf.
Die Hausfrau blickte von der Seite hin. Aber als Hieronymus sagte: »Modder, äßt doch net esu mager!« und ihr den durchwachsenen Speck hinschob, sagte sie: »Et es für alde Leit vill bekömmlicher, se äßen net esu fett!«
Die Conzen schob den Speck weit von sich ab; so gern sie ihn aß, jetzt hätte sie kein Scheibchen sich abgeschnitten. Sie langte sich nur die letzte Semmel her, aber als sie gerade anfangen wollte, die langsam zu mampfen, sprach die Schwiegertochter: »Mir kriehn morjen kein frisch Weißbrot. Erscht öwermorjen. Hei dat brauchen mir für dat Könd!« Da legte sie hastig die Semmel wieder hin.
»Hei hatt Ihr dat Brot, schnied Eich noren ahf!« Die Sohnesfrau schob ihr den Brotlaib zu, aber in des alten Weibes Augen schossen die Tränen: dies Brot war ja schon an die zwei Wochen alt, wie konnte sie das noch beißen?
Die Lies beachtete der alten Frau Kummer nicht, aber Hieronymus sagte: »Se hat doch kein Zähn mieh. Dao, Modder, äßt noren!« und schob ihr wieder die Semmel zu. Aber die Alte schüttelte verneinend die Haube: »Wat ei’m net gegunnt es, dat schmeckt aach net!«
»Wieso net gegunnt!« Der Lies starke Stimme wurde noch stärker. »Hei es Eich ahles gegunnt!«
»Dat maanen ech aach!« bekräftigte der Sohn.
»O, Jesses, gegunnt?« In ausbrechender Bitterkeit schlug die Alte die Hände zusammen. Wenn sie alles aufzählen wollte, was ihr hier gegönnt war, wie bald wäre sie da am Ende! Schwerfällig erhob sie sich vom hölzernen Schemel, es war besser, sie ging in ihre Kammer hinauf.
»Bleiwt!« Der Sohn schrie sie an. Es war gut gemeint – sie brauchte doch nicht gleich aufzustehen – aber er schrie zu sehr. Erschrocken fuhr die Alte zusammen, sie zitterte, das Kind fing an zu greinen.
Die Schwiegertochter riß es ihr aus dem Arm: »Net emaol dat Könd könnt Ihr mieh verwaohren!« Tänzelnd ging sie nun selber mit dem Kleinen in der Stube auf und ab.
Seiner Last ledig, stand das alte Weib jetzt plötzlich da, hilflos streckte es die Arme von sich; es hätte so gern das Kind wiedergenommen, es kam sich auf einmal so völlig unnötig vor hier, so ganz überflüssig.
»Nä, nä!« Die Lies wehrte den sich nach dem Kind streckenden Armen. »Et es Eich ja doch ahles zu vill! Ihr denkt ja doch noren dran, wie Ihr Eiren Wanst pflegt!«
Der Sohn mischte sich drein: »No, se es ja aach ald, hat genog gearbeit in ihrem Läwen. Laoß se gewärden!«
»Ech laoßen se jao!« Gereizt klang die Stimme der jungen Frau. »Se soll mech nor gewärden laoßen.«
Jesus Maria, ließ sie denn die Schwiegertochter nicht gewähren, nicht alles ganz so machen, wie die wollte? Mit weit aufgerissenen Augen starrte die alte Frau drein. Es dämmerte ihr eine furchtbare Frage wie in fernem Nebel, noch nicht deutlich zu erkennen. Aber nun kam die Frage näher und näher: war es wirklich der Himmel auf Erden, den sie sich erbeten hatte – war es nicht schon das Fegefeuer bei lebendigem Leib?!
Die Conzen wurde totenblaß. Wie ein Höhnen gellte es ihr plötzlich ganz nahe ans Ohr. Sollte das möglich sein, konnte das möglich sein?! Menschen, die nehmen ja Opfer an, die vergessen zu danken, aber – ›Sei mir gegrüßt, liebe Schmerzhafte Mutter, mildreiche Trösterin aller Betrübten, sei gegrüßt tausendmal, geehrt und gebenedeit‹ – wo war der mühsame Spargroschen hin, den müden Leib zu begraben?!
Das Gesicht der Greisin verzog sich schmerzhaft, eine Grimasse war’s fast; ihre Augen blickten entsetzt. Wie allen Anhaltes beraubt, griffen ihre Hände umher. Und dann wurden ihr die Beine auf einmal ganz wacklig, ächzend sank sie auf den Schemel zurück. Sie fing bitterlich an zu weinen.
Es war still in der Stube, das Kind hatte beim Tänzeln der Mutter mit Greinen aufgehört, man hörte nichts als das Schluchzen der Alten.
Verdrießlich stand Hieronymus auf: hier war’s ungemütlich! Da ging er lieber ins Wirtshaus.
Aber die Lies hing sich an ihn: »Ech leiden et net, et es en Sauwäder – on öwerhaupt –!« Sie machte eine kleine Pause, als suche sie einen Grund. Und dann schloß sie sehr bestimmt: »Dau bleiwst mer hei!«
Da setzte sich der Mann wieder nieder; aber er war verdrossen. Weibergezänk! Es gab nichts Scheußlicheres, als wenn sie untereinander das Zanken kriegten! Er stemmte die Ellenbogen auf, stützte den Kopf in die Hände und döste vor sich hin.
Die Lies, die auf einen zärtlichen Abend gerechnet hatte, war bitter enttäuscht. Was, auch zwischen den Hieronymus und sie wollte die Alte sich drängen? War man denn nie allein? O je, wenn sie geahnt hätte, was es heißt, die Schwiegermutter im Haus haben müssen, nie wäre sie eine solche Heirat eingegangen! Sie sagte es im Ton der leidenden Unschuld.
Da lief auch der Alten die Galle über: was, die wollte noch gekränkt tun? Sie schrie laut: »Spaor dein Red! Et es jao ahles Lug on Trug. Modderche hin, Modderche här, on: ›Ihr krieht et kommod.‹ – olau, weil se meinen Jong absolut freien wollt! Duh kam se mer bahl de Stuw eingerennt. Eweil haot se äwer vergäß, wat ech für se gedahn haon!« Die Conzen lachte erbittert. »Nao Eberhardsklausen sein ech met’m gerennt, met dem mannsdollen Mensch – mich haot den Deiwel geritt. Dat Heiligenhäusche haon ech gestift – mein Dahlers, mein saure Spaorgroschen! Hätt ech et nie net gestift!« Wie eine Wütende hämmerte die Alte sich vor den Kopf mit beiden Fäusten: »Vermaledeit sei et!«
Erschrocken schwiegen die beiden anderen. Die Mutter hatte sich die Schürze ganz über Gesicht und Haube geworfen.
Ja, das war auch zum Weinen! Eine schöne Dummheit war es gewesen, das Heiligenhaus zu bauen! Der Hieronymus ärgerte sich jetzt noch nachträglich darüber. Das Geld wäre wahrhaftig nötiger zu anderem gewesen. Und überhaupt, wenn das Heiligenhäuschen nicht gewesen wäre, wenn es nicht dagestanden hätte, so nahe bei seinem Acker, dann wäre er nicht darin untergeschlupft bei jenem Unwetter und in seiner Betrunkenheit. Und die Lies hätte sich ihm nicht an den Hals hängen können in ihrem Getue vor Donner und Blitz. Und er hätte dann keine Verpflichtung gehabt als ehrlicher Kerl. Heute noch wäre er ledig!
»Kotzdonner noch ehs!« Mit der ganzen Hand faßte er ins rotgewürfelte Halstuch und riß daran, als ersticke es ihn. Er würgte an etwas. Und dann wandte er sich der Alten zu: »Dat es ahl noren dein Schuld!«
»Jao, dat es et aach,« stimmte die Lies gleich mit ein. Was für eine Schuld es eigentlich war, die der Hieronymus seiner Mutter beimaß, hatte sie nicht verstanden, aber sie verstand, daß er auf die Alte böse war, und das paßte ihr. Sie hetzte: war das eine Manier, daß so eine aufmuckte, an der man täglich Barmherzigkeit übte? Daß sie sich jetzt aufspielte, als hätte sie ihr wunders was Gutes getan?
Der Hieronymus boste sich immer mehr. Hätte die Mutter, die dumme Betschwester, ihre Spargroschen nicht unterm Strohsack lassen können? Wie durfte sie sein Erbe so schmälern! Aber das verlorene Erbe war es weniger, was ihn so erzürnte. Von unten herauf sah er finster nach seiner Frau hin – die gefiel ihm doch gar nicht.
Und in einer plötzlichen Wut sprang er auf, schlug mit der Faust auf den Tisch, daß Speck und Brot umeinander tanzten und dann hinab auf den Estrich sprangen, und brüllte die weinende Alte an: »Dau – dau bist dran schuld! Wat dau mer eingebrockt has’, ech muß’t eweil ausfressen. Gieh zum Deiwel met dei’m Heiligenhaus!«
Draußen heulte der Wind, die Tür sprang auf, wie auffordernd wies sie ihre ganze gähnende Leere. Da tappte die Alte blindlings hinaus. Sie tat die Schürze nicht vom Gesicht, sie sagte kein Wort mehr.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Am Morgen ließ sich die Alte nicht sehen. War sie noch böse? Dem Hieronymus tat es schon leid: er hatte die Mutter doch zu grob angefahren. War die alte Frau vielleicht von dem Ärger krank?
Er tappte hinauf in die Kammer, da war das Bett leer, es hatte gar keiner darin gelegen. Huh, und kalt war es hier! Dem Sohn lief ein Frösteln über den Leib: das hatte er ja gar nicht gewußt, daß es so eisig hier oben war. Wo steckte sie nur?! Ihn faßte die Unruhe.
Und je weiter der Tag voranschritt, die Mutter sich aber nicht sehen ließ, desto größer wurde die Unruhe. Zu wem war die alte Frau wohl hingelaufen?!