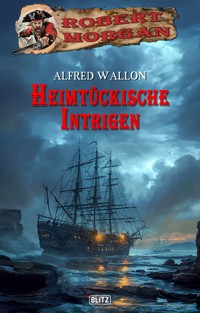
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Allgemeine Reihe
- Sprache: Deutsch
Die dramatische Flucht aus den Kerkern des Londoner Tower ist geglückt. Robert Morgans Sohn Jeffrey gehört nun zu den Geächteten, auf deren Ergreifung ein hohes Kopfgeld ausgesetzt ist. Tot oder Lebend! Robert Morgan erzählt Jeffrey, wie er durch heimtückische Intrigen von einem angesehenen britischen Navyoffizier zu einem verhassten Piraten wurde. Dafür sind Morgans Todfeinde Lord Peter Dawson und Admiral James Fawcett verantwortlich. Noch ist der Tag nicht gekommen, an dem sich Morgan für diese Schmach rächen wird. Er geht auf Kurs in Richtung Karibik. Dies ist auch das Ziel der Meuterer, die in der Zwischenzeit mit Morgans Schiff Seeadler die irische Küste verlassen haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen:
7001 Stefan Melneczuk Marterpfahl
7002 Frank W. Haubold Die Kinder der Schattenstadt
7003 Jens Lossau Dunkle Nordsee
7004 Alfred Wallon Endstation
7005 Angelika Schröder Böses Karma
7006 Guido Billig Der Plan Gottes
7007 Olaf Kemmler Die Stimme einer Toten
7008 Martin Barkawitz Kehrwieder
7009 Stefan Melneczuk Rabenstadt
7010 Wayne Allen Sallee Der Erlöser von Chicago
7011 Uwe Schwartzer Das Konzept
7012 Stefan Melneczuk Wallenstein
7013 Alex Mann Sicilia Nuova
7014 Julia A. Jorges Glutsommer
7015 Nils Noir Dead Dolls
7016 Ralph G. Kretschmann Tod aus der Vergangenheit
7017 Ralph G. Kretschmann Aus der Zeit gerissen
7018 Ralph G. Kretschmann Vergiftetes Blut
7019 Markus Müller-Hahnefeld Lovetube
7020 Nils Noir Dark Dudes
7021 Andreas Zwengel Nützliche Idioten
7022 Astrid Pfister Bücherleben
7023 Alfred Wallon Der Sohn des Piratenkapitäns
7024 Mort Castle Fremde
7025 Manuela Schneider Die Waffe des Teufels
7026 Rudolph Kremer Die Turmkammer der schreienden Alraune
7027 Alfred Wallon Heimtückische Intriegen
7028 Marco Theiss Ein Texaner gegen Chicago
7029 Uwe Niemann Das unreine Herz
7030 Nils Noir Damn Evil
7031 Rudolph Kremer Die Höhle des blauen Drachen
7032 Wolfgang Rauh Ignael
Heimtückische Intrigen
ROBERT MORGAN No.02
Alfred Wallon
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
* * *
Copyright © 2025 Blitz Verlag, eine Marke der Silberscore Beteiligungs GmbH, Mühlsteig 10, A-6633 Biberwier
Redaktion: Danny Winter
Grafik & Umschlaggestaltung: Mario Heyer unter Verwendung der KI Software Midjourney
Satz: Gero Reimer
Alle Rechte vorbehalten.
www.blitz-verlag.de
7027 vom 26.03.2025
ISBN: 978-3-68984-387-8
Inhalt
Gallaghers Ende
Warten auf Rettung
Hinterhalt auf hoher See
Tage des Glücks
Ein verräterischer Plan
Flucht ins Ungewisse
Schicksalhafte Begegnung
In karibischen Gewässern
Spurensuche
Ein Begräbnis auf hoher See
Gefahr am Horizont
Kampf um Leben und Tod
Alfred Wallon
Gallaghers Ende
Josh Dobbs spürte die zornigen Blicke Leutnant Everhearts in seinem Rücken. Der breitschultrige Wärter kratzte sich immer wieder nervös über sein stoppeliges Kinn, während er versuchte, mit den Soldaten Schritt zu halten, und das zu einer Stunde, wo er normalerweise längst tief und fest schlief.
Aber in dieser Nacht war alles anders. Nicht nur, dass es jemand geschafft hatte, sich mit einem Vorwand und falschen Papieren Zugang zum Kerker des Tower zu verschaffen: Nein, es war diesen Bastarden sogar gelungen, einen Gefangenen zu befreien und dann mit ihm nicht nur aus dem Tower zu entkommen, sondern auch aus London.
Allein bei dem Gedanken daran, dass diese elenden Hundesöhne es geschafft hatten, einen erfahrenen Wärter wie ihn auszutricksen, wurde Dobbs wütend. Nicht nur er, sondern auch alle anderen, die in diesem Teil des Towers ihren Dienst taten, hatten von Admiral Fawcett höchstpersönlich einen gewaltigen Rüffel abbekommen. Der Admiral hatte sogar geschworen, Dobbs standrechtlich erschießen zu lassen, wenn er sein Spatzenhirn nicht sofort anstrengte und ihm erzählte, auf welche Weise das Ganze überhaupt hatte passieren können.
Josh Dobbs war ein Mann schlichten Gemütes, und wenn ein Mann wie Admiral Fawcett ihm drohte, dann war das kein Scherz. Deshalb hatte Dobbs natürlich vom ersten Besuch des Henkers erzählt, und von Tom Gallagher, der mit dem falschen Henker und einem verkleideten Priester in den Tower gekommen war.
Dobbs kannte Gallagher schon seit vielen Jahren. Warum hätte er jemals daran zweifeln sollen, dass ausgerechnet Tom Gallagher an diesem falschen Spiel beteiligt war? Und doch musste es so sein. Eine andere Möglichkeit gab es nicht, und genau deshalb war er jetzt mit Leutnant Everheart und fünf weiteren Soldaten auf dem Weg zu dem Haus, in dem Gallagher wohnte.
„Wie weit ist es noch?“
Leutnant Everhearts Stimme klang sehr ungeduldig. Auch er wollte so schnell wie möglich dem Admiral einen Erfolg melden, damit seine militärische Laufbahn nicht einen plötzlichen Knick bekam.
„Am Ende der Straße rechts“, erwiderte Dobbs rasch und zeigte in die betreffende Richtung. „Dort ist es das dritte Haus. Was wird mit Gallagher geschehen, Leutnant?“
„Das entscheidet der Admiral und nicht wir, Dobbs“, winkte der Offizier ab und gab seinen Soldaten ein kurzes Zeichen, die Gewehre bereit zu halten. „Los, weiter!“
Dumpf klangen die Schritte der Soldaten auf dem harten Kopfsteinpflaster der engen Gassen in diesem Stadtviertel. In keinem der Häuser brannte zu dieser späten Stunde noch Licht. Das war gut so, denn umso schneller konnten Leutnant Everheart, Josh Dobbs und die übrigen Soldaten ihren Plan in die Tat umsetzen.
Tom Gallaghers Haus wirkte von außen unscheinbar. Hier lebte kein Mann, der über große Reichtümer verfügte. In all den Jahren seiner Tätigkeit als Kerkerwärter hatte er zwar immer sein Auskommen gehabt, hatte aber auch kaum etwas für später zurücklegen können. Dobbs wusste nicht viel über Gallagher, außer dass er eine kranke Mutter hatte, die bei ihm im Haus lebte und die er noch versorgte.
„Zwei Mann gehen hinters Haus!“, befahl der Leutnant. „Ihr anderen kommt mit. Ihr schießt sofort auf meinen Befehl, wenn es nötig ist. Verstanden?“
Sekunden später stand der Leutnant vor der Tür und schlug mit der Faust dagegen.
„Gallagher!“, rief er mit lauter Stimme. „Aufmachen, aber sofort!“
Es interessierte ihn nicht, dass auch die anderen Bewohner in dieser Straße von dem Lärm geweckt wurden. Leutnant Everheart hatte einen Auftrag durchzuführen, und diese Sache hier wollte er so schnell wie möglich hinter sich bringen.
„Was ist denn?“, hörte er eine mürrische Stimme im Haus. „Wer ist da?“
„Mach auf, Gallagher, oder wir treten die Tür ein!“, rief der Leutnant. „Wird´s bald?“
Im Fenster neben der Tür war der flackernde Lichtschein einer Petroleumlampe zu erkennen. Schlurfende Schritte erklangen, und wenig später öffnete Gallagher die Tür. Er sah müde aus und machte einen niedergeschlagenen Eindruck.
„Warum stört Ihr mich, Leutnant?“, fragte er Everheart mit bitterer Stimme. „Mein Dienst beginnt erst morgen früh wieder und ...“
Der Leutnant trat einen Schritt nach vorn und stieß Gallagher den Gewehrkolben in den Magen. Das geschah so plötzlich, dass dieser laut aufstöhnte und zu Boden sank. Fassungslos sah er, wie die anderen Soldaten an dem Leutnant vorbei ins Haus stürmten.
„Seid Ihr wahnsinnig?“, beschwerte sich Gallagher unter Schmerzen. Aber der Blick des Leutnants war unbarmherzig. Auf sein Geheiß hin packten zwei Soldaten Gallagher an den Armen und rissen ihn einfach hoch, während aus dem oberen Stockwerk die besorgte Stimme seiner Mutter erklang.
„Du kommst mit uns, Tom“, sagte Josh Dobbs, der sich bis jetzt noch im Hintergrund gehalten hatte. „Ich fürchte, du wirst einige unangenehme Fragen zu beantworten haben. Und ich rate dir dringend, die Wahrheit zu sagen. Sonst ...“
Er sprach diesen Satz bewusst nicht zu Ende, bemerkte aber, wie es in Gallaghers Augen nervös aufflackerte. Dass dieser den Blicken des Leutnants auswich, war eindeutig.
„Tom!“, hörte Gallagher die besorgte Stimme seiner Mutter aus den oberen Räumen. „Was ist denn da unten? Ist jemand gekommen?“
„Ich muss noch mal weg, Mutter!“, rief Gallagher unter den höhnischen Blicken des Leutnants. „Es kann dauern!“
Mehr konnte er nicht mehr sagen, denn in diesem Moment zerrten ihn die beiden Soldaten einfach mit sich. Gallaghers Sorge um seine kranke Mutter bestimmte sein weiteres Denken und Handeln. Sein verzweifelter Blick richtete sich auf den Leutnant, der in der Nähe der Tür stand.
„Meine Mutter, Sir!“, rief er. „Sie ist krank und braucht Hilfe. Jemand muss nach ihr sehen. Bitte!“
„Das hättest du dir früher überlegen können, bevor du diesem Piratenpack geholfen hast, Gallagher“, antwortete Leutnant Everheart. „Für Verräter gibt es keine Gnade. Das müsstest du eigentlich wissen. Bringt diesen Bastard weg, Männer!“
Gallagher bäumte sich unter dem harten Zugriff der Soldaten auf, aber die machten kurzen Prozess mit ihm. Ein paar Schläge und Tritte ließen den Kerkerwächter ganz schnell verstummen. Erschöpft und stöhnend hing er in den Armen seiner Peiniger, die ihn einfach mit sich zogen.
„Gut gemacht, Dobbs“, lobte ihn der Leutnant. „Den ersten Teil hätten wir hinter uns.“
„Was geschieht mit der alten Frau?“, wollte Dobbs wissen, weil die verängstigten Rufe von Gallaghers Mutter immer noch zu hören waren.
„Das kümmert mich nicht“, erwiderte der Leutnant und schlug die Tür hinter sich zu.
* * *
„Er ist zäh“, sagte Admiral James Fawcett mit einem verständnislosen Blick auf den zitternden und blutenden Mann, der in der Ecke des Kerkers kauerte und wie ein in die Enge getriebenes Tier um sich blickte. „Ich verstehe nicht, warum er nicht redet. Sorgt dafür, dass er geständig ist. Wir haben keine Zeit zu verlieren!“
Leutnant Everheart und Josh Dobbs befolgten den Befehl des Admirals ohne Zögern. Damit der Kerkerwächter sich wieder Vorteile verschaffen konnte, übernahm er es selbst, auf den vor Angst laut schreienden Gallagher einzuschlagen und lachte dabei sogar gehässig. Einem Kerl wie Dobbs wäre jedes Mittel Recht gewesen, um die Schlappe wieder auszuwetzen, die er erlitten hatte. Schließlich war er doch von einem verkleideten Piraten überwältigt worden und hatte genauso wenig bemerkt, dass der Mönch und der Henker in Wirklichkeit zwei berüchtigte Piraten waren, die von der britischen Krone schon seit vielen Jahren gesucht wurden.
„Nicht mehr schlagen!“, schrie Gallagher und hob beide Hände vors Gesicht, um sich vor den Fäusten des breitschultrigen Dobbs zu schützen. Aber der war mitleidlos und prügelte weiter auf ihn ein. So lange, bis Gallagher schließlich die entscheidenden Worte brüllte: „Ich sage alles!“
Dobbs dagegen war so in Rage, dass er das zunächst gar nicht gehört hatte. Er fuhr damit fort, den wehrlosen Gallagher zu schinden, so dass ihn Leutnant Everheart schließlich davon abhalten musste, Gallagher totzuschlagen.
Admiral Fawcett beobachtete angewidert den schwitzenden Kerkerwärter und gab ihm zu verstehen, dass er jetzt verschwinden sollte. Dobbs verbeugte sich noch einmal demütig vor dem Admiral und verließ den Kerker ganz schnell.
„Gallagher, du bist nicht besonders schlau mit deiner Verstocktheit“, richtete der Admiral nun das Wort an den blutenden und stöhnenden Mann. Gallagher war so schwach, dass er sich aus eigener Kraft nicht mehr erheben konnte. Zwei Soldaten mussten ihn packen und hochreißen. „Ich sage es nicht noch einmal. Gestehe endlich, was du weißt, und ich sorge dafür, dass deine Strafe milde ausfallen wird. Also was ist jetzt?“
In den Augen des Gefangenen flackerte es unruhig. Er murmelte etwas Unverständliches vor sich hin und schaute immer wieder zur Kerkertür, wo Dobbs soeben verschwunden war.
„Soll ich ihn rufen lassen?“, fragte Admiral Fawcett und wischte sich mit der linken Hand ein imaginäres Staubkorn von seiner rechten Schulter. „Dobbs wäre sicherlich sehr froh darüber, seine Arbeit fortzusetzen.“
„Nein ...“, erwiderte Gallagher. „Alles, aber nur das nicht. Ich will ja ... alles sagen. Wirklich ...“
„Gut“, antwortete Fawcett. „Dann sind wir ja schon einen entscheidenden Schritt weitergekommen, Gallagher. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Geschichte.“
Er forderte den Gefangenen demonstrativ auf und wartete mit vor der Brust verschränkten Armen, was ihm der ehemalige Kerkerwärter zu berichten hatte. Zuerst kamen die Worte nur stockend über die aufgesprungenen Lippen des gepeinigten Mannes, aber mit jeder weiteren Minute redete Gallagher immer schneller. Weil er genau wusste, dass sein Leben davon abhing!
„In einer Hafenkneipe also“, sagte Admiral Fawcett. „Und du Narr hast diese Fremden einfach mit nach Hause genommen? Was für ein Leichtsinn!“
„Sie haben mir geholfen“, sagte Gallagher. „Sonst hätte man mich zusammengeschlagen und tot liegen lassen, Sir.“
Fawcetts Blick ließ Gallagher spüren, dass das vielleicht besser für ihn gewesen wäre. Er sprach es nicht aus, aber der eingeschüchterte Kerkerwächter hatte die Mimik auch so verstanden.
„Der Anführer erzählte von einem Schiff, das vor der irischen Küste ankert, Sir“, fuhr Gallagher rasch fort. „Dort sollten die anderen Männer auf die Rückkehr warten. Ich habe das nicht verstanden“, sagte Gallagher.
„Was hast du noch mitbekommen?“, fuhr ihn Admiral Fawcett wütend an.
„Nur das, Sir“, kam sofort die Antwort. „Ich schwöre es bei Gott und der Kirche.“
„Hast du denn nicht gewusst, wer diese Halunken wirklich sind, Mann?“, fragte der Admiral weiter. „Dir hätte doch klar sein müssen, dass du damit Hochverrat begehst.“
„Meine Mutter, Sir“, seufzte Gallagher. „Die Männer bedrohten sie mit dem Tod. Einer von ihnen blieb zuhause bei ihr. Er hätte sie kaltblütig getötet, wenn ich nicht ...“
„Kaum zu glauben“, murmelte Admiral Fawcett kopfschüttelnd. „Wegen einer alten Hexe muss die britische Krone den höhnischen Triumph eines berüchtigten Piraten erdulden. Und alles nur, weil dieser Trottel hier nicht Manns genug war, um die Obrigkeit zu informieren.“
Bei den letzten Worten schaute er zu Leutnant Everheart, der mit seinen Soldaten das Verhör bisher schweigend verfolgt hatte. Als dieser die Blicke des Admirals auf sich gerichtet fühlte, trat er einen Schritt nach vorn.
„Leutnant, Ihr und die übrigen Männer seid Zeugen, dass ein Mann aus Euren eigenen Reihen zum Verräter geworden ist. Er genoss das Vertrauen der britischen Krone, und er hat es schimpflich missbraucht. Dafür kann es nur eine Lösung geben, nicht wahr?“
„Natürlich, Sir“, sagte der Leutnant und stand stramm vor dem Admiral. „Wie lauten Eure Befehle, Sir?“
„Ich denke, dass wichtigere Dinge auf dem Spiel stehen als ein langwieriger Gerichtsprozess, an dessen Ende auch nur ein Urteil stehen kann“, erwiderte Fawcett. „Kraft meines Ranges erteile ich Euch und Euren Männern den Befehl, diesen Verräter auf der Stelle hinzurichten. Und wenn Ihr das Urteil vollstreckt habt, dann bringt die Leiche weg von hier. Verstanden?“
„Klar und deutlich, Sir“, versicherte Leutnant Everheart mit einem zackigen Gruß. „Soll es jetzt gleich geschehen?“
Der Admiral gab mit einem kurzen Nicken sein Einverständnis und verließ die Zelle mit schnellen Schritten. Die Angstschreie Gallaghers nahm er nur beiläufig wahr. Sie verstummten in dem Moment, als ein Schuss in der Zelle fiel. Leutnant Everheart hatte Fawcetts Befehl sofort ausgeführt.
* * *
Lord Peter Dawson stand die unruhige Nacht noch im Gesicht geschrieben, als ihn Admiral James Fawcett am frühen Morgen in seinem Haus am Grosvenor Square aufsuchte. Die Laune des Lords hatte den sprichwörtlichen Nullpunkt erreicht, weil dieser verfluchte Hundesohn Morgan alle getäuscht hatte. So kaltblütig war sein Plan gewesen, dass niemand mit den Folgen gerechnet hatte.
Auch Admiral Fawcett, der von einem Bediensteten in die Bibliothek des Lords gebracht wurde, blickte verärgert drein, als er Lord Dawson begrüßte. Ungeduldig wartete er ab, bis der Diener den Raum wieder verlassen hatte.
„Es gibt Neuigkeiten“, sagte Fawcett. „Deshalb bin ich gleich zu Euch gekommen, Lord Dawson. Ich hoffe, Ihr versteht, dass ich bereits die notwendigen Schritte in die Wege geleitet habe.“
„Ihr müsst schon etwas deutlicher werden“, erwiderte der Lord, während er zu einer Anrichte ging, zwei Gläser mit einer hellbraunen Flüssigkeit füllte und eines davon dem Admiral gab. Der nahm das Glas wortlos entgegen und trank es in einem Zug aus. Lord Dawsons Blick war missbilligend, weil Fawcett diesen guten Brandy nicht zu würdigen wusste. Aber er sagte ihm das nicht.
„Wir haben den Mann erwischt, der Morgan und seine Kumpane in den Tower brachte. Sein Name ist oder besser gesagt war Tom Gallagher. Ein Wächter des Towers, dessen Mutter Morgan als Druckmittel benutzt hat. Dieser Bastard ist wirklich mit allen Wassern gewaschen, das muss ich neidlos anerkennen. Aber wir haben dennoch etwas erfahren können. Dieser Gallagher war geständig.“
Fawcett berichtete dem Lord, was er von Gallagher erfahren hatte und bemerkte, wie überrascht dieser jetzt war.
„Ein zweites Schiff? Vor der irischen Küste? Natürlich, warum sind wir nicht von selbst auf diesen Gedanken gekommen“, murmelte der Lord mit wütendem Gesichtsausdruck.
„Ich habe keinen Anlass, an dieser Aussage zu zweifeln, Lord Dawson. Deshalb sind kurz vor Sonnenaufgang zwei Fregatten der Royal Navy in See gestochen, mit Kurs auf die irische Küste. Unsere Schiffe sind schnell und wendig. Wir haben somit wenigstens eine Chance, diesem Hund Morgan auf den Fersen zu bleiben. Weil er sicher nicht damit rechnet, dass er verfolgt wird.“
„Eine gute Entscheidung“, fügte Lord Dawson hinzu. „Ich wünschte, ich hätte mitkommen können. Diesem Bastard Morgan hätte ich sehr gern gegenübergestanden, wenn er hoffentlich bald in Ketten gelegt und zurück nach London gebracht wird.“
„Wir arbeiten daran“, meinte Admiral Fawcett. „Aber in der Zwischenzeit gilt es, den König zu verständigen. Habt Ihr schon ...?"
„Nein“, erwiderte Lord Dawson. „Seine Majestät, König George I. hält sich außerhalb von London auf und wird erst heute Mittag zurückerwartet. Ich denke, Ihr solltet ebenfalls mitkommen, wenn wir ihn über die Ereignisse im Tower informieren.“
„Darauf könnt Ihr euch verlassen“, stimmte Fawcett sofort zu. „Ich denke, wir werden eine geeignete Erklärung finden, damit der König uns weiterhin sein Vertrauen schenkt, oder?“
„Worauf Ihr Euch verlassen könnt“, lächelte Lord Dawson.
* * *
„Wie geht es ihm?“, fragte Morgan, als er die Tür zu seiner Kajüte öffnete und abwechselnd von Bart McCormack zu dem erschöpften jungen Mann blickte, der die Augen geschlossen hatte und dessen Stirn schweißüberströmt war.
„Nicht gut“, erwiderte der weißhaarige Seemann mit ernster Miene. „Jeffrey hat Fieber, Robert. Ich tue, was ich kann.“
Morgan trat ans Bett. In seinen stoppelbärtigen Gesichtszügen arbeitete es, als er sich über Jeffrey beugte und mit der rechten Hand nach dessen Stirn tastete. Er murmelte einen leisen Fluch, als er die Hitze spürte, die den Körper seines Sohnes nicht zur Ruhe kommen ließ.
„Was hast du ihm gegeben, Mac?“, wollte Morgan wissen. „Er schafft es doch, oder?“
„Alles, was Jeffrey braucht, ist ein erholsamer und tiefer Schlaf“, versuchte McCormack den Kapitän zu beruhigen. „Die Zeit im Kerker hat ihm sehr zugesetzt. Ganz zu schweigen von der Feuchtigkeit in diesem Rattenloch.“
„Ich könnte diese britischen Bastarde mit meinen eigenen Händen erwürgen“, sagte Morgan. „Was sie meinem Sohn angetan haben, werde ich niemals vergessen. Dafür werden sie alle bezahlen, Mac.“
„Deine Rechnung kannst du ihnen später präsentieren, Robert“, meinte McCormack. „Ich glaube, dies ist ganz sicher nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Wie sieht es am Horizont aus?“
„Keine Verfolger, wenn du das meinst“, erwiderte Morgan. „Bei diesem Hundewetter wagt sich kaum ein Schiff auf die offene See. Die warten alle ab, bis die dunklen Wolken weitergezogen sind und sich das Meer wieder beruhigt hat.“
„Beruhigt?“ McCormack runzelte die Stirn, weil ihm das stärkere Schwanken des Schiffes nicht entgangen war. „Mir kommt es so vor, als wenn der Sturm erst noch bevorsteht. Und zwar nicht mehr lange.“
Bei diesen Worten riskierte er einen Blick aus dem Lukenfenster der Kapitänskajüte. Was er sah, gefiel ihm ganz und gar nicht. Zunächst waren es nur vereinzelte trübe Wolken gewesen, die der aufkommende Wind vor sich hergetrieben hatte. Aber mittlerweile hatte sich dies noch verdichtet. Auch der Regen war stärker geworden, und der Wind peitschte die Wellen immer heftiger.
„Es ist nicht der erste Sturm, den wir meistern, Mac“, meinte Morgan, als er den skeptischen Blick seines alten Gefährten richtig deutete.
„Wenn ich auf den Planken des Seeadlers stünde, dann würde ich mir auch keine Sorgen machen“, entgegnete McCormack. „Aber ob dieses Schiff einem so schweren Orkan wirklich gewachsen ist?“
„Wir werden es bald herausfinden“, sagte Morgan und schaute noch einmal zu Jeffrey, dessen Lippen sich jetzt bewegten. Sekunden später murmelte er einige Worte im Schlaf vor sich hin, die Morgan und McCormack nur zur Hälfte verstanden.
„Er phantasiert im Fieber“, sagte der irische Seemann. „Wer weiß, was er in seinem Träumen alles durchmacht? Geh nach oben und bring das Schiff sicher durch den Sturm, Robert. Hier kannst du jetzt sowieso nichts tun. Ich bleibe hier bei deinem Sohn und lasse ihn keine einzige Sekunde aus den Augen. Mach dir keine Sorgen. Wenn es schlimmer wird, dann habe ich im Notfall noch die Kräutertropfen aus Hispaniola. Mir haben sie damals auch gegen das Fieber geholfen.“
In McCormacks Worten klang Zuversicht an. Das machte es Morgan leichter, die Kajüte wieder zu verlassen. Er nickte dem Iren noch einmal kurz zu, bevor er sich abwandte, die Tür hinter sich schloss und wieder an Deck ging.
Noch bevor er die Decksplanken betrat, hörte er schon die aufgeregte Stimme von Barnabas, der am Achterdeck stand und zusammen mit Morton und Wallace besorgt in Richtung Kimm blickte. Dort hatte sich eine schwarze Wolkenfront gebildet, die genau in Richtung der Bainbridge trieb. Auch der Wind hatte an Intensität zugenommen und bauschte die Segel stark auf.
„Refft die Segel!“, erklang Morgans lauter Befehl an die Männer, die in seinem Blickfeld standen. „Fock- und Besanmast. Seid ihr noch nicht oben in den Wanten? Nun macht schon. Der Sturm wird uns bald erreichen!“
Die Männer beeilten sich, die Befehle ihres Kapitäns auszuführen. Wieselflink kletterten sie hinauf in die Wanten und verrichteten ihre Arbeit teilweise in schwindelnder Höhe. Die Bainbridge tanzte jetzt noch stärker auf den Wellen als vor einer halben Stunde, und dieses Schwanken machte sich hoch oben in den Masten besonders bemerkbar. Aber Morton, Wallace und Barnabas waren erfahrene Seeleute und wussten genau, was sie in solch einer Situation zu tun hatten.
Während sich die Männer um die Segel kümmerten, ging Morgan rasch zum Steuerruder, wo der tätowierte Davies stand. Normalerweise hätte McCormack diese Aufgabe erfüllt, aber Morgan war es lieber, dass sich der Ire um seinen Sohn Jeffrey kümmerte und noch ein wenig auf ihn aufpasste. Denn McCormack war der Einzige an Bord, der einige medizinische Kenntnisse besaß. Wenn es einer schaffte, Jeffrey wieder auf die Beine zu bringen, dann nur McCormack.
„Ich übernehme das Steuer“, sagte Morgan.
„Aye, Kapitän“, antwortete Davies und trat sofort wieder zurück. Besorgt blickte auch er auf die schwarze Wolkenwand, die sich mit geradezu beängstigender Geschwindigkeit näherte. Von einem Augenblick zum anderen öffnete der Himmel plötzlich seine Schleusen, und es begann heftig zu regnen. Wie aus Kübeln goss es, während in der Wolkenwand mehrere helle Blitze zuckten und kurz darauf ein heftiger Donnerschlag folgte.
Das Heulen des Windes wurde jetzt so stark, dass die Rufe der Männer von Backbord gar nicht mehr zu hören waren. Aber Morgan wusste, dass er sich auf jeden einzelnen von ihnen verlassen konnte. Er schaute kurz hinauf zu den Masten und sah, dass seine Leute die Segel gerefft hatten. Jetzt hatte der Wind nicht mehr ganz so viel Angriffsfläche wie zuvor, so dass Morgan keine Probleme mit dem Steuern hatte.
Nur wurden die Wellen immer höher. Gischt spritzte über das Deck und ließ die Planken glitschig werden. Morgans Männer hatten sich an die Masten gebunden, um sich vor weiteren Wellen zu schützen. Nur Sekunden später war es wieder soweit. Von Steuerbord her näherte sich ein weiterer Brecher der Bainbridge und erwischte das Schiff auf der gesamten Breitseite.
Die Schreie seiner Männer verstummten, und auch Morgan hatte Mühe, in der allgegenwärtigen Gischt überhaupt noch etwas erkennen zu können. Aber er hielt das Steuerruder fest mit beiden Händen und somit die Bainbridge weiter auf Kurs. Sekunden später atmete er erleichtert auf, als er sah, dass keiner seiner Leute über Bord gegangen war und die Welle ansonsten keinen Schaden angerichtet hatte.
Um das Schiff herum tobte ein Orkan, der die Bainbridge auf den hohen Wellen tanzen ließ. Wäre Robert Morgan nicht so ein erfahrener Seemann und Kapitän gewesen, dann hätten er und seine Mannschaft große Probleme gehabt, das Schiff durch den Sturm zu steuern. Morgan blickte weiter in Richtung Kimm und hoffte, dass sich die dunklen Wolken bald verzogen. Aber ein Ende dieses Sturms war noch lange nicht in Sicht. Stattdessen bäumte sich die Bainbridge immer mehr gegen die hohen Wellen auf, und ein Ruck ging durch das gesamte Schiff, wenn der Wind eine weitere Welle auf das Segelschiff zutrieb.
„Die Hölle will uns noch nicht“, murmelte Morgan und hielt die Bainbridge weiter auf Kurs. Er war durchnässt bis auf die Haut und zitterte angesichts des schneidenden Windes. Aber jetzt Schwäche zu zeigen, hätte den Anfang vom Ende bedeutet. Morgans Gedanken konzentrierten sich ganz auf das Ziel, das er mit dem Schiff unbedingt erreichen wollte. Und auch kein noch so starker Orkan würde ihn davon abhalten!
„Wasser im Laderaum!“, schrie auf einmal eine besorgte Stimme durch das Heulen des Windes. Es war Muggins, der eben noch unter Deck gewesen war und einigen Kameraden zuwinkte. Die Männer banden die Taue los, mit denen sie sich an den Masten festgezurrt hatten und folgten ihrem Kameraden unter Deck, bevor eine weitere Welle über die Schiffsplanken spülte.
„Davies!“, rief Morgan durch den Sturm und gestikulierte mit der linken Hand dem Seemann zu, näher zu kommen. „Geh unter Deck und sieh nach, was da los ist. Gib mir sofort Bescheid!“
Der tätowierte Seemann nickte und spurtete sofort los. In diesem Moment trieb der Wind eine weitere hohe Welle heran, die der Bug spaltete. Trotzdem spritzte die Gischt so hoch, dass Davies mitgerissen wurde. In letzter Sekunde konnte er sich noch am Bugspriet festklammern, sonst wäre er vom Sog mitgerissen worden. Er winkte Morgan kurz zu, um ihm zu signalisieren, dass alles in Ordnung war und begab sich rasch unter Deck.
Die englische Küste schien sich vor Morgan in einer anderen Welt zu befinden. Auch wenn die Bainbridge nur wenige Meilen vom Festland entfernt war, so bekamen er und seine Mannschaft die Stärke des Sturms in ihrer ganzen Härte zu spüren. Jedes andere Schiff hatte wahrscheinlich beim Aufziehen der schwarzen Wolkenfront sofort einen anderen Kurs eingeschlagen und sich längst in einem sicheren Hafen oder in einer geschützten Bucht befunden, um dort solange zu warten, bis der Sturm vorübergezogen war.
Das gibt uns den Vorsprung, den wir dringend brauchen, dachte Morgan. Hauptsache, wir erreichen die irische Küste so schnell wie möglich und können dann mit dem Seeadler weg. Das englische Hoheitsgebiet sollten wir in den nächsten Monaten besser meiden.
Erneut tauchte der Bug der Bainbridge tief in das Wellental ein und zog sofort eine weitere Wassermenge über das gesamte Deck nach sich. Die Masten knarrten gefährlich, aber sie hielten dem Druck des Sturms stand.
Davies kam wieder an Deck. Er bahnte sich seinen Weg durch den peitschenden Regen und den heulenden Wind und musste erst einmal verschnaufen, als er die Brücke und seinen Kapitän erreicht hatte.
„Alles unter Kontrolle!“, rief er.
Morgan atmete auf, als er das hörte.
„Wie viel Wasser ist im Laderaum?“, wollte er wissen.
„Es steht kniehoch!“ rief Davies. „Aber Muggins und die anderen schuften wie Sklaven. Wir schaffen das, Kapitän!“
„Wenn das hier vorbei ist, spendiere ich ein Fass Rum!“, entscheid Morgan. „Geh zurück zu den anderen und pack mit an. Und sag ihnen, dass ich das Schiff sicher auf Kurs halte!“
„Aye“, antwortete Davies und spurtete sofort wieder los. Noch bevor er den Zugang zum Unterdeck erreicht hatte, klarte an der Kimm der dunkle Himmel auf. Das Heulen des Windes ließ nach, und auch der peitschende Regen flaute ab.
„Endlich“, murmelte Morgan. „Das war verdammt knapp.“
Die Anspannung, die von ihm Besitz ergriffen hatte, wich und machte einer Zuversicht Platz, die ihn zum ersten Mal wieder lächeln ließ. Auch die Männer an Deck hatten bemerkt, dass der unangenehme Regen endlich nachließ und die trüben Wolken weiter in Richtung Osten zogen, genau auf die englische Küste zu. Umso besser!
„Worauf wartet ihr?“, rief Morgan seinen Männern zu. „Segel setzen! Beeilt euch!“
Er beobachtete nur kurz, wie die Seeleute seinen Befehl ausführten und wandte sich dann an Davies, der sich jetzt wieder in der Nähe der Brücke aufgehalten hatte.
„Übernimm das Steuer“, sagte er. „Kurs auf Nordwesten.“
„Aye, Sir“, meinte Davies und nahm sofort seine Position ein. „Wir haben es wieder einmal geschafft, oder?“
„Sieht so aus“, sagte Morgan und verließ die Brücke. Das Schiff schwankte immer noch stark, und der Wellengang war alles andere als ruhig. Aber wenigstens hatten die großen Brecher nachgelassen, die ihre Gischt über das Deck spülten. Die Planken waren immer noch sehr glatt, aber Morgans Schritte waren sicher. Er erreichte den Treppengang, der zum Ladenraum führte und stieg die Stufen rasch nach unten.
Von weitem schon hörte er die Rufe der Männer. Sie hatten eine Kette gebildet und versuchten, Herr über das eindringende Wasser zu werden. Muggins hatte das Kommando und sorgte dafür, dass die Seeleute wie ein Uhrwerk funktionierten. Die Männer waren so mit ihrer Arbeit zugange, dass sie Morgan zunächst gar nicht bemerkten.
„Wie sieht´s aus, Muggins?“, wollte Morgan wissen, während ein prüfender Blick alles aufnahm, was um ihn herum geschah.
„Es hätte schlimmer sein können“, erwiderte Muggins und wischte sich über die schweißfeuchte Stirn. „Wir haben die lecke Stelle mittlerweile abgedichtet. Und das bisschen Wasser hier kriegen wir auch noch aus dem Laderaum. Keine Sorge.“
„Gut“, antwortete Morgan. „Sag mir Bescheid, wenn ihr zusätzliche Leute braucht.“
„Für diesen Kleinkram doch nicht“, sagte Muggins. „Die anderen haben doch oben an Deck sicher auch genug zu tun. Wir schaffen das allein, Kapitän. Vielleicht noch eine Stunde, dann ist alles erledigt.“
Damit gab sich Morgan zufrieden. Er wandte sich wieder ab, schritt über den langen und schmalen Gang zurück in den Bereich des Schiffes, wo sich seine Kajüte befand. Auf halbem Weg dorthin begegnete ihm ein sichtlich aufgeregter Bart McCormack.
„Ist was mit dem Jungen?“, fragte Morgan.
„Ach was“, erwiderte der weißhaarige Ire. „Der hat den ganzen Orkan überhaupt nicht mitbekommen. Der schläft so sicher wie in Abrahams Schoß, und das ist auch besser so. Was ist oben an Deck? Ich wollte gerade hinaufgehen und ...“
„Alles unter Kontrolle, Mac“, unterbrach ihn Morgan. „Davies steht am Steuerruder. Du musst ihn noch nicht ablösen. Es ist mir wichtiger, dass du bei Jeffrey bleibst.“
„Den besorgten Großvater spiele ich aber nicht auf immer und ewig, Robert“, sagte McCormack seufzend. „Ich habe auch noch andere Aufgaben an Bord.“
„Die wirst du wieder schneller übernehmen als dir lieb ist“, antwortete Morgan und betrat zusammen mit McCormack kurze Zeit später seine Kajüte. Ein kurzer Blick zu Jeffrey zeigte ihm, dass der Ire sich gut um den Jungen gekümmert hatte. Er schlief immer noch, aber seine Züge waren jetzt wesentlich entspannter als zuvor. Als er die Stirn Jeffreys berührte, fühlte er sofort, dass auch das Fieber nicht mehr so stark war. Ein gutes Zeichen!
In diesem Moment öffnete Jeffrey die Augen und blickte im ersten Moment verwirrt um sich.
„Es ist alles in Ordnung, Junge“, redete Morgan sofort auf ihn ein. „Du bist in Sicherheit.“
„Wo ... wo bin ich?“, fragte Jeffrey mit krächzender Stimme. „Ich habe ... Durst ...“
„Du bist an Bord der Bainbridge, Jeffrey“, klärte ihn Morgan auf, während McCormack nach dem Wasserkrug griff, einen Becher einschenkte und ihn Morgan reichte. Er half Jeffrey beim Trinken. „Der Kerker liegt hinter dir. Du musst dir keine Sorgen mehr machen.“
Er bemerkte den unsicheren Blick seines Sohnes und überlegte fieberhaft nach den passenden Worten. Für Morgan war es nach diesen langen Jahren der Trennung sehr ungewohnt, auf einmal seinem Sohn gegenüber zu sitzen und ihm Mut zu machen. Deshalb war er froh darüber, als McCormack das Wort ergriff.
„Wir sind auf dem Weg nach Irland, Jeffrey. Und dann bekommst du endlich ein richtiges Schiff zu sehen. Der Seeadler wartet dort auf uns, und danach verlassen wir Europa.“
„Ja, aber was ist denn mit ...?“ Jeffreys Gedanken überschlugen sich. Natürlich dachte er in diesem Augenblick an seine Vergangenheit, die wohlbehütet und ohne Sorgen gewesen war.
„Vergiss es“, fuhr Morgan fort. „Man weiß jetzt, dass du mein Sohn bist. In England bist du nicht mehr sicher. Deshalb nehmen wir dich mit in die Karibik, Junge.“
Er bemerkte das überraschte Aufleuchten in Jeffreys Augen. Was mochte dem Jungen jetzt wohl durch den Kopf gehen?
„Ich weiß, dass das jetzt sehr viel auf einmal für dich ist, Jeffrey“, sprach er weiter. „Aber manchmal entwickeln sich die Dinge eben ein wenig anders als man geplant hat. Und glaub mir bitte eins: Ich habe nicht gewollt, dass du in diese Dinge mit hineingezogen wirst. Ich weiß nicht, wie das überhaupt geschehen konnte. Aber ich werde es herausfinden, das schwöre ich.“
Bevor Jeffrey darauf etwas erwidern konnte, wandte er sich ab und verließ die Kajüte. McCormack hatte noch einen kurzen Blick auf Morgans Gesicht werfen und feststellen können, dass es von Emotionen gezeichnet war. Er bemerkte natürlich auch Jeffreys fragende Blicke und wusste, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt war, um gegenseitige Vergangenheitsbewältigung zu betreiben.
„Er ist manchmal etwas rau, Jeffrey“, sagte McCormack, nachdem Morgan die Kabine verlassen hatte. „Verzeih ihm seinen Umgangston. Er muss erst noch lernen, was es bedeutet, einen Sohn an seiner Seite zu haben.“
„Aber warum hat er sich all die Jahre über nicht gemeldet?“, fragte Jeffrey. „Ich wusste überhaupt nichts von ihm bis zu dem Zeitpunkt, als die Soldaten des Königs mich ergriffen und in den Tower brachten. Glaubt mir, ich war völlig ahnungslos.“
„Das kann ich mir gut vorstellen“, murmelte McCormack. „Aber dein Vater hat sehr viel riskiert, als er von deiner Gefangennahme erfuhr. Er hielt sich auf New Providence auf, als ihm die Nachricht überbracht wurde. Und von diesem Zeitpunkt an plante er nichts anderes als deine Befreiung. Er hat dabei nicht nur sich in große Gefahr gebracht, sondern auch die Mannschaft. Aber es gab keinen unter ihnen, der in solch einem Moment gezögert hätte.“
„Wer ist er wirklich?“, hakte Jeffrey nach. „Diese beiden Männer im Kerker: Sie nannten ihn den Schwarzen Piraten.“
„Ich kann dir einiges über Robert Morgan erzählen, Jeffrey“, antwortete McCormack. „Aber ich denke, dass dies dein Vater besser selbst tun sollte. Diese Gelegenheit wird sich schon bald ergeben. Hab bis dahin Geduld, Junge. Und versuche ihn zu verstehen. Dein Vater hat es nicht leicht gehabt in all den Jahren. Gib ihm nur eine Chance. Um mehr möchte und kann ich dich nicht bitten.“
„Diese Männer, die mich gefangen nehmen ließen“, ließ Jeffrey dennoch nicht locker. „Was haben sie mit meinem Vater zu tun?“
„Das ist eine sehr lange Geschichte“, winkte McCormack ab. „Ich weiß selbst nicht alles darüber. Aber du wirst sie erfahren. Ganz bestimmt sogar. Und jetzt ruhst du dich besser wieder ein wenig aus. Sei froh, dass du so tief und fest geschlafen hast. Wir haben nämlich einen heftigen Orkan hinter uns, der die Bainbridge arg mitgenommen hat. Ich muss jetzt mal nach oben gehen und nach dem Rechten sehen. Kommst du allein klar?“
Jeffrey nickte.
„Ich sehe nachher nochmal nach dir“, versprach ihm McCormack und ging zur Tür der Kajüte. „Einverstanden?“
„Einen Moment noch!“, ließ ihn Jeffrey innehalten, als McCormack die Tür schon geöffnet hatte. „Sagt ihm bitte, dass ich mich für alles bedanke. Und auch dafür, dass Ihr selbst auch Eurer Leben riskiert habt, Sir.“
„Ich bin kein Sir“, brummte McCormack. „Wenn du mit mir reden willst, dann tu das ganz normal. Ich heiße Bart McCormack. Meine Freunde nennen mich übrigens Mac. Wenn du willst, kannst du mich auch so nennen.“
„Klar“, erwiderte dieser. „Trotzdem danke, Mac.“
„Ist doch selbstverständlich“, schmunzelte McCormack und schloss die Tür hinter sich. Über den schmalen Gang erreichte er die Treppe zum Oberdeck und stand wenige Augenblicke später im Freien. Die Planken waren noch feucht von dem heftigen Regenguss, und von Osten kam jetzt eine frische Brise, die die Segel aufbauschte. Morgan hatte sofort auf den Wetterumschwung reagiert und die Segel setzen und neu ausrichten lassen. Die Bainbridge nahm weiter Kurs in Richtung Nordwesten.
McCormack ging zur Brücke, wo Davies am Steuerruder stand. „Wird Zeit, dass ich dich ablöse“, meinte er zu dem tätowierten Seemann. „Oder hat der Kapitän während meiner Abwesenheit andere Befehle ausgegeben?“
„Nein“, erwiderte Davies. „Das Ruder gehört wieder dir, Steuermann.“ Er überließ McCormack den Posten. „Was ist mit dem Jungen? Wie geht es ihm?“
„Schon viel besser“, antwortete der weißhaarige Ire. „Als er an Bord kam, war er total erschöpft und hatte Fieber. Aber jetzt denke ich, dass er sich langsam wieder erholt.“
„Das ist gut“, meinte Davies. „Der Kapitän ist nervös. Er versucht es sich nicht anmerken zu lassen. Aber jedes Mal, wenn er sich unbeobachtet glaubt, dann ...“
„Ich weiß, was du meinst“, setzte McCormack die Gedankengänge seines Kameraden fort. „Ruh dich jetzt auch ein paar Stunden aus. Ich rufe nach dir, wenn du gebraucht wirst. Wo ist Morgan?“
„Eben war er noch hier“, sagte Davies und ließ seine Blicke über das Deck schweifen. „Da vorn steht er jetzt, direkt am Bug.“ Er zeigte mit der rechten Hand in die betreffende Richtung. „Was ihm jetzt wohl durch den Kopf geht?“
„Wenn er will, dass wir das wissen sollen, dann wird er uns das schon sagen“, antwortete McCormack und gab Davies mit einem eindeutigen Blick zu verstehen, dass er darüber nicht weiter sprechen wollte. Davies verzog sich daraufhin wieder unter Deck, während McCormack die Bainbridge sicher über das Meer steuerte und die Distanz zur britischen Küste mit jeder weiteren Stunde immer größer wurde.
* * *
Die ganze Zeit über stand Robert Morgan am Bug und schaute hinaus aufs offene Meer. Niemand von den anderen Mannschaftsmitgliedern kam in seine Nähe oder sprach ihn direkt an. Alle spürten, dass Morgan allein mit sich und seinen Gedanken sein wollte. So verging eine gute halbe Stunde, bis er sich schließlich abwandte und zurück zur Brücke ging.
„Wurde Zeit, dass du kommst, Robert“, sagte McCormack zu ihm. „Ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie lange du eigentlich noch Trübsal blasen willst.“
Morgan blickte überrascht auf. In diesem Ton durfte kein anderer der Mannschaft mit ihm reden. Aber Bart McCormack war ein Vertrauter, und es war nicht das erste Mal, dass Morgan mit ihm über ganz persönliche Dinge redete. Aber noch zögerte er. McCormack machte deshalb den Anfang an und kam auf das zu sprechen, wovon er vermutete, dass es den Schwarzen Piraten schon seit geraumer Zeit beschäftigte.
„Willst du darüber reden?“, fragte er ihn direkt und sah, dass Morgan seufzte und schließlich nickte.
„Mac, ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte dafür finde“, setzte Morgan zu einer Erklärung an. „Aber alles ist so neu und verwirrend. Als ich von Jeffreys Ergreifung erfuhr, stand für mich von Anfang an fest, dass wir etwas tun müssen, um ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien.“
„Das haben wir ja auch getan“, warf der irische Seemann mit ein. „War das vielleicht nicht richtig?“
„Natürlich war es das. Aber jetzt, wo ich den Jungen so ganz nah vor mir sehe, ist das kein abstrakter Gedanke mehr, verstehst du? Es wird persönlich.“
„War es das nicht von Anfang an, Robert?“





























