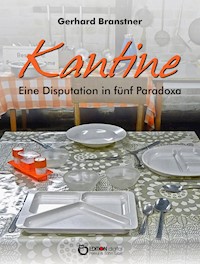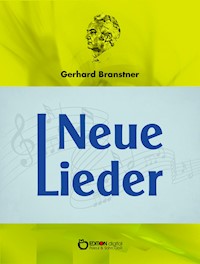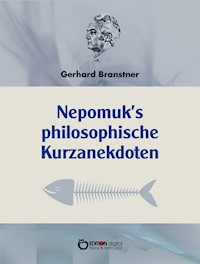7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem Band sind 3 Texte zu finden, die alle mit dem Theater und mit seinem Lieblingsthema Heiterkeit zu tun haben: „Kantine“ von 1977, „Kunst des Humors - Humor der Kunst“ von 1980 und „Das eigentliche Theater oder Die Philosophie des Augenblicks“ von 1984. „Kantine“ spielt tatsächlich in der Kantine eines Theaters, wo sich fünf Personen zu einer Disputation treffen, um über das Theater zu reden, als da sind ein optimistischer Gast namens Toredid, ein skeptischer Theaterkritiker namens Pirol, der gutgläubige Schauspieler Hermann, der Gelegenheitsklavierspieler Alfons und die Kantinenkellnerin Liesbeth. Gegenstand ihrer Disputation ist die Frage, ob große Kunst in unserer Zeit möglich ist. Im Verlaufe des Gesprächs wird eine kühne Behauptung aufgestellt: Pirol: Wir leben in einer Zeit, in der nur schlechte Stücke geschrieben werden können. Nicht, dass unsere Zeit an sich schlecht wäre. Wer wollte das behaupten? Aber es ist eine schlechte Zeit für gute Stücke. Toredid: Ein interessanter Gedanke. Pirol: Sie teilen meine Meinung nicht? Toredid: Ich bin genau der entgegengesetzten. Keine Zeit war so gut für gute Theaterstücke wie unsere. Pirol: Eine kühne Behauptung. Toredid: Eine andere aufzustellen würde sich nicht lohnen. Pirol: Und der Beweis? Toredid: Er wird nicht kurz sein, aber heiter. Pirol: Da lache ich schon jetzt. Toredid: Tun Sie es, solange Ihnen noch danach zumute ist. Pirol: Gehn wir in den Ring. Sie für die Behauptung, dass heutzutage große Kunst möglich ist, und ich für die gegenteilige. Auf den Ausgang dieser Auseinandersetzung darf man gespannt sein. Der zweite Text „Kunst des Humors – Humor der Kunst. Beitrag zu einer fröhlichen Wissenschaft“ entstand ursprünglich als Dissertation und wurde - von einem halben Dutzend Professoren abgelehnt. Die Argumente waren durchweg komisch, das komischste aber war, dass der Humor kein seriöser (wissenschaftlicher) Gegenstand sei. Komik vergeht, Humor besteht. Eine Theorie über ihn allerdings nur, wenn sie tatsächlich von wissenschaftlichem Ernste ist. Der Leser hat die Möglichkeit, sich sein eigenes Urteil zu machen, denn die Arbeit wird in ihrem Inhalt unverändert gedruckt; sie hat nur eine gefälligere Form erhalten, wie sie diese auch vor zwanzig Jahren erhalten hätte, wäre damals ihre Veröffentlichung gegeben gewesen. Im dritten Text „Das eigentliche Theater oder Die Philosophie des Augenblicks“ befasst sich der Autor mit den Gesetzen, mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Theaters.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Gerhard Branstner
Heitere Poetik
Von der Kantine zum Theater
Das Buch erschien 1988 im Mitteldeutschen Verlag Halle - Leipzig.
Die Erstveröffentlichung von „Kantine“ erfolgte 1977 beim VEB Hinstorff Verlag Rostock, die Erstveröffentlichung von „Kunst des Humors - Humor der Kunst“ 1980 und von „Das eigentliche Theater oder Die Philosophie des Augenblicks“ 1984 beim Mitteldeutschen Verlag Halle - Leipzig
ISBN 978-3-96521-768-3 (E–Book)
Titelbild: Ernst Franta
© 2022 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E–Mail: verlag@edition–digital.de
Internet: http://www.edition-digital.de
KANTINE
Eine Disputation in fünf Paradoxa
Ein optimistischer Gast namens Toredid, ein skeptischer Theaterkritiker namens Pirol, der gutgläubige Schauspieler Hermann, der Gelegenheitsklavierspieler Alfons und die Kantinenkellnerin Liesbeth disputieren die Frage, ob große Kunst in unserer Zeit möglich ist, und überprüfen dabei auch vergangene und künftige Zeiten.
Alfons spielt eine Fantasiemischung auf dem Klavier. Sobald der Vorhang sich gänzlich geöffnet hat, wendet Alfons sich um, bohrt sich in den Zähnen und blickt auf Pirol. Der sitzt allein an seinem Tisch und starrt in den vor ihm stehenden Kaffee. Liesbeth lehnt gähnend an der Theke und hascht ohne Ehrgeiz nach einer vor ihrer Nase umherschwirrenden Fliege. Gedämpfte Musik klingt auf.
Liesbeth: Die Vorstellung beginnt.
Pirol: Ich kann es nicht verhindern.
Liesbeth stellt den Bühnenlautsprecher ein. Musik schwillt an, und Beifall klingt auf. Liesbeth will etwas sagen, gibt es aber mit Blick auf Pirol auf, stellt den Lautsprecher ab. Alfons spielt wieder Klavier. Toredid tritt ein, sieht sich um, woran man erkennt, dass er ortsfremd ist. Liesbeth geniert sich wegen ihrer legeren Haltung und stellt sich adrett hin; man sieht ihr an, dass der Gast sie irritiert. Alfons spielt noch ein paar Takte, hört wie hypnotisiert auf und wendet sich langsam um. Allein Pirol achtet nicht auf den Fremden, stiert weiter in seinen Kaffee. Toredid hat etwas Anonymes, Zeitloses an sich: der altmodische Hut, Anzug und Stockschirm kontrastieren auf seltsame Art mit seinem jugendlichen Aussehen und seinem freien Benehmen. Er tritt an Pirols Tisch.
Toredid: Bitte, ist dieser Stuhl frei?
Pirol: blickt erstaunt auf. Nicht nur dieser. Weist auf die übrigen Tische, die alle unbesetzt sind.
Toredid blickt zu Liesbeth. Sie kommt sogleich heran. Toredid reicht ihr Hut und Schirm. Sie hatte eine Bestellung erwartet, nimmt in ihrer Verblüffung jedoch Hut und Schirm und bringt beides zum Kleiderständer.
Toredid verneigt sich leicht gegen Pirol.Toredid.
Pirol: Pirol.
Toredid: Ich weiß. Setzt sich.
Pirol: Sie kennen mich?
Alfons: der bereits einiges getrunken hat Wer kennt Pirol nicht? Den unfehlbaren Theaterkritiker! Und weshalb ist er unfehlbar? Weil er seine Kritik immer erst nach der fünfzigsten Vorstellung eines Stückes schreibt.
Toredid: zu Liesbeth Einen Kaffee bitte.
Pirol: Ein Stück, das fünfzig Vorstellungen erreicht, muss entweder sehr gut oder sehr schlecht sein. Und da es gute Stücke nicht gibt, weiß ich bei einem, das die fünfzigste Vorstellung erlebt, genau, woran ich mit ihm bin.
Toredid: Heute wird ein Stück das fünfzigste Mal gegeben. Beifall ist zu hören. Die Vorstellung hat bereits begonnen.
Pirol: Sie möchten wissen, weshalb ich in der Kantine sitze statt im Parkett?
Toredid: Ich nehme an, Sie sind sich diesmal doch nicht ganz sicher, ob es ein schlechtes Stück ist, das die fünfzigste Vorstellung erreicht hat. Und um einem Fehlurteil zu entgehen, sehen Sie es sich gar nicht erst an.
Alfons: Das hat gesessen. Lacht schadenfroh
Pirol: steht drohend auf Wie war Ihr Name?
Toredid: ungerührt freundlich Toredid.
Pirol: Nie gehört. Setzt sich wieder. Einen seltenen Namen soll man nicht ausrotten.
Toredid: Das ist weltmännisch gedacht.
Hermann kommt in voller Maske herein.
Hermann: in fröhlicher Wut Ein Miststück ist das! Ein Scheißstück! Ahmd, Liesbeth!
Liesbeth: Ahmd, Hermann!
Hermann setzt sich ohne Umstände zu Pirol und Toredid an den Tisch.
Hermann: zu Liesbeth Kurz und klar!
Liesbeth bringt einen Klaren.
Hermann: Ich möchte bloß wissen, was so ein Autor sich dabei denkt! Zwei Sätze am Anfang und zwei Sätze am Schluss, und die zwei Stunden dazwischen kann ich in der Kantine hocken; das soll nun eine Rolle sein! Zwei Stunden Kantine, und das fünfzigmal. Macht genau hundert Stunden. Pro Stunde zwei Klare, macht zweihundert Klare. Trinkt das Glas aus, stülpt es auf den Zeigefinger und reckt ihn hoch. Das geht ins Geld. Liesbeth bringt ein gefülltes Glas, nimmt das geleerte vom Finger, Hermann schleckt ihn ab. Aber daran denkt so ein Autor nicht. Und das Publikum, das denkt auch nicht an so was. Sitzt da unten und lacht blöd. Zu Pirol. Was sagst du denn dazu, du bist doch Kritiker?
Pirol: Was soll ich dazu sagen?
Hermann: Dass ich recht habe, sollst du sagen! Ums Maul sollst du mir gehen, wozu bist du Kritiker! Also, was sagst du?!
Pirol: Nichts.
Hermann: zu Toredid Da haben Sie’s! Entweder gehen sie einem ums Maul, oder sie halten, wenn sie nicht wissen, ob’s das richtige Maul ist, die Klappe. Das sind mir Kritiker! Wer sind Sie denn überhaupt?
Toredid: Toredid.
Hermann: Nie gehört. Erhebt sich wie vordem Pirol. Nichts für ungut, muss mal telefonieren. Ab. Kunstpause. Alfons wendet sich zum Klavier und spielt ein paar rauschende Takte, hört abrupt wieder auf. Kunstpause.
Pirol: Es kann kein gutes Stück sein.
Toredid: Aber sicher sind Sie sich nicht.
Pirol: Wir leben in einer Zeit, in der nur schlechte Stücke geschrieben werden können. Nicht, dass unsere Zeit an sich schlecht wäre. Wer wollte das behaupten? Aber es ist eine schlechte Zeit für gute Stücke.
Toredid: Ein interessanter Gedanke.
Pirol: Sie teilen meine Meinung nicht?
Toredid: Ich bin genau der entgegengesetzten. Keine Zeit war so gut für gute Theaterstücke wie unsere.
Pirol: Eine kühne Behauptung.
Toredid: Eine andere aufzustellen würde sich nicht lohnen.
Pirol: Und der Beweis?
Toredid: Er wird nicht kurz sein, aber heiter.
Pirol: Da lache ich schon jetzt.
Toredid: Tun Sie es, solange Ihnen noch danach zumute ist.
Pirol: Gehn wir in den Ring. Sie für die Behauptung, dass heutzutage große Kunst möglich ist, und ich für die gegenteilige.
Toredid: Und in welcher Runde wünschen Sie, k. o. zu
Pirol: Wer gewonnen hat, entscheiden nicht Sie.
Alfons: Wir brauchen einen Schiedsrichter.
Toredid: Das Publikum soll Richter sein.
Pirol: Einverstanden.
Alfons: deutet auf dem Klavier einen Tusch an Das Spiel kann beginnen.
Pirol: Was ist das Charakteristikum unserer Zeit? Die Diskussion. Es wird viel diskutiert, aber wenig gestritten. Wir haben zu wenig strittige Punkte und zu viel unstrittige. Die Kunst, jedenfalls die dramatische, lebt aber vom Streit.
Toredid: Das ist richtig. Und das Gegenteil ist auch richtig-
Pirol: Auch? Hätte sich beinahe am „auch“ verschluckt
Toredid: amüsiert Auch.
Pirol: Das ist ein Paradoxon.
Toredid: Ganz recht.
Toredid steht auf, nimmt den Schirmstock, spickt ihn nahe der Rampe in den Boden, zieht den Stiel wie ein Mikrofonstativ hoch, klappt den Griff wie ein Notenpult auseinander und legt ein Manuskript auf das so entstandene Katheder. Zieht das Lesezeichen, ein Kinnbärtchen, aus dem Manuskript, klebt es sich an und setzt einen Kneifer auf. Jetzt nimmt er in professoraler Pose das Publikum zum Auditorium. Alfons spielt einen Tusch. Toredid hält eine Kurzvorlesung. Toredid in der Mimik, Gestik und Sprechweise des akademisch ernsten, etwas komischen, liebenswerten, manchmal in Verzückung geratenden und das Auditorium vergessenden Professors
Das Erste Paradoxon der Kunst
Der Streit, so heißt es, ist der Vater aller Dinge. Wer aber ist ihre Mutter? Gewöhnlich ist die Frage nach der Mutter leichter zu beantworten als die nach dem Vater. Die Frage nach der Mutter aller Dinge ist jedoch die schwierigste aller Fragen. Und bis heute hat man keine Antwort darauf gefunden. Deshalb wurde sie auch nie gestellt, denn schlaue Leute stellen eine Frage erst dann, wenn sie die Antwort wissen. Um die unsre zu beantworten, müssen wir zunächst das metaphorische Wort Streit durch den wissenschaftlichen Begriff „Widerspruch“ ersetzen. Ein Widerspruch besteht bekanntlich aus zwei Seiten, die sich, da einander entgegengesetzt, bekämpfen und auf diese Weise vorantreiben. Weshalb treiben sie sich nicht auseinander? Gegensätze ziehen sich an, sagt man. Weshalb aber ziehen sie sich an? Weil dialektische Gegensätze einander gegensätzlich und zugleich miteinander identisch sind. Jede Seite eines Widerspruchs birgt das Wesensmerkmal der anderen Seite in sich. Und je identischer beide sind, desto besser funktionieren sie als sich wechselseitig vorantreibende Gegensätze. Wie also der Widerspruch, der Kampf der Gegensätze, der Vater aller Dinge ist, so ist die Identität – der Gegensätze – die Mutter aller Dinge, denn ohne sie läuft nichts zusammen, sondern alles auseinander. Auch in der Kunst. Welche Identität aber ist die Mutter der Kunst? Die Identität der Gegensätze Kunst und Wirklichkeit.
Pirol: Wie? Kunst und Wirklichkeit sollen Gegensätze sein? Das klingt nicht gut, gar nicht gut.
Toredid: Doch es ist gut, es ist das Beste, was beide sich gegenseitig sein können. Oder war es nicht so, dass Gegensätze sich wechselseitig vorantreiben? Also ist es das Beste für die Kunst wie für die Wirklichkeit, wenn sie einander entgegengesetzt sind. Nur wenn die Kunst der Wirklichkeit widerspricht, hat sie etwas zu sagen. Sie kann freilich der Wirklichkeit nur widersprechen, wenn sie sich auf den entgegengesetzten Standpunkt, also auf den Standpunkt des Nichtwirklichen stellt.
Das wirklich Nichtwirkliche aber ist das Mögliche. Allein vom Standpunkt des Möglichen aus kann die Kunst den Widerspruch der Wirklichkeit zu ihren Möglichkeiten erfassen. Das aber ist der einzige wirklich interessante Widerspruch, denn allein aus ihm entspringen die uns wirklich bewegenden Probleme.
Toredid wühlt im Manuskript, als ob er die Probleme suche.
Nun sind jedoch Wirklichkeit und Möglichkeit in ständiger Veränderung begriffen: Jede neue Wirklichkeit produziert neue Möglichkeiten, und jede neue Möglichkeit postuliert eine neue Wirklichkeit. So erneuert sich der Widerspruch ständig, will sagen: Wirklichkeit und Möglichkeit stehen unaufhörlich in einem dialektischen, mithin gespannten Verhältnis zueinander.
Pirol: Was aber, wenn die Wirklichkeit in keinem Verhältnis zu ihren Möglichkeiten steht, wenn das Verhältnis beider ein Missverhältnis ist?
Toredid: Da muss halt die Wirklichkeit um des Möglichen willen unmöglich gemacht werden.
Pirol: Und von wem?
Toredid: Von der Kunst. Sie hat an dem Verhältnis in guten Zeiten teil, also hat sie auch in schlechten Zeiten Anteil zu nehmen. Sie hat die missratene Wirklichkeit unmöglich zu machen, um dem Möglichen zur Wirklichkeit zu verhelfen. Die Kunst – speziell die Literatur – ist Hebamme des Möglichen, das ist ihr Beruf. Und der verlangt wie jeder andere Gewissen und Wissen. Die Kunst muss wissen, was wirklich, faktisch, objektiv möglich ist Das ist nicht alles Denkbare, aber es ist das Realisierbare. Und das ist genug. Das ist mehr, als die meisten ahnen, jedenfalls aber mehr, als manche wahrhaben wollen. Es ist das, was sein könnte, aber nicht ist.
Die objektive Möglichkeit ist das Maß der Wirklichkeit. Und indem die Kunst von diesem Maß ausgeht, geht sie der Wirklichkeit voraus, wird sie vom Abbild der Wirklichkeit zu deren Vorbild, hört sie auf, Nachahmung der Wirklichkeit zu sein, und wird – was bleibt ihr andres übrig? – Vorahmung der Wirklichkeit.
Da haben wir es: Die Kunst ist Vorahmung der Wirklichkeit. Aber nicht, indem sie die Vorahmung als schon vorhandene Wirklichkeit, also eine verschönte Wirklichkeit vorführt, sondern indem sie die Wirklichkeit kritisch, als ihrer Vorahmung noch nicht entsprechend, darstellt. Um aber vorahmen zu können, um der Wirklichkeit vorausgehen zu können, muss die Kunst von der Wirklichkeit ausgehen, denn diese und nur diese birgt die verwirklichbaren Möglichkeiten, und die verborgensten sind die interessantesten. Folglich muss die Kunst tief in die Wirklichkeit eindringen, muss sich aufs Innigste mit ihr verbinden. Die innigste Verbindung aber ist – die Identität. Also ist Identität der Gegensätze Kunst und Wirklichkeit erforderlich. Und diese Identität ist die wahre Mutter aller Kunst. Ohne sie wäre der Gegensatz von Kunst und Wirklichkeit unproduktiv, nihilistisch, zerstörerisch, weil ein unnatürlicher Gegensatz, wie umgekehrt die Identität von Kunst und Wirklichkeit, die nicht den Gegensatz beider einschließt, eine unnatürliche und falsche und demzufolge leblose, faule, schlechte Identität wäre, auch wenn sie manchem recht wäre.
Schließen wir: Die Kunst lebt vom Streit. Das ist richtig. Sie lebt vom Streit mit der Wirklichkeit, denn sie streitet für das Mögliche. Also muss der Künstler ein streitbarer Mensch sein, was er nur sein kann, wenn er keinen Respekt vor der Wirklichkeit hat. Richtig ist aber auch, dass die Kunst von der Identität lebt, von der Verbindung mit ihrer Wirklichkeit, mit ihrer Zeit. Also muss der Künstler mit seiner Zeit verbunden sein, insbesondere da, wo das menschenfeindliche Missverhältnis von Wirklichkeit und Möglichkeit nicht mehr besteht, in unserer Zeit also.
Ein Mensch, der mit dieser Zeit nicht in Übereinstimmung lebt, in dem lebt unsere Zeit nicht, und er sieht in unserer Wirklichkeit keine Möglichkeiten. Ein solcher Mensch ist das bedauernswerteste Geschöpf unter der Sonne. Und wäre er Künstler, so wäre er keiner.
Toredid bedankt sich mit Verneigen für die Aufmerksamkeit des Publikums, Alfons spielt einen Tusch, Toredid stellt den alten Zustand wieder her und setzt sich, sich jetzt wieder in seiner eigenen Art gebend, an den Tisch.
Pirol: ironisch Da haben wir nun in Gestalt des Widerspruchs zwischen Kunst und Wirklichkeit den Vater der Kunst und in der Identität der beiden ihre Mutter. Nur die Kunst haben wir nicht.
Alfons: Den Eindruck habe ich auch.
Pirol: Die Kunst entspringt den Widersprüchen innerhalb der Wirklichkeit, den Widersprüchen zwischen den verschiedenen Seiten und Erscheinungen der Wirklichkeit selbst. Diese Widersprüche müssen ausgetragen werden, davon lebt die Kunst. Und sie lebt schon schlecht genug davon, denn um das Austragen dieser Widersprüche ist es schlecht bestellt, wenigstens was unsere eigenen betrifft. Ihr Widerspruch zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit aber verdeckt die wirklichen Widersprüche vollends.
Toredid: fröhlich Im Gegenteil.
Pirol: Wie das?
Toredid: Sie sind erstaunlich unhöflich.
Pirol: Was hat das mit der Kunst zu tun?
Toredid: Es hat mit der Kunst des Zuhörens zu tun. Ich sagte, die objektive Möglichkeit ist das Maß der Wirklichkeit. Als solches ist sie auch das Maß der Widersprüche innerhalb der Wirklichkeit.
Pirol: Das Maß der Wirklichkeit liegt in ihr selbst.
Toredid: Erlauben Sie ein Beispiel aus der Mathematik?
Pirol: Wenn Ihnen das hilft.
Toredid: Ich nehme an, wir sind uns darin einig, dass zwei mal zwei vier ist
Pirol: wittert eine Falle, zögernd Nehmen wir es an.
Toredid: Nun behauptet aber einer, zwei mal zwei sei fünf, und ein anderer behauptet, es sei dreieinhalb. Offensichtlich stehen beide Behauptungen in Widerspruch zueinander. Wie lösen Sie ihn?
Pirol: Ich weise nach, dass beide Lösungen falsch sind.
Toredid: Indem Sie von der richtigen ausgehen.
Pirol: Was sonst?
Toredid: Nun steht aber auch in der Wirklichkeit mehr oder weniger Fehlerhaftes in Widerspruch zueinander. Doch da wollen Sie die richtige Lösung, wie sie in der objektiven Möglichkeit gegeben ist, außer Betracht lassen. Da begnügen Sie sich mit dem Maß, das die Wirklichkeit selbst bietet, etwa mit zwei mal zwei ist fünf. Und das, obwohl in der Wirklichkeit die Dinge weitaus verwickelter sind als in unserem mathematischen Beispiel, verwickelt mit moralischen Erwägungen, politischen Rücksichten, subjektiven Vorurteilen, persönlichen Interessen, Gefühlen, Gewohnheiten, Traditionen und dergleichen. Wie wollen Sie sich da zurechtfinden, wie wollen Sie da Partei ergreifen, wie wollen Sie da zur Lösung der Widersprüche beitragen, wenn Sie kein objektives Maß, das heißt ein Maß außerhalb der Wirklichkeit haben, sondern von der Wirklichkeit selbst, beispielsweise von der Zwei-mal-zwei-ist-fünf-Wirklichkeit ausgehen?
Alfons: Maß ist immer gut. Liesbeth, noch ein Maß!
Liesbeth bringt Alfons ein Bier.
Toredid: Sie selbst beklagen sich über die Art, in der wir unsere Widersprüche austragen. Auf andere Art austragen können wir sie doch wohl nur, wenn wir sie objektiv erfassen, also in ihrem Verhältnis zum objektiv Möglichen. Erst dann erkennen wir, welches Ausmaß die Widersprüche wirklich haben.
Alfons: Hoch lebe das objektive Maß! Hebt sein Glas und trinkt.
Pirol: Dass wir unsere Widersprüche nicht ordentlich austragen, dass viel diskutiert, aber wenig gestritten wird, hat politische Gründe. Was kann da eine theoretische Erkenntnis ausrichten?
Toredid: unternehmungslustig Alles! Das Erkennen der objektiven Möglichkeit ist ein theoretischer Vorgang, sie selbst aber ist ein politisches Argument, und das unbestechlichste dazu. Vor diesem Argument kann keine Wirklichkeit bestehen, selbst die beste nicht, wenn sie auch nur im Geringsten unter ihren Möglichkeiten ist. Und welche ist das nicht? Wir bilden uns viel auf unseren Wirklichkeitssinn ein. Was wir jedoch nötig haben, ist der Möglichkeitssinn. Er ist von beiden der edlere. Ohne ihn wird der Wirklichkeitssinn zum Starrsinn, denn er ist in sich konservativ. Erst als im Möglichkeitssinn aufgehobener erhält er seinen wirklichen Sinn. Also müssen wir unseren Möglichkeitssinn ausbilden, ihn auf alle erdenkliche Weise befördern und pflegen.
Pirol: Dann bleibt immer noch die Frage, wie er zu einem allgemeinen gemacht werden kann.
Toredid: Indem wir es unmöglich machen, keinen zu haben. Unmöglich, weil peinlich. Wie es unanständig ist, mit offener Hose herumzulaufen, so unanständig muss es sein, ohne Möglichkeitssinn herumzulaufen
Pirol: Und was dann?
Toredid: Dann erlebt das schöpferische und zugleich kritische Denken eine ungeahnte Blüte. Die Wirklichkeit wird ohne Unterlass auf ihre Möglichkeiten geprüft. Und wo sie darunter bleibt, wird sie aufgehoben. Das erfordert und befördert Verstand und Fantasie, Mut und Redlichkeit.
Pirol: Und was sagt Ihr Arzt dazu?
Toredid: im gleichen Ton, weil nicht verblüfft Er hält mich für völlig normal.
Pirol: Dann schicken Sie Ihren Arzt mal zum Arzt. Ihr Möglichkeitssinn ist ein Hirngespinst. Er ist, in Ihrem Sinne genommen, die absolute Kritik. Und die wird nirgends gebraucht.
Toredid: Nicht nur Ihre Höflichkeit, auch Ihre Logik ist reparaturbedürftig. Sie verwechseln das Konstruktive mit dem Absoluten und das allein Gültige mit dem allgemein Geltenden. Galileis Auffassung, dass sich nicht die Sonne um die Erde, sondern die Erde um die Sonne bewegt, war schon seinerzeit die allein gültige. Allgemeine Geltung hat diese Auffassung allerdings erst später erlangt.
Pirol: Viel später.
Toredid: Aber unvermeidlich, eben weil sie die allein gültige ist.
Hermann kommt zurück.
Hermann: wisst ihr, was meine Frau gesagt hat? Wisst ihr natürlich nicht. Ich hab’ ihr am Telefon gesagt, dass der Pirol hier sitzt und einer namens Toredid. Da hat sie gesagt, den Pirol kennt sie, den Toredid aber nicht. Was ist jetzt die größere Beleidigung? Setzt sich, zu Toredid. Meine Frau, müssen Sie wissen, ist ein Aas. Die sagt nie was, was keine Beleidigung ist.
Alfons: Bei deiner Trauung, war das auch eine Beleidigung, als sie da ja gesagt hat?
Hermann: Da hatte sie sich versprochen. Eigentlich hatte sie nein sagen wollen. Da sie aber stets das Gegenteil von dem sagt, was sie meint, hat sie ja gesagt. Der Standesbeamte fand aber nichts dabei und hat uns getraut.
Toredid: zu Pirol Fällt Ihnen an dem Manne etwas auf?
Pirol: Sollte es das?
Toredid: Seine Ehe scheint, wie man so sagt, ein ernstes Problem zu sein.
Pirol: Welche Ehe ist das nicht?
Toredid: Das ist nicht. die Frage. Die Frage ist, wie nimmt man so ein Problem: ernst oder heiter?
Pirol: Ernst, ein ernstes Problem nimmt man ernst.
Toredid: mit Hinweis auf Hermann Er nimmt es heiter. Das sollte Ihnen aufgefallen sein.
Pirol: Unangenehm?
Toredid: Angenehm.
Pirol: Ich bitte Sie! Wer ein ernstes Problem heiter nimmt, macht sich und anderen etwas vor. Statt mit dem Problem fertig zu werden, vertuscht er es nur. Heiterkeit ist Verrat an der Wahrheit, sie verniedlicht, beschönigt. Denken Sie nur an unsere heiteren Theaterstücke.
Alfons: plärrt Heitere Theaterstücke sind staatserhaltend! Hackt ein paar Takte eines Parademarsches auf dem Klavier. Heiteres Theater – zufriedene Leute, Herz, was willst du mehr?
Hermann: Du hast heitere Stücke die Masse gesehen, zufrieden bist du aber nicht.
Alfons: Ich habe ja auch nicht gelacht. Weil ich den Trick durchschaut habe.
Pirol: Heiterkeit ist Demagogie.
Toredid: Immer?
Pirol: Immer dann, wenn sie auf ernste Probleme zielt. Ein ernstes Problem, das nicht ernst genommen wird, wird entstellt.
Toredid: Das ist richtig. Und das Gegenteil ist auch richtig.
Pirol: Wieder so ein Paradoxon.
Toredid: Ganz recht.
Vorgang wie bei der vorigen Kurzvorlesung.
Toredid: in der professoralen Art Das Vierte Paradoxon der Kunst …
Pirol: Nach meiner Rechnung ist es das zweite!
Toredid: in seiner Art Der systematischen Folge nach ist es das vierte. Wieder professoral
Das Vierte Paradoxon der Kunst
Der allzu große Ernst, heißt es, ist lächerlich. Welcher Ernst ist nicht lächerlich? Der nicht allzu große? Der mittlere? Was überhaupt ist Ernst? Kennzeichnet er den tiefer veranlagten Menschen und steht, verglichen mit der Heiterkeit, höher? Oder ist der Ernst heruntergekommene Heiterkeit? Das wäre denkbar.
Karl Marx sagt: Heiterkeit ist die wesentliche Form des Geistes. Danach wäre der Ernst eine unwesentliche Form, wenn nicht gar eine Deformation des menschlichen Geistes. Es sei denn, unser Geist hat die ihm wesentliche Form, die Form der Heiterkeit, noch gar nicht angenommen. Dann wäre der Ernst eine Vorform des menschlichen Geistes. Das aber ist eine historische Frage, es ist die Frage nach der Geschichte der psychischen Verfassung des Menschen, nach der Gesetzmäßigkeit dieser Geschichte. Und da haben wir wieder eine der Fragen, die schlaue Leute nicht stellen, bevor sie die Antwort wissen.
Immerhin sollten wir wissen, dass die bis heute aufgedeckten Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Entwicklung die Frage nach unserer psychischen Entwicklung offenlassen. Die uns bekannten Gesetze erklären lediglich die Entwicklung der materiellen Verfassung der Gesellschaft und das Verhältnis von Materiellem und Ideellem. Sie erklären nicht die eigene Entwicklung des Ideellen. Die Entwicklung der psychischen Verfassung des Menschen, die Eigengesetzlichkeit der menschlichen Psyche muss erst noch aufgedeckt werden. Wir tun dies, indem wir von vorn anfangen, bei unseren Altvordern, den Naturvölkern.
Die urgesellschaftlichen Produktionsverhältnisse sind uns wohlbekannt, die haben wir in der Schule gelernt. Was aber haben wir vom psychischen Verhalten dieser Völker gelernt? Die Gentilverfassung ist uns gegenwärtig, die Gemütsverfassung der Menschen dieser Zeit dagegen ist uns nicht gegenwärtig. Ist das nicht wichtig? Ist das nicht das eigentlich Wichtige? Geht es nicht letzten Endes darum, wie uns zumute ist? Wie uns einmal zumute sein wird? Also auch, wie uns einstmals zumute war. Denn wie uns einmal war, so wird uns einmal auch wieder sein. Und das auf höherer Stufe. Das ist gesetzlich gesichert, durch das Gesetz der Negation der Negation. Daher stimmt es uns zuversichtlich, wenn wir erfahren, dass wir einmal eine heitere Gesellschaft waren. Heiterkeit war, so unglaublich es auch klingen mag, die dauernde und allgemeine Gemütsverfassung der Naturvölker: nicht nur der Südseeinsulaner, sondern auch der nordamerikanischen Indianer (zu ernsten Helden wurden sie erst durch uns gemacht), nicht nur der Pygmäen, sondern auch der Eskimo. Anderslautende Auffassungen, mögen sie noch so verbreitet sein, entsprechen nicht dem wirklichen Tatbestand, darin sind sich alle gewissenhaften Forscher einig. Nicht einig sind sie sich in der Erklärung dieses Tatbestandes. Die einen behaupten, die Heiterkeit habe sich gebildet, weil ohne sie der Erbarmungslosigkeit der Natur nicht hätte widerstanden werden können; andere wiederum erklären die Heiterkeit aus der Freigebigkeit der Natur. Offenbar schließen sich diese Erklärungen gegenseitig aus. Die Logik hingegen besagt: Eine allen Naturvölkern gemeinsame Wesensart kann nur aus einer allen gemeinsamen Bedingung erklärt werden, und die allen Naturvölkern gemeinsame Bedingung ist die gesellschaftliche Gleichheit. Nicht ihr Verhältnis zur Natur, sondern das Verhältnis der Menschen zueinander bedingt ihre Wesensart. Und die heitere Wesensart findet ihre Bedingung in der gesellschaftlichen Gleichheit, genauer: in der auf gesellschaftlicher Gleichheit beruhenden Freiheit. Die Richtigkeit dieser Erklärung erweist sich auch dadurch, dass die Naturvölker ihre Heiterkeit verloren, sobald sie ihrer Freiheit verlustig gingen.
Die Heiterkeit stirbt an der Klassengesellschaft. An ihre Stelle tritt der Ernst. In ihm haben wir die psychische Verfassung, die der in Klassen gespaltenen Menschheit gemäß ist. Der Ernst ist die Wesensart des mit seinesgleichen uneins gewordenen Menschen.
Was aber, wenn die Klassengesellschaft abgeschafft und die auf gesellschaftlicher Gleichheit beruhende Freiheit wiederhergestellt wird? Dann stellt sich auch die Heiterkeit als allgemeine Wesensart des Menschen wieder ein. Dem Gesetz der Negation der Negation folgend, entwickelt sich die psychische Verfassung des Menschen von der Heiterkeit der Naturvölker über den Ernst der Klassengesellschaft zur Heiterkeit der kommunistischen Menschheit. Und erst auf dieser Stufe wird die Heiterkeit zur wesentlichen Form des Geistes. Sie ist jetzt nicht mehr naive – was nicht heißen will: primitive – sie ist jetzt wissende, historisch erfahrene Heiterkeit, sie hat den Ernst in sich aufgehoben.
Die Aufhebung des Ernstes in Heiterkeit ist jedoch kein einfacher und einmaliger Akt, sie ist ein komplizierter und dauernder, weil historischer Prozess. Und wir stehen gerade am Anfang. Die Jahrtausende währende Herrschaft des Ernstes ist noch ungebrochen. Er denkt nicht daran, sich aufheben zu lassen. Noch dazu von seinem Gegenteil. Was ist da zu machen? Da muss der Ernst lächerlich gemacht werden. Dagegen ist er machtlos. Aller Ernst, nicht nur der allzu große, ist im Grunde lächerlich. Er ist falscher Anspruch, mehr Schein als Sein, Diskrepanz zwischen Erscheinung und Wesen, verabsolutierte Relativität, also komisch. Also muss er als das aufgedeckt werden, wenn er aufgehoben, wenn das Gesetz der Aufhebung des Ernstes in Heiterkeit vollstreckt werden soll. Der Ernst ist die Wirklichkeit, die unmöglich gemacht werden muss, soll die Heiterkeit als wesentliche Form des menschlichen Geistes Wirklichkeit werden. Folglich bedarf es der Kunst. Wie wir gesehen haben, ist sie imstande, Wirklichkeit um des Möglichen willen unmöglich zu machen. Und sie ist berufen, Wirklichkeit vorzuahmen, in unserem Falle den Prozess der Aufhebung des Ernstes in Heiterkeit. Na schön. Aber wie?
Wie wir wissen, hat die Heiterkeit ihre Bedingung in der Freiheit. Und umgekehrt findet die Freiheit die ihr gemäße Form in der Heiterkeit. Der Kampf um die Freiheit ist ernst, die Freiheit selbst ist heiter. Nur in dieser Form ist sie genießbar, wird sie zum Genuss. Also ist die (in unserem historischen Sinne verstandene) Heiterkeit Kriterium der Freiheit. Ernste Freiheit ist ein Widerspruch in sich. Daher muss die Kunst, will sie die Aufhebung des Ernstes in Heiterkeit vorahmen, einen Vorgeschmack geben von der Heiterkeit als Form der Freiheit, von der Freiheit in Form der Heiterkeit. Das ist das Höchste, was die Kunst geben kann, und zugleich das Schwierigste. Aber einfacher geht es nicht, wenn es Kunst sein soll.
Schließen wir: Sowohl die naive Heiterkeit als auch der bloße Ernst stellen historische Vorformen dar, aus denen, dem Gesetz der Negation der Negation folgend, die den Ernst in sich aufhebende Heiterkeit als die wesentliche Form des Geistes hervorgeht. Wir werden von allen guten Geistern verlassen, wenn wir den wesentlichen, den Geist der Heiterkeit, nicht gewinnen. Gewinnen wir ihn aber, so werden uns die bösen verlassen. Die Kunst, berufen, Vorahmung der Wirklichkeit zu sein, findet den tiefsten Sinn ihres Berufes in der Vorahmung des historisch notwendigen Prozesses der Aufhebung des Ernstes in Heiterkeit, der heiteren Aufhebung des Ernstes. Die Aufhebung einer Erscheinung in der ihr entgegengesetzten aber ist die höchste Form der Identität beider Erscheinungen. Mithin stellt die Kunst, sobald sie ihrem wirklichen Berufe nachgeht, die höchste Form der Identität von Ernst und Heiterkeit her. Eben das ist die Kunst – an der Kunst.
Die übliche Rückverwandlung nach Verneigung und Tusch.
Alfons: Ihre Theorie hat was Beängstigendes an sich. Da drehen sich einem ja alle Begriffe um.
Hermann: Und Logik hat was Überzeugendes an sich. Und was Sie da eben vorgetragen haben, war verdammt logisch. Das immerhin habe ich begriffen.
Pirol: Und ich habe begriffen, was der Grundfehler
Ihrer Theorie ist.
Toredid: erheitert, ohne Spott Wirklich?
Pirol: Jetzt habe ich das Generalargument gegen Sie in der Hand.
Toredid: Aber Sie verraten es nicht.
Pirol: Noch nicht. Ich warte, bis Sie das vollständige Gebäude Ihrer Theorie errichtet haben, um es dann mit einem Schlage zu vernichten.
Alfons: Wie hoch soll denn das Gebäude werden? Da wir das erste und das vierte Stockwerk schon haben, kommen jedenfalls noch zwei dazwischen.
Toredid: Und eins obendrauf.
Alfons: Fünf Stockwerke im ganzen! Vorfreudig Das gibt einen schönen Bums, wenn’s mit einem Schlage zusammenkracht!
Liesbeth: zeigt Alfons einen Vogel, serviert Toredid einen frischen Kaffee Ich bin für die Aufhebung des Ernstes!
Pirol: ironisch Die Stimme des Volkes.
Liesbeth: unbeirrt Als ich hier in der Kantine anfing, dachte ich, ich bin unter lauter Spinner geraten. Mit der Zeit hab’ ich aber gemerkt, dass es an der Fantasie liegt. Theaterleute haben eine lebhafte Fantasie. Die denken sich alles Mögliche aus, wie was sein könnte oder sein müsste, und damit verglichen ist die Wirklichkeit eben meistens mies.
Hermann: Und dann wird geschimpft und geflucht.
Liesbeth: Ja, bloß nicht an der zuständigen Stelle. Da sitzen nämlich die ernsten Leute, und vor denen hat man Schiss. Wenn da überall heitere Leute säßen, hätten wir eher den Mut, mal was zu sagen. Treuherzig naiv Deshalb bin ich dafür, dass wir die Negation der Negation machen
Toredid und Hermann klatschen Beifall.
Pirol: Edle Einfalt!
Toredid: Aber nicht ohne tiefere Wahrheit. Der Umgang mit ernsten Menschen erfordert in der Tat eine gewisse Vorsicht. Sie sind verschlossen und verstehen leicht was verkehrt. Man weiß nicht, wie man sie nehmen soll, und nimmt sich in Acht. Man gibt sich anders, als man ist, und die natürliche Unbefangenheit ist dahin. Ernst macht unfrei. Und ein ernster Vorgesetzter zumal ist die Einschüchterung in Person.
Hermann: Vielleicht sind die Vorgesetzten deshalb so ernst.
Toredid: Der Gedanke ist nicht von der Hand zu weisen.
Pirol: Sie geben sich alle Mühe, den Ernst unmöglich zu machen.
Toredid: Wie Sie sehen, mit Erfolg. Ich brauche ihn bloß als das darzustellen, was er ist: als die Vergewaltigung des natürlichen Wesens des Menschen. Der Ernst ist eine ausgemachte Unanständigkeit.
Pirol: Und Ihre Heiterkeit ist das Allheilmittel?
Toredid: Was sonst?
Pirol: Und das in einer Welt, die in weiten Teilen von Hunger und Elend gezeichnet ist, in der Kriege oder Bürgerkriege tagtäglich Hunderte Menschenleben fordern. Das ist, mit Verlaub, blutiger Ernst!
Toredid: Sie verwechseln da etwas. Ich rede vom Ernst als einer Haltung, und zwar einer bornierten, menschenunfreundlichen Haltung; und Sie reden vom Ernst einer Situation, einer Lage, eines Problems. Das sind zwei völlig verschiedene Begriffe.
Pirol: Aber die Haltung muss doch dem Problem, der Sache angemessen sein. Und eine blutig ernste Sache kann man nur ernst, nicht heiter nehmen.
Toredid: Sie bringen schon wieder etwas durcheinander. Ich habe im vorigen Paradoxon unmissverständlich dargestellt, dass die Heiterkeit als historische Erscheinung der klassenlosen Gesellschaft zugehört, Sie aber wollen sie auf die Klassengesellschaft und deren Probleme angewandt haben.
Pirol: Also versagt sie da.
Toredid: Sie nicht, wir.
Pirol: Also was denn nun?!
Toredid: Da wir noch der Klassengesellschaft verhaftet sind, können wir nur bedingt die Heiterkeit gewinnen, wie sie in der Zukunft selbstverständlich sein wird. Natürlich müssen auch da ernste Probleme ernst genommen werden, aber durch einen in Heiterkeit aufgehobenen und dadurch von seiner Borniertheit und Menschenunfreundlichkeit befreiten Ernst. Erst als das befähigt er uns, ernste Probleme auf menschliche Art zu bewältigen. Daher sollten wir, soweit es uns gegeben ist, allerdings schon heute den Ernst in Heiterkeit aufheben.
Hermann: Die Theorie ist uns ja schon gegeben.
Toredid: Der heitere Mensch hat die geistige Freiheit, sich aus der sklavischen Abhängigkeit von der Wirklichkeit zu lösen und das Mögliche zu erkennen. Ernst bannt, Heiterkeit löst. Und da sie historisch unvermeidlich ist, ist auch der Möglichkeitssinn unvermeidlich. Die Heiterkeit macht ihn allgemein. Das ist die Lösung.
Pirol: Darf ich konstatieren: Sie machen die allgemeine Geltung der Möglichkeit als Maß der Wirklichkeit von der Heiterkeit abhängig.
Toredid: Ich nehme an, das kommt Ihnen entgegen.
Pirol: Es erleichtert mir die Widerlegung.
Alfons: Schade, dass wir noch drei Stockwerke darauf warten müssen.
Pirol: Um einen kleinen Vorgeschmack davon zu geben, will ich schon jetzt auf eine Ungereimtheit aufmerksam machen. Sie unterteilen die psychische Entwicklung des Menschen in drei Stufen: naive Heiterkeit, bloßer Ernst und endlich Heiterkeit als die wesentliche Form des Geistes. Abgesehen davon, dass Sie damit nicht den ganzen Inhalt der menschlichen Psyche, sondern bestenfalls deren Grundhaltung erfassen …
Toredid: Was sonst sollte ich erfassen, wenn ich ihr Grundgesetz erfasse?
Pirol: leicht irritiert Abgesehen davon übersehen Sie offenbar, dass die ernste Stufe voller Heiterkeit ist. Als Zeugen rufe ich, um nur einige zu bemühen, Aristophanes, Lukian, Rabelais, Cervantes, Shakespeare und Moliere auf.
Toredid: Die zeugen von etwas ganz anderem. Die zweite Stufe der Negation der Negation verkehrt stets das Wesen der negierten Erscheinung in ihr gerades Gegenteil. Eben darin besteht die dialektische Funktion der zweiten Stufe. Nur im Kampf gegen seine Verkehrung, gegen sein gerades Gegenteil kann sich das Wesen einer Erscheinung voll ausbilden, nur angesichts seines Gegenteils kann es sich selbst erkennen, zu sich selbst kommen. Indem die Negation das Wesen einer Erscheinung in sein Gegenteil verkehrt, fordert sie es zugleich heraus. Ein jedes Wesen wehrt sich gegen seine Verkehrung: es versucht, sich zu bewahren, sich wiederherzustellen, aber eben auf mehr oder weniger verkehrte, abenteuerliche, groteske, komische oder tragische Weise.
Hermann: Das ist der Schlüssel für die Merkwürdigkeiten der Klassengesellschaft. Jetzt erklärt sich manches, und manche Erklärung wird jetzt fragwürdig.
Toredid: Da die Negation das Wesen einer Erscheinung aufhebt, bringt sie das Wesen gegen sich auf, wird von ihm attackiert und manchmal, wenn auch nur partiell, sogar besiegt. Daher ist die zweite Stufe der Negation niemals ganz sie selbst, sie ist stets die unreinlichste der drei Stufen. Sie ist die Stufe der Ausnahmen.
Hermann: Und die bestätigen bekanntlich die Regel.
Toredid: Sie bestätigen sie nur in dem Falle, da sie die Regel beschädigen, ohne sie dadurch außer Kraft setzen zu können. Zu Pirol Die von Ihnen aufgerufenen Herren sind dafür Zeugen. Auch dafür, dass die Heiterkeit in der zweiten Stufe der Entwicklung nicht mehr die spontane Folge von ihr günstigen Bedingungen, sondern vielmehr Ausdruck der Ungunst ihrer Bedingungen ist. Unter diesen Bedingungen erfordert die Heiterkeit eine individuelle Anstrengung, nämlich die subjektive Aufhebung des Ernstes, was ihr die Form des Humors gibt. Der Humor ist die nicht allen gegebene, die nicht ein für alle Mal gegebene Heiterkeit, er ist die Heiterkeit des Einzelnen, er ist vereinzelte Heiterkeit, die sich ständig gegen die Allgemeinheit des Ernstes behaupten muss. Der Humor ist die Heiterkeit als Ausnahme, und der Ernst bestimmt die Regeln. Zu Pirol Ihre heiteren Herren bezeugen also nichts als die Herrschaft des Ernstes.
Hermann: Sie räumen ganz schön auf in der Menschheitsgeschichte. Aber auf die Art macht sie einem erst richtig Spaß. Da reimt sich alles und kriegt seinen Sinn und sein Ziel, und ein heiteres dazu.
Pirol: Leider ein unerreichbares. Die Menschheit ist nun einmal dem Ernst verfallen, und von diesem Sündenfall erhebt sie sich niemals wieder. Ausnahmen hat es gegeben und wird es auch in Zukunft geben, mehr aber auch nicht.
Toredid: Das psychische Verhalten des Menschen ändert sich mit seinen gesellschaftlichen Verhältnissen. Das ist ein objektives Gesetz.
Pirol: Damit verurteilen Sie den Menschen von Gesetzes wegen, der Wechselbalg seiner Verhältnisse zu sein.
Toredid: Und was halten Sie dagegen?
Pirol: Nichts Besseres, aber was anderes.
Toredid: Und das wäre?
Pirol Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Toredid: Das ist richtig. Und das Gegenteil ist auch richtig.
Alfons: Das nächste Paradoxon kommt auf uns zu.
Übliche Verwandlung.
Toredid in der professoralen Art
Das Zweite Paradoxon der Kunst
Der Mensch, heißt es, ist ein Gewohnheitstier. Was ein Tier ist, wissen wir. Was aber ist ein Gewohnheitstier? In Brehms Tierleben ist es nicht verzeichnet. Dagegen ist dort viel von Gewohnheiten die Rede, von Verhaltensgewohnheiten, die das Tier befähigen, mit seiner Umwelt auszukommen. Gewohnheiten in diesem Sinne sind eine Form der Anpassung an die gegebenen Existenzbedingungen. Und das gilt nicht nur für das Tier, das gilt auch für den Menschen.
Wenn es unsinnig ist, das von Darwin entdeckte Gesetz der Anpassung schematisch auf den Menschen zu übertragen, so ist es noch unsinniger, es nicht auf ihn zu übertragen. Darwins Entdeckung ist von weitaus umfassenderer und tieferer Bedeutung, als Darwin selbst angenommen hat. Allerdings nur, wenn es spezifisch genommen, wenn die menschliche Anpassung als „arteigene“ genommen wird. Dann entdeckt sich uns das Gesetz der Anpassung als das Grundgesetz aller menschlichen Entwicklung. Nur indem der Mensch sich anpasst, entwickelt er sich, und er entwickelt sich auf seine Weise, indem er sich auf seine Weise anpasst. Der Zugvogel flieht vor dem Winter nach dem warmen Süden, der Mensch heizt den Ofen an. Das ist der Unterschied. Der Mensch nimmt nicht eine Veränderung mit sich vor, er verändert seine Umwelt. Der Mensch unterscheidet sich vom Tier dadurch, dass er sich der Natur anpasst, indem er die Natur sich anpasst. Er verändert sie zu seinen Zwecken. Er arbeitet. Und erst indem er arbeitet, verändert er auch sich. Insofern ist seine Anpassung eine indirekte.
Die spezifische Form der menschlichen Anpassung an die Natur durchläuft, wiederum dem Gesetz der Negation der Negation folgend, drei Phasen. Die erste Phase ist, dem urgesellschaftlichen Niveau der Produktivkräfte entsprechend, durch eine noch sehr primitive Anpassung der Natur an den Menschen gekennzeichnet. Auch finden wir hier noch häufig direkte, für das Tier typische Formen der Anpassung, denken wir nur an die menschlichen Zugvögel, die Nomaden.
Die zweite Phase ist durch die Klassengesellschaft gekennzeichnet. Die rasch zunehmende Anpassung der Natur an den Menschen wird erkauft durch die Anpassung des Menschen an die Produktion: Der Sklave, der Leibeigene, der Lohnarbeiter wird zum bloßen Produktionsmittel abgerichtet, und die Natur wird den Zwecken der herrschenden Klasse unterworfen. Die Folge ist die Zerstörung der Natur und die Zerstörung der Natur des Menschen. So kann das nicht weitergehen.
Da wird das Wesen der Sache, da wird die Anpassung als Grundgesetz der menschlichen Entwicklung in das gerade Gegenteil verkehrt. Doch das ist, wie wir wissen, die Funktion der zweiten Phase der Negation der Negation. Die Verkehrung des Wesens ist Voraussetzung seiner Wiederherstellung auf höherer Stufe. Toredid hat, um diesen Satz zu demonstrieren, eine Spirale in die Luft gemalt, blickt jetzt auf die über seinem Kopf stehen gebliebene Hand, blickt ins Manuskript, blickt wieder auf die Hand, blickt wieder ins Manuskript und macht die Spirale geschwind zurück, lässt die Hand eine Verlegenheitsgeste machen, fährt fort Die Produktion, durch die Anpassung des Menschen an sie maßlos geworden, verlangt um ihrer eigenen Fortentwicklung willen ein Maß, und dieses Maß findet sie in der Anpassung an den Menschen.
Bis zu einem bestimmten Stande der Produktivkräfte ist es produktiver, den Menschen der Produktion anzupassen; von einem bestimmten Stande der Produktivkräfte an ist es produktiver, die Produktion dem Menschen anzupassen, sie der harmonischen Bildung von Körper und Geist dienlich zu machen. Mit der Aufhebung der Anpassung des Menschen an die Produktion wird aber auch die widernatürliche Anpassung der Natur an den Menschen notwendig aufgehoben. Der Mensch kann die Natur sich nur dann vollkommen anpassen, wenn er sich der Natur vollkommen anpasst, wenn er ihr folgt. Insofern ist auch die spezifisch menschliche Anpassung, die Anpassung der Natur an den Menschen, letztlich nur eine Form der Anpassung an die Natur. Um aber der Natur zu folgen, muss der Mensch seiner eigenen Natur folgen. Um natürlich zu produzieren, muss er seine eigene Natur produzieren. Und das vollbringt die Produktion, sobald sie ihm angepasst ist.
Gegenüber der zweiten Phase, die eine menschliche Beziehung zur Natur nur als Ausnahme kennt – was die Idyllisierung der Natur oder die Flucht in sie erklärt – ist die dritte Phase durch die Wiederherstellung der natürlichen Einheit von Mensch und Natur gekennzeichnet. Der Mensch ist nicht mehr wider die Natur, er ist wieder eins mit der Natur; er ist kein Wesen außerhalb der Natur, er ist nur das höchste Wesen der Natur. Er ist gesellschaftliches Wesen nur, um das höchste Wesen der Natur zu werden.
Das ist die Antwort auf die Frage nach der Natur des Menschen, das ist die Lösung des Rätsels Mensch. Er ist, um mit Friedrich Engels zu sprechen, die zum Bewusstsein ihrer selbst gekommene Natur. Die Natur kommt in uns zu sich, aber nur, wenn wir wieder zu uns kommen, wenn wir wieder in den Schoß der allumfassenden Natur zurückkehren. Aber nicht als der Verlorene Sohn, sondern als natürlichste, weil höchste, als höchste, weil bewusste, ihrer selbst bewusste Natur.
Kommen wir zurück zum Menschen als Gewohnheitstier. Die Gewohnheiten sind eine Form der Anpassung, und zwar die elementarste, niederste, primitivste, unbewussteste Form, aber eben deshalb die rationellste. Wer etwas auf gewohnte Weise tut, denkt nicht darüber nach, weshalb er es so und nicht anders tut. Und das ist der unschätzbare Vorzug der Gewohnheiten. Wenn wir über all unser Tun ständig nachdächten, befänden wir uns in der Lage des Tausendfüßlers, der darüber nachdenkt, welchen Fuß er wann setzen soll, und darüber aus dem Tritt kommt. Vieles im Leben tut man nun einmal besser, wenn man es gedankenlos tut. Und überdies ersparen wir uns auf diese Weise viel Zeit, auch Zeit zum Denken, die wir an anderer Stelle dringend benötigen. Indem uns die Gewohnheiten zu unbewussten, stereotypen, motorischen Handlungen befähigen, sind sie eine unersetzliche Form der Anpassung. Zugleich sind sie aber auch die Form der Anpassung, die am stärksten dem Trägheitsgesetz unterliegt. Nur ein häufig und über lange Zeit wiederholter Akt der Anpassung kann zu einer Gewohnheit werden. Daraus entspringt Autorität. Das macht man nun einmal so, heißt es da. Gewohnheiten haben etwas Abergläubisches an sich. Sie sitzen tief, ihnen ist schwer beizukommen. Überalterten Gewohnheiten aber muss man beikommen, denn sie sind nichts als die Anpassung an überalterte Zustände. Und solange sie erhalten bleiben, erhalten sie diese Zustände.
Was kann da helfen? Da kann nur das Gesetz der Anpassung selbst helfen. Es selbst bringt in seiner höchsten Form das Gegenmittel gegen die Gewohnheiten hervor. Die höchste Form der Anpassung des Menschen an die Wirklichkeit – auch an die gesellschaftliche – aber ist die spielerische Anpassung der Wirklichkeit an den Menschen. Nur im Spiel mit der Wirklichkeit kann diese der wahren Natur des Menschen angepasst werden, denn nur im Spiel mit der Wirklichkeit kann der Mensch seine Natur verwirklichen.
Das setzt allerdings das Spiel mit den Mitteln der Anpassung voraus, und eines der wichtigsten Mittel ist die Wissenschaft. Also muss mit ihr gespielt, muss sie zum Spiel erhoben werden: zum Denkspiel, zum Denklust-Spiel, zum Denk-Lustspiel.
Pirol: Na das wird ein Theater werden!
Toredid: in seiner Art Das ist schon ein Theater, zum Publikum und Sie sitzen drin – und machen das Spiel mit. Treiben wir es noch weiter. Wieder professoral Das Spiel ist keine auf das Kind beschränkte Eigenart, es ist die Eigenart der Gattung Mensch. Als höchste Form der Anpassung aber ist das Spiel die sich als letzte herausbildende Form der Anpassung. Sie setzt eine Wirklichkeit voraus, die für das Spiel mit ihr geeignet, die darauf eingerichtet ist. Das dauert ein Weilchen. Und sie setzt einen Menschen voraus, der dieses Spiel versteht. Der Erwachsene unterscheidet sich vom Kind nicht dadurch, dass er über das Alter des Spielens hinaus ist, sondern dadurch, dass sein Spiel auf ein anderes Objekt gerichtet ist. Dem kindlichen Spiel vertrauen wir nur Nachbildungen der Wirklichkeit an, dem des Erwachsenen ist die Wirklichkeit selbst anvertraut. Das setzt aber auch den erwachsenen, den historisch erwachsenen Menschen voraus. Nur weil die menschliche Gattung das Alter des Spielens noch nicht erreicht hat, glaubt der Erwachsene, über das Alter des Spielens hinaus zu sein. In Wirklichkeit ist er in dieses Alter noch nicht eingetreten. Erst der spielende Mensch ist der als Gattung erwachsene Mensch. Wir hingegen sind noch damit beschäftigt, aus den Flegeljahren herauszukommen, was uns sehr schwerfällt, da wir nicht einmal wissen, dass wir in ihnen sind. Wollte sagen: es bis heute nicht wussten.
Erst der zum Spiel mit der Wirklichkeit befähigte Mensch und die auf das Spiel mit ihr eingerichtete Wirklichkeit passen zusammen, sind einander angepasst. Erst dann haben wir eine menschliche Wirklichkeit und den wirklichen Menschen. Erst im Spiel mit der Wirklichkeit macht sie uns Vergnügen, stellen wir uns mit ihr auf vertrauten Fuß, fühlen wir uns in ihr zu Hause. Uns in der Welt heimisch zu fühlen ist aber der Endzweck aller Anpassung. Und wenn wir ihn erreicht haben, fängt es erst richtig an. Das Spiel mit der Wirklichkeit als höchste Form der Anpassung ist jedoch den Gewohnheiten als deren niederster Form diametral entgegengesetzt. Waren die Gewohnheiten das konservative Element der Anpassung, so ist das Spiel deren revolutionäres. Daher ist es das wirksamste Korrektiv der Gewohnheiten. Im Spiel – das liegt in seiner Natur – wird nichts so gelassen, wie es ist. Da heißt es nicht: Das habe ich schon immer so getan; da heißt es: Mal sehen, ob es anders besser getan werden kann. Da wird die Wirklichkeit auf ihre menschlichen Möglichkeiten geprüft, da wird das Menschenmögliche probiert. Das Spiel mit der Wirklichkeit ist die höchste Form ihrer Beherrschung. Und die höchste Form der Selbstbeherrschung. Daher ist das Spiel mit der Wirklichkeit das genussvollste aller Spiele. Der Spieltrieb des Menschen, erst einmal wieder geweckt und auf die Wirklichkeit, die gesellschaftliche vor allem, gelenkt, findet jetzt seinen menschlichen Sinn. Und jetzt erst erfüllt sich der Sinn des menschlichen Lebens. Denn erst der spielende, der mit seinen Lebensbedingungen spielende Mensch ist wirklich Mensch. Die Kunst nun, bereits mehrmals aufgerufen, Vorahmung der Wirklichkeit zu sein, wird jetzt zur Vorahmung des Spiels mit der Wirklichkeit berufen. Ihr Amt ist es, den Genuss dieses Spiels, aber auch seine Regeln vorzuahmen, denn ohne Regeln spielten wir nicht mit der Wirklichkeit, wir würden sie verspielen. Wenn sich aber im regelrechten Spiel mit der Wirklichkeit der Sinn des menschlichen Lebens erfüllt, wird die Kunst, indem sie uns durch die Vorahmung dieses Spiels zu ihm befähigt, zur Lebenskunst. Und das Leben selbst, den Regeln der Kunst folgend, sie nachahmend, wird zur Kunst. Es nimmt ihre Form an, formiert sich nach ästhetischen Regeln.
Schließen wir: Jedes Lebewesen hat seine spezifische Eigenentwicklung, die letzten Endes jedoch nichts anderes als eine spezifische Form der Anpassung an die Natur ist. Auch der Mensch ist und bleibt ein Wesen der Natur und folgt in seiner Entwicklung dem Naturgesetz der Anpassung, wenngleich diese sich, bedingt durch die Spezifik des Menschen; produktives Wesen zu sein, als Anpassung der Natur an den Menschen spezifiziert. Diese Anpassung nun durchläuft drei Phasen, die sich durch das Verhältnis des Menschen zur Produktion voneinander unterscheiden. Während in der ersten Phase alle Menschen das gleiche, weil noch natürliche Verhältnis zur Produktion haben, wird in der zweiten Phase ein Teil der Menschen der Produktion angepasst, um dem anderen Teil als Produktionsmittel zu dienen. Die dritte Phase hingegen zeichnet sich durch die Anpassung der Produktion an den Menschen aus, wodurch dieser wieder zu einem ungeteilten, also natürlichen Wesen wird. Erst jetzt kann er sich der Natur, kann er die Natur sich anpassen.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das ist richtig. Ohne ein bestimmtes Repertoire an Gewohnheiten wäre er nicht existenzfähig. Das hat er mit dem Tier gemein. Die dem Menschen gemäße Form der Anpassung aber ist die spielende, spielerische, die als Spiel betriebene. Erst da, wo er anfängt, mit der Wirklichkeit zu spielen, hört er auf, Tier zu sein. Erst in diesem Spiel findet der Mensch sein wahres Wesen. Und erst, indem die Kunst ihm darin vorahmt, wird sie selber wesentlich, wird sie zu einem Bedürfnis des menschlichen Wesens.
Übliche Rückverwandlung.
Hermann: Wenn ich Sie recht verstanden habe, hat die Kunst die Funktion der Anpassung, wodurch die Anpassung zu einer Kunst wird.
Liesbeth: Ich dachte immer, wer sich anpasst, ist ein Lump.
Alfons: Und wer sich nicht anpasst, ist ein Idiot! Der kriegt was vorn Latz und ist ein toter Mann. Haut auf die Tasten. Leute, passt euch an, und ihr habt mehr vom Leben! Haut wieder auf die Tasten. Resigniert Jedenfalls habt ihr eure geheiligte Ruhe.
Toredid: Anpassung und Anpassung sind zweierlei. Die eine ist ein Naturgesetz, die andere ist Opportunismus.
Hermann: Was nicht ausschließt, dass sich beide in die Haare kriegen.
Toredid: Das ist sogar unvermeidlich. Das Gesetz der Anpassung fordert die Anpassung der Wirklichkeit an den Menschen, der Opportunist hingegen passt sich der gegebenen Wirklichkeit an. Statt sie zu verändern, macht er es sich in ihr bequem. Wenn da einer daherkommt und die Wirklichkeit verändern will, vielleicht gar noch mit ihr spielen …
Hermann: Da spuckt der Opportunist Gift und Galle, da gerät er in Panik.
Pirol: Und dann beruhigt er sich wieder. Weil nichts war. Weil es nur falscher Alarm war. Das Spiel mit der Wirklichkeit findet nicht statt.
Toredid: Und warum nicht?
Pirol: hämisch Weil es in Wirklichkeit nicht geht.
Toredid: vergnügt Das ist eine Behauptung, keine Widerlegung.
Hermann: Stimmt.
Pirol: giftig Ihre Theorie widerlegt sich selbst, hanebüchen wie sie ist.
Hermann: bekommt Spaß an der Sache Das ist wieder nur eine Behauptung! Zu Toredid Wenn der so weitermacht, siegen wir auf der ganzen Linie. Haut Toredid vor Begeisterung mächtig auf die Schulter
Toredid: kontrolliert, ob noch alle Knochen an ihrer Stelle sind Noch solch ein Schlag, und wir siegen ohne mich.
Liesbeth: Mal davon ab. Das mit den Zugvögeln und dem Ofen ist mir eingegangen. Die Tiere müssen sich der Natur anpassen, wenn sie den Winter überleben wollen. Der Mensch dagegen heizt die Wohnung. Wieso ist das aber auch eine Anpassung an die Natur?
Hermann: Wann heizt du denn, im Winter oder im Sommer?
Liesbeth: Im Winter natürlich.
Hermann: betont Natürlich!
Toredid: Alles, was der Mensch tut, erklärt sich letzten Endes aus der Notwendigkeit der Anpassung. Das hat er mit dem Tier gemein. Das Tier kann sich jedoch nur organisch anpassen, daher entwickelt es sich auch nur organisch. Dieser Entwicklung sind aber biologische Grenzen gesetzt. Der Mensch hingegen verwandelt die Natur selbst, er macht die grenzenlose Natur zum Material seiner Anpassung. Daher sind die Möglichkeiten seiner Entwicklung unbegrenzt.
Pirol: Aber nicht beliebig.
Toredid: Natürlich nicht. Wenn wir die Natur vermenschlichen, ihr unsere Form geben, so kann das doch immer nur eine besondere Form der Natur sein. Das gebieten ihre Gesetze. Ihnen können wir nicht entrinnen. Und das ist unser Glück. So bleiben wir immer Kinder der Natur. Auch wenn wir gegenwärtig ziemlich entartete sind.
Pirol: ironisch Ich für meine Person habe nichts dagegen, ein Kind der Natur zu sein. Wenn ich mich recht erinnere, geht es in unserem Gespräch jedoch um etwas ganz anderes, nämlich um die Frage, ob heutzutage große Kunst möglich ist.
Toredid: Allein das Verständnis der Einheit von Mensch und Natur ist eine wesentliche Voraussetzung der Kunst.
Pirol: Die Einheit von Mensch und Natur hat schon der Pantheismus gesucht und verfehlt.
Toredid: Weil er das wirkliche Wesen des Menschen verfehlt hat.
Pirol: Da mussten erst Sie kommen mit Ihrer Theorie des höchsten Wesens!
Hermann kommt von der Theke, ein Schnapsglas in der Hand.
Hermann: Das mit der Anpassung, das will mir nicht aus dem Kopf. Hat man einmal angefangen, darüber nachzudenken, begegnet sie einem überall. Nehmen wir diesen Schnaps. Ich kippe ihn oben zur Luke rein – tut es – und er kommt von allein unten im Magen an, wo er ja hingehört. Und warum kommt er da an? Weil der Bau des menschlichen Körpers dem Fallgesetz angepasst ist. Wie ist das aber mit der Psyche, beispielsweise mit der Moral? Folgt die auch dem Gesetz der Anpassung?
Toredid: Gewiss.
Pirol: frohlockt Das glaubhaft zu machen dürfte Ihnen nun doch schwerfallen. Ich bestreite nicht, dass der Sitz des Magens ein Ergebnis der Anpassung ist, eine Moral lässt sich daraus aber wohl kaum machen. Lacht affektiert.
Toredid: Wie ich feststelle, lässt sich daraus nicht einmal ein guter Witz machen.
Hermann: gewollt naiv Es lacht ja auch keiner.
Pirol verschluckt sein Lachen, worüber die anderen herzhaft lachen
Liesbeth: Was ist nun mit der Moral? Das interessiert mich.
Alfons: Mich auch. Da wird’s nämlich politisch.
Liesbeth: Wieso?
Alfons: Weil die Moral doppelt ist. Doppelte Moral aber ist Politik.
Liesbeth: Das ist mir zu hoch.
Alfons: Beispiel: Offiziell verkündet man: alles Gute und Schöne wird gefördert. In Wirklichkeit geht es aber ganz anders lang, nimm nur das Theater. Was nicht in den Kram passt, hat zu unterbleiben, und wenn es noch so gut und schön ist. So sieht die Wirklichkeit aus, und danach sieht auch die Moral aus. Da wär’s mir tatsächlich lieber, Sie hätten recht und die Moral gehorchte einem Naturgesetz. In Wirklichkeit gehorcht sie ganz was anderem. Aber in Ihrer großspurigen Theorie kommt die Wirklichkeit ja nicht vor. Sie bauen nichts als Luftschlösser, ich aber muss mit sechs Personen in einer baufälligen Zweieinhalbzimmerwohnung hausen.
Hermann: betroffen So kenne ich dich ja gar nicht. Ich hab’ dich nie richtig ernst genommen, aber was du da sagst …
Alfons: in gesteigerter Erregung Was weißt du denn schon! Meinst du, ich hocke zum Vergnügen hier rum und spiele den Hanswurst? Ich war mal wer, lange, bevor du zum Theater gekommen bist.
Hermann: Und wer warst du?
Alfons: Parteisekretär.
Hermann: Am Theater?
Alfons: Ja, und dann war ich’s auf einmal nicht mehr. Weil ein Stück abgesetzt wurde, ein gutes Stück. Aber plötzlich war das kein gutes Stück mehr, und weil ich das nicht wahrhaben wollte, wurde ich gleich mit abgesetzt. Und wie das so geht. Einige Jahre später war das Stück plötzlich wieder ein gutes.
Liesbeth: Da warst du doch gerechtfertigt.
Alfons: Denkst du. Da gab es einige, die konnten es mir nicht verzeihen, dass sie unrecht gehabt hatten. Und als wieder ein Stück abgesetzt wurde und ich wieder der einzige war, der es nach wie vor für gut hielt, hatte ich ganz ausgespielt.
Hermann: Das Wichtigste für das Theater ist ein gutes Stück, und wer das als erster erkennt, sollte einen Preis kriegen.
Alfons: Stattdessen kriegt er Ärger. Weil da welche sind, die selber keinen kriegen möchten. Wie viel Gutes geht verloren, nur weil einige glauben, es könnte Ärger machen! Sie verhüten den Ärger, und damit verhüten sie, dass was zustande kommt.
Hermann: Aus Verhütungen kommt der Sozialismus nicht zustande.
Alfons: Aber den Verhütern geht es gut in ihm. Abgesehen davon, dass sie sich den Charakter verderben. Der Gesellschaft jedoch werden gute Stücke entzogen, den Autoren wird ein nicht wieder gutzumachendes Unrecht zugefügt, und ich habe meinen Beruf verloren.
Hermann: Und was machst du jetzt?
Alfons: Was ich gemacht habe, bevor ich zum Theater ging. Fenstertischler in einem Baubetrieb. Aber vom Theater komme ich nicht los. Nach Feierabend tauche ich immer mal hier auf, auch wenn ich mich dann doch nur besaufe.
Pirol: zu Toredid Das passt unserem großen Theoretiker nicht ins Konzept, wie?
Toredid: zu Alfons, ohne Ironie Ich danke Ihnen. Deutet eine Verneigung an.
Alfons: Wofür? Dass ich Sie endlich bekehrt habe?
Toredid: Im Gegenteil.
Alfons: Sie nehmen das, was ich gesagt habe, doch nicht etwa als Beweis für die Richtigkeit Ihrer Theorie?!
Toredid: Nicht als Beweis für die Richtigkeit, aber als Beweis für die Nützlichkeit meiner Theorie.
Alfons: Sie sind wohl nicht bei Tröste!
Toredid: wieder fröhlich Wir wollen nicht vom Thema abweichen. – Was Sie eben geschildert haben, ist nicht nur Ihnen widerfahren, mir ist eine Reihe ähnlicher Fälle bekannt. Inwiefern das die Nützlichkeit meiner Theorie beweist, erkläre ich später. Zunächst ist die Frage zu beantworten, ob die Moral dem Naturgesetz der Anpassung unterliegt.
Pirol: Vorwärts! Ich bin gespannt.