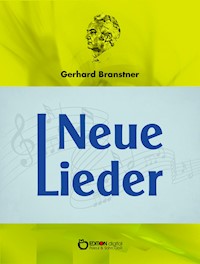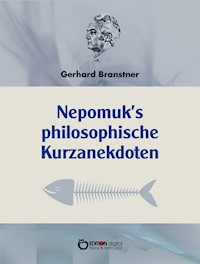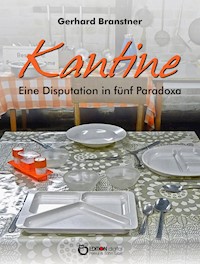
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wozu schreibt man ein Buch? Damit es gelesen wird. Und wozu schreibt man ein Theaterstück? Damit es gespielt wird. Solche Absicht hatte wahrscheinlich auch Gerhard Branstner, als er seine „Kantine“ schrieb. Im Deutschen Theater in Berlin sah es auch Rainer Kerndl, der Theaterkritiker des „Neuen Deutschland“: Dialog über Kunst, aber kein spielbares Stück Gerhard Branstners „Kantine" im Foyer des DT Seinen Diderot hat Gerhard Branstner gut gelesen, in verwandelter Form reicht er ihn weiter ans Theaterpublikum: Der, optimistische Herr Toredid — lesen Sie den Namen mal rückwärts — gibt vermittels philosophierender Plauderhaftigkeit einiges zum besten, über die Möglichkeit, heutzutage und hier gute Stücke fürs Theater zu verfertigen, über Kunst und Wirklichkeit, Ideal und Machbares, über Gesellschaft und Theater und und und … „Kantine“ nennt Branstner den Dialog, der im Grunde ein Diskurs mit gelegentlichen Einwänden und Zustimmungen der Partner ist, sicher manch lesenswertes Paradoxum zum weiten Feld der angeschnittenen Themen enthält, nur allerdings eines ganz und gar nicht ist: ein spielbares Theaterstück. Das wird am Ende unfreiwillig komisch: Die gar nicht so undummen Äußerungen Herrn Toredids über fantasievolles Theater geraten allenfalls zur ästhetisch-abstrakten Programmerklärung, ganz und gar nicht zur Erfüllung. Genau eben das, was in dem fiktiven Theaterkantinengespräch verlangt wird, findet absolut nicht statt. „Kantine“ ist kein spielbares Stück. Autoren mögen solchem Irrtum unterliegen. Weshalb auf Theaterqualität versessene Dramaturgen eines hochdotierten Schauspielhauses sie kritiklos nachvollziehen, mag eines der letzten Geheimnisse des Jahres 1979 bleiben. Wenn man diesen Text als eine Art festgeschriebener Plauderei — gewissermaßen als im Straßenanzug und mit der Absicht, das Publikum als Partner einzubeziehen — weitergegeben hätte … warum nicht? Ihn als ein Stück Theaterfantasie in naturalistischer Dekoration und mit dem krampfhaften Versuch szenischer Haltungen und Handlung zu verkaufen, ist nur als grandioser Irrtum zu verstehen. Er fand statt im obergeschossigen Foyertheater des Deutschen Theaters in der Berliner Schumannstraße. Als Gastregisseur ließ sich Hartmut Ostrowsky nennen, Ernst Kahler bringt es fertig, seine Toredid-Texte mit erstaunlich gelassener Heiterkeit anzubieten, die vier anderen Darsteller versuchen, aus ihren Stichwort-Texten Spielhaltungen abzuleiten. Aber machen Sie sich am besten Ihr eigenes Bild.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Gerhard Branstner
Kantine
Eine Disputation in fünf Paradoxa
Die Erstveröffentlichung erfolgte 1977 beim VEB Hinstorff Verlag Rostock.
ISBN 978-3-96521-772-0 (E–Book)
Titelbild: Ernst Franta
© 2022 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E–Mail: verlag@edition–digital.de
Internet: http://www.edition-digital.de
KANTINE
Eine Disputation in fünf Paradoxa
Ein optimistischer Gast namens Toredid, ein skeptischer Theaterkritiker namens Pirol, der gutgläubige Schauspieler Hermann, der Gelegenheitsklavierspieler Alfons und die Kantinenkellnerin Liesbeth disputieren die Frage, ob große Kunst in unserer Zeit möglich ist, und überprüfen dabei auch vergangene und künftige Zeiten.
Alfons spielt eine Fantasiemischung auf dem Klavier. Sobald der Vorhang sich gänzlich geöffnet hat, wendet Alfons sich um, bohrt sich in den Zähnen und blickt auf Pirol. Der sitzt allein an seinem Tisch und starrt in den vor ihm stehenden Kaffee. Liesbeth lehnt gähnend an der Theke und hascht ohne Ehrgeiz nach einer vor ihrer Nase umherschwirrenden Fliege. Gedämpfte Musik klingt auf.
Liesbeth: Die Vorstellung beginnt.
Pirol: Ich kann es nicht verhindern.
Liesbeth stellt den Bühnenlautsprecher ein. Musik schwillt an, und Beifall klingt auf. Liesbeth will etwas sagen, gibt es aber mit Blick auf Pirol auf, stellt den Lautsprecher ab. Alfons spielt wieder Klavier. Toredid tritt ein, sieht sich um, woran man erkennt, dass er ortsfremd ist. Liesbeth geniert sich wegen ihrer legeren Haltung und stellt sich adrett hin; man sieht ihr an, dass der Gast sie irritiert. Alfons spielt noch ein paar Takte, hört wie hypnotisiert auf und wendet sich langsam um. Allein Pirol achtet nicht auf den Fremden, stiert weiter in seinen Kaffee. Toredid hat etwas Anonymes, Zeitloses an sich: der altmodische Hut, Anzug und Stockschirm kontrastieren auf seltsame Art mit seinem jugendlichen Aussehen und seinem freien Benehmen. Er tritt an Pirols Tisch.
Toredid: Bitte, ist dieser Stuhl frei?
Pirol: blickt erstaunt auf. Nicht nur dieser. Weist auf die übrigen Tische, die alle unbesetzt sind.
Toredid blickt zu Liesbeth. Sie kommt sogleich heran. Toredid reicht ihr Hut und Schirm. Sie hatte eine Bestellung erwartet, nimmt in ihrer Verblüffung jedoch Hut und Schirm und bringt beides zum Kleiderständer.
Toredid verneigt sich leicht gegen Pirol.Toredid.
Pirol: Pirol.
Toredid: Ich weiß. Setzt sich.
Pirol: Sie kennen mich?
Alfons: der bereits einiges getrunken hat Wer kennt Pirol nicht? Den unfehlbaren Theaterkritiker! Und weshalb ist er unfehlbar? Weil er seine Kritik immer erst nach der fünfzigsten Vorstellung eines Stückes schreibt.
Toredid: zu Liesbeth Einen Kaffee bitte.
Pirol: Ein Stück, das fünfzig Vorstellungen erreicht, muss entweder sehr gut oder sehr schlecht sein. Und da es gute Stücke nicht gibt, weiß ich bei einem, das die fünfzigste Vorstellung erlebt, genau, woran ich mit ihm bin.
Toredid: Heute wird ein Stück das fünfzigste Mal gegeben. Beifall ist zu hören. Die Vorstellung hat bereits begonnen.
Pirol: Sie möchten wissen, weshalb ich in der Kantine sitze statt im Parkett?
Toredid: Ich nehme an, Sie sind sich diesmal doch nicht ganz sicher, ob es ein schlechtes Stück ist, das die fünfzigste Vorstellung erreicht hat. Und um einem Fehlurteil zu entgehen, sehen Sie es sich gar nicht erst an.
Alfons: Das hat gesessen. Lacht schadenfroh
Pirol: steht drohend auf Wie war Ihr Name?
Toredid: ungerührt freundlich Toredid.
Pirol: Nie gehört. Setzt sich wieder. Einen seltenen Namen soll man nicht ausrotten.
Toredid: Das ist weltmännisch gedacht.
Hermann kommt in voller Maske herein.
Hermann: in fröhlicher Wut Ein Miststück ist das! Ein Scheißstück! Ahmd, Liesbeth!
Liesbeth: Ahmd, Hermann!
Hermann setzt sich ohne Umstände zu Pirol und Toredid an den Tisch.
Hermann: zu Liesbeth Kurz und klar!
Liesbeth bringt einen Klaren.
Hermann: Ich möchte bloß wissen, was so ein Autor sich dabei denkt! Zwei Sätze am Anfang und zwei Sätze am Schluss, und die zwei Stunden dazwischen kann ich in der Kantine hocken; das soll nun eine Rolle sein! Zwei Stunden Kantine, und das fünfzigmal. Macht genau hundert Stunden. Pro Stunde zwei Klare, macht zweihundert Klare. Trinkt das Glas aus, stülpt es auf den Zeigefinger und reckt ihn hoch. Das geht ins Geld. Liesbeth bringt ein gefülltes Glas, nimmt das geleerte vom Finger, Hermann schleckt ihn ab. Aber daran denkt so ein Autor nicht. Und das Publikum, das denkt auch nicht an so was. Sitzt da unten und lacht blöd. Zu Pirol. Was sagst du denn dazu, du bist doch Kritiker?
Pirol: Was soll ich dazu sagen?
Hermann: Dass ich recht habe, sollst du sagen! Ums Maul sollst du mir gehen, wozu bist du Kritiker! Also, was sagst du?!
Pirol: Nichts.
Hermann: zu Toredid Da haben Sie’s! Entweder gehen sie einem ums Maul, oder sie halten, wenn sie nicht wissen, ob’s das richtige Maul ist, die Klappe. Das sind mir Kritiker! Wer sind Sie denn überhaupt?
Toredid: Toredid.
Hermann: Nie gehört. Erhebt sich wie vordem Pirol. Nichts für ungut, muss mal telefonieren. Ab. Kunstpause. Alfons wendet sich zum Klavier und spielt ein paar rauschende Takte, hört abrupt wieder auf. Kunstpause.
Pirol: Es kann kein gutes Stück sein.
Toredid: Aber sicher sind Sie sich nicht.
Pirol: Wir leben in einer Zeit, in der nur schlechte Stücke geschrieben werden können. Nicht, dass unsere Zeit an sich schlecht wäre. Wer wollte das behaupten? Aber es ist eine schlechte Zeit für gute Stücke.
Toredid: Ein interessanter Gedanke.
Pirol: Sie teilen meine Meinung nicht?
Toredid: Ich bin genau der entgegengesetzten. Keine Zeit war so gut für gute Theaterstücke wie unsere.
Pirol: Eine kühne Behauptung.
Toredid: Eine andere aufzustellen würde sich nicht lohnen.
Pirol: Und der Beweis?
Toredid: Er wird nicht kurz sein, aber heiter.
Pirol: Da lache ich schon jetzt.
Toredid: Tun Sie es, solange Ihnen noch danach zumute ist.
Pirol: Gehn wir in den Ring. Sie für die Behauptung, dass heutzutage große Kunst möglich ist, und ich für die gegenteilige.
Toredid: Und in welcher Runde wünschen Sie, k. o. zu
Pirol: Wer gewonnen hat, entscheiden nicht Sie.
Alfons: Wir brauchen einen Schiedsrichter.
Toredid: Das Publikum soll Richter sein.
Pirol: Einverstanden.
Alfons: deutet auf dem Klavier einen Tusch an Das Spiel kann beginnen.
Pirol: Was ist das Charakteristikum unserer Zeit? Die Diskussion. Es wird viel diskutiert, aber wenig gestritten. Wir haben zu wenig strittige Punkte und zu viel unstrittige. Die Kunst, jedenfalls die dramatische, lebt aber vom Streit.
Toredid: Das ist richtig. Und das Gegenteil ist auch richtig-
Pirol: Auch? Hätte sich beinahe am „auch“ verschluckt
Toredid: amüsiert Auch.
Pirol: Das ist ein Paradoxon.
Toredid: Ganz recht.
Toredid steht auf, nimmt den Schirmstock, spickt ihn nahe der Rampe in den Boden, zieht den Stiel wie ein Mikrofonstativ hoch, klappt den Griff wie ein Notenpult auseinander und legt ein Manuskript auf das so entstandene Katheder. Zieht das Lesezeichen, ein Kinnbärtchen, aus dem Manuskript, klebt es sich an und setzt einen Kneifer auf. Jetzt nimmt er in professoraler Pose das Publikum zum Auditorium. Alfons spielt einen Tusch. Toredid hält eine Kurzvorlesung. Toredid in der Mimik, Gestik und Sprechweise des akademisch ernsten, etwas komischen, liebenswerten, manchmal in Verzückung geratenden und das Auditorium vergessenden Professors
Das Erste Paradoxon der Kunst
Der Streit, so heißt es, ist der Vater aller Dinge. Wer aber ist ihre Mutter? Gewöhnlich ist die Frage nach der Mutter leichter zu beantworten als die nach dem Vater. Die Frage nach der Mutter aller Dinge ist jedoch die schwierigste aller Fragen. Und bis heute hat man keine Antwort darauf gefunden. Deshalb wurde sie auch nie gestellt, denn schlaue Leute stellen eine Frage erst dann, wenn sie die Antwort wissen. Um die unsre zu beantworten, müssen wir zunächst das metaphorische Wort Streit durch den wissenschaftlichen Begriff „Widerspruch“ ersetzen. Ein Widerspruch besteht bekanntlich aus zwei Seiten, die sich, da einander entgegengesetzt, bekämpfen und auf diese Weise vorantreiben. Weshalb treiben sie sich nicht auseinander? Gegensätze ziehen sich an, sagt man. Weshalb aber ziehen sie sich an? Weil dialektische Gegensätze einander gegensätzlich und zugleich miteinander identisch sind. Jede Seite eines Widerspruchs birgt das Wesensmerkmal der anderen Seite in sich. Und je identischer beide sind, desto besser funktionieren sie als sich wechselseitig vorantreibende Gegensätze. Wie also der Widerspruch, der Kampf der Gegensätze, der Vater aller Dinge ist, so ist die Identität – der Gegensätze – die Mutter aller Dinge, denn ohne sie läuft nichts zusammen, sondern alles auseinander. Auch in der Kunst. Welche Identität aber ist die Mutter der Kunst? Die Identität der Gegensätze Kunst und Wirklichkeit.
Pirol: Wie? Kunst und Wirklichkeit sollen Gegensätze sein? Das klingt nicht gut, gar nicht gut.
Toredid: Doch es ist gut, es ist das Beste, was beide sich gegenseitig sein können. Oder war es nicht so, dass Gegensätze sich wechselseitig vorantreiben? Also ist es das Beste für die Kunst wie für die Wirklichkeit, wenn sie einander entgegengesetzt sind. Nur wenn die Kunst der Wirklichkeit widerspricht, hat sie etwas zu sagen. Sie kann freilich der Wirklichkeit nur widersprechen, wenn sie sich auf den entgegengesetzten Standpunkt, also auf den Standpunkt des Nichtwirklichen stellt.
Das wirklich Nichtwirkliche aber ist das Mögliche. Allein vom Standpunkt des Möglichen aus kann die Kunst den Widerspruch der Wirklichkeit zu ihren Möglichkeiten erfassen. Das aber ist der einzige wirklich interessante Widerspruch, denn allein aus ihm entspringen die uns wirklich bewegenden Probleme.
Toredid wühlt im Manuskript, als ob er die Probleme suche.
Nun sind jedoch Wirklichkeit und Möglichkeit in ständiger Veränderung begriffen: Jede neue Wirklichkeit produziert neue Möglichkeiten, und jede neue Möglichkeit postuliert eine neue Wirklichkeit. So erneuert sich der Widerspruch ständig, will sagen: Wirklichkeit und Möglichkeit stehen unaufhörlich in einem dialektischen, mithin gespannten Verhältnis zueinander.
Pirol: Was aber, wenn die Wirklichkeit in keinem Verhältnis zu ihren Möglichkeiten steht, wenn das Verhältnis beider ein Missverhältnis ist?
Toredid: Da muss halt die Wirklichkeit um des Möglichen willen unmöglich gemacht werden.
Pirol: Und von wem?
Toredid: Von der Kunst. Sie hat an dem Verhältnis in guten Zeiten teil, also hat sie auch in schlechten Zeiten Anteil zu nehmen. Sie hat die missratene Wirklichkeit unmöglich zu machen, um dem Möglichen zur Wirklichkeit zu verhelfen. Die Kunst – speziell die Literatur – ist Hebamme des Möglichen, das ist ihr Beruf. Und der verlangt wie jeder andere Gewissen und Wissen. Die Kunst muss wissen, was wirklich, faktisch, objektiv möglich ist Das ist nicht alles Denkbare, aber es ist das Realisierbare. Und das ist genug. Das ist mehr, als die meisten ahnen, jedenfalls aber mehr, als manche wahrhaben wollen. Es ist das, was sein könnte, aber nicht ist.
Die objektive Möglichkeit ist das Maß der Wirklichkeit. Und indem die Kunst von diesem Maß ausgeht, geht sie der Wirklichkeit voraus, wird sie vom Abbild der Wirklichkeit zu deren Vorbild, hört sie auf, Nachahmung der Wirklichkeit zu sein, und wird – was bleibt ihr andres übrig? – Vorahmung der Wirklichkeit.
Da haben wir es: Die Kunst ist Vorahmung der Wirklichkeit. Aber nicht, indem sie die Vorahmung als schon vorhandene Wirklichkeit, also eine verschönte Wirklichkeit vorführt, sondern indem sie die Wirklichkeit kritisch, als ihrer Vorahmung noch nicht entsprechend, darstellt. Um aber vorahmen zu können, um der Wirklichkeit vorausgehen zu können, muss die Kunst von der Wirklichkeit ausgehen, denn diese und nur diese birgt die verwirklichbaren Möglichkeiten, und die verborgensten sind die interessantesten. Folglich muss die Kunst tief in die Wirklichkeit eindringen, muss sich aufs Innigste mit ihr verbinden. Die innigste Verbindung aber ist – die Identität. Also ist Identität der Gegensätze Kunst und Wirklichkeit erforderlich. Und diese Identität ist die wahre Mutter aller Kunst. Ohne sie wäre der Gegensatz von Kunst und Wirklichkeit unproduktiv, nihilistisch, zerstörerisch, weil ein unnatürlicher Gegensatz, wie umgekehrt die Identität von Kunst und Wirklichkeit, die nicht den Gegensatz beider einschließt, eine unnatürliche und falsche und demzufolge leblose, faule, schlechte Identität wäre, auch wenn sie manchem recht wäre.
Schließen wir: Die Kunst lebt vom Streit. Das ist richtig. Sie lebt vom Streit mit der Wirklichkeit, denn sie streitet für das Mögliche. Also muss der Künstler ein streitbarer Mensch sein, was er nur sein kann, wenn er keinen Respekt vor der Wirklichkeit hat. Richtig ist aber auch, dass die Kunst von der Identität lebt, von der Verbindung mit ihrer Wirklichkeit, mit ihrer Zeit. Also muss der Künstler mit seiner Zeit verbunden sein, insbesondere da, wo das menschenfeindliche Missverhältnis von Wirklichkeit und Möglichkeit nicht mehr besteht, in unserer Zeit also.
Ein Mensch, der mit dieser Zeit nicht in Übereinstimmung lebt, in dem lebt unsere Zeit nicht, und er sieht in unserer Wirklichkeit keine Möglichkeiten. Ein solcher Mensch ist das bedauernswerteste Geschöpf unter der Sonne. Und wäre er Künstler, so wäre er keiner.
Toredid bedankt sich mit Verneigen für die Aufmerksamkeit des Publikums, Alfons spielt einen Tusch, Toredid stellt den alten Zustand wieder her und setzt sich, sich jetzt wieder in seiner eigenen Art gebend, an den Tisch.
Pirol: ironisch Da haben wir nun in Gestalt des Widerspruchs zwischen Kunst und Wirklichkeit den Vater der Kunst und in der Identität der beiden ihre Mutter. Nur die Kunst haben wir nicht.
Alfons: Den Eindruck habe ich auch.