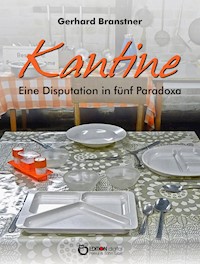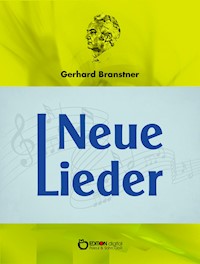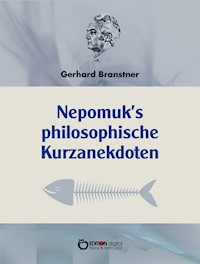7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Hausbuch ist in typisch Branstnerscher Manier nicht zuletzt oder besser gesagt vor allem eine Lobpreisung – eine Lobpreisung des Spiels, wie der Autor in seiner „Gebrauchsanweisung“ anmerkt: Brecht war ohne Zweifel ein Revolutionär der Literaturgeschichte und ein Revolutionär auf dem Theater. Seine Methode, die Darstellung, das Dargestellte der progressiven Kritik preiszugeben, hat über viele Jahre und viele Länder Wirkung gezeigt. Aber wer diese Welt hinter sich hat, wer mit ihr fertig ist, der hat die Kritik über. Er will eine positive Haltung einnehmen. Und die positivste Haltung ist das Spiel. Folglich stelle ich nicht dar, um das Dargestellte der Kritik preiszugeben, sondern um es dem Spiel preiszugeben. Im Spiel setzen wir alle unsere Wesenskräfte frei. Es ist die höchste Verwirklichung des Menschen. Das hat schon Schiller geahnt. Nur gewusst hat er es nicht. Die Zeiten waren nicht ernst genug. Die ernstesten Zeiten bedürfen der größten Heiterkeit. Das ist nicht paradox. Das ist Dialektik. Ohne Heiterkeit aber ist das Spiel nicht möglich. Dieses Buch ist ein Exempel der vielfältigsten Heiterkeit. Als Voraussetzung der hohen Kunst des Spiels. Hier ein Beispiel aus der Abteilung „Der skurrile Mensch“: Ein lahmer Schreiber kann keinen eiligen Brief schreiben Ein Kaufmann bat einen Schreiber: „Setze mir einen Brief auf, es ist eilig!“ „Das geht nicht“, erwiderte der Schreiber, „ich habe mir den Fuß verstaucht.“ Der Kaufmann konnte diese rätselhafte Rede nicht verstehen. Da stand der Schreiber auf und humpelte einige Male hin und her. „Wenn der Brief etwas weniger eilig ist“, sagte er, „könnte es gehen.“ Der Kaufmann verstand noch immer nicht. „Ich will dich ja nirgendwo hinschicken“, sagte er, „du sollst mir doch nur einen Brief aufsetzen.“ „Jedes Mal, wenn jemand einen von mir geschriebenen Brief erhält“, erklärte jetzt der Schreiber, „lässt man mich rufen, da kein anderer als ich meine Handschrift lesen kann.“ „Das trifft sich gut“, sagte der Kaufmann, „denn der Brief soll eine geheime Botschaft enthalten. Und gar so eilig ist er nicht.“ Da war der Schreiber einverstanden und setzte die geheime Botschaft auf. Er kritzelte jedoch nur willkürliche Zeichen auf das Papier, denn in Wirklichkeit konnte er überhaupt nicht schreiben. Aber er besaß ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Also: Das schlimmste Gekrakel gilt oft als Orakel Weitere Kapitel sind unter anderem dem erotischen und dem philosophischen sowie dem weisen und dem törichten Menschen gewidmet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Gerhard Branstner
Die Weisheit des Humors
Ein Hausbuch
Das Buch erschien 2002 im Eigenverlag Gerhard Branstner, gefördert duch:
Philosophischer Salon e.V., Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin
ISBN 978-3-96521-760-7 (E–Book)
Titelbild: Ernst Franta
Wir bedanken uns beim Verlag Dietmar Klotz für die Genehmigung zum Abdruck der Tierfabeln.
© 2022 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E–Mail: verlag@edition–digital.de
Internet: http://www.edition-digital.de
Ohne Wahrheit ist die Kunst,
was die Pflaume ohne Wurm:
ein Ding,
worüber sich kein Mensch aufregt
Gebrauchsanweisung
Dieses Buch soll der Erbauung dienen, in diesem Sinne ist es ein Hausbuch. Aber es ist auch ein Buch für Rezitatoren, Profis und Hobbyrezitatoren. Darüber hinaus ist es eine Fundgrube für die Kleinkunstbühne. Und auch Komponisten finden hier vielfältiges Material. Das Buch kann also gelesen, gesprochen, gespielt und gesungen werden. Am besten, indem ich eine Rolle annehme, z.B. die des Trunkenbolds, der höheren Tochter, des Bösewichts, des Stotterers usw. und von dieser Rolle aus vortrage.
In anderer Weise enthält das Buch eine philosophische Weltansicht. Wer wissen will, in welcher Zeit er lebt und welche er vor sich hat, kann sich hier Auskunft und Zuversicht holen. Und vor allem ist es eine Weltparodie. Denn wer mit dieser Welt fertig ist, wer sie geistig, politisch und moralisch hinter sich hat, der kann sie nur noch als Parodie nehmen, als Parodie von ihr Abschied nehmen. Und schließlich erfährt der Leser eine literaturhistorische Delikatesse. Bertolt Brecht war ohne Zweifel ein Revolutionär der Literaturgeschichte und ein Revolutionär auf dem Theater. Seine Methode, die Darstellung, das Dargestellte der progressiven Kritik preiszugeben, hat über viele Jahre und viele Länder Wirkung gezeigt. Aber wer diese Welt hinter sich hat, wer mit ihr fertig ist, der hat die Kritik über. Er will eine positive Haltung einnehmen. Und die positivste Haltung ist das Spiel. Folglich stelle ich nicht dar, um das Dargestellte der Kritik preiszugeben, sondern um es dem Spiel preiszugeben. Im Spiel setzen wir alle unsere Wesenskräfte frei. Es ist die höchste Verwirklichung des Menschen. Das hat schon Schiller geahnt. Nur gewusst hat er es nicht. Die Zeiten waren nicht ernst genug. Die ernstesten Zeiten bedürfen der größten Heiterkeit. Das ist nicht paradox. Das ist Dialektik. Ohne Heiterkeit aber ist das Spiel nicht möglich. Dieses Buch ist ein Exempel der vielfältigsten Heiterkeit. Als Voraussetzung der hohen Kunst des Spiels.
1. Der erotische Mensch
Ein Kleiner ist besser als keiner
***
Ein Obstgärtner, ein Lagerhalter und ein Totengräber loben ihre Frauen
Der Obstgärtner:
Was hab ich nicht versucht,
die Stare zu verscheuchen.
Doch jetzt, so will mir deuchen,
sind sie aus meiner Welt.
Ich habe meine Frau
als Scheuche aufgestellt.
Der Lagerhalter:
Mein Weib, das ist drei Zentner schwer
und misst dasselbe längs wie quer.
Drum teilt man es in Zonen,
will man die Augen schonen.
Der Kopf ist einem Kürbis gleich,
die Augen sind verquollen,
das Kinn hat Kinn und Kinneskinn,
da ist der Hals verschollen.
Der Busen ist kein Busen mehr
und auch kein Meeresbusen,
da können ganze Völkerscharn
zur gleichen Zeit dran schmusen.
Dieses Massenmedium
hängt gewaltig lang herum,
was beim Tanz Verdruss erregt,
weil es an die Schenkel schlägt.
Vor den Beinen muss ich warnen,
denn was zwischen diesen klafft,
hat schon manchen unerfahrnen Mann
samt Hut dahingerafft.
Ja, mein Weib, das ist 'ne Tolle,
wo du's greifst, greifst du ins volle.
Ja, mein Weib, das ist ein Trumm.
Und ich hüpfe um es rum
und ruf andermal ums eine:
Alles meine! Alles meine!
Der Totengräber:
Auch wenn es unbegreiflich ist,
ich lieb mein Frauchen sehr.
Und wenn es erst gestorben ist,
dann lieb ich es noch mehr.
So sprachen die drei Männer
als wahre Frauenkenner.
Und auch zum guten Schluss
spricht jeder (weil er muss):
Ich lobe mir die meine
und brauche weiter keine.
Ein Mann ohne Weib ist ein Deckel ohne Topf
***
Der Gefoppte
Sie blieb ihm treu, was
ihm ein Rätsel war.
Die Weiber sind doch
unberechenbar!
***
Das Mittelding
Der Mensch hat Kopf und Beine,
zu denken und zu gehn.
Das Ding in beider Mitten
bleibt ungeachtet stehn.
Doch ohne es wär keiner
von uns in dieser Welt,
weshalb's von allen Dingen
am besten mir gefällt.
Es gibt Frauen,
die nur deshalb an Gott glauben,
weil er ein Mann ist
Genügsamkeit beweist der Mann, der
die Augen seiner Frau sehr schön findet
und doch nicht möchte,
dass sie mehr davon hätte.
***
Wenn die Frau zu lange kein Fleisch bekommt
„Geh auf den Markt und kauf etwas Fleisch“, sagte eine Frau zu ihrem Mann, „wir haben lange keines gehabt.“ Der Mann ging auf den Markt, doch dort vertrank er das Geld. Den nächsten Tag das gleiche: Wieder brachte er kein Fleisch nach Hause. So ging das eine ganze Zeit.
Nun traf der Mann eines Tages auf dem Markt einen Freund und lud ihn zum Essen ein. Der Freund war einverstanden, und der Mann kaufte zwei Hähnchen. Zu Hause angekommen, sagte er zu seiner Frau: „Dies ist ein Freund von mir und hier sind zwei Hähnchen. Bereite sie zu, eines für meinen Freund und eines für mich.“
Die Frau wollte schon zornig werden, doch dann sagte sie: „Wir haben kein Brot im Hause. Geh und besorge welches.“
Der Mann ging, und die Frau bereitete die Hähnchen zu. Dann nahm sie ein großes Messer, trat zu dem Freund und sagte: „Es ist soweit!“
Der Freund bekam es mit der Angst und fragte: „Was soll das?“
„Ich will dir nur die Hoden abschneiden“, sagte die Frau. „Das ist bei uns so Sitte, wenn ein Freund zum ersten Mal zu Gast ist.“
Der Freund sprang auf und rief: „Ich muss vorher noch einmal hinausgehen, um mein Wasser abzuschlagen!“ Und sobald er hinausgelangt war, rannte er davon.
Die Frau aber aß schnell die Hähnchen auf. Und wie sie gerade damit fertig war, kam der Mann mit dem Brot zurück. Er blickte umher und fragte: „Wo ist mein Freund?“
"Da kannst du auch gleich nach den Hähnchen fragen", erwiderte die Frau.
Der Mann blickte in den Topf, fand ihn leer und stürzte aus dem Hause. Als er den Freund in der Ferne davonlaufen sah, rief er ihm hinterher: „Lass uns wenigstens eines!“
Da rannte der Freund noch schneller und rief zurück: „Wenn du mich einholst, kannst du sie alle beide haben!“
Also: Ehezwist
zeugt Weiberlist
Der nicht zu fromme Pilgrim
Der Mann einer etwas einfältigen Frau begab sich, einem Gelübde folgend, auf eine Pilgerfahrt. Die solcherart alleingelassene Frau war aber nicht nur von schwachem Verstande, sie war auch schwanger. Der Muezzin hingegen, dessen Frau gerade ihre Verwandten besuchte, meinte bei sich: Ich bin allein, und die Frau des Pilgrims ist allein; wir könnten uns gut die Zeit miteinander vertreiben. Und bei der ersten Gelegenheit sagte er zu der einfältigen Frau: „Du bist zu bedauern, denn dein Mann hat dich mit einem unfertigen Kinde zurückgelassen.“
„Wie kann das sein?“, fragte die Frau verwundert.
„Es erfordert viel Mühe“, erklärte der Gebetsrufer, „bis ein Kind fertig ausgearbeitet ist. Dein Mann hat nur für den Körper gesorgt, Kopf und Glieder aber fehlen noch. Es ist eine Schande, solch einen Krüppel zu gebären.“ Da erschrak die Frau gewaltig und rief: „O Gott, hilf mir!“
„Gott kann da nicht helfen“, erklärte der Gebetsrufer. „Doch wenn du einverstanden bist, will ich die Mühe auf mich nehmen und das Kind fertig ausarbeiten. Da dein Mann sehr fromm ist und von diesen Dingen nichts versteht, muss er mir dankbar sein, wenn ich an seine Stelle trete. Wir dürfen jedoch keine Zeit verlieren.“
Das sah die Frau denn auch ein. Der Muezzin machte sich sogleich an die Arbeit und setzte dem unfertigen Kinde zunächst den Kopf an, dann Nase und Ohren, danach Arme und Beine, schließlich Hände und Füße mit allen Fingern und Zehen und tat das alles so genau und geschickt, dass die Frau sehr wohl erkannte, wie wenig doch ihr Mann von diesen Dingen verstanden hatte. Der Muezzin aber war es noch nicht zufrieden, besserte noch dies und jenes und führte es bis in alle Einzelheiten aus. So war er vollauf beschäftigt, und erst als die Rückkunft des Pilgrims zu erwarten stand, erklärte er das Kind für gänzlich ausgearbeitet.
Die Frau bedauerte das sehr, musste es aber zufrieden sein und empfing ihren Mann ohne rechte Freude. Der war aber nicht so fromm, dass er nicht bald hinter die Sache gekommen wäre. Und sobald er sich ihrer vergewissert hatte, zögerte er nicht lange und reiste in den Ort, wo die Frau des Muezzin bei ihren Verwandten zu Besuch weilte. Und als er dort getan hatte, was seines Willens gewesen war, kehrte er zurück und sagte zu dem Muezzin: „Da du so gern Kinder fertig ausarbeitest, wird es dich sicherlich freuen, dass deine Hilfe wieder einmal erforderlich ist, noch dazu es sich diesmal um deine eigene Frau handelt. Den Anfang habe ich schon gemacht.“
Also: Der erste Anstoß macht den Mann;
der Nachstoß zeigt den Feigling an
Der allzu bescheidene Dieb
Ein Kaufmann hatte sein Lebtag an nichts anderes als an den Gelderwerb gedacht. Nun, da er alt und schwach geworden war, dachte er an dieses und jenes und auch daran, sich wohl zu verheiraten. Er wurde auch bald mit einem anderen Kaufmann einig und nahm dessen Tochter zur Frau. Diese aber war jung und hübsch und ekelte sich vor dem alten Manne, weshalb sie ihm auch stets den Rücken zukehrte, wenn beide das gemeinsame Lager einnahmen.
Eines Abends aber drang ein Dieb ins Haus, und die Frau geriet, sobald sie ihn erblickte, in Furcht und schloss ihren Mann fest in ihre Arme. Der war darüber sehr erfreut und zitterte vor Entzücken. Nach einer Weile erblickte aber auch er den Dieb und erkannte in ihm die Ursache seiner Wonne. Da erhob er sich von dem Lager und flüsterte, so dass es seine Frau nicht hören konnte, dem Dieb zu: „Ich verdanke dir ein nicht mehr erwartetes Glück. Nimm alles, was ich habe, es ist dein.“ Doch dann besann er sich und sagte: „Trag aber nicht alles mit einem Mal fort. Komme morgen und die folgenden Tage um die gleiche Zeit wieder und nimm immer nur ein Teil, so hast du es leichter.“ Der Dieb war es zufrieden und nahm sich eine Handvoll Münzen aus der Kassette, um die folgende Nacht eine andere Handvoll zu nehmen und so fort. Und immer wurde dem alten Manne ein großes Entzücken zuteil.
Die Kassette war jedoch noch nicht zur Hälfte geleert, da erhob sich der alte Mann, als der Dieb einen seiner üblichen Besuche machte, von dem Lager und sagte: „Jede Nacht ein Dieb im Haus, das geht über meine Kräfte. Sei nicht so bescheiden und nimm den Rest des Geldes mit einem Mal.“
Also: Zu später Beginn bringt
keinen Gewinn
Und: Zu langer Anlauf
frisst die Kraft auf
***
Das Schäfchenspiel
Amint und Doris waren Hirten,
doch fanden beide es gescheiter,
statt Schafe hüten Scherz zu treiben
und so weiter, und so weiter:
Nur scherzte Doris nicht umsonst.
Da zahlte er als nobler Streiter
einen Gang mit einem Schäfchen
und so weiter, und so weiter.
Amintens Herde schrumpfte schnell.
Am Ende bat der flotte Reiter:
„Lass mich ohne Schaf noch einmal!“
und so weiter, und so weiter.
„Erwirb die Herde dir zurück,
jetzt zahle ich!“, rief Doris heiter
und sie küsste ihm das Sterzchen
und so weiter, und so weiter.
Er holte Schaf für Schaf zurück
und überdies noch ihre - leider:
Nun muss wieder er bezahlen
und so weiter, und so weiter,
und so weiter …
***
Jungfer ade!
Gar wohl auf einem Tanz
verlor sie ihren Kranz.
Was mag das für ein Kranz gewesen sein?
Was mag das für ein Tanz gewesen sein?
***
Des Jägers Wunderhorn
Ein Jäger hat ein Horn, gib acht!
Das bläst er nur bei Nacht tirilü,
das bläst er nur tirilütütü, das bläst er nur
bei Nacht.
Und er versteht sich auf das Horn
von hinten und von vorn tirilü.
Von hinten und tirilütütü, von hinten und
von vorn.
Und als sich ihm ein Mägdlein naht,
was glaubt ihr, was er tat tirilü,
was glaubt ihr, was tirilütütü, was glaubt ihr, was
er tat?
Er zeigte ihr das Instrument
und fragt', wie sie es fand' tirilü
und fragt', wie sie tirilütütü, und fragt', wie sie
es fand'.
Das Mägdlein nahm's in Augenschein
und in die Hände zwein tirilü,
und in die Händ' tirilütütü, und in die Hände
zwein.
„Das Horn find' ich gar recht“, sprach sie,
„wenn Ihr auch kennt das Spiel tirilü,
wenn Ihr auch kennt tirilütütü, wenn Ihr auch kennt
das Spiel.“
Der Jäger sprach: „Ich kann' es wohl“,
und stieß mit großer Kunst
die Töne, dass die Ader schwoll –
tirilütütü! Tirilü!
Und auch die Zwischentöne,
die weichen und die andern,
lässt er in schnellem Wechsel
durch alle Lagen wandern –
tirilütütü! Tirilü!
Noch manch verschlungne Wendung
und unverhofften Sprung
vollführt sein Instrumentum.
Da naht die Morgendämmerung –
tirilütütü! Tirilütütü!
Sprach sie: „Ach schnell noch mal von vorn,
es ist ein Wunderhorn tirilü, tirilü,
es ist fürwahr tirilütütü, fürwahr ein Wunderhorn.
Ach schnell noch mal tirilütütütütü,
ach schnell noch mal von vorn!“
***
Gegensätze ziehen sich nicht an, es sei denn, an dem einen ist vom andern etwas dran
Wie weise, sprach die Eule, war doch die Natur, als sie Männchen und Weibchen so einrichtete, dass sie einander genau ergänzen.
Im Gegenteil, widersprach der Storch, der als Fachmann auf dem Gebiete galt. In Wirklichkeit hat sich die Natur bei der Verteilung der Geschlechtsorgane geirrt und das männliche Teil dem Weibchen, das weibliche Teil aber dem Männchen verliehen. Nur so ist es zu erklären, dass die beiden sich ständig hinterdreinlaufen und das Männchen versucht, dem Weibchen das eigentlich diesem gehörende Glied zuzustecken, während das Weibchen darauf aus ist, dem Männchen das seine zu geben.
***
Nimmst du die Folge für den Grund, bringst du die Logik auf den Hund
Die Spitzmaus machte dem Mäuserich ständig Vorwürfe, weil er des Abends, statt schön zu Hause zu bleiben, auf die Promenade ging und dort mit den flotten Mäuschen flirtete. Da die Vorwürfe nichts fruchteten, versuchte es die Spitzmaus endlich auf eine andere Art. Sie machte sich schön, verkleidete sich und folgte dem Mäuserich auf die Promenade. Dort begann sie sogleich einen Flirt mit ihm; und da er sie sehr nett fand, folgte er ihrer Einladung, sie nach Hause zu begleiten. Dort angelangt, erkannte er, dass er vor dem eigenen Loche stand. Nun gab sich auch die Spitzmaus zu erkennen und erklärte ihn seiner Schuld für überführt.
Statt aber zerknirscht zu sein, wurde der Mäuserich ungemein vergnügt und sagte: Wenn du nur immer halb so hübsch zurechtgemacht und nett zu mir gewesen wärst wie vorhin auf der Promenade, wäre ich auch immer gern zu Hause geblieben. Also hast du nicht mich, sondern dich der Schuld überführt.
***
Das Verhängnis der Müllerstochter
In einem grünen Tale,
nicht weit vom tiefen Wald,
steht eines Müllers Mühle,
darin ein Kindlein lallt.
Und am Ende von dem Tal
rauscht ein großer Wasserfal.
Nach sechzehn, siebzehn Jahren,
da lallt das Kind nicht mehr.
Da ist's 'ne ranke Jungfer,
die trällert froh umher.
Und am Ende von dem Tal
rauscht ein großer Wasserfal.
Ein Förster wollt' sie freien,
der ihr die Liebe bot.
Ein Wilddieb kam gegangen
und schoss den Förster tot.
Und am Ende von dem Tal
rauscht ein großer Wasserfal.
Der Wilddieb, schön und heftig,
nahm sie in seinen Arm.
Da endigte sein Leben
ein Schuss von dem Gendarm.
Und am Ende von dem Tal
rauscht ein großer Wasserfal.
Sie glaubt', mit dem Gendarme
wär sie aus allem Leid.
Doch in einem Gemenge
schlug ihn ein Räuber breit.
Und am Ende von dem Tal
rauscht ein großer Wasserfal.
Der Räuber nahm sie mit sich
auf seine Lagerstatt.
Da stahl sie ihm das Messer
und dolcht' ihn, bis er matt.
Und am Ende von dem Tal
rauscht ein großer Wasserfal.
Nun sitzt sie bei der Mühle
und weint in sich hinein.
Wie kann nach so viel Liebe
man so alleine sein.
Und am Ende von dem Tal
rauscht ein großer Wasserfal.
Und am Ende …
***
Eine Stellungssache
Der Volksmund sagt ganz klar:
„Wenn eine Jungfer fällt,
so fällt sie auf den Rücken.“
Doch das ist nicht ganz wahr,
denn manche fällt verkehrt
und leidet es im Bücken.
***
Besorgnis
Die Frau geht oft zum Doktor!
Warum nicht?
Ihr Mann hat doch die Gicht.
***
Umkleideter Wunsch
Ich möchte deine Kleidung sein,
da wär ich immer um dich.
Am Tag das Halterehen zu zwein,
das Höschen selbstverständlich,
und nachts dein Flatterhemde.
Spricht das nicht Liebesbände?
***
Ein gutes Mundwerk
Er kann es, gleichviel wo und wann.
Und kann er einmal nicht mehr, dann
richtet sie ihn mit dem Munde
wieder auf zur nächsten Runde.
Die Macht der Verwöhnung ist eine Himmelsmacht. Daher müssen mitunter Himmel und Hölle in Bewegung gebracht werden, ehe die Gleichberechtigung durchgesetzt und die Frage dahin entschieden ist, dass der Mann sich die Pantoffeln selber holt.
***
Von einem Manne, der nicht vom Frühstücks tisch aufstand, ohne seine Kaffeetasse zu zerschmettern
Da las ein Mann eines Tages (es war einer von denen, die es auch heute noch geben soll, und es war ein Tag wie jeder andere), da las dieser Mann eines Tages beim Frühstück in der Zeitung, dass vor einigen hundert und zweiundvierzig Jahren ein Despot des alten Orients nicht öfter denn einmal mit einer Frau geschlafen habe, da er es verschmähte, hieß es weiter in dem Blatte, ein zweites Mal aus demselben Gefäß zu trinken. Der Mann warf über den Rand der Zeitung einen Blick auf seine Frau, die am Herd stand und dem Baby einen süßen Brei kochte. Bittere Verachtung in der Brust schmetterte er das Blatt auf den Tisch und sprang auf. Der Küchenstuhl fiel um. Die Frau blickte über die Schulter, wandte sich aber schnell dem Herd wieder zu, da der Brei überzukochen drohte. Sie rührte heftig. Den Rest seiner Verachtung zusammenfassend, griff der Mann die Kaffeetasse beim Henkel und zerschmetterte sie auf dem Boden. Die Frau fuhr herum. Im gleichen Augenblick kochte der Brei über, die Frau sprang zum Herd, und der Mann sammelte die Scherben auf. Aber ein Gedanke hatte sich in seinem Gehirn festgehakt, eine Idee seines Aufbegehrens war geblieben, und seitdem feuerte er stets, nachdem er sorgsam den letzten Schluck ihres Inhalts ausgetrunken hatte, die Kaffeetasse mit großer Geste auf den Boden, wo sie in tausend Scherben zersprang. (Wenn schon nicht die Frau, so war es doch wenigstens die Tasse, die er nicht zweimal gebrauchen wollte.) Stets auch räusperte er sich danach ein wenig verlegen, griff nach seiner Aktenmappe und schritt aus dem Haus. Die Tassen sparte er sich von seinem Taschengeld ab, und sie waren von der billigsten Sorte.
Die Frau gewöhnte sich an das sonderbare Verhalten ihres Gatten, ja es schien ihr bald die beste Eigenschaft an ihm zu sein, ahnte sie doch, dass es aufs innigste mit seiner ehelichen Treue verknüpft war.
In jedem Mann steckt ein Tyrann
Eheabratung
Mädchen, nimm dir nie und nimmer
einen Ehemann.
Was er von Berufes wegen,
höre dir jetzt an:
Der Uhrenmacher zieht dich auf,
der Drechsler dreht dir Spindelbeine,
der Kutscher nimmt dich ins Geschirr,
der Schneider plättet dir gleich eine,
der Schornsteinfeger schwärzt dich an,
der Klempner redet dauernd Blech,
der Nagelschmied schlägt auf den Kopf,
der Schuster bringt dir nichts als Pech,
der Schindeldecker hockt nur oben,
der Maurer denkt nur an den Durst,
der Seiler dreht dir einen Strick,
dem Fleischer bist du völlig Wurst.
Nun weißt du, was dir blühen kann,
nimmst du dir einen Ehemann.
***
Ein Flickschneider wollte seine Liebe flüstern - und warum er keine Gelegenheit fand
In einer Kleinstadt lebte von Kind auf ein Flickschneider, der zeit seines Lebens auf keinen grünen Zweig gekommen war. Überdies galt er für ein bisschen komisch, weshalb er im Ort auch keine Frau finden konnte, obwohl er sich schon lange darauf spitzte. Schließlich wurde ihm das Warten zu lang, und er annoncierte in der Zeitung. Da er aber keine Reichtümer oder eine glänzende Erscheinung zu bieten hatte, bekam er nur eine Zuschrift; und auch damit hatte es einen Haken. Die Frau schrieb, dass sie, sonst ohne Fehl, schwerhörig sei. Der Flickschneider antwortete ihr, in diesem Falle sei an eine eheliche Verbindung nicht zu denken.
Der ganze Ort, sobald er von dem Vorfall erfuhr, lachte über den Schneider und hielt ihn nun vollends für eine komische Figur, da er eine im Ganzen so günstige Partie ausgeschlagen hatte. In Wahrheit mag es aber wohl ein sehr feines Empfinden für den rechten Ton gewesen sein, das den Flickschneider an dieser Verbindung hinderte. Denn ist es nicht eine Ungereimtheit, jemandem zärtliche Gefühle ins Ohr zu brüllen, noch dazu, wenn einer diese Gefühle jahrelang still in seiner Brust gehegt hat?
***
Das ganze noch ma. Liebeslied eines sächsischen Dorftrottels
Ech hawe in dar Liewe
nu ehma wenich Gligg.
So giehd es mir schon emmer,
mir giehds wie Hans im Gligg.
Die eene is zu heddzich,
die annere zu gald,
die eene is zu gindisch,
die annere zu ald.
Un hawe ech ma eene,
schon ha ech wädder Bäch:
Ä beeser Buwe gommd un
nemmd se mer een fach wech.
Nu ha ech wädder geene
und schdieh alleene da!
Da sang ech aus Verzweiflung
das ganze Leed noch ma:
***
Ech hawe in dar Liewe nu ehma …
Davon, wie ein Unglück kommen musste, damit das Glück kommt
Die beiden galten als ein ungleiches Paar, und das waren sie auch. Sie hatte früh ihre Eltern verloren und war von der Schwester ihrer Mutter, einer despotischen Jungfer, aufgezogen worden. Schon von klein an war sie schmal und blass und auffallend schüchtern gewesen, wenn nicht gar ängstlich. Er dagegen, breitgebaut und von gesunder Hautfarbe, war wegen seines Jähzorns gefürchtet. Da er erst nach dem Kriege in den kleinen Ort gekommen und überdies wortkarg war, wusste keiner so recht, was in ihm vorging. Auch sie wusste es nicht, denn auch zu Hause sprach er kaum ein Wort. Sie waren sich im Grunde ihres Wesens fremd geblieben, und wenn er ihr gegenüber auch nie seinen Jähzorn gezeigt hatte, lebte sie doch in einer ständigen Angst vor ihm. Das macht den panischen Schrecken verständlich, der sie überfiel, als sie einen alten Briefumschlag in den Ofen warf und ihr im nächsten Augenblick einfiel, dass sie vor Tagen das Lotterielos in den Umschlag gesteckt hatte. Sie riss die Ofentür auf und starrte in die Flammen. Von dem Umschlag war nicht mehr die Spur zu sehen. Die Tage bis zur Bekanntgabe der Gewinnliste lebte sie wie in einem Albtraum, und als endlich die Zeitung kam, in der die glücklichen Gewinner standen, brach sie zusammen. Sie hatte die Nummer ihres Loses gesehen. Es dauerte, bis sie wieder zu sich kam, und ganz zu sich kommen konnte sie nicht, denn die Angst vor ihrem Mann raubte ihr alle Sinne. In seinem Jähzorn würde er sie womöglich erschlagen, und das wäre wohl noch das Beste. Als er von der Arbeit nach Hause kam und sie die Tür schlagen hörte, wurden ihr die Knie weich. Sie tastete nach einem Stuhl, faltete die Hände im Schoß und ließ den Kopf sinken. Ohne den Blick zu heben, gestand sie ihm ihre schreckliche Dummheit. Die bange Stille dauerte nur einige Sekunden, da hörte sie ihren Mann lachen. Sie hatte ihren Mann noch nie lachen gehört. Dieses Lachen hüllte sie ein wie ein weiches, warmes Tuch. Sie begriff nicht, wie ihr geschah, sie glaubte zu schweben, und sie schwebte wirklich. Er hatte sie wie ein Kind auf beide Arme genommen, schwang sie sachte hin und her und summte leise ein Lied. Dann setzte er sie behutsam an den für das Abendbrot bereiteten Tisch, nahm seinen Platz ihr gegenüber ein, lachte noch einmal und machte sich über das Essen her.
Seit dem Tage hatte sie keine Angst mehr vor ihm, im Gegenteil, sein Wesen war ihr vertraut, als kenne sie es von kindauf. Für ein ungleiches Paar wurden sie noch immer angesehen, doch galt ihre Ehe nun für die glücklichste im Städtchen.
Über das verbrannte Los haben die beiden nie ein Wort gesprochen. Sie wussten, dass da auch ohne Worte alles gesagt war.
Die Liebe
Die Liebe ist die Blume, die da blüht,
und die Wolke, die fern am Himmel zieht.
Die Liebe ist der Vogel, der da singt,
und die Quelle, die aus der Erde springt.
Die Liebe ist die Quelle und der Vogel
und die Blume, die da blüht,
und die Wolke, die fern am Himmel zieht.
***
2. Der lustige Mensch
Humor hat, wer gleich lacht;
später lachen ist keine Kunst
***
Ernst bannt, Heiterkeit löst
***
Das welthistorische Unglück der Verernstung
Das utopische Denken wird schlechthin im Vorhof des wissenschaftlichen Sozialismus von Marx und Engels angesiedelt. In Wirklichkeit existiert es in mehr oder weniger artikulierter Form seit dem Beginn der Klassengesellschaft, denn der tiefste Sinn aller Gesellschaftsutopie ist die Sehnsucht nach der Gleichheit der Menschen. Und diese Sehnsucht wurde mit der Ungleichheit des Eigentums (an den Produktionsmitteln) und aller anderen daraus entspringenden Ungleichheiten geweckt. Selbst das an Jesus und dem Urchristentum heute noch Gültige ist nur so erklärbar. Wie die „unablässige Heiterkeit“ (Hermann Melville) der Naturvölker auf der sozialen Gleichheit beruhte, so beruht die Verernstung des Menschen in der Klassengesellschaft auf der sozialen Ungleichheit und deren unmenschlichen Folgen. Und die dümmste Folge besteht darin, dass sich die Menschheit dieses Vorgangs bis heute nicht bewusst ist.
Die Bewusstheit äußert sich in der unbotmäßigen Heiterkeit.
Heute sind wir noch immer entweder ernst oder heiter, und das auch in der Literatur. Dabei wird das eine wie das andere vollkommen erst durch die wirkliche Verschmelzung beider, auf die einige Leute allerdings schlecht zu sprechen sind, weil sie nicht wissen, wie sie sich ihr gegenüber verhalten sollen.
Geladne Gäste schießen nicht
***
Gefährdete Helden
Als einmal die Beobachtung gemacht wurde, dass der heiteren Helden der Menschheit, wie Till Eulenspiegel und seinesgleichen, weit weniger gedacht werde als der ernsten Helden, obgleich sie doch, was man von den ernsten nicht immer sagen könne, niemals einen Menschen ernstlich in Gefahr gebracht hätten, meinte Nepomuk:
„Wenn wir der heiteren Helden mehr gedächten, so könnten sie die ernsten durchaus in Gefahr bringen.“
Der Humor ist (kybernetisch gesprochen) das Regulativ des psychischen Menschen als sichselbst stabilisierendes System.
Heiterkeit ist die Vermenschlichung des Ernstes.
Humor ist die Selbstbestätigung als Subjekt, die zum Gegenstand eines Genusses geworden ist, wodurch ihre Handhabung die spielerische Eleganz, die Leichtigkeit, den Charme gewinnt, welche Eigenschaften in ihrer Gesamtheit das „gewisse Etwas“ ausmachen, welches der Erscheinung des Humors eigen ist.
***
Der wundertätige Schelm
Ein armer Schelm hatte im Streit einen angesehenen Mann erschlagen und sollte mit dem Leben dafür büßen.
„Wenn ich ein Wunder vollbringe“, sprach der Schelm zum Richter, „wirst du mir dann die Strafe erlassen?“ Der Richter sagte das zu, und der Schelm erklärte: „Ich werde dich, nachdem ich dich getötet habe, wieder zum Leben erwecken.“
Da lachte der Richter und sprach: „Ich erlasse dir die Strafe, aber erlass du mir auch das Wunder.“
Also: Witz wirkt mitunter
so gut wie ein Wunder
***
Der vertauschte Buchstabe
Sich legen, bringt Segen
Dem Bimmel sei Dank
Vorbeugen ist besser als Heulen
Was sich leckt, das liebt sich
Jung gefreut hat nie gereut
Vorsicht ist die Butter der Weisheit
Viel Geschrei und wenig Wille
Gut Ding will Keile haben
Andere Länder, andere Ditten
Wo ein Willi ist, ist auch ein Weg
Ente gut, alles gut
Sich eins ins Fäustchen machen
Alten Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann
Undank ist der Welt Hohn
Geld negiert die Welt
Unrecht Mut gedeihet nicht
Bist Du nicht billig, so brauch ich Gewalt
(bitte fortsetzen)
***
Welthumor
Gefragt, weshalb er nicht an Gott glaube, erwiderte Nepomuk: „Weil mir nicht bewiesen werden konnte, dass Gott jemals gelacht hat. Wie aber könnte ein Mann, der diese Welt gemacht hat, ernst bleiben?“
Wer zuletzt lacht, lacht allein.
***
3. Der elegische Mensch
Man muss sich Gott nur ernsthaft bei der Arbeit vorstellen, um die Unsinnigkeit einer Erschaffung der Welt sofort vor Augen zu haben.
***
Oma, erzähl uns was
Wenn heut die Enkel tollen
um Omas Knie und wollen
was hörn als Ohrenschmaus,
dann sucht die Oma aus
das Märchen von Schneewittchen,
des Prinzen losem Flittchen
und andres, was sie hält
zu nutz der Kinderwelt.
Da lachen und da weinen
sich unvermerkt die Kleinen
in eine Märchenzeit,
und Mär wird Wirklichkeit.
Wenn dermaleinst die Enkel
der Oma ziehn am Senkel
und wolln was Lustges hörn
und weinen auch mal gern,
da ist sie gleich bereit
und schildert unsre Zeit.
Und allen klingts, auf Ehr,
als obs ein Märchen wär.
Ohne den Teufel auf der Erde gäbe es keinen Gott im Himmel.
***
Freue dich, kein Tier zu sein
Der Esel, das ist weltbekannt,
hat einen Mangel an Verstand.
Auch das Kamel hat leider kein'.
Drum freue dich, ein Mensch zu sein.
Der Hund vollzieht die Liebe pur,
hat von Romantik keine Spur.
Der Gockel gar tritt mit dem Bein.
Drum freue dich, ein Mensch zu sein.
Der Hering ist nicht für Musik,
ob lebend oder in Aspik.
Die Sprotte ist dafür zu klein.
Drum freue dich, ein Mensch zu sein.
Die Sau trinkt keinen Alkohol
und fühlt sich trotzdem säuisch wohl.
Das Murmeltier trinkt nicht mal Wein.
Drum freue dich, ein Mensch zu sein.
Der Tausendfüßler nicht gleich muss
verzweifeln, fehlt ihm mal ein Fuß.
Dem Regenwurm fehlt nie ein Bein.
Drum freue dich, ein Mensch zu sein.
Der Floh zahlt keine Kirchensteuer
und glaubt auch nicht ans Fegefeuer.
Die Laus fällt auch nicht darauf rein.
Drum freue dich, ein Mensch zu sein.
Der Affe ist dem Menschen ähnlich,
nur ist er nicht wie er so dämlich
und schlägt sich selbst den Schädel ein.
Drum freue dich, ein Mensch zu sein!
***
Beschreibung einer Weltumfahrt
nach M. Claudius
Wer einmal eine Reise tut,
der kann uns was erzählen.
Drum nahm ich meinen Stock und Hut
und wollt' nicht länger fehlen.
Zuerst gings an den Nordpol hin,
da war es kalt, bei Ehre.
Da dacht ich so in meinem Sinn,
dass warm es besser wäre.
In Grönland freuten sie sich sehr,
mich ihres Orts zu sehen,
und setzten mir den Trankrug her.
Ich ließ ihn aber stehen.
Da grinsten still die Eskimos
und gingen ihrer Wege.
Da schalt ich einen einen Kloß
und kriegte viele Schläge.
Nun fuhr ich nach Amerika,
da sagt' ich zu mir: Lieber,
entdeckt hat es Columbia,
wer deckt es zu nun wieder?
Von hier ging ich nach Mexiko –
ist weiter als nach Bremen
da, dacht' ich, liegt das Geld wie Stroh.
Du sollt'st 'n Sack voll nehmen.
Allein, allein, allein, allein,
wie kann ein Mensch sich trügen.
Ich fand da nichts als Sand und Stein
und ließ den Sack da liegen.
Drauf kauft' ich etwas kalte Kost
und Branntewein und Kuchen und
setzte mich auf Extrapost:
Land Asia zu besuchen.
Der Mogul ist ein großer Mann
und gnädig übermaßen.
Und klug: Er war jetzt eben dran,
'n Kopf abschlahn zu lassen.
Dabei furzt er ins Hosenbein –
bei aller Groß und Gaben.
Was hilfts dann noch, Mogul zu sein?
Das kann ich so wohl haben.
Ich sucht' im Land die kreuz und quer,
fand aber nichts zu beißen.
Und ist der Magen hohl und leer,
so lässt sichs auch schlecht reisen.
Ich gab dem Wirt mein Ehrenwort,
ihn nächstens zu bezahlen.
Und damit zog ich weiter fort
nach China und Bengalen.
Nach Java und nach Otaheit,
nach Afrika nicht minder.
Und sah bei der Gelegenheit
viel Tier und Menschenkinder.
Und fand es überall wie hier,
fand Weise und fand Narren.
Die Menschen grade so wie wir:
zum Weinen und zum Lachen.
***
Ohne Hoffnung ist kein Leben
Als ein Mann, der sich häufig dem Trunke ergab, von seinem kleinen Sohn nach Hause geführt wurde, trafen sie an der Straßenkreuzung auf einen Trauerzug.
„Was tragen sie da?“, fragte der Sohn.
„Einen Menschen“, antwortete der Vater ärgerlich und gab dem Kleinen eine Ohrfeige.
„Und wo tragen sie ihn hin?“
Der Vater gab dem Kleinen abermals eine Ohrfeige und raunzte: „An einen Ort, wo es keine Hoffnung mehr gibt.“ Der Kleine schluchzte auf und rief: „Da bringen sie ihn bestimmt zu uns!“
Also: Ist die Hoffnung tot,
tut kein Mord mehr not
***
Elegie auf den Biss eines tollen Hundes
Wohlan, ihr Leute, neigt das Ohr
zu meiner Elegie.
Da biss einmal ein toller Hund
den eignen Herrn ins Knie –
und wie!
Und wie die Welt davon erfuhr,
hieß es: So fängt es an.
Und wo führt's hin, wenn sich kein Hund
wie'n Mensch benehmen kann –
na dann!
Na dann ade, lieb Heimatland!
Vom tollen Hund gezinkt:
Das hat noch keiner überlebt,
der gute Mann ist hin –
wohin?
Wohin, ihr Leute, lief s hinaus?
Erzählt's von Mund zu Mund:
Der gute Mann krepierte nicht,
nur starb der tolle Hund –
na und?
Na und, die Elegie ist aus
ganz ohne Sang und Klang.
Und wem sie etwa kurz vorkommt,
der häng sich selber dran –
wohlan!
***
Der geplättete Zorn
Der Schneider, jäh im Zorne,
wills dem Lehrling weisen
und wirft das Bügeleisen
nach dem armen Tropf.
Der duckt sich, und das Eisen
trifft die Meisterin am Kopf.
„Na, auch gut“, brummt der Schneider
und näht besänftigt weiter.
***
Die förmliche Nachfrage
Gefragt, wie es ihm gehe, erkundigt sich Nepomuk zunächst, was er denn das vorige Mal auf die gleiche Frage geantwortet habe. Der andere konnte sich nicht erinnern.
„Sehen Sie“, erklärte Nepomuk, „so geht es mir.“
***