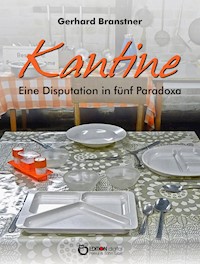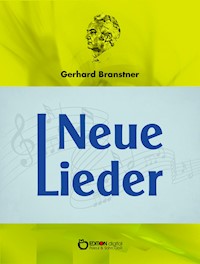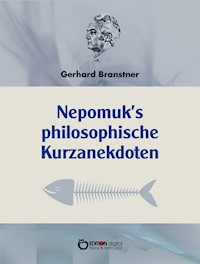Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Das ist ein Plädoyer für die Anekdote: Eines ist unbestritten: Die Anekdote hat drei wunderbare Eigenschaften. Das sind die Weisheit, die Heiterkeit und die Geselligkeit. Darin kommt ihr keine andere Kunst gleich. Was Wunder, dass ihr meine große Liebe gehört. Und ein langes Vorwort. Letzteres aber steht am Anfang dieser Anekdotensammlung und dort kann man es auch selber nachlesen. Außerdem rühmt Branstner, der die Bescheidenheit immer für unmoralisch hielt, seine eigenen Anekdoten: Die Nepomuks zu schreiben war unvermeidlich. Ihre logische und philosophische Eigenart sind neben meiner sprudelnden Fantasie wesentliche Triebkräfte meiner Produktion. Ich hatte etwa 15 Nepomuks geschrieben, als mir die Geschichten vom Herrn Keuner von Bertolt Brecht begegneten, von deren Existenz ich bis dahin nichts gewusst hatte. Erfreut begrüßte ich einen exzellenten Partner und Konkurrenten. Das ist eine merkwürdige Eigenschaft von mir: ich freue mich, wenn ich nicht allein gut bin. Ich sehne mich geradezu nach mindestens gleichguten Partnern. Daher bedauere ich es, dass Peter Hacks dazu nicht taugt. Zwar ist er ein großartiges Genie und hat auf vielen verschiedenen Gebieten Hervorragendes geleistet, doch auf dem Gebiet der Politik und Geschichtsphilosophie ist er eine brillante Null. Wie könnte der Massenmörder Stalin, lebte er noch, den Kapitalismus verhindert haben, wo der Stalinismus doch wesentliche Ursache der Kapitalisierung des Sozialismus war? Da steht die historische Kausalität Kopf. Hier zwei dieser Keuner-Geschichten, sorry, Nepomuk-Geschichten: Die unmoralische Tugend Als Nepomuk hörte, wie einmal mehr das Lob der Bescheidenheit gesungen wurde, rief er aufgebracht: „Wer seine Fähigkeiten unter dem Mantel der Bescheidenheit verbirgt, erschwert ihren richtigen Einsatz oder macht ihn ganz unmöglich. Daher ist Bescheidenheit nichts als Drückebergerei!“ Heimlich unheimlich Ein Bekannter Nepomuks beklagte sich darüber, dass wir zu wenig aus unseren Fehlern lernen. „Dabei“, so meinte er, „haben wir doch genug gemacht, um hätten lernen zu können, wie man Fehler vermeidet.“ „Wir sollten vielmehr lernen“, entgegnete Nepomuk, „wie man Fehler macht. Da Fehler niemals gänzlich zu vermeiden sind, müssen wir uns darin üben, sie so geschickt wie möglich auszuführen. Das Richtige ungeschickt gemacht ist oft ein größerer Fehler als der geschickt gemachte Fehler. In diesem steckt immerhin ein gewisser Witz, weshalb er auch leichter eingestanden wird als der ungeschickte.“
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Gerhard Branstner
Wie Fritz den Teufel erschlug
Kleine Anekdotenbibliothek
Das Buch erschien 2003 in der Kater-Taschenbibliothek im trafo Verlag, Berlin.
ISBN 978-3-96521-818-5 (E–Book)
Titelbild: Ernst Franta
© 2022 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E–Mail: verlag@edition–digital.de
Internet: http://www.edition-digital.de
Vorbemerkung zu Wie Fritz den Teufel erschlug“
Die Anekdote hat es, wie du, lieber Leser, gleich merken wirst, in sich, denn sie hat mehr als alle anderen Literaturformen hinter sich: Mehr als zweitausend Jahre und den ganzen Erdball. Sie reicht von Japan bis an den oberen Nil, von Südfrankreich bis zu den Indianern Nordamerikas, von den Eskimo bis zu den Pygmäen. Weltreisende, die sich bei den Naturvölkern aufgehalten haben, berichten von dem unbändigen Gelächter, das in der Anekdoten zum Besten gebenden abendlichen Runde zu erleben war.
Eines ist unbestritten: Die Anekdote hat drei wunderbare Eigenschaften. Das sind die Weisheit, die Heiterkeit und die Geselligkeit. Darin kommt ihr keine andere Kunst gleich. Was Wunder, dass ihr meine große Liebe gehört. Und ein langes Vorwort.
Ob sie vom professionellen Rapsoden oder in der fröhlichen Runde vorgetragen wird, allemal hat sie mehr Geist und Witz als die angestrengten Späße, mit der die Moderatoren in unseren Breitengraden das Publikum malträtieren.
Da ich dem Publikum Gelegenheit geben wollte, eine innige Neigung für diese Kunstform zu gewinnen, habe ich vier der wichtigsten Anekdotenformen produziert.
Die erste ist die Anekdote, die ich in der orientalischen Manier geschrieben habe. Die orientalische Anekdote hat ihren eigenen Reiz. Sie ist von sinnlicher Sprache, hat eine gut gebaute Geschichte und eine witzige Pointe. Wobei der Witz oft eine demokratische Eigenschaft besitzt: Der arme Schlucker offeriert dem Herrscher einen verblüffenden Spaß, wofür der ihm die Strafe erlässt. Das mag in der Wirklichkeit seltener vorkommen als in der Anekdote, immerhin wird es durch sie dem armen Schlucker wohler.
Die orientalische Anekdote verdankt ihren Reichtum und ihre Geltung den regen Handelsverbindungen ihrer Zeit und der damit verbundenen Höhe der Kultur. Allein Bagdad hatte zur Zeit seiner Blüte (10. und 11. Jahrh.) etwa 12 000 Mühlen, 12 000 Karawansereien, 100 000 Moscheen, 60 000 Bäder und 80 000 Basare. Zugleich gab es aber noch keinen Buchdruck. Also musste eine literarische Form gefunden werden, die vom Gedächtnis aufbewahrt und mit dem Mund weitergegeben werden konnte. Und da war keine besser als die Anekdote. Das ist nicht das einzige Mal, wo ein eklatanter Mangel, auch wenn er gar nicht empfunden wird, ein exzellentes Produkt hervorbringt. Allerdings nur, wenn dem Mangel ein Überfluss entgegensteht (dem noch nicht erfundenen Buchdruck ein ungeheurer Reichtum an Erzählgut). Zum Schluss der Betrachtung über die orientalische Anekdote soll gesagt sein, was über sie hinaus das Wichtigste an ihr ist: die gehobene gesprochene Sprache. Zweifellos muss wirkliche Literatur gehobene Sprache sein, aber doch nicht gewollte, gedrechselte, gestelzte, selbst wenn sie die gediegene Schönheit der Sprache Thomas Manns hat. Die Lösung liegt allein darin, gehobene gesprochene Sprache zu sein. Diese ist weniger anstrengend, dafür sinnfälliger, geselliger, menschenfreundlicher. Diese Sprache war stets das absolute Ziel meiner literarischen Arbeit.
Wer genauer wissen will, wie sich meine Anekdoten von den originalen Vorgaben unterscheiden, kann sich in der Bibliothek das Buch „Die Ochsenwette“ besorgen. Bei der Gelegenheit kommt er auch in den Genuss der wunderschönen Zeichnungen von Renate Totzke-Israel.
Die Anekdoten in der Art der Kalendergeschichte kann in dieser Weise nur ein Thüringer schreiben, nämlich wenn er in der Rudolstädter Gegend zu Hause ist. Dort werden Anekdoten, oder Schnurren und Schnärzchen, wie sie da heißen, nicht erzählt, sie werden erst einmal vollbracht. Was dem einen in seiner Dussligkeit oder Gutgläubigkeit widerfährt oder dem anderen zum Schabernack mitgespielt wurde, wird des Abends in der Kneipe zum besten gegeben, oft noch ausgeschmückt oder schlüssiger gemacht, bis es die gültige, endgültige Form erhalten hat. Wer in dieser thüringischen Tradition großgeworden ist, kann gar nicht anders, als sein Leben lang Schnurren und Schnärzchen vollbringen und erzählen.
In meinen Kalendergeschichten werden gut ein Dutzend Anekdoten erzählt, die in meiner engeren Heimat geschehen sind. Der magenkranke Straßenarbeiter in „Warum Wilhelm sich stets mit zwei Fingern an die Schläfe tippte“ und der Bibelforscher in „Wenn die Gefahr ...“ ist beide Mal mein Vater. Und die Alte in „Von Gespenstern - und wie ein Junge nicht an sie glaubte“ ist meine eigene Mutter, in Wirklichkeit eine bildschöne, hochbegabte Frau, aber dem Gespensterglauben verfallen. Ihre Freundin war Kartenlegerin und hatte ihr geweissagt, dass sie an meiner Geburt sterben werde, weshalb sie zum Leidwesen meines Vaters peinlichst aufpasste. Aber einmal muss ihr doch vor Lust die Vorsicht vergangen sein, und ich kam zustande. Ich bin folglich ein reines Versehen. Ich bitte den Leser, das Kuriosum meiner Existenz gebührend zu würdigen.
Ich produziere keine Literaturgattung, ohne ihre Geschichte von Anfang bis Ende gesichtet, ihre Höhepunkte studiert und ihre besten Vertreter zum Maß genommen zu haben. Nicht, um ihnen nachzufolgen, sondern um sie zu übertreffen. Meine Ahnen in der Kalendergeschichte sind vor allem Jörg Wickram mit seinem Rollwagenbüchlein, der Till Eulenspiegel natürlich und Johann Peter Hebel mit dem Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes. Hebel vor allem ist mir sehr nahe.
Nicht Kleist, sondern Hebel ist in Wahrheit der echte deutsche Anekdotendichter. Ihn interessiert nicht das Holzbein, das einem invaliden Marketender in einem der preußischen Kriege weggeschossen wurde und das er, obwohl er seine Initialen in es geschnitzt hatte, in dem Kampfgetümmel nicht wiederfinden konnte. Als blinder Passagier nach Argentinien verschlagen, erhält er als erste Nahrung eine dünne Suppe und dazu einen aus Holz geschnitzten Löffel gereicht. Und was sieht er auf dem Löffel? Die Initialen seines Holzbeines. So konnte er die Suppe doch wenigstens mit dem Rest seines eigenen Holzbeines löffeln. Dergleichen Anekdoten, deren Sinn auf einem irrwitzigen Zufall beruht, sind nicht die Sache Hebels. Statt auf dem Witz des Zufalls beruht bei ihm der Sinn auf dem Witz der handelnden Personen. Vor allem aber ist es das Gemüt, die Gemütsart, der fast betuliche Humanismus Hebels, dem ich mich verpflichte.
Ich wünsche dem Leser, dass er einen Genuss an dieser Gemütsart hat.
Die Nepomuks zu schreiben war unvermeidlich. Ihre logische und philosophische Eigenart sind neben meiner sprudelnden Fantasie wesentliche Triebkräfte meiner Produktion. Ich hatte etwa 15 Nepomuks geschrieben, als mir die Geschichten vom Herrn Keuner von Bertolt Brecht begegneten, von deren Existenz ich bis dahin nichts gewusst hatte. Erfreut begrüßte ich einen exzellenten Partner und Konkurrenten. Das ist eine merkwürdige Eigenschaft von mir: ich freue mich, wenn ich nicht allein gut bin. Ich sehne mich geradezu nach mindestens gleichguten Partnern. Daher bedauere ich es, dass Peter Hacks dazu nicht taugt. Zwar ist er ein großartiges Genie und hat auf vielen verschiedenen Gebieten Hervorragendes geleistet, doch auf dem Gebiet der Politik und Geschichtsphilosophie ist er eine brillante Null. Wie könnte der Massenmörder Stalin, lebte er noch, den Kapitalismus verhindert haben, wo der Stalinismus doch wesentliche Ursache der Kapitalisierung des Sozialismus war? Da steht die historische Kausalität Kopf.
Meine Fähigkeit, einen Konkurrenten neidlos als Mitstreiter anzuerkennen, ist identisch mit anderen Anerkennungen. Meine Lieblingsfarbe ist nicht, wie man meinen sollte, rot, sondern bunt, anders wäre ich kein Kommunist. Aber wenn es schon eine bestimmte Farbe sein muss, dann lila. Mein Lieblingstier ist nicht der deutsche Schäferhund, ich mag alle Tiere, aber wenn es schon ein bestimmtes sein muss, dann der Regenwurm. Ich mag alle Blumen, aber wenn es schon eine bestimmte sein muss, dann nicht die Rose, sondern die Primel. Ich gewinne nicht gern im Spiel, weil mir der Verlierer leid tut, obwohl der schlechte Verlierer nicht so schlecht ist wie der schlechte Gewinner. Gute Gewinner sind eine Rarität. Ich mag alle Rassen, wenn es aber eine bestimmte sein muss, dann nicht der blonde Recke, sondern der stets lustige Pygmäe. Dieses Gemüt, diese Weisheit, diese Menschlichkeit mögen die Nepomuks Dir lieber Leser vermitteln.
Trotz allem darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Nepomuks dreimal besser sind als Brechts Geschichten vom Herrn Keuner. Das sind sie zunächst in ihrer literarischen Qualität. Keuner ist keine literarische Figur, sondern ein abstraktes Sprachrohr des Autors, während Nepomuk ein Charakter ist, der nach eigenem Bekunden sich körperlich kaum unter die Schulter geht, sich geistig also weit überragt. Auch sprachlich sind die Nepomuks deutlich besser. Zweitens ist die Originalität der thematischen Einfälle, der Witz der Geschichten den Keunergeschichten weit überlegen. Und drittens ist die haushohe Überlegenheit, welche die Nepomuks in ihrem philosophischen Gehalt haben, unübersehbar. Die Voraussetzung dafür ist in der Vorbemerkung zur Werkauswahl genügend charakterisiert.
Gewiss war Brecht als Dichter ein bedeutendes Genie. Ich habe ein sechswöchiges Praktikum bei ihm gemacht und ihn als genialen Regisseur erlebt. Und in Maßen (wenn er sich auf die Begründung seiner Schreibweise beschränkte) war er auch ein theoretisches Genie. Dass er menschlich nicht ohne Fehl und Tadel war, ist eine andere Sache. Ich konnte erleben, wie er sich leutselig mit einem Hofarbeiter unterhielt und nach dem Befinden von dessen Kindern erkundigte. Nach seinem Weggang fragte ein Kollege den Hofarbeiter, weshalb er nicht gesagt habe, dass er ohne Kinder sei. Ich will doch nicht entlassen werden, war die Antwort. Tatsächlich war Brecht ein Übelnehmer, wie es die meisten eitlen Leute sind. „Ist ein Mensch nicht einfach, so nimm ihn eben zweifach“ ist einer meiner bewährten Sprüche. Trotzdem bewundere ich Brecht unendlich. Und als er starb, habe ich das erste und einzige Mal in meinem Leben geweint.
Für den Fall, dass sich der Leser für das Zustandekommen der Nepomuks interessiert, seien hier zwei der häufigsten Quellen genannt. Die eine ist der „grüne Tisch“. Die mir eigenen dialektischen Gegensätze Fantasie und Logik sind ja keine ruhenden Potenzen, sondern unruhige Kinder, die nicht zu bändigen sind und ständig auf unerwartete Ideen kommen. Die andere Quelle ist natürlich die Wirklichkeit, auch die längst vergangene. Beispielsweise der Friedensschluss von Brest-Litowsk. Die Bolschewiki waren gerade an die Macht gelangt und mussten sie sichern, was gegen den deutschen Imperialismus, der zwar ziemlich am Ende war, der sich auflösenden russischen Armee aber leicht den Rest geben konnte, problematisch war, noch dazu er den Sowjets unglaubliche Friedensbedingungen abverlangte. Trotzki, der Verhandlungsführer, wollte keinen Fußbreit Sowjetboden hergeben, und Bucharin wollte gar den heiligen Krieg gegen den deutschen Imperialismus ausrufen. Lenin hatte einen ungeheuer schweren Stand mit seiner Auffassung, dass die Revolution nur durch den schnellsten Friedensschluss zu retten sei, gleich unter welchen Bedingungen. Trotzki hat später begriffen, dass Lenin Recht hatte. Bucharin hat wohl nie etwas begriffen. Die resolute, kurzentschlossene Entscheidung Lenins war mir immer als Beispiel gegenwärtig, zu einer Geschichte wurde sie aber erst durch ein völlig anderes Ereignis. Ich gucke aus dem Fenster meiner Wohnung in der Berliner Friedrichstraße und sehe eine Frau auf der anderen Seite, in die ich im Augenblick verschossen war. Ihre natürliche Schönheit und Grazie nahmen mich absolut gefangen. Nur stimmte etwas nicht, sie hinkte schrecklich. In der Sommerhitze hatte sie keine Strümpfe an und die feuchten Füße schmerzten in den engen Schuhen. Kaum hatte ich das gedacht, schon zog die Frau die Schuhe aus und schritt nun wie eine Königin dahin. Eine wunderschöne Frau barfuß auf der Friedrichstraße. Lenin zog die Hosen aus und die Frau die Schuhe. Und beide gingen nun ruhig ihres Weges. Fertig war die Nepomukanekdote. Nun soll natürlich keiner diese Geschichte in ihrer Herkunft entschlüsseln, vielmehr soll er begreifen, dass man manchmal die Hosen ausziehen muss, um den Arsch zu retten.
Was die utopische Anekdote betrifft, so ist nur zu sagen, dass sie, um sie zu erfinden, eine souveräne Zukunftsfantasie voraussetzt, um die Dummheiten unserer Gegenwart bloßzustellen. Wenn der Antikommunist Honecker seinem antikommunistischen Busenfreund Breshnew beim Empfang auf dem Flughafen als erstes die Gewehrläufe der Ehrenkompanie unter die Nase hält, wie in „Der ehrenvolle Empfang“ veralbert, so waren beide eifrig und erfolgreich mit der Vernichtung des Sozialismus beschäftigt. Der Spaß an der Zukunft ist zugleich der große Spaß über die Gegenwart. Und dass diese voller Bananen mit Reißverschluss ist, lässt sich nicht bestreiten. Und das ist noch eines ihrer harmlosen Übel.
Am Ende noch drei Anmerkungen zur Anekdote. Zum einen ist sie die wanderfreudigste Literaturform. Der Roman, das Theaterstück ist häufig außerhalb ihres Entstehungsortes nur gemindert oder gar nicht genießbar. Anders die Anekdote. Die orientalische beispielsweise bereitet in der ganzen Welt Genuss. Obwohl sie oder weil sie in den unterschiedlichsten Zeiten und Ländern selbstständig in fast identischer Form entsteht. Die gleichen gesellschaftlichen Verhältnisse bringen die gleichen Anekdoten hervor, darin ist sie authentischer Ausdruck ihrer Verhältnisse. Zum zweiten hat sie die natürlichste literarisch gehobene Sprache. Sie kann als einziges Genre gleichermaßen hervorragend gelesen und gesprochen werden. Und schließlich ist der hier gegebene Band Anekdoten ein Kompendium von Weisheit, wie es in keinem anderen Buch zu finden ist. Ob Goethes „Faust“ oder Tolstois „Krieg und Frieden“, Shakespeares „Hamlet“ oder Thomas Manns „Zauberberg“, sie alle und auch alle zusammen kommen dem Anekdotenband an Weisheit nicht mal in etwa nahe. Und diesen Anekdotenband, dieses Büchlein hast Du, lieber Leser, in der Hand. Nutze es. Nicht mit Ehrfurcht, wohl aber mit Vergnügen.
Dein Gerhard Branstner
Die Ochsenwette
Der wundertätige Schelm
Ein armer Schelm hatte im Streit einen angesehenen Mann erschlagen und sollte mit dem Leben dafür büßen.
„Wenn ich ein Wunder vollbringe“, sprach der Schelm zum Richter, „wirst du mir dann die Strafe erlassen?“ Der Richter sagte das zu, und der Schelm erklärte: „Ich werde dich, nachdem ich dich getötet habe, wieder zum Leben erwecken.“
Da lachte der Richter und sprach: „Ich erlasse dir die Strafe, aber erlass du mir auch das Wunder.“
Also: Witz wirkt mitunter
so gut wie ein Wunder
Die Antwort des Verrückten
Ein Gelehrter hatte seine Schüler um sich versammelt und sprach zu ihnen von den Dingen des Lebens. Da stellte sich ein Verrückter neben den Gelehrten, zog ein Buch hervor und blätterte eifrig darin herum. Er blätterte und blätterte und blätterte in einem fort.
Da wurde der Gelehrte wütend und rief: „Mann, du hast ja das Buch verkehrt herum in der Hand!“ „Entschuldige bitte“, erwiderte der Verrückte, „ich bin Linkshänder.“
Also: Wer einen Verrückten belehrt,
ist schnell bekehrt
Wenn die Frau zu lange kein Fleisch bekommt
„Geh auf den Markt und kauf etwas Fleisch“, sagte eine Frau zu ihrem Mann, „wir haben lange keines gehabt.“ Der Mann ging auf den Markt, doch dort vertrank er das Geld. Den nächsten Tag das gleiche: Wieder brachte er kein Fleisch nach Hause. So ging das eine ganze Zeit. Nun traf der Mann eines Tages auf dem Markt einen Freund und lud ihn zum Essen ein. Der Freund war einverstanden, und der Mann kaufte zwei Hähnchen. Zu Hause angekommen, sagte er zu seiner Frau: „Dies ist ein Freund von mir, und hier sind zwei Hähnchen. Bereite sie zu, eines für meinen Freund und eines für mich.“
Die Frau wollte schon zornig werden, doch dann sagte sie: „Wir haben kein Brot im Hause. Geh und besorge welches.“
Der Mann ging, und die Frau bereitete die Hähnchen zu. Dann nahm sie ein großes Messer, trat zu dem Freund und sagte: „Es ist so weit!“
Der Freund bekam es mit der Angst und fragte: „Was soll das?“
„Ich will dir nur die Hoden abschneiden“, sagte die Frau. „Das ist bei uns so Sitte, wenn ein Freund zum ersten Mal zu Gast ist.“
Der Freund sprang auf und rief: „Ich muss vorher noch einmal hinausgehen, um mein Wasser abzuschlagen!“ Und sobald er hinausgelangt war, rannte er davon.
Die Frau aber aß schnell die Hähnchen auf. Und wie sie gerade damit fertig war, kam der Mann mit dem Brot zurück. Er blickte umher und fragte: „Wo ist mein Freund?“
„Da kannst du auch gleich nach den Hähnchen fragen“, erwiderte die Frau.
Der Mann blickte in den Topf, fand ihn leer und stürzte aus dem Hause. Als er den Freund in der Ferne davonlaufen sah, rief er ihm hinterher: „Lass uns wenigstens eines!“
Da rannte der Freund noch schneller und rief zurück: „Wenn du mich einholst, kannst du sie alle beide haben!“
Also: Ehezwist
zeugt Weiberlist
Die sicherste Art, einen Dieb zu erwischen
Ein Dieb nahm einem Derwisch den Turban fort und eilte davon. Der Derwisch aber ging gemächlichen Schritts auf den Friedhof und setzte sich dort nieder. „Was sitzest du hier?“, fragten die Leute, „der Dieb ist doch in der anderen Richtung davongelaufen.“
„Er mag laufen, wohin er will, zuletzt muss er doch hierher kommen“, sagte der Derwisch, „deshalb sitze ich hier.“
Als diese Worte dem Dieb zu Ohren kamen, ging er sogleich zum Friedhof und sagte zu dem Derwisch: „Hier hast du deinen Turban zurück, ich müsste sonst immer an den Tag denken, an dem du mich mit Sicherheit erwischst. Wie aber kann einer leben, wenn er ständig solch ein Ende vor Augen hat.“
Also: Setz deinem Leben ein gutes Ziel,
dann wird dir das Leben nie zu viel
Erkenntnis des Wesens der Schweine
Als ein Schweinehirt unter seinen schwarzen Schweinen ein weißköpfiges entdeckte, hielt er es, da er so etwas noch nicht gesehen hatte, für eine Kostbarkeit und beschloss, es dem König zu bringen. Auf dem Wege dorthin aber, schon in der Nähe des Königshofes, erblickte er lauter Schweine mit weißen Köpfen, und er kehrte verdrossen wieder um. Da aber kam ihm ein Gedanke, und als er zu Hause angelangt war, nahm er eines von den gewöhnlichen schwarzen Schweinen und machte sich wieder auf den Weg zum König. Als dieser das schwarze Schwein sah, war er ganz entzückt, denn so etwas hatte er noch nie gesehen, und er beschenkte den Schweinehirt reichlich.
Der Schweinehirt aber kaufte für das erhaltene Geld eine ganze Herde weißköpfiger Schweine, die in dieser Gegend sehr billig waren, und brachte sie nach Hause, wo er sie für teures Geld wieder verkaufte. Jetzt erwarb er eine noch größere Herde schwarze Schweine und trieb sie in die Gegend der weißköpfigen, um sie dort für teures Geld zu verkaufen. Auf diese Weise gelangten schließlich alle schwarzen Schweine in die Gegend der weißköpfigen und umgekehrt, und jeder hielt nun die eigenen Schweine für besonders kostbar, obwohl sich doch allein ihr Ort, nicht aber ihr Wert verändert hatte.
Allmählich verlor sich jedoch die Täuschung, und endlich sah man in beiden Gegenden die eigenen wie die fremden Schweine gleichermaßen für ganz gewöhnliche Tiere an, ungeachtet, welche Farbe sie hatten. Der Schweinehirt aber war unterdessen ein reicher Mann geworden.
Also: Ob schwarzes oder weißes Schwein –
im Topfe endet aller Schein
Der Tischler, der ungestört arbeiten wollte
Frohgemut ging ein Mann zu einem Tischler und sagte: „Ich habe einen Sohn bekommen, zimmere mir bitte eine Wiege.“
Der Tischler versprach die Wiege, und der Mann zahlte für ihre baldige Fertigstellung ein Silberstück. Nach einer Woche ging er wieder zu dem Tischler, doch die Wiege war noch nicht fertig. Die Woche darauf ebenso. Auch nach einem Monat war die Wiege noch nicht fertig. Und so ging es Monate und Jahre hindurch. Aus dem Knaben wurde ein Mann, der Mann nahm sich eine Frau und zeugte einen Sohn. Da ging der Alte wieder zum Tischler.
„Wie steht es mit der Wiege?“, fragte er. „Ich hatte sie vor einiger Zeit bei dir bestellt und für ihre baldige Anfertigung ein Silberstück gezahlt.“
„Hier hast du das Silberstück zurück“, brummte der Tischler ärgerlich. „Wenn mich jemand drängt, kann ich nicht arbeiten.“
Der Alte ging nach Hause und legte sich bald darauf zum Sterben nieder. Da lief sein Sohn zum Tischler und sagte: „Mit meinem Vater geht es zu Ende, nun braucht er einen Sarg.“
„Warum hat er das nicht gleich gesagt“, schimpfte der Tischler, „jetzt habe ich die ganze Zeit an der Wiege gearbeitet!“
Also: Macht dir die Arbeit auch viel Freude –
vergiss dabei nicht ganz die Leute
Der außerordentliche Fall
Ein Reisender bat einen Hauswirt um Übernachtung und erhielt ein Zimmer im Erdgeschoss. In der Nacht aber hörte der Hauswirt den Gast im Obergeschoss lachen. Dort befand sich auch das Zimmer der Frau des Hauswirts. Der ging hinein und fragte den Gast: „Was suchst du in diesem Zimmer?“
„Ich habe mich im Schlaf umgedreht und bin hierher gefallen.“
„Aber man fällt doch von oben nach unten und nicht von unten nach oben!“
„Deshalb lache ich ja gerade“, erklärte der Gast.
Da packte der Wirt den Mann am Gürtel, warf ihn die Treppe hinab und rief: „So, jetzt ist der Fall wieder in Ordnung!“
Also: Nach oben fallen ist kein Wunder;
du fällst auch wieder runter
Gerechter Lohn für schöne Worte
Ein Dichter hatte auf einen Würdenträger ein überschwängliches Loblied gemacht. Darauf sagte der Würdenträger zu dem Dichter: „Komm morgen zu mir, und ich will dir ein reiches Geschenk machen.“
Am nächsten Tage kam der Dichter schon bei Morgengrauen und wollte das Geschenk abholen. Der Würdenträger aber sagte: „Du hast ein Gedicht geschrieben, das nicht der Wahrheit entspricht, und ich habe ein Versprechen gegeben, das nicht der Wahrheit entspricht. Wir haben uns gegenseitig mit schönen Worten erfreut und sind gleich. Was willst du jetzt noch?“
Also: Nicht immer und an allen Orten
gewinnt die Kunst mit schönen Worten
Das alte Lied
Ein neu eingesetzter Beamter gab für die Würdenträger seines Amtsbereiches ein Fest. Zur Unterhaltung der Gäste trat auch ein Sänger auf, der sich wie folgt vernehmen ließ: „Fort mit dem Alten, herein mit dem Neuen; fort mit dem Unglücksstern, herein mit dem Glücksstern!“
Der Beamte fühlte sich über die Maßen geschmeichelt. „Das ist ein schönes Lied“, meinte er, „es hat mir sehr gefallen.“
„Das war auch die Meinung Eures Vorgängers“, sagte der Sänger stolz.
„Wie!“, rief der Beamte, „singst du dieses Lied jedes Mal bei Ankunft eines neuen Beamten?“
„Es ist das einzige Lied, das ich kenne“, sagte der Sänger.
Also: Das Lob im Allgemeinen
passt immer, will es scheinen
Wie durch Umpflanzen Diebe entstehen
Ein Weiser aus dem Lande Dschi war nach Dschu gekommen und wollte dem König seine Aufwartung machen. Als der König davon erfuhr, sagte er zu seinem Ratgeber: „In Dschi reden die Leute schlecht über die Zustände in meinem Lande, und man hält mich für einen unbilligen Herrscher. Ich will dem Mann eine Lehre erteilen. Wie soll ich das anstellen?“
„Lass, wenn er bei dir ist, einen Gefesselten hereinführen und ihn auf die Frage, wer er sei, antworten, er komme aus Dschi und sei ein Dieb“, sagte der Ratgeber.
So sollte es denn auch gemacht werden. Als der König mit dem Weisen aus Dschi beim Mahle saß, kamen plötzlich zwei Beamte herein und führten einen gefesselten Mann mit sich.
„Wer bist du?“, rief der König, „und was hast du verbrochen?“
„Ich stamme aus Dschi“, antwortete der Gefesselte, „und ich wurde soeben beim Stehlen gefasst.“
Der König sah den Weisen spöttisch an und sagte: „Man scheint bei euch in Dschi übergenug Diebe zu haben, dass sie schon nach Dschu kommen, um hier zu stehlen.“ Der Weise lächelte kaum merklich und erwiderte: „Wie ich gehört habe, sind die Orangen im Süden dieses Landes von köstlichem Geschmack, wogegen sie, sobald man sie in den Norden verpflanzt, zu ganz gewöhnlichen Früchten werden. Was mag wohl der Grund sein?“
„Ich denke, es liegt am Klima“, sagte der König.
„Mit den Menschen“, fuhr der Weise fort, „scheint es ähnlich zu sein. In Dschi stehlen sie nicht, sobald sie aber nach Dschu kommen, werden sie zu Dieben. Ist es das Klima von Dschu, das sie so plötzlich verwandelt?'
Da schwieg der König.
Also: Natur und Mensch gedeihen
auf beste Art im Freien
Der nützliche Vorschlag
Ein Kanzler liebte es, kostspielige, aber wenig nützliche Bauvorhaben ausführen zu lassen. Da schlug ihm ein Mann eines Tages folgendes vor: „Lasst den See nahe der Hauptstadt trockenlegen, und Ihr werdet eine große Fläche Land gewinnen.“
Der Kanzler war von diesem Vorschlag begeistert, fragte aber nach einigem Überlegen: „Wohin mit dem Wasser des Sees?“
„Grabt einen ebenso großen See daneben, und das Problem ist gelöst“, antwortete der Mann.
Darüber musste der Kanzler lachen. Doch dann wurde er still, und er führte weiterhin keine derartigen Bauvorhaben mehr aus.
Also: Unsinn auf der Spitzen
bleibt nicht lange sitzen
Die gefährliche Bescheidenheit
Da ein Mann viel Rühmens von seiner Weisheit machte, ließ ihn der König des Landes zu sich rufen. Der Mann erschien, und der Herrscher sagte zu ihm: „Du bist für deine Weisheit weithin berühmt. Doch ohne ein Amt innezuhaben, ist Weisheit nicht viel nutze. Daher will ich dich zum Richter ernennen.“
Der Mann aber entgegnete bescheiden: „Ich bin zu diesem Amt nicht geeignet.“
Der König forderte eine Erklärung. Der Mann gab sie ihm, indem er sagte: „Habe ich die Wahrheit gesagt, so bin ich in der Tat ungeeignet; habe ich jedoch gelogen, so bin ich ebenso ungeeignet, denn ein Lügner kann nicht Richter sein.“
„Vor dem Amt des Richters“, sagte der König, „hat dich deine Erklärung bewahrt, denn sie ist schlüssig. Da sie es aber nur ist, indem sie den Fall einschließt, dass du mich belogen hast, hat sie dich um deinen Kopf gebracht. Und falls du doch wahr gesprochen hast und also unschuldig gerichtet wirst, so ist es auch kein Schade, in jedem Falle verlierst du ja nur einen ungeeigneten Kopf.“
Da war der Mann, der doch nur den Fährnissen des Richteramtes entgehen wollte, mit seiner Weisheit am Ende.
Also: Der Feigheit liebstes Kleid
ist die Bescheidenheit
Und: Feigheit hilft nicht immer;
manchmal macht sie’s schlimmer
Die Liste für alle Fälle
Ein Glaubenslehrer ritt auf einem lahmen Pferd von einem Ort zum anderen, seine wenigen Schüler aber liefen hinter ihm her und lauschten seinen Worten. Da stolperte das lahme Pferd, und dem Reiter fiel der Turban vom Kopf. Er glaubte, die Schüler würden ihn aufheben, und ritt weiter. Nach einer Weile aber fragte er: „Wo ist mein Turban?“
„Er wird dort liegen, wo er niedergefallen ist“, antworteten die Schüler.
Da wurde der Glaubenslehrer zornig und rief: „Was niederfällt, muss man aufheben!“
Sogleich lief einer der Schüler zurück, hob den Turban auf und legte auch den Dung hinein, den das Pferd an der gleichen Stelle verloren hatte. Als der Lehrer den Turban aufsetzte, fiel ihm der Dung ins Gesicht, und er geriet ganz außer sich und gab dem Schüler eine Maulschelle.
„Wie. Herr!“ rief der Schüler, „sagtest du nicht soeben, dass alles, was niederfällt, aufzuheben sei? Und nun, da ich deiner Vorschrift folge, schlägst du mich!“
„Wie kann man so einfältig sein“, erwiderte der Glaubenslehrer. „Es gibt Dinge, die man aufhebt, und andere, die man liegen lässt.“
Damit wussten die Schüler jedoch nichts anzufangen, und sie baten ihn, die Dinge, die man aufheben soll, auf eine Liste zu schreiben. Das tat er denn auch.
Nach einiger Zeit stolperte nun das Pferd ein weiteres Mal und warf den Glaubenslehrer kopfüber in eine Grube. Da eilten die Schüler herbei und nahmen die Liste zur Hand. Und während einer sie vorlas, zogen die anderen ihrem Lehrer den Turban, das Überkleid, die Jacke und das Beinkleid aus und hoben es auf, den Glaubenslehrer aber ließen sie nackt in der Grube liegen. Und soviel er auch schrie, die Schüler sagten ungerührt: „Du stehst nicht auf der Liste. Wir tun nur, was geschrieben steht.“
Da half alles nichts, er musste sich die Liste geben lassen und schrieb, mit dem Kopf in der Grube: „Wenn euer Glaubenslehrer gefallen ist, so müsst ihr ihn wieder aufheben.“
Und sobald die Schüler das geschrieben sahen, zogen sie ihn heraus und setzten ihn wieder aufs Pferd.
Also: Wortgetreue Schüler sind
im Ernstfall hilflos wie ein Kind
Der tödliche Rat
Ein König hatte mit dem Amt seines Vaters, der vor Kurzem gestorben war, auch dessen Ratgeber übernommen. Um diesen auf die Probe zu stellen, fragte er ihn: „Wie kommt es, dass ich vom Volke weniger gefürchtet werde als mein Vater, obwohl ich doch schon einige Menschen zum Tode verurteilt habe?“
„Ihr bestraft nur die schlechten Leute“, entgegnete der Ratgeber, „daher kommt es, dass die guten vor Euch keine Angst haben. Wenn Ihr meinen Rat befolgen wollt, so lasst ab und zu auch einen Unschuldigen töten, und Ihr werdet von allen gefürchtet sein.“
Da gab der König den Befehl, den Ratgeber zu töten. Jetzt aber fürchtete das Volk den König überhaupt nicht mehr, und es sagte ihm in allen Dingen, was es dachte, weshalb er fortan keinen anderen Ratgeber nötig hatte.
Also: Das ist das beste Regiment,
wo man das Ding beim Namen nennt
Oder: Der wohlgeratne Herrscher hat
das ganze Land an Rates statt
Und: Beim Raten bedenket, an wen ihr euch wendet
Der unbelehrbare König
„Wie lange habe ich noch zu leben?“, fragte ein König, dessen Herrschaft zu Ende ging, seinen Astrologen. „Noch zwei Jahre“, sagte der Astrologe.
Darüber fiel der König in große Verzweiflung und wollte keinen Trost annehmen. Doch da trat ein Mann vor den König und erbot sich, die Vorhersage des Astrologen außer Kraft zu setzen. Der Astrologe wurde neuerlich gerufen, und der Mann fragte ihn: „Wie viel Jahre hast du selber noch zu leben?“
„Zwanzig Jahre“, sagte der Astrologe.
„Du irrst dich“, sagte der Mann, zog sein Schwert und schlug dem Astrologen den Kopf ab. Da war er auf der Stelle tot.
Jetzt wandte sich der Mann dem König zu und sagte: „Du hast selber gesehen, dass sich dein Astrologe geirrt hat. Bekümmere dich also nicht weiter um seine Worte.“
Doch der König fiel in eine noch tiefere Verzweiflung und rief: „Was soll ich bloß ohne meinen Astrologen beginnen? Er war mein bester Ratgeber! Und hättest du ihn nicht erschlagen, würde er dir mühelos bewiesen haben, dass er sich nicht geirrt hat.“
Also: Wer sein Reich auf Lügen stützt,
misstraut der Wahrheit, selbst wenn sie ihm nützt
Eine Lebenskunst
Ein Mann verwendete die beste Zeit seines Lebens darauf, die Kunst des Drachentötens zu erlernen; und er hatte sein ganzes Vermögen dafür hingegeben.
Einen Drachen aber bekam er niemals zu Gesicht.
Also: Kunst und Leben treffen sich
mitunter nur gelegentlich
Der kostspielige Hofstaat
Ein König beklagte sich bei seinem Wesir darüber, dass zu wenig Geld in der Schatzkammer sei. „Ich glaube“, so sagte er, „die Beamten sind nicht ehrlich und nehmen zu viel für sich, sodass nur ein geringer Teil der Einnahmen in: die Schatzkammer gelangt.“
„Ich habe eine andere Erklärung“, entgegnete der Wesir. „Diese Erklärung kann ich jedoch nur in Anwesenheit des gesamten Hofes geben.“
Der König war damit einverstanden und ließ alle Hofleute rufen. Als der Hof vollständig versammelt war, bestieg der König seinen Thronsitz. Sogleich trat erwartungsvolle Stille ein. Jetzt kam auf einen Wink des Wesirs ein Mann in den Saal, in seinen Händen aber trug er einen riesengroßen Klumpen Butter. Und sobald er den Saal betreten hatte, übergab er den Klumpen an den ihm am nächsten stehenden Höfling, der ihn wiederum seinem Nachbarn reichte. So wanderte der Klumpen Butter von Hand zu Hand und wurde zusehends kleiner. Und als er endlich zum Wesir gelangt war, hatte er kaum noch die Größe einer Faust.
Der Wesir reichte dem König die kleine Butterkugel und sagte: „Wir alle konnten sehen, dass niemand auch nur die kleinste Menge Butter auf unehrliche Weise beiseite gebracht hat, und doch ist sie auf einen Bruchteil ihrer einstigen Menge zusammengeschmolzen. Dem kann man nicht beikommen, es liegt in der Natur der Sache.“
Der König wusste darauf nichts zu sagen und erkannte die Erklärung des Wesirs an. Doch da trat der Mann, der die Butter gebracht hatte, vor den König und sagte: „Es liegt nicht in der Natur der Sache, es liegt an den vielen Händen, durch die die Butter gegangen ist. Ebenso verhält es sich in allen anderen Dingen. Auch wenn die Beamten nicht unehrlich sind, so sind es doch zu viele, an deren Fingern etwas hängen bleibt.“
Also: Geht ein Ding von Hand zu Hand,
wird es bald nicht mehr erkannt
Oder: Was alle betasten,
lass besser im Kasten
Und: Viele Hände –
schnelles Ende
Der Anfang und das Ende
Ein Jäger hatte einen seltenen Vogel gefangen und ging in die Stadt, um ihn auf dem Markt zu verkaufen. Als er an dem Verkaufsstand des Krämers vorbeikam, sprang dessen Katze nach dem Vogel und fraß ihn auf. Der Hund des Jägers stürzte sich auf die Katze und biss sie tot. Da erschlug der Krämer den Hund, und der Jäger erschlug den Krämer.
Sobald die Verwandten und Freunde des Krämers davon erfahren, rotteten sie sich gegen den Jäger zusammen, der wiederum seine Verwandten und Freunde zu Hilfe rief. Und die Freunde wiederum riefen ihre Verwandten und Freunde zu Hilfe, bis sich schließlich alle wehrhaften Männer der Stadt in zwei feindlichen Haufen gegenüberstanden. Jetzt begann der Kampf, und der Tod hielt reichliche Ernte, sodass am Ende kaum einer am Leben blieb. Eben da fiel ein räuberisches Heer in die Stadt ein; und da es niemanden mehr gab, der es abwehren konnte, wurde die Stadt geplündert und gebrandschatzt, und keiner kennt heute ihren Namen mehr. Und das alles, weil die Katze den Vogel gefressen hatte.
Also: Zwietracht im Haus
lockt den Räuber zum Schmaus
Und: Jeder Streit
hat seine Zeit
Der Dieb als Lehrer
Ein Dieb wollte ein Ross stehlen, wurde aber dabei erwischt.
Der Besitzer sagte zu ihm: „Wenn du mir zeigst, wie man Pferde stiehlt, sollst du dieses Tier bekommen.“
Der Dieb sagte: „Das will ich dir zeigen“, schwang sich auf das Pferd und sprengte davon.
Der Besitzer rannte hinterher und rief: „Haltet ihn, haltet den Dieb!“
Der Dieb ließ den Mann näher herankommen, aber nicht zu nahe, und sagte: „Was schreist du so? Das Pferd gehört mir!“
„Nein, du hast es gestohlen!“
„Das gebe ich zu“, sagte der Dieb. „Wie könnte ich sonst behaupten, dass es mir gehört. Indem ich es stahl, habe ich dir gezeigt, was du sehen wolltest. Dafür hast du mir das Pferd zugesagt. Was beklagst du dich jetzt?“
Damit ritt der Dieb davon, der Besitzer des Pferdes aber blieb stehen und kratzte sich eine Weile hinterm Ohr.
Also: Wer dem Rossdieb vertraut,
hat auf Rossmist gebaut
Der schwierige Schuhkauf
In einem kleinen Dorf lebte ein Mann, der wollte sich neue Schuhe kaufen und nahm dafür zu Hause Maß. Danach machte er sich auf den Weg in die Stadt. Als er auf dem Markte angekommen war und nach dem Maßzettel suchte, musste er feststellen, dass er ihn verloren hatte.
Statt nun die Schuhe gleich am Fuß zu probieren, ging er wieder nach Hause. Der Nachbar, dem er sein Missgeschick klagte, lachte über den Unverstand des Mannes, der dem Maßzettel mehr als den Füßen vertraute.
Am nächsten Tage machte sich der Mann wieder auf den Weg zum Markt. Diesmal aber passte er die Schuhe am Fuß an, kaufte sie, nahm sie unter den Arm und ging zufrieden nach Hause. Dort probierte er die Schuhe noch einmal an und stellte zu seinem Erstaunen fest, dass sie ihm zu klein waren. Am nächsten Morgen probierte er sie ein weiteres Mal und erstaunte wieder, denn jetzt waren sie ihm zu groß. Ganz verstört lief er aus dem Haus und berichtete dem Nachbarn von der merkwürdigen Erscheinung.
„Nach dem langen Weg zum Markt“, erklärte ihm dieser, „waren deine Füße angeschwollen, und danach hast du die Schuhe gekauft. Auf dem Heimweg schwollen deine Füße noch mehr an, und die Schuhe erschienen dir, als du sie jetzt anprobiertest, zu klein. Heute Morgen aber, da du deine Füße noch nicht angestrengt hast, müssen dir die Schuhe natürlich ein wenig zu groß sein.“