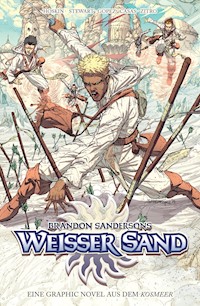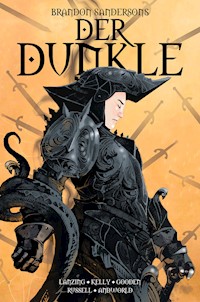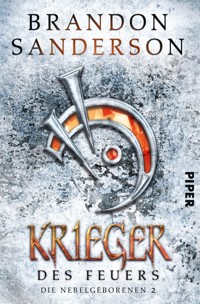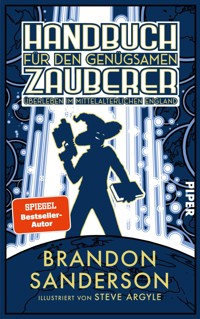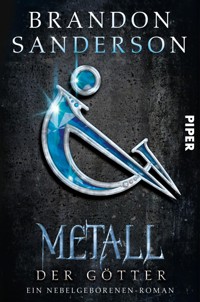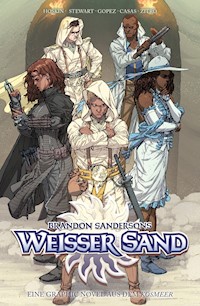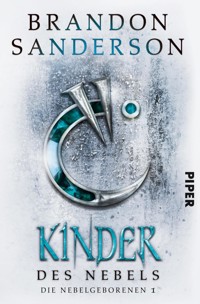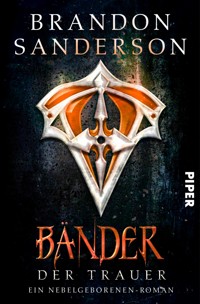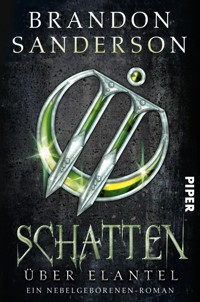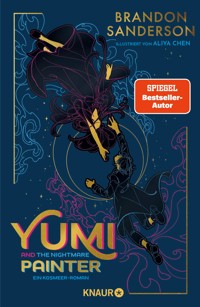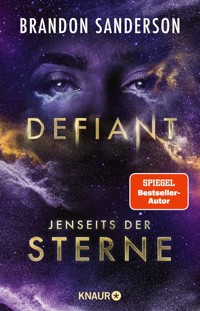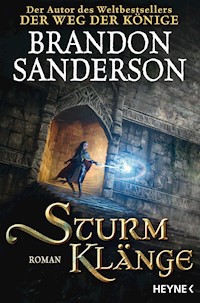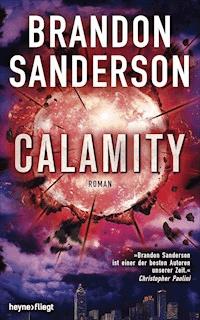9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Letzte Reich ist Vergangenheit, der Oberste Herrscher besiegt. Das jetzt freie Volk der Skaa und die Nebelgeborenen blickten hoffnungsvoll in die Zukunft. Doch um wirklich ein neues glückliches Zeitalter herbeizuführen, müssen die Helden um Rebellenanführerin Vin und den neuen König Elant noch einige Prüfungen bestehen. Es gilt Kriege mit neuen Feinden zu bestreiten – und nun muss auch noch ein uraltes Grauen besiegt und das Land von einem tödlichen Fluch befreit werden. Doch dafür müssen die mit den magischen Kräften der Metalle ausgestatteten Nebelgeborenen düsteren Geheimnissen aus vergangenen Zeiten auf die Spur kommen, sodass am Ende ein Held aller Zeiten vielleicht doch noch alles zum Guten wenden kann ... Weitere Bände der Reihe: Erstes Zeitalter der Nebelgeborenen: Kinder des Nebels (Band 1) Krieger des Feuers (Band 2) Held aller Zeiten (Band 3) Zweites Zeitalter der Nebelgeborenen (»Wax & Wayne«-Reihe): Hüter des Gesetzes (Band 4) (vormals erschienen als: Jäger der Macht) Schatten über Elantel (Band 5) Bänder der Trauer (Band 6) Metall der Götter (Band 7)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1292
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy!
www.Piper-Fantasy.de
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Michael Siefener
© Dragonsteel, LLC 2008
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Mistborn 3: The Hero of Ages« bei Tor Books, New York 2008
© Piper Verlag GmbH, München 2019
Erstmals erschienen im Wilhelm Heyne Verlag, München 2010
Die Rechte an der deutschen Übersetzung von Michael Siefener liegen beim Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Karten und Illustrationen: Isaac Stewart
Covergestaltung und -motiv: www.buerosued.de
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Karte: Das letzte Reich
Karte: Urteau
Karte: Fadrex
Prolog
Erster Teil
Das Erbe des Überlebenden
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Zweiter Teil
Stoff und Glas
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Dritter Teil
Der zerbrochene Himmel
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Vierter Teil
Die schöne Vernichterin
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Fünfter Teil
Vertrauen
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Epilog
Ars Arcanum
Metallurgisches Kurzglossar
Namen und Begriffe
Zusammenfassung des ersten Buches
Zusammenfassung des zweiten Buches
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für Jordan Sanderson,
der jedem, der es wissen will, sagen kann,
wie es ist, einen Bruder zu haben,
der den größten Teil seiner Zeit mit Träumen verbringt.
(Danke, dass du es mit mir aushältst.)
Prolog
Marsch versuchte sich zu töten.
Seine Hand zitterte, während er die Kraft sammelte, die er benötigte, um nach oben zu greifen, sich den Stachel aus dem Rücken zu ziehen und damit sein ungeheuerliches Leben zu beenden. Er hatte es aufgegeben, sich befreien zu wollen. Drei Jahre. Drei Jahre als Inquisitor, drei Jahre eingekerkert in seinen eigenen Gedanken. Diese Jahre hatten ihm bewiesen, dass es kein Entkommen gab. Sogar jetzt umwölkte sich sein Verstand.
Und dann übernahm es die Kontrolle. Die Welt um ihn herum schien zu vibrieren, und plötzlich sah er alles klar und deutlich. Warum hatte er gekämpft? Warum hatte er sich Sorgen gemacht? Alles war so, wie es sein sollte.
Er machte einen Schritt nach vorn. Auch wenn er nicht mehr wie ein gewöhnlicher Mensch sehen konnte – schließlich waren ihm lange Stahlstacheln mit der Spitze voran durch die Augen getrieben worden –, spürte er den Raum um sich herum. Die Stacheln ragten aus seinem Hinterkopf hervor. Wenn er die Hand hob und sich dort berührte, fühlte er die scharfen Spitzen. Sie waren nicht blutig.
Die Stacheln schenkten ihm Macht. Alles, was er sah, war mit feinen blauen allomantischen Linien umrahmt, die seine Welt erhellten. Der Raum war von bescheidener Größe, und einige Gefährten – die ebenfalls blau umrahmt waren, denn die allomantischen Linien deuteten auf das Metall in ihrem Blut hin – standen neben ihm. Jeder hatte Stacheln in den Augen.
Jeder außer dem Mann, der auf die Platte des Tisches vor ihnen gebunden war. Marsch lächelte, nahm einen Stachel vom Tisch und wog ihn in der Hand. Der Gefangene war nicht geknebelt. Das hätte die Schreie verhindert.
»Bitte«, flüsterte der zitternde Gefangene. Sogar ein Haushofmeister aus Terris brach zusammen, wenn er sich seinem eigenen gewaltsamen Tod gegenübersah. Der Mann kämpfte schwach. Er befand sich in einer sehr unangenehmen Lage, denn er war auf einer anderen Person an den Tisch gefesselt worden. Der Tisch war für solche Zwecke entworfen und besaß Vertiefungen für den unteren Körper.
»Was willst du von mir?«, fragte der Terriser. »Ich kann dir nicht mehr über die Synode sagen!«
Marsch betastete den Messingstachel und fuhr mit dem Finger über die Spitze. Es gab noch viel zu tun, aber er zögerte und genoss den Schmerz und die Angst in der Stimme des Mannes. Er zögerte, damit er …
Marsch erlangte die Herrschaft über seinen Geist zurück. Die Gerüche des Raumes verloren ihre Süße; stattdessen stank es jetzt nach Blut und Tod. Seine Freude verwandelte sich in Gestalt gewordenes Entsetzen. Sein Gefangener war ein Bewahrer aus Terris – ein Mann, der sein ganzes Leben zum Wohle anderer gearbeitet hatte. Ihn zu töten war nicht nur ein Verbrechen, sondern eine Tragödie. Marsch versuchte sich zu beherrschen, seinen Arm nach oben zu zwingen und den Achsstab aus seinem Rücken zu ziehen – was ihn sofort töten würde.
Doch es war zu stark. Die Kraft. Irgendwie hatte sie Macht über Marsch – und sie brauchte ihn und die anderen Inquisitoren als Werkzeuge. Sie war frei – Marsch spürte noch immer, wie sie darüber frohlockte –, aber irgendetwas hielt sie davon ab, unmittelbar auf die Welt einzuwirken. Ein Widerstand. Eine andere Kraft, die wie ein Schutzschild über dem Land lag.
Es war noch nicht vollkommen. Es brauchte mehr. Noch etwas anderes … etwas Verborgenes. Und Marsch würde dieses Etwas finden und es seinem Herrn und Meister bringen. Dem Meister, den Vin befreit hatte. Das Wesen, das bei der Quelle der Erhebung eingeschlossen gewesen war.
Es nannte sich selbst Ruin.
Marsch lächelte, als sein Gefangener aufschrie; dann trat er einen Schritt vor und hob den Stachel in seiner Hand. Er drückte die Spitze gegen die Brust des wimmernden Mannes. Der Stachel musste Körper und Herz durchdringen und dann in das Fleisch des Inquisitors fahren, der unter ihm lag. Die Hämalurgie war eine schmutzige Kunst.
Und genau deshalb machte sie so viel Spaß. Marsch nahm einen Hammer zur Hand und schlug zu.
Erster Teil
Das Erbe des Überlebenden
Kapitel 1
Unglücklicherweise bin ich der Held aller Zeiten.
Fatren blinzelte in die rote Sonne, die sich hinter ihrem ewigen Schirm aus dunklem Dunst verbarg. Ein wenig schwarze Asche fiel aus dem Himmel, wie es in letzter Zeit oft geschah. Die dicken Flocken regneten schnurgerade herunter, die Luft war stickig und heiß, und nicht die geringste Andeutung einer Brise hob Fatrens Stimmung. Seufzend lehnte er sich zurück gegen das Bollwerk aus Erde und blickte über Vetitan. Über seine Stadt.
»Wie lange?«, fragte er.
Druffel kratzte sich an der Nase. Sein Gesicht war schwarz gefleckt von der Asche. In der letzten Zeit hatte er nicht mehr sonderlich auf Reinlichkeit geachtet. Fatren wusste jedoch, dass er selbst nach den Anstrengungen der vergangenen Monate auch keinen großartigen Anblick bot.
»Vielleicht eine Stunde«, sagte Druffel und spuckte in den Schmutz des Bollwerks.
Fatren seufzte und betrachtete die niedergehende Asche. »Glaubst du, dass es stimmt, Druffel? Was die Leute sagen?«
»Was?«, fragte Druffel zurück. »Dass die Welt untergeht?«
Fatren nickte.
»Keine Ahnung«, meinte Druffel. »Ist mir auch egal.«
»Wie kannst du das nur sagen?«
Druffel zuckte die Achseln und kratzte sich. »Sobald die Kolosse da sind, bin ich ein toter Mann. Das ist zumindest für mich das Ende der Welt.«
Fatren schwieg darauf. Er mochte es nicht, seinen Zweifeln Ausdruck zu verleihen; er sollte schließlich der Starke sein. Als die Grafen den Ort verlassen hatten – eine bäuerliche Gemeinschaft, die ein wenig städtischer war als die Plantagen im Norden –, war er derjenige gewesen, der die Skaa dazu überredet hatte, weiterhin Ackerbau zu betreiben. Fatren war es gewesen, der die Erpresserbanden ferngehalten hatte. In einer Zeit, in der die meisten Dörfer und Plantagen jeden halbwegs gesunden Mann an die eine oder andere Armee verloren hatten, besaß Vetitan noch eine arbeitsfähige Bevölkerung. Ein großer Teil des Getreides hatte als Bestechungsgeld herhalten müssen, aber Fatren war es gelungen, seine Leute zu schützen.
Größtenteils.
»Heute hat sich der Nebel erst gegen Mittag verzogen«, sagte Fatren leise. »Er hält sich immer länger. Du hast die Ähren gesehen, Druffel. Es geht ihnen nicht gut – zu wenig Sonnenlicht, vermute ich. Im nächsten Winter werden wir nicht genug zu essen haben.«
»Wir werden es nicht bis zum nächsten Winter schaffen«, entgegnete Druffel. »Nicht einmal bis zum nächsten Sonnenuntergang.«
Das Traurige – das wirklich Entmutigende – daran war, dass Druffel früher einmal ein Optimist gewesen war. Fatren hatte seinen Bruder schon seit Monaten nicht mehr lachen gehört. Nichts hatte Fatren lieber vernommen als dieses Lachen.
Nicht einmal die Mühlen des Obersten Herrschers haben Druffel das Lachen austreiben können, dachte Fatren. Aber den letzten beiden Jahren ist es gelungen.
»Fatz!«, rief eine Stimme. »Fatz!«
Fatren schaute auf, als ein Junge am Rande des Bollwerks herbeigelaufen kam. Sie hatten es fast vollendet; es war Druffels Idee gewesen, bevor er endgültig aufgegeben hatte. Ihr Ort zählte etwa siebentausend Einwohner und war daher recht ausgedehnt. Es war viel Arbeit gewesen, ihn vollständig mit einem Verteidigungswall zu umgeben.
Fatren hatte kaum tausend richtige Soldaten unter seinem Kommando – es war sehr schwer gewesen, so viele Männer bei einer so geringen Einwohnerzahl zu finden – und darüber hinaus gab es etwa tausend weitere Männer, die entweder zu jung oder zu alt oder zu ungeübt zum Kämpfen waren. Er hatte keine Ahnung, wie groß die Koloss-Armee war, aber sicherlich handelte es sich um mehr als zweitausend Soldaten. Der Verteidigungswall würde nur sehr wenig ausrichten können.
Der Junge – Sev – hatte Fatren endlich schnaubend und keuchend erreicht. »Fatz!«, rief er. »Da kommt jemand!«
»Schon?«, fragte Fatren. »Druff hat doch gesagt, dass die Kolosse noch ziemlich weit entfernt sind.«
»Kein Koloss, Fatz«, sagte der Junge. »Ein Mann. Komm und sieh ihn dir an!«
Fatren wandte sich an Druff, der sich die Nase wischte und mit den Schultern zuckte. Sie folgten Sev an der Innenwand des Bollwerks entlang bis zum Vordertor. Asche und Staub wirbelten über die gestampfte Erde, sammelten sich in den Ecken, trieben umher. Es war kaum mehr Zeit zum Saubermachen geblieben. Die Frauen mussten auf den Feldern arbeiten, während die Männer zu Soldaten ausgebildet wurden und Vorbereitungen für den Krieg trafen.
Vorbereitungen für den Krieg. Fatren sagte sich, dass er eine Streitmacht von zweitausend »Soldaten« zur Verfügung hatte, aber was er wirklich hatte, waren bloß tausend Skaa-Bauern mit Schwertern. Es stimmte, dass sie eine zweijährige Ausbildung erhalten hatten, doch sie hatten kaum Kampferfahrung.
Eine Gruppe von Männern hatte sich um das Vordertor versammelt; sie standen entweder auf dem Bollwerk oder lehnten sich dagegen. Vielleicht war es falsch, dass ich so viele Männer zu Soldaten gemacht habe, dachte Fatren. Wenn diese tausend Männer stattdessen in den Minen gearbeitet hätten, dann besäßen wir ein wenig Erz für Bestechungen.
Doch die Kolosse waren nicht bestechlich. Sie töteten einfach nur. Fatren dachte mit einem Schaudern an Gartwald. Diese Stadt war größer als seine eigene gewesen, aber kaum einhundert Überlebende hatten bis nach Vetitan entkommen können. Das war vor drei Monaten gewesen. Verrückterweise hatte er gehofft, die Kolosse wären vielleicht damit zufrieden, diese Stadt zerstört zu haben.
Er hätte es besser wissen müssen. Die Kolosse waren nie zufrieden.
Fatren kletterte auf die Krone des Verteidigungswalls. Soldaten in geflickter Kleidung und umgebundenen Lederstücken machten ihm Platz. Er spähte durch die fallende Asche auf das dunkle Land, das aussah, als wäre es mit tiefschwarzem Schnee bedeckt.
Ein einsamer Reiter näherte sich; er trug einen dunklen Umhang mit einer Kapuze.
»Was meinst du, Fatz?«, fragte einer der Soldaten. »Ein Späher der Kolosse?«
Fatren schnaubte. »Kolosse senden keine Späher aus, vor allem keine menschlichen.«
»Er hat ein Pferd«, meinte Druffel und stieß ein Grunzen aus. »Wir könnten noch eines gebrauchen.« Es gab nur fünf in der Stadt. Und alle litten an Unterernährung.
»Ein Kaufmann«, sagte einer der Soldaten.
»Er hat keine Waren dabei«, wandte Fatren ein. »Außerdem müsste es ein sehr tapferer Kaufmann sein, wenn er in dieser Gegend allein reist.«
»Ich habe noch nie einen Flüchtling auf einem Pferd gesehen«, meinte einer der Männer. Er hob seinen Bogen und sah dabei Fatren an.
Fatren schüttelte den Kopf. Niemand schoss, als der Fremde ohne große Eile herbeiritt. Er hielt sein Pferd unmittelbar vor dem Stadttor an. Fatren war stolz auf dieses Tor. Zwei Flügel aus echtem Holz steckten in dem Bollwerk aus Erde. Das Holz und auch die erstklassigen Steine, aus denen der Rahmen bestand, hatte er aus dem Herrenhaus im Innern des Ortes geholt.
Nur sehr wenig war von dem Fremden unter dem dicken, dunklen Mantel zu erkennen, den er zum Schutz vor der Asche trug. Fatren schaute über die Krone des Verteidigungswalls, betrachtete den Fremden eingehend, sah dann seinen Bruder an und zuckte die Achseln. Still fiel die Asche herab.
Der Fremde sprang von seinem Pferd herunter.
Sofort hastete er den Wall hoch, als erhielte er einen Auftrieb von unten. Dabei öffnete sich der flatternde Umhang. Darunter trug er eine Uniform aus strahlendem Weiß.
Fatren fluchte und sprang zurück, als der Fremde die Spitze des Bollwerks erreicht hatte und sich auf den Rahmen des hölzernen Tores stellte. Der Mann war ein Allomant. Ein Adliger. Fatren hatte gehofft, sie würden sich in ihren Kämpfen im Norden verzetteln und seine Leute in Ruhe lassen.
Oder zumindest in Ruhe sterben lassen.
Der Neuankömmling drehte sich um. Er trug einen kurzgeschorenen Bart und kurzes schwarzes Haar. »In Ordnung, Männer«, sagte er, während er mit einem unnatürlichen Gleichgewichtssinn über den Torsturz schlenderte, »uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Machen wir uns an die Arbeit.« Er trat von dem Tor auf den Wall. Sofort zog Druffel sein Schwert und deutete mit der Spitze auf den Fremden.
Das Schwert sprang aus Druffels Hand und flog durch die Luft, angetrieben von einer unsichtbaren Kraft. Der Fremde ergriff die Waffe, als sie an ihm vorbeischoss. Er wirbelte das Schwert in seiner Hand hin und her und untersuchte es. »Guter Stahl«, sagte er und nickte. »Ich bin beeindruckt. Wie viele von euren Soldaten sind so gut ausgerüstet?« Er drehte die Waffe noch ein wenig in seiner Hand und gab sie dann mit dem Griff voran Druffel zurück.
Druffel warf Fatren einen verwirrten Blick zu.
»Wer seid Ihr, Fremder?« fragte Fatren mit so viel Mut, wie er aufzubringen vermochte. Er wusste nicht viel über Allomantie, aber er war sich ziemlich sicher, dass dieser Mann ein Nebelgeborener war. Vermutlich konnte der Fremde jeden einzelnen Mann auf dem Wall mit einem bloßen Gedanken töten.
Der Fremde beachtete seine Frage nicht, sondern drehte sich um und schaute auf die Stadt. »Ist sie ganz von dem Verteidigungswall umgeben?«, fragte er an einen der Soldaten gewandt.
»Äh … ja, Herr«, bestätigte der Mann.
»Wie viele Tore gibt es?«
»Nur dieses eine, Herr.«
»Öffnet das Tor und führt mein Pferd herein.«
Also, dachte Fatren missmutig, als der Soldat davoneilte, dieser Fremde weiß eindeutig, wie man Leute herumkommandiert. Der Soldat dachte nicht einmal einen Augenblick lang darüber nach, dass er gerade den Befehl eines Fremden befolgte, ohne Fatren dafür um Erlaubnis zu bitten. Fatren bemerkte, wie sich die übrigen Soldaten aufrechter hielten und ihre Vorsicht ablegten. Dieser Mann redete so, als ob er erwartete, dass man ihm gehorchte, und die Soldaten gaben ihm durch ihr Verhalten Recht. Das war kein Adliger, wie Fatren sie gekannt hatte, als er Diener im Haus des Grafen gewesen war. Dieser Mann war anders.
Der Fremde betrachtete wieder die Stadt. Asche fiel auf seine schöne weiße Uniform, und Fatren empfand es als Schande, dass dieses Kleidungsstück schmutzig wurde. Der Neuankömmling nickte stumm und begann mit dem Abstieg von der Wallanlage.
»Wartet!«, rief Fatren, und der Fremde blieb stehen. »Wer seid Ihr?«
Der Neuankömmling drehte sich um und begegnete Fatrens Blick. »Mein Name ist Elant Wager. Ich bin dein Herrscher.«
Mit diesen Worten drehte sich der Mann um und setzte seinen Abstieg fort. Die Soldaten machten ihm Platz, und viele folgten ihm.
Fatren warf seinem Bruder einen raschen Blick zu.
»Herrscher?«, murmelte Druffel und spuckte aus.
Fatren war ähnlich zumute. Was sollten sie nun tun? Er hatte nie zuvor gegen einen Allomanten gekämpft; er war sich nicht einmal sicher, wie er damit beginnen sollte. Der »Herrscher« hatte Druffel mühelos entwaffnet.
»Organisiert die Leute in der Stadt«, sagte der Fremde – Elant Wager – von vorn. »Die Kolosse rücken aus nördlicher Richtung heran. Sie werden das Tor nicht beachten und stattdessen über die Wallanlage klettern. Ich will, dass sich die Alten und die Kinder im südlichsten Teil der Stadt versammeln. Bringt sie in so wenigen Häusern wie möglich unter.«
»Wozu soll das gut sein?«, wollte Fatren wissen. Er eilte hinter dem »Herrscher« her – er wusste nicht, was er sonst tun sollte.
»Die Kolosse sind am gefährlichsten, wenn sie sich im Blutrausch befinden«, sagte Wager, während er weiterging. »Wenn sie die Stadt einnehmen, sollen sie so lange wie möglich nach eurem Volk suchen. Wenn ihre Raserei allmählich erlahmt, während sie nach euch suchen, werden sie abkühlen und stattdessen plündern. Dann können sich die Bewohner heimlich davonstehlen, ohne dass sie gejagt werden.«
Wager blieb stehen, drehte sich um und sah Fatren an. Sein Gesichtsausdruck war grimmig. »Es ist nur eine schwache Hoffnung, aber das ist immerhin etwas.« Mit diesen Worten ging er weiter die Hauptstraße der Stadt entlang.
Fatren hörte das Flüstern der Soldaten hinter ihm. Sie alle hatten schon von einem Mann namens Elant Wager gehört. Er war derjenige, der vor mehr als zwei Jahren nach dem Tod des Obersten Herrschers die Macht in Luthadel ergriffen hatte. Die Nachrichten aus dem Norden waren für gewöhnlich spärlich und unzuverlässig, aber in den meisten wurde der Name Wager erwähnt. Er hatte alle Mitbewerber um den Thron besiegt und sogar seinen eigenen Vater getötet. Lange hatte er die Tatsache, dass er ein Nebelgeborener war, geheim gehalten und schließlich die Frau geheiratet, die den Obersten Herrscher umgebracht hatte. Fatren bezweifelte, dass ein so wichtiger Mann – der vermutlich eher eine Legende als eine Tatsache war – eine so unwesentliche Stadt im Südlichen Dominium besuchte, vor allem ohne jede Begleitung. Selbst die Minen waren nicht mehr viel wert. Der Fremde musste ein Lügner sein.
Aber … er war eindeutig ein Allomant …
Fatren beeilte sich, mit ihm mitzuhalten. Wager – oder um wen auch immer es sich handeln mochte – blieb vor einem großen Gebäude nahe dem Stadtzentrum stehen. Das hier war das Haus des Stahlministeriums gewesen. Fatren hatte angeordnet, die Türen und Fenster zu vernageln.
»Habt ihr die Waffen dort drinnen gefunden?«, fragte Wager und wandte sich an Fatren. Dieser stand eine Weile reglos da. Dann schüttelte er den Kopf. »Nein, im Haus des Grafen.«
»Er hat seine Waffen zurückgelassen?«, fragte Wager überrascht.
»Wir glauben, er hatte vor, zurückzukommen und sie abzuholen«, erklärte Fatren. »Die Soldaten, die er hiergelassen hat, sind irgendwann desertiert und haben sich einer vorbeiziehenden Armee angeschlossen. Sie haben alles mitgenommen, was sie brauchen konnten. Und den Rest haben wir uns geholt.«
Wager nickte und rieb sich gedankenvoll das bärtige Kinn, während er das alte Ministeriumsgebäude betrachtete. Es war groß und bedrohlich, trotz – oder gerade wegen – seiner Verlassenheit. »Deine Männer wirken gut ausgebildet. Das hatte ich nicht erwartet. Hat einer von ihnen Kampferfahrung?«
Druffel schnaubte leise und deutete damit an, dass er der Meinung war, der Fremde solle nicht so neugierig sein.
»Unsere Männer haben genug gekämpft, um gefährlich zu sein, Fremder«, sagte Fatren. »Einige Banditen wollten uns die Herrschaft über die Stadt abjagen. Sie haben geglaubt, wir wären schwach und können leicht eingeschüchtert werden.«
Falls der Fremde diese Worte als Bedrohung aufnahm, dann zeigte er es nicht. Er nickte bloß. »Haben einige von euch schon einmal gegen Kolosse gekämpft?«
Fatren tauschte einen raschen Blick mit Druffel aus. »Männer, die gegen Kolosse kämpfen, überleben nicht, Fremder«, sagte er schließlich.
»Wenn das stimmen würde«, wandte Wager ein, »dann wäre ich bereits ein Dutzend Mal gestorben.« Er drehte sich um und betrachtete die wachsende Menge von Soldaten und Einwohnern. »Ich bringe euch alles über die Kolosse bei, was ich weiß, aber uns bleibt nicht viel Zeit. Ich will, dass die Hauptmänner und Gruppenführer in zehn Minuten beim Tor versammelt sind. Die regulären Soldaten sollen sich in Schlachtreihen entlang des Verteidigungswalls aufstellen. Ich werde den Hauptmännern und Gruppenführern ein paar Kniffe beibringen, die sie dann an ihre Männer weitergeben können.«
Einige Soldaten machten sich auf den Weg, aber die meisten blieben an Ort und Stelle. Der Neuankömmling schien nicht beleidigt zu sein, dass seine Befehle nicht sofort befolgt wurden. Still stand er da und betrachtete eindringlich die bewaffnete Menge. Er sah nicht verängstigt und auch nicht wütend oder enttäuscht aus. Er wirkte lediglich … majestätisch.
»Herr«, sagte einer der Hauptmänner schließlich. »Habt Ihr eine Armee zu unserer Unterstützung mitgebracht?«
»Sogar zwei«, antwortete Wager. »Aber uns bleibt nicht die Zeit, auf sie zu warten.« Er begegnete Fatrens Blick. »Ihr habt mir geschrieben und mich um Hilfe gebeten. Und als euer Lehensherr bin ich hergekommen, um sie euch zu gewähren. Wollt ihr sie noch haben?«
Fatren runzelte die Stirn. Er hatte weder diesen Mann noch irgendeinen anderen Herrn um Hilfe gebeten. Er öffnete den Mund und wollte etwas erwidern, doch er hielt inne. Er verschafft mir die Möglichkeit, so zu tun, als hätte ich ihn um Hilfe gebeten, dachte Fatren. Das war von Anfang an sein Plan. So kann ich meine Anführerschaft aufgeben, ohne als Versager dazustehen.
Wir werden sterben. Aber wenn ich in die Augen dieses Mannes sehe, dann glaube ich fast, dass wir vielleicht doch noch nicht ganz verloren sind.
»Ich …hatte nicht erwartet, dass Ihr allein kommt, Herr«, hörte Fatren sich schließlich sagen. »Ich war überrascht, Euch zu sehen.«
Wager nickte. »Das ist verständlich. Komm, wir reden über Kriegstaktik, während sich deine Männer versammeln.«
»Sehr gern«, sagte Fatren. Aber als er einen Schritt nach vorn machte, ergriff Druffel seinen Arm.
»Was machst du da?«, zischte sein Bruder. »Du hast diesem Mann geschrieben? Das glaube ich dir nicht.«
»Ruf die Soldaten zusammen«, sagte Fatren anstelle einer Antwort.
Druffel stand kurz reglos da, dann fluchte er leise und stapfte davon. Er wirkte nicht so, als wollte er die Soldaten zusammenrufen, also winkte Fatren zwei seiner Hauptmänner herbei und bedachte sie mit dieser Aufgabe. Als das getan war, gesellte er sich zu Wager, und die beiden begaben sich wieder zum Tor, während Wager einigen Soldaten befahl, ihnen vorauszugehen und die Leute zurückzuhalten, damit er und Fatren vertraulich miteinander reden konnten. Die Asche fiel weiterhin vom Himmel, schwärzte die Straße und bedeckte die schiefen, einstöckigen Häuser.
»Wer seid Ihr?«, fragte Fatren leise.
»Der, für den ich mich ausgegeben habe«, antwortete Wager.
»Ich glaube Euch nicht.«
»Aber du vertraust mir«, bemerkte Wager.
»Nein. Ich will bloß nicht mit einem Allomanten streiten.«
»Das reicht fürs Erste«, meinte Wager. »Mein Freund, zehntausend Kolosse marschieren auf deine Stadt zu. Du brauchst jede Hilfe, die du bekommen kannst.«
Zehntausend?, dachte Fatren verblüfft.
»Ich nehme an, du bist für diese Stadt verantwortlich?«, fragte Wager.
Fatren schüttelte seine Benommenheit ab. »Ja«, antwortete er. »Ich heiße Fatren.«
»In Ordnung, Graf Fatren, wir …«
»Ich bin kein Graf«, sagte Fatren.
»Dann wirst du halt zu einem gemacht«, erwiderte Wager. »Einen Nachnamen kannst du dir später aussuchen. Bevor wir weiterreden, musst du aber die Bedingungen für meine Hilfe kennen.«
»Was für Bedingungen?«
»Solche, über die nicht verhandelt werden kann«, sagte Wager. »Wenn wir gewinnen, schwörst du mir Lehenstreue.«
Fatren runzelte die Stirn und blieb mitten auf der Straße stehen. Die Asche ging überall um ihn herum nieder. »Darum geht es also? Ihr spaziert vor dem Kampf hier herein und behauptet, irgendein hoher Adliger zu sein, damit Ihr den Ruhm für unseren Sieg einheimsen könnt? Warum sollte ich einem Mann, den ich erst seit wenigen Minuten kenne, die Lehenstreue schwören?«
»Wenn du es nicht tust, nehme ich dir einfach das Kommando weg«, meinte Wager und ging weiter.
Fatren blieb noch einen Augenblick lang stehen, dann beeilte er sich und holte Wager ein. »Oh, ich verstehe. Selbst wenn wir diese Schlacht überleben, werden wir danach von einem Tyrannen beherrscht.«
»Ja«, sagte Wager.
Fatren zog die Stirn kraus. Er hatte nicht erwartet, dass der Mann so offen zu ihm war.
Wager schüttelte den Kopf und betrachtete die Stadt durch die herabregnende Asche. »Früher habe ich geglaubt, ich könnte die Dinge anders regeln. Ich glaube immer noch, dass es eines Tages möglich sein wird. Aber im Moment habe ich keine andere Wahl. Ich brauche deine Soldaten, und ich brauche deine Stadt.«
»Meine Stadt?«, fragte Fatren verwirrt. »Warum?«
Wager hob einen Finger. »Zuerst müssen wir diese Schlacht überleben«, sagte er. »Zu den anderen Dingen kommen wir später.«
Fatren verstummte und stellte erstaunt fest, dass er dem Fremden tatsächlich traute. Er hätte nicht erklären können, warum das so war. Diesem Mann musste man einfach folgen – er war der Führer, der Fatren gern gewesen wäre.
Wager wartete nicht darauf, dass Fatren seinen »Bedingungen« zustimmte. Es war kein Angebot, sondern ein Befehl. Fatren bemühte sich, in Wagers Nähe zu bleiben, als dieser den kleinen Platz vor dem Stadttor betrat. Soldaten eilten umher. Keiner trug eine Uniform – man konnte die einfachen Soldaten von den Hauptmännern nur dadurch unterscheiden, dass die Letzteren ein rotes Band um den Arm trugen. Wager hatte ihnen nicht viel Zeit zum Sammeln gelassen, aber schließlich war allen bekannt, dass die Stadt bald angegriffen werden würde. Sie waren sowieso schon dabei gewesen, ihre Positionen einzunehmen.
»Die Zeit ist knapp«, wiederholte Wager mit lauter Stimme. »Ich kann euch nur weniges beibringen, aber es wird euch helfen.
Die Größe der Kolosse reicht von kleineren Exemplaren, die etwa fünf Fuß messen, bis zu den ganz großen von ungefähr zwölf Fuß. Aber auch die Kleinen sind stärker als ihr. Vergesst das nicht. Zum Glück kämpfen diese Kreaturen, ohne sich mit ihren Gefährten abzustimmen. Wenn ein Koloss Schwierigkeiten hat, wird ihm kein anderer zu Hilfe kommen.
Sie greifen direkt und ohne jede List an und wenden rohe Kraft an, um ihren Gegner zu überwältigen. Das müsst ihr verhindern! Sagt euren Männern, sie sollen sich einzelne Kolosse heraussuchen – je zwei Männer für die kleinen und drei oder vier für die großen. Wir werden keine sehr große Frontlinie bilden können, aber so überleben wir am längsten.
Macht euch keine Sorgen um diejenigen Kreaturen, die um eure Linie herumkommen und in die Stadt eindringen. Wir werden die Zivilisten im hinteren Teil verstecken, und die Kolosse, die durch eure Reihen gelangen, werden sich ans Plündern machen und die anderen im Kampf alleinlassen. Genau das wollen wir! Versucht nicht, sie aus der Stadt zu jagen. Eure Familien werden in Sicherheit sein.
Wenn ihr gegen einen großen Koloss kämpft, nehmt euch seine Beine vor und bringt ihn zu Fall, bevor ihr euch ans Töten macht. Wenn ihr gegen einen kleinen kämpft, müsst ihr dafür sorgen, dass euer Schwert oder Speer sich nicht in seiner lockeren Haut verfängt. Denkt daran, dass die Kolosse nicht völlig dumm sind – sie sind nur etwas schlicht. Vorhersehbar. Sie werden euch auf die einfachste und direkteste Art angreifen, die ihnen möglich ist.
Ihr müsst euch unbedingt klarmachen, dass sie nicht unbesiegbar sind. Heute werden wir gegen sie gewinnen. Lasst euch bloß nicht von ihnen einschüchtern! Kämpft aufeinander abgestimmt, behaltet einen kühlen Kopf, und ich verspreche euch, dass wir überleben werden.«
Die Hauptmänner standen in einer kleinen Gruppe zusammen und sahen Wager an. Sie jubelten nicht über diese Rede, aber sie schienen nun ein wenig mehr Zuversicht zu haben. Sie zerstreuten sich und gaben Wagers Anweisungen an ihre Männer weiter.
Leise näherte sich Fatren dem Herrscher. »Wenn Eure Zahlen stimmen, dann sind sie uns im Verhältnis von fünf zu eins überlegen.«
Wager nickte.
»Sie sind größer, stärker und besser ausgebildet als wir.«
Wager nickte abermals.
»Also sind wir doch verloren.«
Nun sah Wager Fatren an und runzelte die Stirn. Schwarze Asche sprenkelte seine Schultern. »Ihr seid nicht verloren. Ihr habt etwas, das sie nicht haben – etwas sehr Wichtiges.«
»Und was ist das?«
Wager sah ihm tief in die Augen. »Ihr habt mich.«
»Herrscher!«, rief eine Stimme vom Verteidigungswall herunter. »Kolosse gesichtet!«
Sie machen bereits ihm zuerst Meldung, dachte Fatren. Er wusste nicht recht, ob er beeindruckt oder beleidigt sein sollte.
Sofort hielt Wager auf das Bollwerk zu und setzte seine Allomantie dazu ein, die Entfernung mit einem raschen Sprung zu überbrücken.
Die meisten Soldaten standen gebückt da oder verbargen sich unter dem Wall, obwohl der Feind noch weit entfernt war. Wager jedoch stand aufrecht in seiner weißen Uniform und blinzelte in die Ferne.
»Sie schlagen ein Lager auf«, sagte er lächelnd. »Gut. Graf Fatren, bereite deine Männer auf einen Anschlag vor.«
»Auf einen Anschlag?«, fragte Fatren, während er hinter Wager die Böschung hochkletterte.
Der Herrscher nickte. »Die Kolosse werden müde vom Marsch sein, und das Errichten des Lagers lenkt sie ab. Wir werden keine bessere Gelegenheit mehr haben, um sie anzugreifen.«
»Aber wir sind in der Verteidigungsposition!«
Wager schüttelte den Kopf. »Wenn wir warten, steigern sie sich möglicherweise selbst in einen Blutrausch hinein und stürmen dann auf uns zu. Es ist besser, wenn wir angreifen, anstatt abzuwarten und getötet zu werden.«
»Wir sollen den Schutz des Bollwerks verlassen?«
»Diese Verteidigungsanlage ist beeindruckend, Graf Fatren, aber letztlich ist sie nutzlos. Du hast nicht genug Männer, um sie in ihrer ganzen Länge zu verteidigen, und die Kolosse sind für gewöhnlich größer und stämmiger als die Menschen. Sie werden einfach das Bollwerk erobern und halten, während sie von dort aus in die Stadt strömen.«
»Aber …«
Wager sah ihn an. Sein Blick war ruhig, aber fest und erwartungsvoll. Die Botschaft war einfach. Ich befehle jetzt hier. Es würde keine Diskussionen geben.
»Ja, Herr«, sagte Fatren und rief einige Boten herbei, damit sie den Befehl verbreiteten.
Wager sah zu, wie die Jungen davonschossen. Es schien eine gewisse Verwirrung unter den Männern einzusetzen; sie hatten nicht erwartet, angreifen zu müssen. Immer mehr Augen richteten sich auf Wager, der aufrecht auf dem Wall stand.
Er sieht wirklich wie ein Herrscher aus, dachte Fatren unwillkürlich.
Die Befehle liefen durch die Reihen der Soldaten. Die Zeit verging. Schließlich starrte ihn die gesamte Armee an. Wager zog sein Schwert und hielt es hoch in den aschfleckigen Himmel. Dann sprang er unmenschlich schnell von der Verteidigungsanlage herunter und rannte auf das Lager der Kolosse zu.
Einen Augenblick lang rannte er allein. Dann biss Fatren die Zähne zusammen, damit er nicht die Nerven verlor, und musste erstaunt feststellen, dass er dem Herrscher folgte.
Auf dem Bollwerk entstand ein großer Aufruhr, und die Soldaten rannten mit einem gemeinsamen Aufschrei und erhobenen Waffen auf den Tod zu.
Kapitel 2
Das Innehaben der Macht hat seltsame Dinge mit meinem Geist angestellt. Innerhalb weniger Augenblicke wurde ich vertraut mit der Macht selbst, mit ihrer Geschichte und den Arten, auf welche sie eingesetzt werden kann.
Doch dieses Wissen war deutlich anders als jede Erfahrung oder auch nur die Fähigkeit, die Macht zu benutzen. Ich wusste nun zum Beispiel, wie ich einen Planeten im Himmel bewegen konnte. Aber ich wusste nicht, wohin ich ihn setzen sollte, damit er sich nicht zu nah oder zu fern der Sonne befand.
Wie immer begann TenSoons Tag in der Dunkelheit. Das lag natürlich auch daran, dass er keine Augen hatte. Er hätte sie sich schaffen können, denn er entstammte schließlich der dritten Generation und hatte dadurch sogar für einen Kandra ein hohes Alter. Er hatte schon viele Leichen verdaut und dadurch gelernt, Sinnesorgane zu bilden, ohne ein Modell für sie zu besitzen.
Doch leider würden ihm Augen nicht weiterhelfen. Er hatte nämlich keinen Schädel, und es war ihm klar, dass die meisten Organe ohne einen vollständigen Körper – und ein vollständiges Skelett – nicht funktionierten. Seine eigene Masse würde die Augen zerdrücken, wenn er eine falsche Bewegung machte, und es wäre sehr schwierig, sie zu drehen, damit er seine Umgebung wahrnehmen konnte.
Doch es gab nicht viel, was er sich hätte ansehen können. TenSoon bewegte sich ein wenig in seinem Kerker. Sein Körper war kaum mehr als eine Ansammlung durchscheinender Muskeln – wie eine Masse großer, miteinander verbundener Schnecken, kaum besser formbar als eine Molluske. Wenn er sich bemühte, konnte er einen der Muskeln ablösen und ihn entweder mit einem anderen verbinden oder etwas Neues daraus erschaffen. Doch ohne ein Skelett war er völlig machtlos.
Erneut regte er sich in seiner Zelle. Seine Haut war ein eigenes Sinnesorgan – es vermittelte eine Art Geschmacks- oder Geruchssinn. Nun roch sie den Gestank seiner eigenen Ausscheidungen am Rande der Zelle, aber er wagte es nicht, diesen Sinn auszuschalten. Er war eine seiner wenigen Verbindungen zur Außenwelt.
Die »Zelle« bestand lediglich aus einer steinernen Grube mit einem Gitter darüber. Sie war kaum groß genug, um seine Masse ganz aufzunehmen. Seine Wächter schütteten von oben Nahrung auf ihn, und in bestimmten Zeitabständen gossen sie auch Wasser hinein, damit er nicht austrocknete und seine Ausscheidungen durch ein kleines Loch am Boden weggespült wurden. Sowohl dieses Loch als auch der Raum zwischen den Gitterstäben waren so klein, dass er sich nicht hindurchzwängen konnte. Der Körper eines Kandra war zwar geschmeidig, aber auch ein bloßer Muskelhaufen konnte nur bis zu einem bestimmten Grad zusammengezogen werden.
Die meisten wurden verrückt, wenn sie so lange eingesperrt waren. Wie lange? Er wusste es nicht einmal mehr. Monate? Aber TenSoon besaß die Segnung der Gegenwart. Sein Geist würde nicht so leicht brechen.
Manchmal verfluchte er diese Segnung, denn sie verweigerte ihm den gnädigen Trost des Wahnsinns.
Konzentriere dich, sagte er zu sich selbst. Er hatte kein Gehirn wie die Menschen, dennoch konnte er denken. Das begriff er nicht. Er war sich nicht sicher, ob es überhaupt irgendein Kandra begriff. Vielleicht wussten die aus der Ersten Generation mehr – aber falls dem so war, klärten sie niemanden darüber auf.
Sie können dich nicht für immer hier einsperren, sagte er zu sich selbst. Im Ersten Vertrag steht …
Aber allmählich zweifelte er an dem Ersten Vertrag – oder eher daran, dass die Erste Generation ihn beachtete. Konnte er ihnen das verübeln, wo er doch selbst ein Vertragsbrecher war? Nach seiner eigenen Aussage hatte er sich gegen den Willen seines Meisters gestellt und einer anderen Person geholfen. Sein Verrat hatte den Tod des Meisters zur Folge gehabt.
Doch diese abscheuliche Tat war das Geringste seiner Verbrechen. Die Strafe für Vertragsbruch war der Tod, und wenn TenSoons Verbrechen damit geendet hätten, dann wäre er getötet worden, und die Sache wäre erledigt gewesen. Doch leider ging es noch um viel mehr. TenSoons Aussage – die er in einer nichtöffentlichen Sitzung vor der Zweiten Generation gemacht hatte – hatte noch einen weiteren, viel gefährlicheren und wichtigeren Fehltritt enthüllt.
TenSoon hatte das Geheimnis seines Volkes verraten.
Sie können mich nicht hinrichten, dachte er und nutzte diesen Gedanken zur Stärkung seiner Konzentration. Nicht, bis sie herausgefunden haben, wem ich es verraten habe.
Das Geheimnis. Das so kostbare, kostbare Geheimnis.
Ich habe uns alle verdammt. Mein gesamtes Volk. Wir werden wieder Sklaven sein. Nein, wir sind schon wieder Sklaven. Wir werden zu etwas anderem werden – zu Automaten, deren Gedanken von anderen kontrolliert werden. Wir werden gefangen und missbraucht werden, und unsere Körper werden nicht länger uns selbst gehören.
Das war es, was er getan hatte – was er in Gang gesetzt hatte. Das war der Grund dafür, dass er Gefangenschaft und Tod verdient hatte. Dennoch wollte er leben. Eigentlich sollte er sich selbst verachten. Aber irgendwie hatte er den Eindruck, dass er richtig gehandelt hatte.
Er regte sich wieder; Massen glatter Muskeln wanden sich umeinander. Doch mitten in der Bewegung erstarrte er. Da waren leise Erschütterungen. Jemand näherte sich.
Er ordnete sich, schob seine Muskeln an die Seitenwände der Grube und bildete so eine Einbuchtung in der Mitte seines Körpers. Er musste alle Nahrung auffangen, die er bekommen konnte, denn er erhielt nur sehr wenig. Doch nichts wurde durch das Gitter auf ihn geschüttet. Er wartete gespannt, bis das Gitter angehoben wurde. Zwar hatte er keine Ohren, aber er spürte die groben Erschütterungen, als das Gitter beiseite gezogen und das raue Eisen auf den Boden geworfen wurde.
Wie bitte?
Als Nächstes kamen Haken herab. Sie wanden sich um seine Muskeln, packten ihn, rissen sein Fleisch auf, während sie ihn aus der Grube hoben. Es schmerzte. Dafür waren nicht nur die Haken verantwortlich, sondern auch die plötzliche Freiheit, als sich sein Körper über den Boden des Gefängnisses ergoss. Unwillig schmeckte er Schmutz und getrockneten Nahrungsschleim. Seine Muskeln bebten. Es war ein seltsames Gefühl, frei und unbehindert zu sein. Er streckte sich und bewegte seine Körpermasse auf eine Art und Weise, die er beinahe vergessen hatte.
Dann kam es. Er schmeckte es in der Luft. Beißend, dick und durchdringend, vermutlich in einem goldgeränderten Kübel, den die Gefangenenwärter herbeibrachten. Sie würden ihn nun doch töten.
Aber das können sie nicht!, dachte er. Der Erste Vertrag, das Gesetz unseres Volkes, es …
Etwas fiel auf ihn. Es war keine Säure, sondern etwas Hartes. Eifrig berührte er es; seine Muskeln rieben gegeneinander, betasteten es, prüften es, spürten es. Es war rund, mit mehreren Löchern und einigen scharfen Kanten … ein Schädel.
Der beißende Geruch wurde stärker. Verursachten seine Wächter ihn? TenSoon bewegte sich rasch, schmiegte sich um den Schädel, füllte ihn. Er hatte bereits ein wenig aufgelöstes Fleisch in einer organähnlichen Tasche gespeichert. Nun holte er es hervor, goss es um den Schädel und machte rasch eine Haut daraus. Die Augen ließ er frei, arbeitete nun an der Lunge, bildete eine Zunge, beachtete die Lippen jedoch zunächst nicht weiter. Er arbeitete mit einem Gefühl der Verzweiflung, als der beißende Geruch stärker wurde, und dann …
Es traf ihn. Es versengte die Muskeln auf der einen Seite seines Körpers, floss über seine Masse, löste sie auf. Anscheinend hatte es die Zweite Generation aufgegeben, ihm seine Geheimnisse entlocken zu wollen. Bevor sie ihn töteten, mussten sie ihm Gelegenheit zum Reden geben. Das verlangte der Erste Vertrag – daher der Schädel. Doch offenbar hatten die Wärter den Befehl erhalten, ihn zu töten, bevor er etwas zu seiner Verteidigung vorbringen konnte. Sie befolgten den Buchstaben des Gesetzes, missachteten aber dessen Sinn.
Allerdings hatten sie nicht bedacht, wie schnell TenSoon arbeiten konnte. Nur wenige Kandras hatten so viel Zeit in Verträgen verbracht wie er. Alle aus der Zweiten Generation und die meisten aus der Dritten hatten sich schon lange vom Dienst zurückgezogen. Sie führten ein angenehmes Leben im Heimatland.
Und ein angenehmes Leben lehrte einen nur wenig.
Bei den meisten Kandras dauerte es viele Stunden, bis sie einen Körper gebildet hatten – einige jüngere benötigten dazu sogar Tage. Doch bereits innerhalb weniger Sekunden hatte TenSoon eine schwach entwickelte Zunge herausgebildet. Als die Säure an seinem Körper hochstieg, trieb er eine Luftröhre aus, ließ Luft in die Lunge und krächzte ein einziges Wort:
»Gericht!«
Der Guss hörte auf. Sein Körper brannte weiterhin. Trotzdem fuhr er in seiner Arbeit fort und bildete innerhalb der Höhlungen des Schädels einfache Hörorgane aus.
Eine Stimme in seiner Nähe flüsterte: »Narr.«
»Gericht!«, sagte TenSoon noch einmal.
»Füge dich in deinen Tod«, zischte die Stimme gelassen. »Bring dich nicht in eine Lage, in der du deinem Volk noch weiteren Schaden zufügen kannst. Die Erste Generation hat dir nur wegen deiner vielen Jahre des zusätzlichen Dienstes diese Gelegenheit zu sterben gegeben!«
TenSoon verstummte. Ein Gerichtsverfahren würde öffentlich sein. Bisher wussten nur wenige um das wahre Ausmaß seines Verrats. Er konnte als Vertragsbrecher sterben, aber wegen seines früheren Werdegangs noch ein gewisses Ansehen behalten. Irgendwo – vermutlich in anderen Gruben in genau diesem Raum – gab es bestimmt einige, die ewige Gefangenschaft erlitten – eine Folter, die am Ende sogar den Geist derjenigen zerstörte, die mit der Segnung der Gegenwart bedacht waren.
Wollte er zu einem von ihnen werden? Wenn er seine Taten vor einem öffentlichen Gericht enthüllte, würde er sich damit ewige Qualen einhandeln. Es wäre dumm, einen Prozess zu erzwingen, denn es gab keine Hoffnung auf einen Freispruch. Sein Geständnis hatte ihn bereits verurteilt.
Wenn er redete, dann nicht, um sich selbst zu verteidigen, sondern aus ganz anderen Gründen.
»Gericht!«, wiederholte er. Diesmal flüsterte er kaum noch.
Kapitel 3
Ich glaube, in gewisser Weise war es schlicht zu überwältigend, eine solche Macht zu haben. Es hätte vieler Jahrtausende bedurft, um sie zu begreifen. Eine Neuschöpfung der Welt wäre einfach gewesen, wenn man mit der Macht vertraut gewesen wäre. Doch ich erkannte die Gefahr, die in meinem Unwissen lag. Wie ein Kind, das plötzlich ungeheuerliche Kraft erhält, hätte ich es zu weit treiben und die Welt als zerbrochenes Spielzeug zurücklassen können, das nie wieder heil gemacht werden kann.
Elant Wager, der zweite Herrscher des Letzten Reiches, war nicht als Krieger geboren worden. Er war ein Adliger gewesen, was ihn in den Tagen des Obersten Herrschers zu einem Angehörigen der feinen Gesellschaft gemacht hatte. Seine Jugend hatte er damit verbracht, die frivolen Spielchen der Großen Häuser mitzuspielen und den Lebensstil einer gehätschelten Elite zu führen.
Es war nicht erstaunlich, dass er als Politiker geendet war. Er hatte sich immer schon für politische Theorie interessiert, und auch wenn er eher ein Gelehrter als ein wahrer Staatsmann war, hatte er doch gewusst, dass er eines Tages die Geschicke seines eigenen Hauses lenken musste. Zuerst hatte er allerdings keinen guten König abgegeben. Er hatte nicht begriffen, dass es mehr zur Führerschaft bedurfte als nur einiger guter Einfälle und ehrenwerter Absichten. Viel mehr.
Ich bezweifle, dass Ihr je ein Feldherr sein werdet, der den Angriff auf den Feind in vorderster Reihe anführt, Elant Wager. Diese Worte hatte Tindwyl ausgesprochen – jene Frau, die ihn in praktischer Politik unterrichtet hatte. Als Elant an ihre Worte dachte, musste er lächeln, während seine Soldaten in das Lager der Kolosse stürmten.
Elant fachte sein Weißblech an. Ein Gefühl der Wärme – das ihm inzwischen vertraut war – bildete sich in seiner Brust, und seine Muskeln spannten sich vor zusätzlicher Stärke und Energie. Er hatte das Metall zuvor geschluckt, so dass er während des Kampfes Kraft daraus ziehen konnte. Er war ein Allomant. Und das flößte ihm manchmal immer noch Ehrfurcht ein.
Wie er es vorhergesagt hatte, waren die Kolosse von dem Angriff vollkommen überrascht. Kurze Zeit standen sie reglos da und waren entsetzt – obwohl sie den Angriff von Elants frisch rekrutierter Armee bemerkt haben mussten. Es fiel den Kolossen nicht leicht, mit dem Unerwarteten umzugehen. Für sie war es schwer zu verstehen, dass eine Gruppe schwacher, zahlenmäßig unterlegener Menschen ihr Lager angriff. Daher brauchten sie eine Weile, um sich auf die neue Lage einzustellen.
Die kleine Armee nutzte diese Zeit gut. Elant selbst schlug als Erster zu und fachte dabei sein Weißblech stärker an, damit er noch mehr Kraft erhielt, als er den ersten Koloss niedermähte. Es war ein kleineres Untier gewesen. Wie alle anderen seiner Art hatte es eine menschenähnliche Gestalt; allerdings war seine blaue Haut zu groß und hing in Falten von ihm herab, so dass es aussah, als hätte sie sich vom Rest des Körpers gelöst. Seine perlenartigen roten Augen zeigten ein wenig nichtmenschliche Überraschung, als es starb und Elant das Schwert aus seiner Brust riss.
»Schlagt rasch zu!«, rief er, als sich weitere Kolosse an ihren Lagerfeuern umdrehten. »Tötet so viele wie möglich, bevor sie in ihren Blutrausch geraten!«
Seine entsetzten, aber gehorsamen Soldaten eilten an ihm vorbei und überrannten die ersten Koloss-Gruppen. Das »Lager« war kaum mehr als ein Ort, an dem die Kolosse Asche und Pflanzen niedergetrampelt und Feuergruben ausgehoben hatten. Elant bemerkte, wie seine Männer angesichts ihrer ersten Erfolge zuversichtlicher wurden, und er unterstützte sie, indem er mit Allomantie an ihren Gefühlen zog und sie dadurch noch tapferer machte. Diese Art von Allomantie war ihm lieber; er hatte sich noch nicht daran gewöhnt, mit Hilfe der Metalle so herumzuspringen wie Vin. Aber Gefühle – das war etwas, das er verstehen konnte.
Fatren, der stämmige Anführer der Stadt, blieb in Elants Nähe, während er eine Soldatengruppe auf ein großes Rudel Kolosse jagte. Elant behielt den Mann im Auge. Fatren war der Herrscher über diese kleine Stadt; falls er starb, wäre das ein schwerer Schlag für die Moral der Truppe. Gemeinsam fielen sie über eine kleine Gruppe überraschter Kolosse her. Die größte Bestie maß etwa elf Fuß. Ihre Haut, die früher einmal locker an ihr herabgehangen hatte, spannte sich nun wie bei allen großen Kolossen fest um den gewaltigen Körper. Die Kolosse hörten nie auf zu wachsen, doch ihre Haut behielt immer dieselbe Größe. Bei den jüngeren Kreaturen hing sie lose und in Falten herab. Bei den großen dehnte sie sich und riss.
Elant verbrannte Stahl und warf eine Handvoll Münzen in die Luft vor ihm. Mit ganzer Kraft stieß er sie von sich ab und schleuderte sie gegen die Kolosse. Die Bestien würden nicht von einfachen Münzen in die Knie gezwungen werden, aber die Metallstücke würden sie verletzen und schwächen.
Noch während die Münzen flogen, griff Elant den großen Koloss an. Die Bestie nahm ihr riesiges Schwert vom Rücken; die Aussicht auf einen Kampf schien sie zu erfreuen.
Der Koloss schlug zuerst zu; er hatte eine beeindruckende Reichweite. Elant musste nach hinten springen; das Weißblech machte ihn gewandter. Die Kolossschwerter waren massive, grobe Waffen und so stumpf, dass man sie beinahe für Keulen halten konnte. Unter der Gewalt des Schlags erzitterte die Luft. Selbst mit Hilfe seines Weißblechs hätte Elant die Klinge nicht abwehren können. Außerdem wog das Schwert – oder genauer: der Koloss, der es hielt – so viel, dass Elant keine Allomantie hätte einsetzen können, um es der Kreatur aus der Hand zu schlagen. Beim Stahldrücken ging es immer nur um Gewicht und Kraft. Wenn Elant gegen etwas drückte, das schwerer war als er selbst, dann wurde er zurückgeschleudert.
Also musste er sich ganz auf die zusätzliche Geschwindigkeit und Gewandtheit verlassen, die ihm das Weißblech verlieh. Er warf sich zur Seite und gab auf eine mögliche Rückhand Acht. Das Geschöpf drehte sich schweigend um und beäugte Elant, schlug aber nicht noch einmal zu. Seine Raserei war noch nicht stark genug.
Elant starrte seinen übergroßen Feind an. Wie bin ich hierhergekommen?, dachte er nicht zum ersten Mal. Ich bin ein Gelehrter und kein Krieger. Die Hälfte seiner Zeit war er der Meinung, es sei nicht seine Aufgabe, Menschen zu führen.
Doch in der anderen Hälfte war er der Meinung, dass er zu viel nachdachte. Er stürmte vor und schlug zu. Der Koloss hatte seinen Angriff vorhergesehen und versuchte, mit seiner Waffe Elants Kopf zu treffen. Doch Elant streckte seine allomantische Kraft aus und zog damit an dem Schwert eines anderen Kolosses. Dadurch brachte er das Wesen aus dem Gleichgewicht und gab zweien seiner Männer die Möglichkeit, es zu töten; gleichzeitig wurde Elant rasch zur Seite gezerrt. Nur ganz knapp entging er der Waffe seines Gegners. Dann wirbelte er in der Luft herum, fachte sein Weißblech noch stärker an und schlug von der Seite zu.
Er trennte das Bein der Kreatur unterhalb des Knies vollkommen ab, und sie stürzte zu Boden. Vin sagte immer, dass Elants allomantische Kraft außergewöhnlich stark sei. Elant war sich dessen nicht sicher – er hatte noch keine große Erfahrung in der Allomantie –, aber die Kraft seines Schlags brachte ihn zum Schwanken. Er erlangte rasch das Gleichgewicht wieder und hieb dem Geschöpf den Kopf ab.
Einige Soldaten starrten ihn an. Seine weiße Uniform war nun mit hellrotem Kolossblut bespritzt. Es war nicht das erste Mal. Elant holte tief Luft, als er nichtmenschliche Schreie im Lager hörte. Die Raserei begann.
»Formiert euch!«, rief Elant. »Bildet Linien, bleibt zusammen, bereitet euch auf den Angriff vor!«
Die Soldaten reagierten nur langsam. Sie waren viel weniger diszipliniert als die Truppen, an die Elant gewöhnt war, aber es gelang ihnen erstaunlich gut, bei seinem Kommando Gruppen zu bilden. Elant warf einen Blick auf den Boden vor ihnen. Es war ihnen gelungen, mehrere hundert Kolosse niederzumetzeln – eine erstaunliche Leistung.
Doch der leichte Teil war nun vorbei.
»Bleibt standhaft!«, schrie Elant, als er vor der Soldatenlinie entlanglief. »Aber kämpft weiter! Wir müssen so viele von ihnen so schnell wie möglich erledigen! Alles hängt davon ab! Zeigt ihnen eure Wut, Männer!«
Er verbrannte Messing, drückte gegen ihre Gefühle, besänftigte ihre Angst. Ein Allomant konnte keine Gedanken kontrollieren – zumindest nicht die von menschlichen Gehirnen –, aber er vermochte einige Gefühle anzustacheln und andere abzuwiegeln. Auch hier hatte Vin gesagt, Elant könne viel mehr Menschen gleichzeitig beeinflussen, als es eigentlich möglich sein sollte. Elant hatte seine Fähigkeiten erst vor kurzem erlangt – unmittelbar an dem Ort, von dem er nun vermutete, dass er die Quelle aller Allomantie war.
Unter dem Einfluss des Besänftigens richteten sich die Soldaten auf. Abermals verspürte Elant einen gesunden Respekt vor diesen einfachen Skaa. Er gab ihnen zwar Mut und nahm ihnen etwas von ihrer Angst, aber ihre Entschlossenheit kam ausschließlich von ihnen selbst. Es waren gute Menschen.
Mit etwas Glück konnte er einige von ihnen retten.
Die Kolosse griffen an. Wie er gehofft hatte, löste sich eine große Gruppe aus dem Hauptlager und stürmte auf das Dorf zu. Einige der Soldaten schrien auf, doch sie waren so sehr damit beschäftigt, sich zu verteidigen, dass sie den Kolossen nicht folgen konnten. Elant warf sich ins Getümmel, wann immer die Front nachzugeben drohte, und stärkte die schwachen Stellen. Dabei verbrannte er Messing und versuchte gegen die Gefühle eines Kolosses in seiner Nähe zu drücken.
Nichts geschah. Diese Kreaturen waren nicht anfällig für Gefühlsallomantie – vor allem dann nicht, wenn sie schon von jemand anderem beeinflusst wurden. Falls es ihm aber gelang, zu ihnen durchzukommen, dann konnte er die völlige Kontrolle über sie erlangen. Dazu waren Zeit, Glück und die Entschlossenheit notwendig, unermüdlich zu kämpfen.
Und das tat er. Er focht zusammen mit den Männern, sah sie sterben, sah sie Kolosse töten, während die Schlachtreihe an den Enden allmählich eine Kurve beschrieb und so einen Halbkreis bildete, der es verhinderte, dass seine Truppen umzingelt wurden. Dennoch war der Kampf außerordentlich hart. Als immer mehr Kolosse in einen Blutrausch gerieten und angriffen, wandte sich das Schicksal rasch gegen Elants Gruppe. Immer noch widerstanden die Kolosse seinen Gefühlsmanipulationen. Aber sie kamen näher …
»Wir sind geliefert!«, kreischte Fatren.
Elant drehte sich um und stellte ein wenig überrascht fest, dass der bullige Graf noch immer lebendig neben ihm stand. Die Männer kämpften weiter. Seit dem Beginn der Raserei waren erst etwa fünfzehn Minuten vergangen, doch schon gab die Schlachtreihe allmählich nach.
Ein Fleck erschien am Himmel.
»Ihr habt uns in den Tod geführt!«, schrie Fatren. Er war über und über mit Kolossblut beschmiert, und eine rote Schliere an seiner Schulter schien von seinem eigenen zu stammen. »Warum?«, wollte er wissen.
Elant deutete in den Himmel, wo der Fleck immer größer wurde.
»Was ist das?«, fragte Fatren durch das Chaos der Schlacht.
Elant lächelte. »Das ist die erste der Armeen, die ich euch versprochen habe.«
*
Vin fiel in einem Gestöber aus Hufeisen aus dem Himmel und landete mitten in der Koloss-Armee.
Ohne zu zögern, setzte sie ihre Allomantie ein und drückte zwei Hufeisen gegen einen Koloss, der sich soeben umdrehte. Das eine erwischte die Kreatur an der Stirn und schleuderte sie zurück, das andere schoss über ihren Kopf hinweg und traf einen weiteren Koloss. Vin wirbelte herum, warf das nächste Eisen an einem besonders großen Ungetüm vorbei und fällte einen kleineren Koloss dahinter.
Sie fachte ihr Eisen an und zog das Hufeisen so zurück, dass es sich um das Handgelenk des größeren Kolosses legte. Sofort riss ihr Ziehen sie auf das Geschöpf zu – und es brachte die Kreatur aus dem Gleichgewicht. Ihr massiges Eisenschwert fiel zu Boden, als Vin gegen die Brust der Bestie prallte. Dann drückte sie sich von dem Schwert ab und machte einen Salto nach hinten, als ein weiterer Koloss auf sie zustürmte.
Sie stieg etwa fünfzehn Fuß hoch in die Luft. Das Schwert verfehlte sie und trennte stattdessen den Kopf des Kolosses unter ihr ab. Dem Koloss, der den Schlag ausgeführt hatte, schien es gleichgültig zu sein, dass er soeben einen Kameraden getötet hatte; er starrte Vin mit blutroten, hasserfüllten Augen an.
Sie zog an dem zu Boden gefallenen Schwert. Es sprang hoch zu ihr, zog sie mit seinem Gewicht aber auch hinunter. Sie ergriff es, während sie fiel – das Schwert war fast so groß wie sie selbst, aber das in ihrem Innern lodernde Weißblech erlaubte ihr, es mühelos zu halten –, und als sie landete, schlug sie dem angreifenden Koloss damit den Arm ab.
Dann trennte sie ihm die Beine unterhalb der Knie durch und ließ ihn sterbend liegen, während sie sich den anderen Feinden zuwandte. Wie immer schienen die Kolosse auf eine wütende, verwirrte Art von Vin fasziniert zu sein. Sie brachten nur eine beträchtliche Größe mit Gefahr in Verbindung und konnten kaum begreifen, dass eine so kleine Frau wie Vin – zwanzig Jahre alt, kaum größer als fünf Fuß und so schlank wie eine Weidengerte – eine Gefahr darstellte. Doch sie sahen, wie das Mädchen tötete, und deswegen näherten sie sich ihr.
Vin war das gerade recht.
Sie schrie, als sie angriff, damit es wenigstens irgendwelche Laute auf dem ansonsten allzu stillen Schlachtfeld gab. Die Kolosse neigten dazu, nichts mehr zu rufen, wenn sie in ihre Raserei verfielen; sie konzentrierten sich nur auf das Töten. Vin warf eine Handvoll Münzen, drückte sie gegen die Gruppe hinter ihr, sprang nach vorn und zog dabei an einem Schwert.
Ein Koloss vor ihr geriet ins Taumeln. Sie landete auf seinem Rücken und griff eine Kreatur neben ihm an. Diese ging sofort zu Boden, und Vin rammte dem Koloss unter ihr das Schwert in den Rücken. Dann drückte sie sich mit ihrer allomantischen Kraft zur Seite und zog an dem Schwert des sterbenden Kolosses. Sie packte seine Waffe, fällte ein drittes Ungetüm, warf das Schwert in die Luft und schleuderte es wie einen gigantischen Pfeil in den Brustkorb eines vierten Ungeheuers. Diese Bewegung warf sie wiederum nach hinten und aus der Schusslinie eines Angriffs. Sie riss das Schwert aus dem Rücken des Kolosses, den sie zuvor niedergestochen hatte. Dabei starb er. Mit einer fließenden Bewegung rammte sie die Waffe einer fünften Bestie durch Schlüsselbein und Brust.
Sie landete. Um sie herum gingen die Kolosse zu Boden.
Vin befand sich nicht in einer Raserei. Sie verspürte keinen Schrecken. Über diese Empfindungen war sie hinausgewachsen. Sie hatte Elant sterben sehen – hatte ihn in den Armen gehalten, als er starb – und dabei gewusst, dass sie es zugelassen hatte. Absichtlich.
Dennoch hatte er überlebt. Jeder Atemzug, den er tat, war unerwartet, vielleicht sogar unverdient. Früher hatte sie befürchtet, dass sie ihn enttäuschen könnte. Aber irgendwie hatte sie in dem Gedanken Frieden gefunden, dass sie ihn nicht davon abhalten konnte, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Und seit sie das begriffen hatte, wollte sie ihn nicht mehr davon abhalten.
Daher kämpfte sie nicht mehr aus Angst um den Mann, den sie liebte. Nun kämpfte sie bewusst. Sie war ein Messer – Elants Messer, das Messer des Letzten Reiches. Sie kämpfte nicht zum Schutz eines einzigen Mannes, sondern zum Schutz der Lebensart, die er geschaffen hatte, und der Leute, die er so unermüdlich beschützte.
Der Friede gab ihr Kraft.
Um sie herum starben die Kolosse, und scharlachfarbenes Blut – zu hell für menschliches – fleckte die Luft. Es gab zehntausend Kämpfer in dieser Armee – zu viele, als dass sie alle hätte töten können. Aber sie brauchte nicht jeden einzelnen Koloss der Armee abzuschlachten.
Sie musste sie nur in Angst und Schrecken versetzen.
Denn obwohl sie früher vom Gegenteil überzeugt gewesen war, konnten Kolosse tatsächlich Angst verspüren. Vin bemerkte, wie sie sich unter den Kreaturen in ihrer Nähe aufbaute, versteckt unter Enttäuschung und Wut. Ein Koloss griff sie an, sie wich zur Seite aus, bewegte sich mit der ungeheuren Schnelligkeit, die ihr das Weißblech verlieh. Währenddessen rammte sie ihm das Schwert in den Rücken, wirbelte herum und bemerkte, wie sich eine massige Gestalt einen Weg durch die Armee auf sie zu bahnte.
Perfekt, dachte sie. Der Koloss war groß – vielleicht sogar der größte, den sie je gesehen hatte. Er musste beinahe dreizehn Fuß messen. Eigentlich hätte ihn ein Herzversagen schon vor langer Zeit töten müssen; seine Haut war geplatzt und halb abgerissen; sie hing in großen Fetzen an seinem Körper herunter.
Sein Brüllen hallte über das seltsam stille Schlachtfeld. Vin lächelte und verbrannte Duralumin. Sofort explodierte das Weißblech, das bereits in ihr flackerte, und verlieh ihr einen gewaltigen, plötzlichen Kräfteschub. Wenn Duralumin zusammen mit einem anderen Metall eingesetzt wurde, verstärkte es dieses und führte dazu, dass es in einer einzigen Stichflamme verbrannte und alle Kraft, die in ihm steckte, auf einmal abgab.
Vin verbrannte zusätzlich Stahl und drückte mit ihrer Allomantie in alle Richtungen. Ihr vom Duralumin verstärktes Drücken schlug wie eine Welle gegen die Schwerter der Kreaturen, die auf sie zustürmten. Die Waffen wurden ihnen aus den Händen gerissen, die Kolosse fielen nach hinten. Die mächtigen Körper gingen zu Boden und zerstreuten sich wie bloße Ascheflocken unter der blutroten Sonne. Das vom Duralumin verstärkte Weißblech verhinderte, dass Vin zerschmettert wurde.
Ihr Stahl und Weißblech verschwanden gleichzeitig, waren verbrannt in einem einzigen Auflodern der Kraft. Sie zog eine kleine Phiole mit Flüssigkeit hervor – eine alkoholische Lösung mit Metallflocken darin – und kippte sie rasch herunter, um ihren Metallvorrat aufzufüllen. Dann verbrannte sie wieder Weißblech und sprang über gestürzte, orientierungslose Kolosse auf die gewaltige Kreatur zu, die sie vorhin gesehen hatte. Ein kleinerer Koloss versuchte sie aufzuhalten, aber sie ergriff sein Handgelenk, drehte es und brach es. Sie entriss ihm sein Schwert, duckte sich unter dem Angriff eines anderen Kolosses hindurch, wirbelte herum, fällte drei weitere Kolosse mit einem einzigen Schlag, indem sie ihnen die Beine bei den Knien abschlug.
Als sie ihre Drehung beendet hatte, rammte sie das Schwert in den Boden. Wie erwartet, griff das dreizehn Fuß große Ungetüm eine Sekunde später an. Das Schwert, das es schwang, war so groß, dass es die Luft zum Schwirren brachte. Vin hatte ihr Schwert gerade zur rechten Zeit in die Erde gestoßen, denn auch mit ihrem Weißblech hätte sie niemals den Schlag dieser gewaltigen Kreatur parieren können. Doch diese Waffe prallte gegen die Klinge ihres Schwertes, das durch die Erde festgehalten wurde. Das Metall erzitterte in Vins Händen, aber sie hielt stand.
Vins Finger stachen noch von diesem mächtigen Hieb, als sie das Schwert losließ und in die Luft sprang. Sie drückte nicht mit ihrer allomantischen Kraft – das musste sie nicht –, sondern landete auf der Parierstange ihres Schwertes und sprang sogleich davon herunter. Der Koloss zeigte dieselbe charakteristische Überraschung wie alle anderen, als er sah, dass sie dreizehn Fuß hoch in die Luft sprang, während ihr Nebelmantel sie umflatterte.
Sie trat dem Koloss seitlich gegen den Kopf. Der Schädel splitterte. Die Kolosse waren außerordentlich widerstandsfähig, aber Vins angefachtem Weißblech hatten sie nichts entgegenzusetzen. Die perlenartigen Augen des Geschöpfs rollten in den Kopf zurück, und es brach zusammen. Vin drückte leicht gegen sein Schwert und hielt sich so lange aufrecht, dass sie, als sie endlich fiel, geradewegs auf der Brust des gefällten Kolosses landete.
Die Kolosse um sie herum erstarrten. Selbst mitten in ihrer Blutraserei entsetzte es sie zu sehen, dass ein so gewaltiges Ungetüm mit einem einzigen Tritt umgebracht wurde. Vielleicht war ihr Verstand zu langsam, um zu verarbeiten, was sie soeben miterlebt hatten. Oder sie konnten neben Angst auch noch eine gewisse Vorsicht empfinden. Vin wusste nicht genug über sie. Doch sie wusste, dass ihr in einer gewöhnlichen Koloss-Armee das, was sie soeben getan hatte, den Gehorsam einer jeden Kreatur eingebracht hätte, die ihr dabei zugesehen hatte.