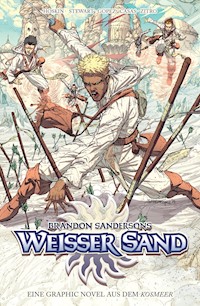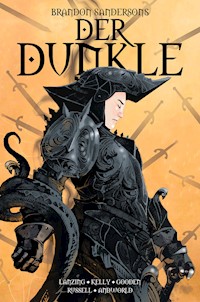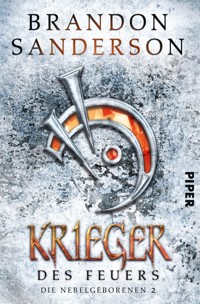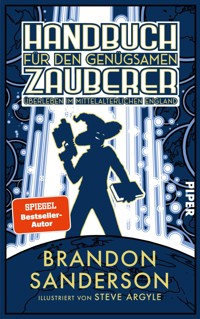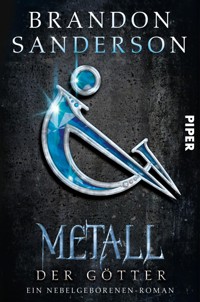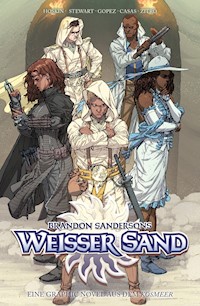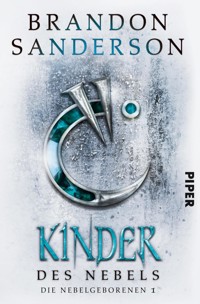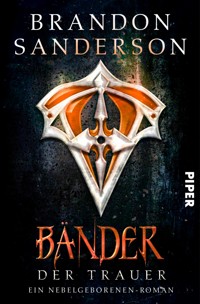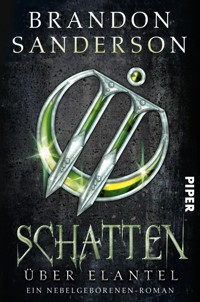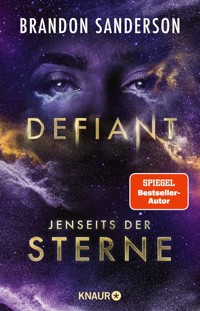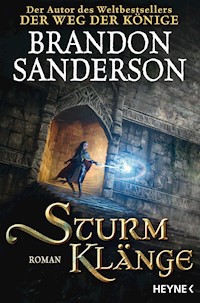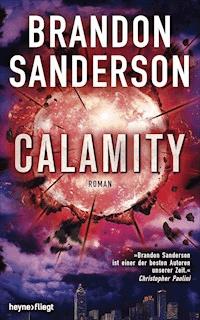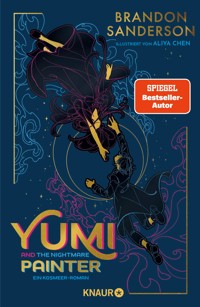
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Zwei einsame Seelen, zwei Welten in Gefahr – ein Geheimnis, das alles zerstören könnte … »Yumi and the Nightmare Painter« vom internationalen Bestseller-Autor Brandon Sanderson ist ein romantischer, asiatisch inspirierter Fantasy-Roman voller einzigartiger Magie und Figuren, die tief berühren. Heimlich sehnt Yumi sich nach einem einzigen Tag als normaler Mensch – doch nur durch absoluten Gehorsam kann sie die Geister beschwören, deren Hilfe für ihr Volk lebenswichtig ist. Während er durch dunkle Straßen patrouilliert, träumt Maler davon, ein Held zu sein. Doch dieser Wunsch hat ihm nur Herzschmerz gebracht und Einsamkeit am Rand der Gesellschaft. Als das Schicksal Yumi und Maler zusammenführt, steht plötzlich alles auf dem Spiel: Vergangenheit und Gegenwart müssen in Einklang gebracht, begangenes Unrecht wiedergutgemacht und ein Geheimnis gelüftet werden. Sonst riskieren sie nicht nur, das zarte Band, das zwischen ihnen wächst, für immer zu verlieren. Sondern auch die Welten, für deren Schutz sie so verzweifelt kämpfen. Romantische High Fantasy in Brandon Sandersons beliebtem Kosmeer-Universum »Yumi and the Nightmare Painter« ist eine der vier »secret project novels«, mit denen Brandon Sanderson auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter sämtliche Rekorde gebrochen hat. Der Fantasy-Standalone ist im Kosmeer-Universum angesiedelt, in dem unter anderem auch die Bestseller-Fantasy-Serien »Die Nebelgeborenen« und »Die Sturmlicht-Chroniken« spielen. »Yumi and the Nightmare Painter« kann ohne Vorkenntnisse gelesen werden und ist ein perfekter Einstieg in die Welten von Kosmeer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Brandon Sanderson
Yumi and the Nightmare Painter
Ein Kosmeer-Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Paula Telge
Illustriert von Aliya Chen
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Heimlich sehnt Yumi sich nach einem einzigen Tag als normaler Mensch – doch nur durch absoluten Gehorsam kann sie die Geister beschwören, deren Hilfe für ihr Volk lebenswichtig ist.
Während er durch dunkle Straßen patrouilliert, träumt Maler davon, ein Held zu sein. Doch dieser Wunsch hat ihm nur Herzschmerz gebracht und Einsamkeit am Rand der Gesellschaft.
Als das Schicksal Yumi und Maler zusammenführt, steht plötzlich alles auf dem Spiel: Vergangenheit und Gegenwart müssen in Einklang gebracht, begangenes Unrecht wiedergutgemacht und ein Geheimnis gelüftet werden. Sonst riskieren sie nicht nur, das zarte Band, das zwischen ihnen wächst, für immer zu verlieren. Sondern auch die Welten, für deren Schutz sie so verzweifelt kämpfen.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
WIDMUNG
ILLUSTRATIONEN
DANKSAGUNG
TEIL EINS
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
TEIL ZWEI
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
TEIL DREI
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
TEIL VIER
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
EPILOG
EIN WEITERER EPILOG
NACHWORT
Ebenfalls für Emily,
die mir, aus irgendeinem wunderbaren Grund, ihre Liebe schenkt.
ILLUSTRATIONEN
von Aliya Chen © Dragonsteel Entertainment, LLC
erscheinen im oder direkt nach dem aufgeführten Kapitel
Im Angesicht des Albtraums 3
Siebenunddreißig Geister 4
Suche nach Rat 5
Begegnung 8
Geistiger Wettstreit 12
Kleiderkauf 15
Die Nudelschülerin 16
Rituelles Bad 17
Malen lernen 19
Stapeln lernen 20
Meditation 22
Strahlendes Staunen 24
Malers Portfolio 27
Trost 27
Der gefestigte Albtraum 28
Im Schleier 32
Erkennen 36
Kilahitos Verteidigung 40
Wettkampf 41
Der Kleiderständer Ein weiterer Epilog
Unbezahlbar Ein weiterer Epilog
DANKSAGUNG
Lasst uns zuallererst Emily danken – der Person, der dieses Buch gewidmet ist –, dafür, dass sie sowohl meine Inspiration als auch meine Co-Präsidentin von Dragonsteel ist. Ihr wärt beeindruckt, wenn ihr wüsstet, wie viel sie hinter den Kulissen stemmt. Sie verdient Lob, Auszeichnungen und vor allem Dankbarkeit, weil sie ihr Buch (ihr lest es gerade) mit euch allen teilt.
Creative Development ist bei uns die Abteilung, die für die Illustrationen in den Büchern, die Concept-Art und viele andere coole Dinge verantwortlich ist. In dieser Abteilung möchte ich besonders Isaac StewarŤ danken – Creative Director und mein langjähriger Komplize –, der die riesige Herausforderung, die Illustrationen für die Geheimprojekte rechtzeitig zu beschaffen, gemeistert hat.
Und wenn wir schon mal dabei sind, Aliya Chen ist die Illustratorin dieses Buches und hat unglaubliche Arbeit geleistet. Mein Ziel für jedes dieser Projekte war es, den Künstler*innen besonders viel Spielraum zu lassen, damit sie die Illustrationen auf ihre Weise erschaffen konnten, und die Zusammenarbeit mit Aliya war fantastisch. Ich hoffe, dass diejenigen unter euch, die das Hörbuch hören, die Zeit finden werden, sich ihre wunderbaren Illustrationen anzuschauen.
Andere Mitarbeiter*innen dieser Abteilung umfassen Rachel Lynn Buchanan (die uns auf Aliyas Kunst aufmerksam gemacht hat), Jennifer Neal, Ben McSweeney, Hayley Lazo, Priscilla Spencer und Anna Erley.
Wir wollen darüber hinaus einigen Leuten außerhalb unseres Unternehmens danken, die uns bei diesem Projekt geholfen haben: Oriana Leckert von Kickstarter und Anna Gallagher sowie Palmer Johnson von BackerKit. Außerdem gilt Bill Wearne ein besonderer Dank, der Wunder vollbracht hat, um sicherzugehen, dass die Bücher planmäßig gedruckt werden.
Unser Lektorat wird geleitet von Peter Ahlstrom. Sein Team hat ebenfalls Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um diese vier zusätzlichen Bücher rechtzeitig fertigzustellen, und verdient dafür großen Respekt! Zu dem Team zählen Karen Ahlstrom, Kristy S. Gilbert (die das Buch gesetzt hat), Betsey Ahlstrom, Jennie Stevens, Emily Shaw-Higham. Deanna Hoak hat dieses Buch redigiert.
Unser betriebswirtschaftliches Team wird geleitet von Matt-»Du veröffentlichst wie viele Bücher dieses Jahr?«-Hatch, der genau rechtzeitig für dieses riesige Projekt zu uns gestoßen ist. Ebenfalls in dem Team sind Emma Tan-Stoker, Jane Horne, Kathleen Dorsey Sanderson, Makena Saluone, Hazel Cummings und Becky Wilson. Ihr habt dafür gesorgt, dass wir alle am gleichen Strang ziehen und das Ziel nicht aus den Augen verlieren – vielen Dank, Leute!
Die Werbe- und Marketingabteilung wird von Adam Horne verantwortet. Das sind diejenigen, die mir mit den Videos zu den Geheimprojekten geholfen haben und die eine unbezahlbare Hilfe waren, als es darum ging, die großen Neuigkeiten zu verbreiten! In Adams Team arbeiten Jeremy Palmer, Taylor D. Hatch und Octavia Escamilla. Gute Arbeit!
Zu guter Letzt möchte ich unserer Merchandise- und Veranstaltungsabteilung danken, die von Kara Stewart geleitet wird. Dieses Team hat die Wahnsinnsleistung vollbracht, die Pakete für die vier Geheimprojekte zusammenzustellen, zu verpacken und zu verschicken. Sie haben auch den Versand der digitalen Ausgaben eingeführt und kümmern sich darüber hinaus um den Kundenservice. Also, egal, welche Ausgabe ihr gekauft habt, dieses Team hat dafür gesorgt, dass sie ihren Weg zu euch findet! Einen Riesendank an die Abteilung für ihren Einsatz.
Das Team umfasst Christi Jacobsen, Lex Willhite und Kellyn Neumann.
Mem Grange, Michael Bateman, Joy Allen, Katy Ives, Richard Rubert, Brett Moore, Ally Reep, Daniel Phipps und Dallin Holden.
Alex Lyon, Jacob Chrisman, Matt Hampton, Camilla Cutler, Quinton Martin, Kitty Allen, Esther Grange, Amanda Butterfield, Laura Loveridge, Gwen Hickman, Donald Mustard III, Zoe Hatch, Logan Reep, Rachel Jacobsen und Sydney Wilson.
In meiner Schreibgruppe für dieses Buch waren Emily Sanderson, Kathleen Dorsey Sanderson, Peter Ahlstrom, Karen Ahlstrom, Darci Stone, Eric James Stone, Alan Layton, Ethan Skarstedt und Ben Olseeeen.
Alpha-Lesende für dieses Buch waren Jessie Farr, Oliver Sanderson, Rachael Lynn Buchanan, Jennifer Neal, Christi Jacobson, Kellyn Neumann, Lex Willhite, Joy Allen und Emma Tan-Stoker.
Beta-Lesende waren Joshua Harkey, Tim Challener, Lingting »Botanica« Xu, Ross Newberry, Becca Reppert, Jessica Ashcraft, Alyx Hoge, Liliana Klein, Rahul Pantula, Gary Singer, Alexis Horizon, Lyndsey Luther, Nikki Ramsay, Suzanne Musin, Marnie Peterson und Kendra Wilson.
Die Gruppe der Gamma-Lesenden bestand zum Großteil aus den Beta-Lesenden, und hinzu kamen: Brian T. Hill, Evgeni »Argent« Kirilov, Rosemary Williams, Shannon Nelson, Brandon Cole, Glen Vogelaar, Rob West, Ted Herman, Drew McCaffrey, Jessie Lake, Chris McGrath, Bob Kluttz, Sam Baskin, Kendra Alexander, Lauren McCaffrey, Billy Todd, Chana Oshira Block und Jayden King.
Und natürlich möchte ich darüber hinaus allen danken, die unsere Kickstarter-Kampagne unterstützt und damit dieses Projekt ermöglicht haben! Eure Begeisterung hat dafür gesorgt, dass es so durch die Decke gegangen ist. Vielen Dank.
Brandon Sanderson
TEILEINS
Kapitel 1
Der Stern schien besonders hell, als der Albtraummaler seine Runden begann.
Der Stern. Singular. Nein, keine Sonne. Nur ein Stern. Wie ein Einschussloch am Mitternachtshimmel, von dem ein helles Licht ausgeht.
Der Albtraummaler stand vor seinem Wohnhaus und starrte den Stern an. Er fand ihn schon immer merkwürdig, diesen Wächter am Himmel. Dennoch, er mochte ihn. Viele Nächte war er sein alleiniger Begleiter. Außer man zählte die Albträume.
Nachdem er den Stern lang genug angestarrt hatte, schlenderte der Albtraummaler die Straße hinab, die, abgesehen von dem Summen der Hion-Leitungen, vollkommen still dalag. Immer anwesend, schwebten sie in der Luft – Zwillingsbänder aus purer Energie, so dick wie das Handgelenk eines Menschen, ungefähr sechs Meter über dem Boden. Stellt sie euch vor wie zwei sehr große Drähte in der Mitte einer Glühbirne – reglos, leuchtend, ohne jegliche Unterstützung von außen.
Eine der Leitungen war ein unentschlossenes Blaugrün. Man könnte es als Aqua bezeichnen oder vielleicht auch als Ozeangrün. So oder so war es eine elektrische Variation. Der bleiche Cousin von Türkis, der immerzu Musik hörend zu Hause hockt und nie genug Sonne abbekommt.
Die andere war ein leuchtendes Fuchsia. Wenn man einer Lichtschnur eine Persönlichkeit zuschreiben könnte, dann war diese frech, ungestüm, unverhohlen. Es war eine Farbe, die man nur tragen würde, wenn man sich jedes Blickes im Raum sicher sein wollte. Ein wenig zu lila für ein strahlendes Pink, war es zumindest ein gemütliches lauwarmes Pink.
Die Einwohner der Stadt Kilahito mögen meine Erklärung unnötig finden. Warum sollte man so viel Aufwand betreiben, um etwas zu beschreiben, das jeder kennt? Es wäre, als würde man euch die Sonne beschreiben. Dennoch braucht ihr diesen Kontext, denn – kalt und warm – die Hion-Leitungen waren die Farben von Kilahito. Ohne einen Pfahl oder Draht zu benötigen, der sie hält, verliefen sie über jeder Straße, ihre Reflexionen in jedem Fenster, leuchteten sie jedem Einwohner. Fäden beider Farben, so dünn wie Draht, gingen von den Hauptleitungen ab, verliefen zu jedem Gebäude und versorgten das moderne Leben mit Strom. Sie waren die Arterien und Venen der Stadt.
Genauso wichtig für das moderne Leben der Stadt war der junge Mann, der unter ihnen langlief, obwohl seine Rolle eine ganz andere war.
Ursprünglich wurde er von seinen Eltern Nikaro genannt – doch der Tradition nach wurden viele Albtraummaler von allen, außer ihren Kollegen, nur noch mit ihrem Titel angesprochen. Nur wenige verinnerlichten den Namen so sehr wie er. Also wollen wir ihn einfach so nennen, wie auch er sich nennt: Maler.
Ihr würdet wahrscheinlich sagen, dass Maler vedisch aussah. Er wies ähnliche äußere Merkmale auf, hatte das gleiche schwarze Haar, jedoch eine hellere Haut als viele, die ihr auf Roschar finden würdet. Er wäre verwirrt über diesen Vergleich gewesen, hatte er doch noch nie von so einem Planeten gehört. Tatsächlich hatten die Bewohner Kilahitos erst vor Kurzem begonnen zu hinterfragen, ob ihr Planet der einzige im Kosmeer ist. Aber wir greifen zu weit vor.
Maler. Er war ein junger Mann, eurer Zählweise nach noch ein Jahr von seinem zwanzigsten Geburtstag entfernt. Sein Volk nutzte andere Zahlen, aber sagen wir der Einfachheit halber, dass er neunzehn war. Schlaksig, gekleidet in ein graublaues Hemd, das er nicht in die Hose steckte, und einen knielangen Mantel, gehörte er zu der Sorte, die ihre Haare so lang trugen, dass sie die Schultern berührten, weil er glaubte, dass das weniger aufwendig war. In Wirklichkeit bedeuteten sie deutlich mehr Aufwand, doch nur, wenn man es richtig machte. Er dachte auch, dass es beeindruckender aussähe. Aber auch hier kommt es darauf an, dass man es richtig macht. Er machte es nicht richtig.
Ihr könntet ihn für zu jung halten, um die Verantwortung für den Schutz der gesamten Stadt zu tragen. Aber ihr müsst wissen, dass er sich die Verantwortung mit Hunderten anderen Albtraummalern teilte. Damit war er auf die gleiche brillante, moderne Art wichtig, wie es auch Lehrer, Feuerwehrmänner und Krankenpfleger sind: essenzielle Arbeiter und Arbeiterinnen, die im Kalender schicke Tage der Wertschätzung verdienen, Worte des Lobs von jedem Politiker und gemurmelte Danksagungen von anderen Restaurantbesuchern. Tatsächlich verdrängen die Diskussionen über den so hohen Wert dieser Berufe andere profanere Gesprächsthemen. Wie zum Beispiel Gehaltserhöhungen.
Aus diesem Grund verdiente Maler nicht viel, gerade genug, um zu essen und ein wenig Taschengeld übrig zu haben. Er lebte in einer Einzimmerwohnung, die sein Arbeitgeber ihm zur Verfügung stellte. Jede Nacht zog er los, um seinen Job zu machen. Und das tat er, auch zu dieser Stunde, ohne Angst davor, ausgeraubt oder angegriffen zu werden. Kilahito war eine sichere Stadt, abgesehen von den Albträumen. Nichts verringert die Kriminalität so effektiv wie randalierende halbbewusste Wesen der Dunkelheit.
Verständlicherweise blieben die meisten Menschen nachts drinnen.
Nacht. Na ja, wir nennen es mal so. Die Zeit, wenn Menschen schlafen. Die Bevölkerung Kilahitos hat ein anderes Verständnis davon als ihr, weil sie in ständiger Dunkelheit lebt. Dennoch würdet ihr sagen, dass es sich während seiner Schichten anfühlte, als sei es Nacht. Maler ging durch leere Straßen und an überfüllten Wohnungen vorbei. Die einzige Aktivität, die er wahrnahm, kam vom Pöbelweg: eine Straße, die man, um es freundlich auszudrücken, als sehr einfaches Geschäftsviertel bezeichnen könnte. Wie zu erwarten, lag die lange, schmale Straße am Rande der Stadt. Hier wurde die Hion-Leitung verbogen und zu Schildern verformt. Diese ragten über jedem der Geschäfte heraus, wie Hände, die versuchen, auf sich aufmerksam zu machen.
Jedes Schild – Buchstaben, Bilder und Designs – wies nur zwei Farben auf, Aqua und Magenta, die in fortlaufenden Linien verliefen. Ja, in Kilahito gab es so etwas wie Glühbirnen, wie sie auf vielen Planeten üblich sind. Aber die Hion-Leitungen funktionierten unabhängig von Technik, und nie musste etwas ausgetauscht werden, deswegen verließen sich viele darauf, besonders draußen.
Bald erreichte Maler den westlichen Rand der Stadt. Das Ende der Hion-Leitungen.
Kilahito war kreisförmig angelegt, und an ihrem Rand verlief eine letzte Reihe Gebäude, die einer Stadtmauer glich. Hauptsächlich Warenhäuser ohne Fenster oder Bewohner. Dahinter verlief eine letzte Straße in einem Kreis um die Stadt. Niemand nutzte sie. Dennoch war sie da, bildete eine Art Puffer zwischen der Zivilisation und dem, was außerhalb lauerte.
Was außerhalb lauerte, war der Schleier: eine endlose, tiefe Finsternis, die die Stadt und alle auf dem Planeten belagerte.
Sie umhüllte die Stadt wie eine Kuppel, die nur von den Hion-Leitungen zurückgehalten wurde. Die Hion-Leitungen konnten auch genutzt werden, um Wege zwischen den Städten zu schaffen. Nur das Licht des Sterns durchdrang den Schleier. Bis heute bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, warum. Doch er war nahe der Stelle, wo Virtuosität sich zersplittert hatte, und ich vermute, dass das einen Einfluss darauf hatte.
Maler blickte hinaus in den Schleier und verschränkte selbstbewusst die Arme. Das war sein Reich. Hier war er der einsame Jäger. Der einzelne Wanderer. Der Mann, der die endlose Dunkelheit durchschritt, ohne Angst vor …
Zu seiner Rechten erklang ein Lachen.
Er seufzte, blickte hinüber zu den anderen Albtraummalern, die den Rand der Stadt abschritten. Akane trug einen hellgrünen Rock und eine weiße Bluse, den langen Pinsel einer Albtraummalerin wie einen Schlagstock auf der Schulter. Tojin lief neben ihr, ein junger Mann mit kräftigen Armen und flachen Gesichtszügen. Maler hatte immer gedacht, dass Tojin wie ein Gemälde war, gemalt ohne das Verständnis von Perspektive und Verzerrung. Die Arme eines Mannes konnten doch nicht so breit sein, sein Kinn nicht sokantig.
Die zwei lachten erneut über etwas, das Akane gesagt hatte. Dann sahen sie ihn dort stehen.
»Nikaro?«, rief Akane. »Hast du wieder die gleiche Schicht wie wir?«
»Ja«, sagte Maler. »Ja, ähm, das steht auch auf dem Plan … glaube ich?« Hatte er es dieses Mal tatsächlich eingetragen?
»Super!«, erwiderte sie. »Dann sehen wir uns später. Oder?«
»Äh, ja.«
Akane ging weiter, ihre Fußsohlen streiften den Stein, den Pinsel in der Hand, die Leinwand unterm Arm. Tojin zuckte kurz mit den Schultern, dann lief er ihr hinterher, seine eigenen Malutensilien verstaut in einer großen Tasche. Maler beobachtete, wie sie sich entfernten, und kämpfte gegen das Bedürfnis an, ihnen zu folgen.
Er war ein einsamer Jäger. Ein einzelner Wanderer. Ein … Einzelgänger? Dennoch wollte er nicht als Paar oder Gruppe arbeiten wie viele der anderen.
Aber es wäre schön, wenn jemand ihn fragen würde. Dann würden Akane und Tojin sehen, dass er Freunde hatte. Natürlich würde er ein solches Angebot mit stoischer Entschlossenheit ablehnen. Denn er arbeitete allein. Er war ein einzelner Jäger. Ein …
Maler seufzte. Es war schwierig, nach einer Begegnung mit Akane eine angemessene grüblerische Stimmung aufrechtzuerhalten. Besonders wenn ihr Lachen aus zwei Straßen Entfernung zu ihm herüberhallte. Für viele seiner Kollegen und Kolleginnen war Albträumezeichnen nicht so ein … ernster Job, wie er es darstellte.
Es half ihm, so darüber zu denken. Es half ihm, sich weniger wie ein Fehler zu fühlen. Besonders in diesen Zeiten, wenn er sich ein Leben vorstellte, in dem er die nächsten zehn Jahrzehnte jede Nacht auf dieser Straße verbringen würde, das Licht der Hion-Leitungen im Rücken. Allein.
Kapitel 2
Yumi hatte den Anblick des Tagsterns schon immer als ermutigend empfunden. Ein Omen des Glücks. Ein Zeichen dafür, dass der Ur-Hijo ihr gegenüber offen und einladend sein würde.
Der Tagstern schien heute besonders hell – erstrahlte in einem sanften Blau am westlichen Horizont, während die Sonne im Osten aufging. Ein kraftvolles Zeichen, wenn man an so etwas glaubte. (Ein alter Witz besagt, dass verlorene Gegenstände dazu neigen, dort aufzutauchen, wo man als Letztes nach ihnen sucht. Omen hingegen tauchen dort auf, wo man als Erstes nach ihnen sucht.)
Yumi glaubte an Zeichen. Sie musste an Zeichen glauben, denn das wichtigste Ereignis ihres Lebens war ein Omen gewesen. Während ihrer Geburt hatte ein fallender Stern den Himmel gezeichnet – was bedeutete, dass sie von den Geistern auserwählt worden war. Sie wurde ihren Eltern genommen und großgezogen, um eine heilige und wichtige Pflicht zu erfüllen.
Sie ließ sich auf dem warmen Boden ihres Wagens nieder, als ihre Dienerinnen Chaeyung und Hwanji eintraten. Sie verbeugten sich in ritueller Haltung und fütterten sie dann mit MaiPon-Stäbchen und Löffeln – eine Mahlzeit aus Reis und Eintopf, die zum Kochen auf dem Boden gestanden hatte. Yumi saß da und schluckte, niemals so unverschämt zu versuchen, selbst zu essen. Immerhin war es ein Ritual, und darin war sie Expertin.
Doch heute könnte sie nicht anders, als sich ablenken zu lassen. Neunzehn Tage waren seit ihrem neunzehnten Geburtstag vergangen.
Es war ein Tag für Entscheidungen. Ein Tag, um aktiv zu werden.
Ein Tag, um – vielleicht – nach dem zu fragen, was sie wollte?
Es waren noch hundert Tage bis zu dem großen Festival in Torio, der prächtigen Hauptstadt, dem Sitz der Königin. Dort wurden jährlich die herausragendste Kunst, die vielversprechendsten Stücke und Projekte enthüllt. Sie war noch nie dort gewesen. Vielleicht … dieses Mal …
Als ihre Dienerinnen sie fertig gefüttert hatten, stand sie auf. Sie öffneten die Tür für sie und sprangen aus ihrem persönlichen Wagen. Yumi nahm einen tiefen Atemzug, dann folgte sie ihnen. Sie trat hinaus ins Sonnenlicht und in ihre Clogs.
Ihre Dienerinnen beeilten sich, enorme Fächer hochzuhalten, um sie vor den Blicken zu verbergen. Natürlich hatten sich Bewohner der Stadt versammelt, um sie zu sehen. Die Auserwählte. Die Yoki-Hijo. Das Mädchen, das die Urgeister beschwört. (Nicht der schmissigste Titel, aber glaubt mir, in ihrer Sprache klingt er besser.)
Dieses Land – das Königreich von Torio – hätte sich nicht mehr von der Stadt unterscheiden können, in der Maler lebte. Nicht eine leuchtende Leitung – kalt oder warm – verlief am Himmel. Keine Wohnhäuser. Kein Bürgersteig. Oh, aber dafür gab es Sonnenlicht. Eine dominante rotorange Sonne, die Farbe wie gebrannter Ton. Gewaltiger und näher als eure Sonne, konnte man auf ihrer Oberfläche eindeutig variierende Farbtupfer erkennen – sie ähnelte einem kochenden Frühstückseintopf, ihre Farben brodelten am Himmel.
Die scharlachrote Sonne tauchte die Landschaft in … nun, vollkommen normale Farben. So funktioniert das Gehirn. Ist man erst ein paar Stunden dort gewesen, fällt einem gar nicht mehr auf, dass das Licht eine Nuance röter ist. Doch kommt man gerade erst an, sticht es einem geradezu ins Auge. Als wäre man Zeuge eines blutigen Massakers und alle um einen herum sind zu abgestumpft, um ihm Aufmerksamkeit zu schenken.
Hinter den Fächern verborgen lief Yumi auf ihren Clogs durch das Dorf zu der örtlichen kalten Quelle. Dort angekommen, zogen ihre Dienerinnen ihr das Nachthemd aus – eine Yoki-Hijo kleidete oder entkleidete sich niemals selbst – und ließen sie in das leicht kühle Wasser hinabsteigen, dessen überraschender Kuss sie frösteln ließ. Kurze Zeit später folgten Chaeyung und Hwanji mit einem schwebenden Tablett voller kristallener Seifen. Sie rieben sie einmal mit der ersten ein, dann wusch Yumi sie fort. Einmal mit der zweiten, dann wusch sie sie fort. Zweimal mit der dritten. Dreimal mit der vierten. Fünfmal mit der fünften. Achtmal mit der sechsten. Dreizehnmal mit der siebten.
Ihr mögt das extrem finden. Falls dem so ist, habt ihr vielleicht noch nie von Religion gehört?
Glücklicherweise hatte Yumis Art der Verehrung einige praktische Vorzüge. Die späteren Seifen waren streng genommen nur im weitesten Sinne welche – ihr würdet sie als parfümierte Cremes mit einer gewissen feuchtigkeitsspendenden Komponente bezeichnen. (Ich finde sie besonders für die Füße wunderbar, obwohl ich sie vermutlich für meinen ganzen Körper brauchen werde, wenn ich erst in der torischen Version der Hölle gelandet bin, weil ich ihre rituellen Salben zur Fußpflege verwendet habe.)
Für Yumis letzte Waschung tauchte sie unter und zählte bis einhundertvierundvierzig. Unter Wasser schwammen ihre dunklen Haare um sie herum, trieben in dem Strudel ihrer Bewegung, als wären sie lebendig. Diese rituelle Waschung sorgte dafür, dass ihre Haare durch und durch rein waren – was wichtig war, denn ihre Religion verbat es ihr, sie zu schneiden, und so reichten sie bis zu ihrer Taille.
Obwohl das Ritual nicht danach verlangte, sah Yumi gern durch das schimmernde Wasser hoch in den Himmel, auf der Suche nach der Sonne. Feuer und Wasser. Flüssigkeit und Licht.
Als sie bis einhundertvierundvierzig gezählt hatte, durchbrach sie die Wasseroberfläche und schnappte nach Luft. Das hätte mit der Zeiteigentlich leichter werden sollen. Streng genommen hättesie ruhig und gelassen auftauchen sollen, wie neugeboren. Stattdessen war sie gezwungen, gegen die Etikette zu verstoßen, indem sie ein bisschen hustete.
(Ja, für sie war Husten ein »Verstoß gegen die Etikette«. Fragt gar nicht erst, was sie von schwerwiegenderen Vergehen hielt, wie etwa davon, zu spät zu einem Ritual zu kommen.)
Nachdem das rituelle Bad abgeschlossen war, war es Zeit für das rituelle Ankleiden, ebenfalls durchgeführt durch ihre Dienerinnen. Die traditionelle Schärpe unter ihrer Brust und dann das größere weiße Tuch, das um ihre Brust gewickelt wurde. Es folgte eine lockere Leggings, dann der Tobok, in zwei Schichten dicken, bunten Stoffs, mit einem weiten Rock. Ein leuchtendes Magenta, ihre rituelle Kleidung für diesen Wochentag.
Sie schlüpfte wieder in ihre Clogs und schaffte es irgendwie, auf natürliche, elegante Weise darauf zu laufen. (Ich würde behaupten, dass ich verhältnismäßig geschickt bin, aber torische Clogs – sie nennen sie Getuk – fühlen sich an, als hätte ich mir Holzklötzchen unter die Füße geschnallt. Es ist nicht unbedingt schwierig, darauf die Balance zu halten – sie sind nur fünfzehn Zentimeter hoch –, dennoch verleihen sie den meisten Ortsfremden die würdevolle Haltung eines betrunkenen Chull.)
Damit war sie endlich bereit für … ihr nächstes Ritual. Diesmal musste sie am Dorfschrein beten, um den Segen der Geister zu erbitten. Also ließ sie sich wieder von den Fächern ihrer Dienerinnen verbergen, verließ die Quelle und lief dann drum herum zum Blumengarten des Dorfs.
Hier schwebten leuchtend blaue Blüten – sie waren becherförmig, um den Regen aufzufangen – auf thermischen Strömungen. Sie befanden sich ungefähr auf Kniehöhe. In Torio wagten es Pflanzen selten, den Boden zu berühren, aus Angst, dass die Hitze der Steine sie eingehen lassen würde. Jede Blüte war ungefähr daumenbreit, mit großen Blättern, die von der Strömung erfasst wurden – wie Lilien mit feinen herunterhängenden Wurzeln, die das Wasser aus der Luft absorbierten. Als Yumi vorbeiging, wirbelten sie umher und stießen gegeneinander.
Der Schrein war ein kleiner hölzerner Bau, an den Seiten größtenteils offen, aber mit einer gitterartigen Kuppel. Bemerkenswerterweise schwebte er ebenfalls anmutig über dem Boden – er wurde von einem einzelnen Geist gehalten, der die Form zweier Statuen angenommen hatte, die sich mit grotesken Gesichtszügen gegenüberstanden. Eine irgendwie männlich wirkende kauerte auf dem Boden, die andere hingegen – weiblich – klammerte sich an die Unterseite des Gebäudes. Obwohl sie getrennt worden waren, als sie die körperliche Form angenommen hatten, waren sie dennoch Teil des gleichen Geists.
Yumi näherte sich durch das Meer von Blumen, ihr Rock wogte in den sanften Luftströmen. Der dicke Stoff hob sich nicht so weit, dass es unangenehm hätte werden können, nur gerade genug, um seine Glockenform zu betonen. Als sie den Schrein erreichte, zog sie erneut die Clogs aus und betrat dann das kühle Holz. Er schwankte kaum, denn die Kraft des Geists hatte ihn fest im Griff.
Sie kniete sich hin und begann das erste der dreizehn rituellen Gebete. Wenn ihr jetzt denkt, dass sich meine Beschreibung ihrer Rituale gezogen hat, dann seid gewiss, dass das beabsichtigt war. Vielleicht hilft es euch – wenn auch nur ansatzweise –, Yumis Leben zu verstehen. Denn das war kein besonderer Tag gewesen, was ihre Pflichten angeht. Das war die Regel. Rituelles Essen. Rituelles Baden. Rituelles Ankleiden. Rituelles Beten. Die Liste ließe sich mühelos fortsetzen. Yumi war eine der Auserwählten. Bei ihrer Geburt auserkoren, war ihr die Gabe verliehen worden, die Hijo, die Geister zu beschwören. In ihrem Volk galt das als riesige Ehre. Und es nutzte jede Gelegenheit, um sie daran zu erinnern.
Die Gebete und die darauffolgende Meditation dauerten ungefähr eine Stunde. Als sie fertig war, sah sie zur Sonne auf, Schlitze in der Kuppel ließen Streifen aus Licht und Schatten auf sie fallen. Sie fühlte sich … glücklich. Ja, sie war sich sicher, dass das die angemessene Emotion war. Sie war mit dieser Aufgabe gesegnet, eine der wenigen Glücklichen.
Die Welt, die die Geister ihnen bescherten, war wunderbar. Die Sonne leuchtete in einem kräftigen Rotorange durch strahlend gelbe, scharlachrote und violette Wolken.
Ein Feld aus schwebenden Blumen, die erzitterten, wenn winzige Eidechsen von einer zur anderen sprangen. Der Stein darunter, warm und kraftvoll, die Quelle allen Lebens, der Wärme und des Wachstums.
Sie war Teil des Ganzen. Ein wichtiger Teil.
Das war doch sicher wunderbar.
Das war doch sicher alles, was sie je brauchen könnte.
Sie konnte doch sicher nicht mehr wollen. Selbst wenn … selbst wenn sie heute Glück haben könnte.
Selbst wenn … sie vielleicht dieses eine Mal fragen könnte?
Das Festival, dachte sie. Ich könnte es in den Kleidern eines gewöhnlichen Menschen besuchen. Einen Tag lang normal sein.
Raschelnder Stoff und das Geräusch von Holzschuhen auf Stein ließen Yumi sich umdrehen. Nur eine Person würde es wagen, sich ihr während der Meditation zu nähern: Liyun, hochgewachsen, in einem strengen schwarzen Tobok mit weißer Schleife. Liyun, ihre Kihomaban – was in etwa eine Mischung aus einer Wächterin und einer Patin ist. Wir werden der Einfachheit halber den Begriff »Wächterin« verwenden.
Liyun blieb einige Schritte vor dem Schrein stehen, die Hände hinter dem Rücken. Vordergründig kümmerte sie sich um Yumis Wohlbefinden, als Dienerin des Mädchens, das die Urgeister beschwört. (Glaubt mir, diese Bezeichnung wächst einem mit der Zeit ans Herz.) Doch selbst die Art, wie Liyun stand, hatte etwas Forderndes. Vielleicht lag es an den modischen Schuhen: Clogs mit breiten Holzsohlen unter den Zehen, aber schmalen Absätzen. Vielleicht lag es auch an ihrer Frisur: hinten kurz, vorne länger – was an den Seiten an die Form einer Klinge erinnerte. Dies war keine Frau, deren Zeit man verschwendete, auch dann nicht, wenn sie nichtgerade auf einen wartete.
Yumi stand schnell auf. »Ist es an der Zeit, Wächterin-nimi?«, fragte sie respektvoll.
Die Sprachen von Yumi und Maler hatten eine gemeinsame Wurzel, beide wiesen eine gewisse Affektiertheit auf, die ich in eurer Sprache nur schwer wiedergeben kann.
Sie konnten Sätze konjugieren oder Wörter mit Modifikatoren versehen, um Lob oder Spott auszudrücken. Interessanterweise gab es bei ihnen keine Flüche oder Schimpfwörter.
Stattdessen änderten sie einfach ein Wort in seine tiefste Form. Ich werde mein Bestes tun, um diese Nuance durch die Wörter »hoch« oder »tief« an bestimmten Schlüsselstellen zu verdeutlichen.
»Die Zeit ist noch nicht ganz gekommen, Auserwählte. Wir sollten den Ausbruch der Dampfquelle abwarten.«
Natürlich. Dann wurde die Luft erneuert; es war besser zu warten, wenn es kurz bevorstand. Aber das wiederum bedeutete, dass sie Zeit hatten. Ein paar kostbare Momente ohne vorgesehene Arbeit oder Zeremonie.
»Wächterin-nimi«, sagte Yumi (hoch) und fasste sich ein Herz. »Das Festival der Enthüllungen. Es rückt näher.«
»Nur noch hundert Tage bis dahin, ja.«
»Und es ist ein dreizehntes Jahr«, fuhr Yumi fort. »Die Hijo werden ungewöhnlich aktiv sein. Wir werden an diesem Tag vermutlich … nichts von ihnen erbitten, nehme ich an?«
»Ich denke nicht, Auserwählte, nein.« Liyun sah in dem kleinen Kalender nach, den sie in ihrer Tasche aufbewahrte. Sie blätterte ein paar Seiten um.
»Wir werden … in der Nähe von Torio-Stadt sein? Wir sind bereits in der Region gereist.«
»Und?«
»Und ich …« Yumi biss sich auf die Lippe.
»Ah …«, sagte Liyun. »Ihr würdet den Festtag gern mit einem Gebet verbringen, um den Geistern für die große Ehre zu danken, die sie Euch erwiesen haben.«
Sag es einfach, flüsterte ein Teil von ihr. Sag einfach Nein. Das ist nicht das, was du willst.
Sag es ihr.
Liyun schlug ihr Buch zu und sah Yumi eindringlich an. »Gewiss ist es das, was Ihr wollt. Ihr würdet nicht aktiv etwas tun wollen, was Eurer Stellung schaden würde. Etwas, das implizieren würde, dass Ihr Euren Stand bedauert. Würdet Ihr das, Auserwählte?«
»Niemals«, flüsterte Yumi.
»Ihr wurdet unter allen Kindern, die in Eurem Jahrgang geboren wurden, auserwählt, diese Berufung, diese Kräfte zu erhalten. Ihr seid eine von den vierzehn derzeit lebenden.«
»Ich weiß.«
»Ihr seid etwas Besonderes.«
Sie hätte es vorgezogen, weniger besonders zu sein – doch sie fühlte sich schuldig, sobald sie das gedacht hatte.
»Ich verstehe«, sagte Yumi und wappnete sich. »Warten wir nicht auf die Dampfquelle. Bitte, führt mich zum Ritualplatz. Ich kann es gar nicht erwarten, meine Pflichten zu erfüllen und die Geister zu rufen.«
Kapitel 3
Es ist beängstigend, wie sich Albträume verwandeln.
Ich spreche von gewöhnlichen Albträumen, nicht von denen, die gemalt werden. Angstträume – sie verändern sich. Sie entwickeln sich. Es ist schlimm genug, im Wachzustand etwas Furchterregendes zu erleben, aber zumindest haben diese Schrecken eine Form, eine Substanz. Etwas, das eine Form hat, kann verstanden werden. Etwas, das Substanz hat, kann zerstört werden.
Albträume sind ein fließender Schrecken. Sobald man den Hauch einer Kontrolle über sie erlangt hat, verändern sie sich. Sie füllen die Nischen der Seele wie verschüttetes Wasser die Risse im Boden. Albträume sind ein durchdringender Schauer, vom Verstand erzeugt, um sich selbst zu bestrafen. So gesehen ist ein Albtraum die Definition von Masochismus. Die meisten von uns sind so bescheiden, solche Dinge für sich zu behalten, sie zu verbergen.
In Malers Welt waren diese dunklen Stellen auffallend anfällig dafür, lebendig zu werden.
Er stand am Rande der Stadt – von hinten beleuchteten ihn radioaktives Türkis und elektrisches Magenta – und starrte in die wogende Dunkelheit. Sie hatte Substanz; sie bewegte sich, floss ähnlich wie flüssiger Teer.
Der Schleier. Die Schwärze darüber hinaus.
Formlose Albträume.
Züge fuhren die Hion-Leitungen entlang zu anderen Orten, wie die Kleinstadt, in der seine Familie noch immer lebte, nur ein paar Stunden entfernt. Er wusste, dass andere Orte existierten. Dennoch war es schwer, sich nicht isoliert zu fühlen, wenn man in diese endlose Schwärze blickte.
Sie blieb von den Hion-Leitungen fern. Meistens.
Er drehte sich um und ging ein Stück die Straße außerhalb der Stadt entlang. Zu seiner Rechten erhoben sich die äußeren Gebäude wie eine Schutzmauer, zwischen denen sich schmale Gassen wanden. Wie bereits erwähnt, handelte es sich nicht um eine echte Festung. Mauern halten keine Albträume auf, sie hindern die Menschen lediglich daran, den äußeren Bereich zu betreten.
Malers Erfahrung nach setzte nur seinesgleichen einen Fuß hier raus. Die gewöhnlichen Leute blieben drinnen; selbst eine Straße weiter fühlte man sich unendlich sicherer. Die Leute lebten wie er einst, versuchten, nicht an das zu denken, was da draußen lauerte. Brodelnd. Wogend. Beobachtend.
Mittlerweile war es seine Aufgabe, sich dem zu stellen.
Zunächst war alles unauffällig – es gab keine Anzeichen dafür, dass besonders waghalsige Albträume die Stadt bedrohten. Sie konnten jedoch äußerst subtil sein. Also setzte Maler seine Runde fort. Das ihm zugeteilte Revier glich in der Form einem Keil, der ein paar Blocks weiter im Zentrum ansetzte, doch der Großteil erstreckte sich nach draußen – wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten war, Spuren von Albträumen zu entdecken.
Während er so seine Runden ging, stellte er sich weiter vor, er wäre ein einsamer Krieger statt im Grunde nichts weiter als ein Schädlingsbekämpfer mit Kunstschulabschluss.
Zu seiner Rechten erstreckten sich die Mauermalereien. Er war sich nicht sicher, wie die anderen Künstler und Künstlerinnen auf die Idee gekommen waren, aber es hatte sich etabliert, dass sie – in langweiligen Momenten während ihrer Rundgänge – zur Übung auf die Außenwände der Stadt malten. Die Wände, die dem Schleier zugewandt waren, hatten keine Fenster, was sie zu riesigen einladenden Leinwänden machte.
Nicht unbedingt Teil des Jobs, war jedes Gemälde ein persönliches Statement. Er ging an Akanes Malerei einer ausladenden Blume vorbei. Schwarze Farbe auf der geweißten Wand. Seine eigene Mauer war zwei Gebäude weiter. Nur eine leere weiße Wand, doch wenn man ganz genau hinsah, erkannte man noch, wie das gescheiterte Projekt darunter durchschimmerte. Er entschied, sie noch mal zu weißeln. Aber nicht heute, denn schließlich entdeckte er doch noch Anzeichen eines Albtraums.
Er trat näher an den Schleier heran, berührte ihn jedoch natürlich nicht. Tatsächlich, die schwarze Oberfläche hier war von irgendetwas gestört worden. Wie Farbe, die, noch nicht ganz trocken, angefasst worden war, sie war … aufgewühlt, in Wallung geraten. Es war schwierig zu erkennen, weil der Schleier kein Licht reflektierte, im Gegensatz zu Tinte oder Teer, dem er ansonsten so sehr glich. Doch Maler war gut ausgebildet.
Hier war etwas aus dem Schleier getreten und hatte sich auf den Weg in die Stadt gemacht. Er holte seinen Pinsel aus der großen Malertasche, ein Werkzeug, so lang wie ein Schwert. Mit dem Pinsel in der Hand fühlte er sich besser. Er schob die Umhängetasche wieder auf den Rücken und spürte das Gewicht der Leinwände und des Tintenfasses darin. Dann machte er sich auf den Weg nach innen – vorbei an der weißen Wand, die sein jüngstes Versagen verbarg.
Er hatte es viermal versucht. Bei diesem letzten Versuch war er weitergekommen als bei den vorherigen. Das Gemälde des Sterns, das er begonnen hatte, nachdem er die Neuigkeiten von der geplanten Reise durch die Finsternis des Himmels gehört hatte. Ein Trip zu dem Stern selbst, den Wissenschaftler mit einem besonderen Schiff und einem Paar Hion-Leitungen bewältigen wollten, die sich über eine unglaubliche Distanz erstreckten.
So hatte Maler etwas Interessantes gelernt. Im Gegensatz zu dem, was alle einst angenommen hatten, war der Stern nicht nur ein Lichtpunkt am Himmel. Teleskope hatten offenbart, dass es ein Planet war – ihren Vermutungen nach belebt von anderen Menschen. Ein Ort, dessen Licht auf wundersame Weise durch den Schleier drang.
Diese Neuigkeiten über die bevorstehende Reise hatten ihn kurzzeitig inspiriert. Doch dann war der Funke erloschen und das Gemälde wieder zum Erliegen gekommen. Wie lange war es her, dass er es übermalt hatte? Mindestens einen Monat.
In der Ecke der Wand, nahe dem Gemälde, entdeckte er eine dampfende Schwärze. Der Albtraum war hier vorbeigekommen, hatte den Stein gestreift und dabei etwas zurückgelassen, das langsam verdunstete und in schwarzen Ranken in die Luft stieg. Er hatte vermutet, dass der Albtraum diesen Weg gewählt hatte, sie suchten sich fast immer den direktesten Weg in die Stadt. Es war dennoch gut, auf Nummer sicher zu gehen.
Maler schlich sich näher heran, begab sich wieder in den Schein der zwei Hion-Leitungen. Irgendwo rechts von ihm erklang ein Lachen, doch sein Albtraum war vermutlich nicht in diese Richtung gegangen. In den Vergnügungsdistrikt gingen die Menschen, um alles andere zu tun, als zu schlafen.
Da, dachte er, als er schwarze Schwaden entdeckte, die aus einem Blumentopf aufstiegen. Der Strauch wuchs nahe den Hion-Leitungen und ihrem nährenden Licht. Als Maler der verlassenen Straße folgte, wirkte es deswegen so, als hätten die Pflanzen links und rechts von ihm ihre Arme in stillem Gruß erhoben.
Die nächste Spur fand er neben einer Gasse. Ein richtiger Fußabdruck, schwarz, dunkler Dampf stieg davon auf. Der Albtraum hatte begonnen, sich zu verwandeln, menschliche Gedanken wahrzunehmen, von einer undefinierten Schwärze in etwas mit Form überzugehen. Zuerst nur eine vage Gestalt, doch statt ein schwebendes, fließendes Etwas zu sein, hatte es jetzt vermutlich Füße. Selbst in der Form hinterließen sie selten Fußabdrücke, er hatte also Glück, einen gefunden zu haben.
Er betrat eine dunklere Straße, wo die Hion-Leitungen über ihm dünner waren. Von Schatten umgeben, erinnerte er sich an die ersten Tage, die er allein gearbeitet hatte. Trotz umfassenden Trainings, trotz der drei Maler, die ihm als Mentoren gedient hatten, hatte er sich ausgeliefert und verletzlich gefühlt – wie eine Schürfwunde, die der Luft ausgesetzt wird, seine Emotionen und Ängste nah an der Oberfläche.
Mittlerweile war die Angst tief unter den Narben der Erfahrung verborgen. Dennoch umklammerte er seine Tasche fest mit einer Hand und hielt den Pinsel vor sich ausgestreckt, während er weiterschlich. Dort an der Wand war ein Handabdruck mit zu langen Fingern und so etwas wie Krallen. Ja, der Albtraum nahm wirklich Gestalt an. Seine Beute musste ganz in der Nähe sein.
Weiter hinten in der schmalen Gasse, an einer kahlen Wand, fand er den Albtraum: ein Wesen aus Tinte und Schatten, etwa zwei Meter groß. Es hatte zwei lange Arme, mit zu vielen Beugungen, die länglichen Handflächen pressten sich gegen die Wand, die Finger gespreizt. Sein Kopf war durch den Stein gedrungen, um in das Zimmer dahinter zu spähen.
Die Großen machten ihn immer nervös, besonders wenn sie lange Finger hatten. Er hatte das Gefühl, solche Gestalten schon in seinen eigenen bruchstückhaften Träumen gesehen zu haben – Fantasiegebilde des Schreckens, die tief in ihm verborgen waren. Seine Füße knirschten auf dem Stein, woraufhin das Wesen den Kopf zurückzog und Schwaden formloser Schwärze wie Asche aus einem schwelenden Feuer aufstiegen.
Doch es hatte kein Gesicht. Sie hatten nie Gesichter – es sei denn, etwas lief völlig schief. Stattdessen war die Vorderseite ihres Kopfs meist von einem noch tieferen Schwarz. Aus diesem Schwarz tropfte eine dunkle Flüssigkeit. Wie Tränen oder Wachs, wenn er einer Flamme zu nahe kommt.
Maler setzte sofort seine mentalen Schutzmechanismen ein und dachte an etwas Ruhiges. Das war die erste und wichtigste Übung. Die Albträume konnten, wie viele Jäger, die sich von Gedanken ernährten, Gedanken und Emotionen spüren. Sie suchten nach den stärksten und rohsten, um sich daran zu laben.
Ein ruhiger Geist war von geringem Interesse.
Das Ding drehte sich um und stieß seinen Kopf erneut durch die Wand. Das Gebäude hatte keine Fenster, was dumm war. Wände hielten Albträume nicht auf. Indem sie die Fenster entfernten, schlossen sich die Bewohner nur selbst in ihren Häusern ein, was ihre Klaustrophobie verstärkte – und die Arbeit der Maler erschwerte.
Maler bewegte sich langsam und vorsichtig und holte eine Leinwand – ein gutes neunzig mal neunzig Zentimeter großes Stück dicken Stoffs auf einem Rahmen – aus seiner Umhängetasche. Er legte sie vor sich auf den Boden. Dann zog er ein Tintenfass hervor – schwarze, flüssige Tinte. Albtraummaler arbeiteten immer in Schwarz auf Weiß, ohne Farben, da man etwas schaffen wollte, das dem Aussehen eines Albtraums ähnelte.
Die Tintenmischung sollte für hervorragende Abstufungen in Grau und Schwarz sorgen. Nicht dass Maler sich in diesen Tagen noch um so viele Nuancen bemühte.
Er tauchte den Pinsel in die Tinte und kniete sich über die Leinwand, dann hielt er inne und starrte den Albtraum an. Die Schwärze dampfte weiterhin von ihm ab, seine Form war noch immer ziemlich undeutlich. Es war wahrscheinlich sein erster oder zweiter Ausflug in die Stadt. Erst nach einem guten Dutzend Ausflügen hatte ein Albtraum genug Substanz, um gefährlich zu sein – und sie mussten jedes Mal zum Schleier zurückkehren, um ihn zu stärken, damit er nicht verdunstete.
Seinem Aussehen nach zu urteilen, war dieser Albtraum noch recht jung. Vermutlich konnte er ihm nichts anhaben.
Vermutlich.
Und genau das war der Grund, warum Maler so wichtig und doch so entbehrlich waren. Ihre Arbeit war zwar unentbehrlich, aber nicht dringend. Solange ein Albtraum während seiner ersten zehn Besuche in der Stadt entdeckt wurde, konnte er gestoppt werden. Das passierte fast immer.
Diese Gedanken halfen Maler, seine Angst unter Kontrolle zu halten. Das war Teil seiner Ausbildung gewesen – überaus pragmatisch. Sobald sich seine Atmung beruhigt hatte, versuchte er, sich vorzustellen, wie der Albtraum aussah, welche Form er gehabt haben könnte. Angeblich hatte man mehr Macht darüber, wenn man etwas malte, das ihm ähnelte. Das bereitete ihm Probleme. Oder besser gesagt hatte es sich in den letzten Monaten so angefühlt, als wäre es die Mühe nicht wert gewesen.
Also entschied er sich heute für die Form eines kleinen Bambusdickichts und begann zu malen. Das Ding hatte schließlich spindeldürre Arme. In gewisser Weise sahen sie aus wie Bambus.
Er hatte bereits zahlreiche Bambusstängel gemalt. Man könnte sogar sagen, dass Maler eine gewisse wissenschaftliche Präzision an den Tag legte, wenn er die einzelnen Segmente zeichnete – ein kleiner seitlicher Pinselstrich zu Beginn, gefolgt von einer langen Linie. Dann ließ er den Pinsel einen Moment lang verweilen, sodass der Klecks, den der Pinsel hinterließ, das Ende des Bambussegments bildete, wenn er ihn wieder anhob. Jedes Segment brauchte nur einen einzigen Pinselstrich.
Das war effizient, was ihm dieser Tage am wichtigsten erschien.
Während er malte, fixierte er die Form in seinem Geist – ein zentrales, kraftvolles Bild. Wie üblich zog dieses bewusste Denken die Aufmerksamkeit des Wesens auf sich. Es zögerte, dann zog es den Kopf aus der Wand und wandte sich ihm zu, wobei ihm die eigene Tinte noch immer vom Gesicht tropfte.
Langsam näherte es sich, auf seinen Armen laufend, die jedoch runder geworden waren. Mit knubbeligen Segmenten.
Maler arbeitete weiter. Strich. Schwung. Blätter, die mit schnellen Pinselstrichen entstanden, dunkler als der Hauptkörper des Bambus. Ähnliche Auswüchse erschienen auf den Armen des Wesens, als es näher kam. Als er unten einen Topf malte, schrumpfte es in sich zusammen.
Das Bild bannte die Kreatur. Lenkte sie ab. Sodass sie, als sie ihn erreichte, vollständig verwandelt war.
Mittlerweile verlor er sich nicht mehr in seinen Bildern. Schließlich, sagte er sich, hatte er einen Job zu erledigen. Und diesen Job erledigte er gut. Als er fertig war, imitierte der Albtraum sogar die Geräusche von Bambus – das leise Rascheln der Stängel, die aneinanderklapperten – und begleitete damit das allgegenwärtige Summen der Hion-Leitungen über ihm.
Er hob den Pinsel von der Leinwand und blickte auf ein perfektes Bambusgemälde, von dem Wesen in der Gasse nachgeahmt, das mit den Blättern an den Wänden raschelte. Dann, mit einem Geräusch, das einem Seufzer ähnelte, löste sich der Albtraum auf. Er hatte ihn absichtlich in eine harmlose Form verwandelt – und nun, da er gefangen war, konnte er nicht mehr zum Schleier fliehen, um neue Kraft zu schöpfen. Stattdessen … verdunstete er einfach wie Wasser auf einer heißen Herdplatte.
Schon bald fand sich Maler allein in der Gasse wieder. Er packte seine Sachen und schob die Leinwand zusammen mit drei leeren Leinwänden in die große Tasche. Dann setzte er seinen Rundgang fort.
Kapitel 4
Die örtliche Dampfquelle brach genau in dem Moment aus, als Yumi – in sicherer Entfernung – auf dem Weg zum Ritualplatz daran vorbeikam.
Ein gewaltiger Wasserstrahl schoss aus dem Loch in der Mitte des Dorfs. Eine wütende, überhitzte Kaskade, die eine Höhe von zwölf Metern erreichte – ein Geschenk der Geister tief unter der Erde. Dieses Wasser war lebenswichtig; Regen war in Torio selten, und Flüsse … nun, man kann sich vorstellen, was der überhitzte Boden mit potenziellen Flüssen anstellte. Wasser war in Yumis Land nicht unbedingt selten, aber es war konzentriert, zentralisiert, erhaben.
Die Luft nahe der Dampfquellen war feucht und nährte die umherschwirrenden Pflanzen und andere Lebewesen. Über den Dampfquellen bildeten sich oft Wolken, die Schatten spendeten und gelegentlich Regen brachten. Das Wasser, das nicht als Dampf entwich, regnete auf große Bronzetabletts, die in sechs konzentrischen Ringen um den Geysir aufgestellt waren. Um sie kühl zu halten, waren sie erhöht, das Wasser floss durch Metalltrichter den Hang zu den nahe gelegenen Häusern hinab. In der Stadt gab es etwa sechzig davon – und noch Raum für mehr, wenn man bedenkt, wie viel Wasser die Dampfquellen lieferten.
Die Häuser waren natürlich weit genug davon entfernt errichtet worden. Dampfquellen waren in dieser Gegend lebenswichtig, aber man sollte sich besser nicht allzu eng mit ihnen anfreunden. Weiter außerhalb der Stadt erstreckte sich das sengende Ödland. Brachland, in dem der Boden selbst für Pflanzen zu heiß war. Der Stein dort konnte Holzschuhe in Brand setzen und Reisende töten, die zu lange dort verweilten. In Torio reiste man nur bei Nacht und nur in schwebenden Wagen, die von fliegenden Geräten gezogen wurden, die von den Geistern erschaffen waren. Es ist überflüssig zu erwähnen, dass die meisten Menschen einfach zu Hause blieben.
Das laute Prasseln der Tropfen auf die Metallschüsseln übertönte das Gemurmel der zuschauenden Menge. Nachdem das Bad beendet und die Gebete gesprochen waren, durfte Yumi nun offiziell bestaunt werden, und so folgten ihre Dienerinnen ihr mit heruntergelassenen Fächern.
Sie hielt den Blick gesenkt und ging geübten Schrittes – eine Yoki-Hijo muss gleiten, als wäre sie ein Geist. Sie war froh über das Geräusch der Dampfquelle, denn obwohl sie es nicht wagte, sich von dem ehrfürchtigen Flüstern und Murmeln beirren zu lassen, überwältigte es sie manchmal. Sie rief sich schnell ins Gedächtnis, dass die Ehrfurcht der Menschen nicht wirklich ihr galt, sondern ihrer Berufung. Sie musste sich daran erinnern, dass sie nicht um ihrer selbst willen verehrt wurde, sondern wegen ihrer Bestimmung. Sie musste Stolz verbannen und bescheiden bleiben. Sie musste auf jeden Fall alles vermeiden, was unangemessen sein könnte – wie zum Beispiel lächeln. Aus Respekt vor ihrer Berufung.
Die Berufung hingegen merkte von alldem nichts. Wie es vieles so an sich hat, was die Menschen verehren.
Sie kam an Häusern vorbei, von denen die meisten zweistöckig waren: Ein Teil war auf dem Boden gebaut, um von der Hitze zu profitieren. Ein anderer Teil auf Stelzen mit Luft darunter, um ihn kühler zu halten. Stellt euch zwei große Blumenkästen vor, die aneinandergebaut sind, einer davon einen Meter erhöht, der andere direkt auf dem Boden. Die meisten von ihnen hatten einen oder zwei stämmige Bäume – gut zwei Meter hoch von den breiten, verflochtenen Wurzeln bis zu den Spitzen ihrer Äste – an sie gekettet, die in ein paar Metern Höhe in den thermischen Strömungen schwebten.
Leichtere Pflanzen flogen hoch oben am Himmel und warfen die unterschiedlichsten Schatten. Tagsüber fand man niedriger schwebende Pflanzen nur in Gärten, wo der Boden kühler war. Und an Orten, an denen Menschen dafür sorgten, dass sie in der Nähe blieben und nicht wegflogen oder weggetrieben wurden. Torio ist das einzige Land, von dem ich je gehört habe, in dem es Baumdiebe gibt.
(Ja, die Thermik ist nicht allein für das Fliegen verantwortlich. Selbst in Torio sind die Bäume aus schwerem Holz. Es bedarf also spezieller lokaler Anpassungen, um zu schweben. Aber darauf werden wir jetzt nicht näher eingehen.)
Am anderen Ende der Stadt befand sich der Kimomakkin oder – wie wir ihn in dieser Geschichte nennen – der Ritualplatz. Ein Dorf hatte in der Regel nur einen, damit die Geister nicht eifersüchtig aufeinander wurden. In der Nähe schwebten ein paar Blumen, und als Yumi eintrat, wurden sie aufgewirbelt und kreisten umher. Sie schossen sofort hoch in den Himmel. Am Ritualplatz war der Stein besonders heiß, wenn auch nicht annähernd so sehr wie im Umland.
(Falls ihr jemals auf den Inseln von Reschi wart, wenn an hellen, schwülen Sommertagen der Sand die Strände säumt, habt ihr vielleicht eine ungefähre Vorstellung. Die Steine dort fühlten sich an, als würde man an einem besonders sonnigen Tag über diesen Sandstrand laufen. Heiß genug, um wehzutun, aber nicht so heiß, dass es tödlich wäre.)
In Torio war Hitze heilig. Die Bewohner versammelten sich außerhalb des Zauns, ihre Clogs schabten über den Stein, Eltern hoben ihre Kinder hoch. Drei örtliche Geisterbeschwörer ließen sich auf erhöhten Hockern nieder, um Lieder zu singen, die, soweit ich das beurteilen kann, von den Geistern unbemerkt blieben. (Trotzdem bin ich froh, dass es diesen Job gibt. Alles, um mehr Musiker in Lohn und Brot zu bringen. Es ist nicht so, als könnten wir nichts anderes tun; es ist eher so, dass wir, wenn wir nichts Produktives zu tun haben, anfangen, Fragen zu stellen wie: »Hey, warum beten sie eigentlich nicht mich an?«)
Alle warteten außerhalb des kleinen umzäunten Bereichs, auch Liyun. Die Musik erklang: rhythmischer Gesang, begleitet von den Klängen der Paddeltrommeln und einer Flöte im Hintergrund, und er wurde immer lauter, als die Quelle sich erleichterte und dann in den Schlaf taumelte.
Auf dem Ritualplatz war nur Yumi.
Die Geister tief unter der Erde.
Und jede Menge Steine.
Die Stadtbewohner hatten Monate damit verbracht, sie zu sammeln und an dem Ort zu verteilen, um dann darüber zu beraten, welche die schönste Form hatten. Ihr denkt vielleicht, dass eure Hobbys langweilig sind und dass die Dinge, zu denen euch eure Eltern früher gezwungen haben, nervtötend waren, aber zumindest habt ihr eure Tage nicht damit verbracht, voller Begeisterung Gesteinsformen zu beurteilen.
Yumi zog sich ein Paar Knieschoner an, ließ sich dann zwischen den Steinen nieder und breitete ihre Röcke aus, die sich in der Thermik aufblähten und wogten. Für gewöhnlich wollte man seine Haut hier nicht so nah am Boden haben. Das Knien hatte an diesem Ort etwas beinahe Intimes. Die Geister versammelten sich an warmen Orten. Oder besser gesagt, Wärme war ein Zeichen dafür, dass sie in der Nähe waren.
Noch waren sie unsichtbar. Man musste sie erst hervorlocken – doch sie kamen nicht auf das bloße Rufen eines beliebigen Menschen. Man brauchte jemanden wie Yumi. Man brauchte ein Mädchen, das die Geister beschwören konnte. Es gab viele geeignete Methoden, aber sie alle hatten eines gemeinsam: Kreativität. Die meisten bewusstseinsfähigen investierten Wesen – ob sie nun als Feen, Seonen oder Geister bezeichnet werden – reagieren auf die eine oder andere Weise auf diesen wesentlichen Aspekt der menschlichen Natur.
Etwas aus nichts. Schöpfung.
Schönheit aus Rohstoffen. Kunst.
Ordnung aus Chaos. Organisation.
Oder in diesem Falle alle drei auf einmal. Jede Yoki-Hijo wurde in einer uralten und mächtigen Kunst ausgebildet. Eine wohlüberlegte, wundersame Kunstfertigkeit, die die volle Synergie von Körper und Geist erforderte. Geologische Umstrukturierungen im Mikrobereich, die ein akutes Verständnis des Gravitationsgleichgewichts voraussetzten.
Mit anderen Worten: Sie stapelten Steine aufeinander.
Yumi wählte einen Stein mit interessanter Form aus, balancierte ihn vorsichtig auf der Spitze und zog dann die Hände weg. Der Stein blieb stehen – hochkant und so, als sollte er eigentlich jeden Moment umfallen. Die Menge hielt den Atem an, obwohl nichts Okkultes oder Mystisches zu sehen war. Diese Kunst war das Produkt von Instinkt und Übung. Sie legte einen zweiten Stein auf den ersten und dann zwei weitere Steine auf den zweiten – und balancierte sie in einer Weise gegeneinander aus, die unmöglich erschien. Die gegensätzlichen Steine – einer neigte sich nach rechts, der andere ruhte in einem gefährlichen Winkel auf seiner linken Spitze – blieben an ihrem Platz, als Yumi sie losließ.
Es war eine bewusste Ehrerbietung, wie sie die Steine positionierte – sie schien sie für einen Moment zu halten und sie zu beruhigen wie eine Mutter ihr schlafendes Kind. Dann zog sie ihre Hände zurück und ließ die Steine so stehen, als würde ein einziger Windstoß ausreichen, sie umzuwerfen. Es war keine Magie. Aber es war zweifellos magisch.
Die Menge war begeistert. Falls ihr die Faszination der Leute seltsam findet, nun … ich würde nicht widersprechen. Es ist durchaus ein wenig seltsam. Nicht nur das Balancieren selbst, sondern auch die Art, wie ihr Volk die Darbietungen und Kreationen der Yoki-Hijo als die bedeutendsten künstlerischen Leistungen überhaupt betrachtete.
Andererseits ist Kunst grundsätzlich nichts, was einen inhärenten Wert hätte. Das soll keine Kritik oder Abwertung sein. Das ist einer der wunderbarsten Aspekte von Kunst – die Tatsache, dass die Menschen selbst entscheiden, was schön ist.
Wir können nicht bestimmen, was Essen ist und was nicht. (Ja, es gibt Ausnahmen. Seid nicht so kleinkariert. Wenn ihr die Murmeln wieder ausscheidet, werden wir alle lachen.) Aber wir können durchaus bestimmen, was als Kunst gilt.
Wenn Yumis Volk also behauptete, dass Steinanordnungen Gemälde und Skulpturen als künstlerische Schöpfung übertreffen … nun, ich persönlich finde das faszinierend.
Und die Geister stimmten zu.
Heute schuf Yumi eine Spirale, wobei sie ihr die Künstlerfolge als eine Art lockere Struktur zugrunde legte. Ihr kennt sie vielleicht unter einem anderen Namen.
Eins, eins, zwei, drei, fünf, acht, dreizehn, einundzwanzig, vierunddreißig. Dann wieder runter. Die Türme aus zwanzig oder dreißig Steinen hätten am eindrucksvollsten sein sollen – und tatsächlich ist es unglaublich, wie gut sie sie stapeln konnte. Doch sie fand Wege, um die Türme aus fünf oder drei Steinen genauso beeindruckend wirken zu lassen. Ungleiche Kombinationen aus winzigen Steinen, auf denen riesige Steine balancierten. Schindelmuster aus Steinen, längliche Steine, die gefährlich weit an den Seiten herausragten. Steine, die so lang wie ihr Unterarm waren, balancierten auf ihren schmalsten Spitzen.
Aufgrund der mathematischen Beschreibung und der Künstlerfolge könnte man annehmen, dass der Prozess methodisch und kalkuliert war. Doch es wirkte eher wie eine organische Improvisation als wie eine technische Meisterleistung. Yumi wiegte sich im Takt der Trommeln, während sie die Steine stapelte. Sie schloss die Augen und ließ den Kopf von einer Seite zur anderen wandern, spürte, wie die Steine unter ihren Fingern knirschten. Sie beurteilte ihr Gewicht und die Art, wie sie sich neigten.
Yumi wollte die Aufgabe nicht einfach nur erledigen. Sie wollte nicht nur eine überzeugende Darbietung für das raunende, begeisterte Publikum abliefern. Sie wollte sich würdig erweisen. Sie wollte die Geister spüren und wissen, was sie von ihr erwarteten.
Sie hatte das Gefühl, dass sie etwas Besseres verdient hatten als sie. Jemanden, der mehr leistete als sie selbst in ihren besten Zeiten. Jemanden, der sich nicht insgeheim nach Freiheit sehnte. Jemanden, der das unglaubliche Geschenk, das ihm gemacht worden war, nicht tief im Inneren ablehnte.
Über die nächsten Stunden wuchs die Skulptur zu einer prächtigen Spirale aus Dutzenden Türmen an. Yumi hielt länger durch als die trommelnden Frauen, die nach etwa zwei Stunden erschöpft zusammenbrachen. Sie machte weiter, als die Zuschauenden ihre Kinder nach Hause ins Bett brachten oder sich zum Essen zurückzogen. Sie machte so lange weiter, bis Liyun sich schließlich kurz entschuldigen musste, um die Toilette aufzusuchen, und dann schnell wieder zurückkam.
Die Umstehenden konnten die Skulptur natürlich bewundern. Aber am besten konnte man sie von oben sehen. Oder von unten. Stellt euch einen großen Strudel aus aufgetürmten Steinen vor, der das Gefühl von wehendem Wind vermittelt, spiralförmig und doch vollständig aus Stein. Ordnung aus Chaos. Schönheit aus Rohstoffen. Etwas aus nichts. Die Geister bemerkten es.
Und zwar in Rekordzahlen.
Während Yumi trotz aufgeschürfter Finger und schmerzender Muskeln weiterarbeitete, begannen die Geister aus den Steinen unter ihr aufzusteigen. Sie hatten die Form von Tränen, leuchteten wie die Sonne – in einem wirbelnden Rot und Blau – und waren kopfgroß. Nach und nach tauchten sie auf und ließen sich neben Yumi nieder, wo sie ihr Werk wie gebannt verfolgten. Sie hatten keine Augen – sie waren kaum mehr als Kleckse –, doch sie konnten zusehen. Oder es zumindest spüren.
Geister dieser Art finden menschliche Schöpfungen faszinierend. Und weil sie diese Skulptur geschaffen hatte – weil sie war, wer sie war –, wussten sie, dass diese Schöpfung eine Gabe war. Als der Tag langsam zur Neige ging und die Pflanzen aus den oberen Schichten des Himmels herabtrudelten, wurde Yumi schließlich träger. Inzwischen waren ihre Finger blutig, die Schwielen von den immer gleichen Bewegungen abgeschürft. Erst schmerzten ihre Arme, dann wurden sie taub, dann schmerzten sie und waren taub zugleich.
Es war Zeit für den nächsten Schritt. Sie konnte sich nicht den kindischen Fehler leisten, den sie in ihren frühen Jahren begangen hatte: so hart zu arbeiten, dass sie bewusstlos zusammenbrach, bevor sie die Geister binden konnte. Es ging nicht nur darum, die Skulptur zu erschaffen oder eine fromme Darbietung zu liefern. Wie das Kleingedruckte in einem Vertrag war auch die Kunst dieses Tages auf gewisse Weise etwas Zweckmäßiges.
Yumi war zu erschöpft, um zu stehen, und wandte sich von ihrer Kreation ab, die aus Hunderten von Steinen bestand. Dann blinzelte sie und zählte die Geister, die sie in all ihrer Pracht umgaben – tatsächlich sahen sie ein bisschen aus wie übergroße Eiskugeln, die aus der Waffel gefallen waren.
Siebenunddreißig.
Sie hatte siebenunddreißig Geister beschworen.
Die meisten Yoki-Hijo hatten Glück, wenn sie sechs Geister beschworen. Ihr bisheriger Rekord lag bei zwanzig.
Yumi wischte sich den Schweiß von der Stirn und zählte dann mit verschwommenem Blick weiter. Sie war müde. So (tief) müde.
»Schickt den ersten Bittsteller vor«, sagte sie mit krächzender Stimme.
Die Menge war außer sich vor Aufregung, und die Menschen rannten los, um Freunde oder Familienmitglieder zu holen, die während der vielen Stunden des Skulpturenbaus ausgeschieden waren. In der Stadt wurde eine strenge Rangfolge der Bedürfnisse eingehalten, die nach Yumi unbekannten Methoden festgelegt wurde. Die Bittsteller wurden vor ihr in einer Schlange aufgestellt, wobei die fünf oder sechs Glücklichen ganz vorne so gut wie sicher drankamen.
Diejenigen, die weiter hinten standen, mussten in der Regel auf einen weiteren Besuch warten, um ihre Anliegen vorzubringen. Da die Geister meistens fünf bis zehn Jahre gebunden blieben – wobei ihre Wirksamkeit ungefähr nach der Hälfte der Zeit nachließ –, bestand immer ein großer Bedarf an den Diensten der Yoki-Hijo. Heute zum Beispiel hatte der Tag mit dreiundzwanzig Namen auf der Liste begonnen, obwohl man nur mit einem halben Dutzend Geistern gerechnet hatte.
Wie man sich vorstellen kann, waren die Mitglieder des Stadtrats mit Feuereifer dabei, die restlichen Namen auf der Liste zu ergänzen. Yumi war sich dessen nicht bewusst. Sie kniete sich lediglich vor den Ritualplatz, senkte den Kopf und versuchte, nicht seitlich auf die Steine zu kippen.
Liyun ließ den ersten Bittsteller vortreten, einen Mann, dessen Kopf ein wenig zu weit vorne auf seinem Hals saß, wie ein Bild, das in zwei Hälften geschnitten und dann nachlässig zusammengeklebt worden war. »Gesegnete Geisterbeschwörerin«, sagte er und wrang seine Mütze in den Händen, »wir brauchen Licht für unser Haus. Wir haben seit sechs Jahren keines mehr.«
Sechs Jahre? Ohne Licht in der Nacht? Plötzlich fühlte sich Yumi noch egoistischer, weil sie versucht hatte, ihren Pflichten zu entkommen. »Es tut mir leid«, flüsterte sie zurück, »dass ich dich und deine Familie all die Jahre im Stich gelassen habe.«
»Ihr habt uns nicht …« Der Mann brach ab. Es war nicht angemessen, einer Yoki-Hijo zu widersprechen. Selbst wenn es ein Kompliment war.
Yumi wandte sich dem ersten Geist zu, der sich neugierig neben sie schob. »Licht«, sagte sie. »Bitte. Im Austausch für dieses Geschenk von mir, würdet ihr uns Licht geben?« Gleichzeitig projizierte sie die richtige Vorstellung. Von einer flammenden Sonne, die zu einer handlichen glühenden Kugel wurde.
»Licht«, wiederholte der Geist. »Ja.«
Der Mann wartete gespannt, während der Geist erzitterte und sich dann in zwei Hälften teilte – eine Seite leuchtete hell in einem freundlichen Orange, die andere wurde zu einer trüben blauen Kugel, die so dunkel war, dass sie besonders in der Dämmerung mit Schwarz verwechselt werden konnte.
Yumi reichte dem Mann die beiden Kugeln, die jeweils in eine Handfläche passten. Er verbeugte sich und zog sich zurück.
Die Nächste in der Reihe bat um ein Abstoßungspaar, wie es auf der Gartenveranda verwendet wurde, um ihre kleine Molkerei in die Luft zu heben, damit sie kühler blieb und sie Butter herstellen konnte. Yumi kam der Bitte nach und überredete den nächsten Geist in der Reihe, sich in zwei gedrungene Statuen mit verzerrten Gesichtszügen zu teilen.
Jeder Wunsch wurde der Reihe nach erfüllt. Es war Jahre her, dass Yumi versehentlich einen Geist verwirrt oder verängstigt hatte – doch das wussten die Menschen nicht, und so warteten sie in besorgter Spannung, hatten Angst, dass ihr Wunsch der sein könnte, bei dem der Geist sich abwenden würde.
Das passierte nicht, obwohl die Erfüllung jeder Bitte mehr Zeit in Anspruch nahm und auch die Geister immer mehr Überzeugungsarbeit bedurften, da Yumis Darbietung mit der Zeit an Wirkung verlor. Außerdem kostete sie jede Bitte … etwas. Etwas, das sich nach einer Weile wieder erholte, aber in dem Moment ein Gefühl der Leere hinterließ. Wie ein Glas Zitronentee, das Löffel für Löffel getrunken wird.
Einige wollten Licht. Andere wollten Abwehrvorrichtungen. Die Mehrheit wollte Flieger – schwebende Geräte mit einer Spannweite von etwa sechzig Zentimetern. Diese konnten tagsüber zur Feldpflege eingesetzt werden, wenn die Pflanzen außerhalb der Reichweite der Bauern waren und stattdessen von den großen Krähen des Dorfs bewacht wurden. Doch es gab einige Bedrohungen, mit denen die Krähen nicht fertigwurden, sodass Flieger für die meisten Siedlungen eine Notwendigkeit waren. Wie immer spaltete sich der Geist in zwei Teile, um die Geräte herzustellen – in diesem Fall in eine Maschine mit großen Insektenflügeln und ein Handgerät, mit dem sie vom Boden aus gesteuert werden konnte.
Im Grunde konnte man aus einem Geist alles machen, vorausgesetzt, er war dazu bereit und man formulierte die Bitte richtig. Für das torische Volk war es so natürlich – und so üblich –, einen Geist als Lichtquelle zu verwenden, wie es für euch Kugeln sind und für andere Welten Kerzen oder Laternen. Man könnte das torische Volk für verschwenderisch halten, was die ihnen gewährte große kosmische Kraft angeht, aber ihr Land war rau, und ihr Boden konnte Wasser buchstäblich zum Kochen bringen. Man muss ihnen verzeihen, dass sie die Ressourcen, die ihnen zur Verfügung standen, nutzten.