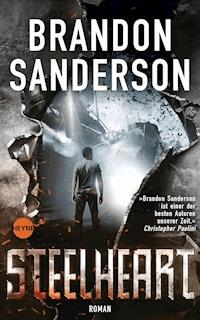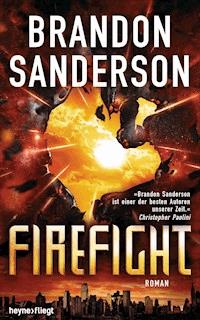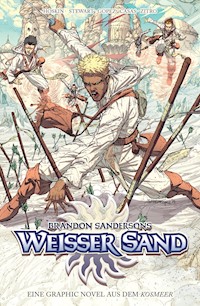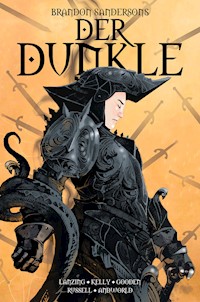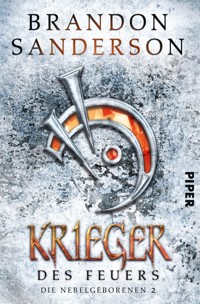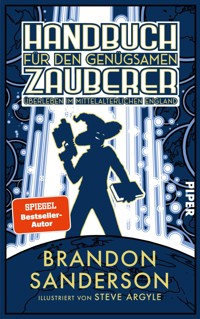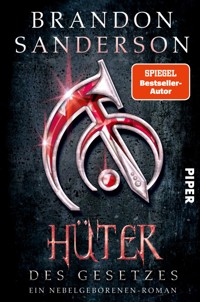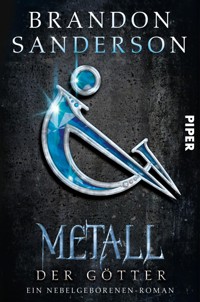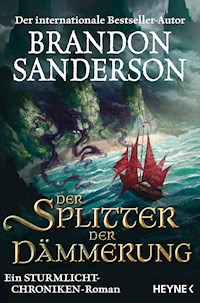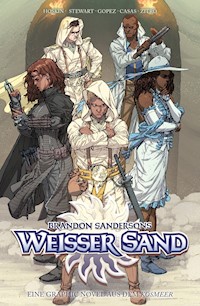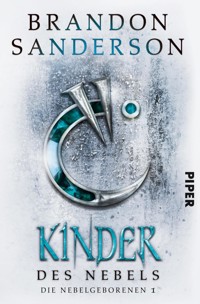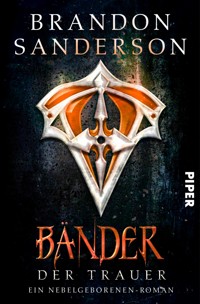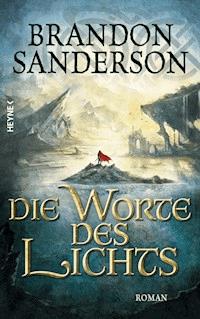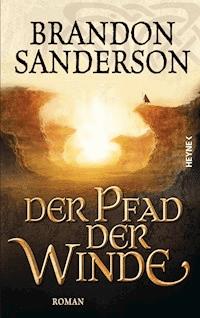
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Sturmlicht-Chroniken
- Sprache: Deutsch
Einst wurde die Sturmwelt Roschar von mächtigen Kriegern beherrscht, deren magische Schwerter über Leben und Tod entschieden. Doch seit der König von Alethkar ermordet wurde, sind die einflussreichsten Fürsten des Landes zerstritten, und das Reich droht im Chaos zu versinken. Dalinar, der Bruder des ermordeten Königs, träumt davon, das Königreich wieder zu vereinen. Ein Traum, den er nur verwirklichen kann, wenn er dem Geheimnis der magischen Klingen auf die Spur kommt. Ein Traum, dessen Erfüllung die dunklen Mächte, die den Tod von Dalinars Bruder zu verantworten haben, unbedingt verhindern wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 996
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Die Originalausgabe ist unter dem Titel
The Way of Kings – Book One of The Stormlight Archive(Part II)
bei Tor/Tom Doherty Associates, LLC, New York, erschienen.
Für Emily,
die so geduldig, so freundlichund auch so wunderbar ist,dass Worte es eigentlich gar nichtbeschreiben können.Ich will es trotzdem versuchen.
Inhaltsverzeichnis
ERSTER TEIL
Sterben
KALADIN · SCHALLAN
1
SEITEN
FÜNF JAHRE UND ZWEI MONATE FRÜHER
Kaladin, sieh dir diesen Stein an«, sagte Tien. »Er verändert die Farbe, wenn du ihn von unterschiedlichen Seiten aus betrachtest.«
Kal wandte den Blick vom Fenster ab und sah seinen Bruder an. Tien war jetzt dreizehn Jahre alt, und aus einem erwartungsvollen Jungen war ein erwartungsvoller Heranwachsender geworden. Obwohl er etwas gewachsen war, wirkte er für sein Alter noch immer klein, und sein wuscheliges schwarzes und braunes Haar verweigerte sich auch weiter allen Versuchen des Frisierens. Er hockte neben dem lackierten Esstisch aus Lehmholz. Seine Augen befanden sich auf der Höhe der glatten Tischplatte, während er einen klumpigen kleinen Stein betrachtete.
Kal saß auf einem Stuhl und schälte mit einem kurzen Messer Langwurzeln. Die braunen Wurzeln waren an der Außenseite schmutzig und wurden klebrig, wenn er sie einschnitt. Seine Finger waren bereits mit einer dicken Schicht aus Krem überzogen. Wieder war er mit einer Wurzel fertig und gab sie an seine Mutter weiter, die sie wusch und in den Eintopf schnitt.
»Mutter, sieh dir das an«, sagte Tien. Die Strahlen des späten Nachmittags fielen durch das Fenster auf der windabgewandten Seite und badeten den Tisch in Licht. »Von dieser Seite aus glitzert der Stein rot, aber von der anderen Seite aus wirkt er grün.«
»Vielleicht ist er ja magisch«, sagte Hesina. Ein Langwurzelstück nach dem anderen landete im Eintopf, und jedes machte ein ganz eigenes Geräusch.
»Das muss es sein«, stimmte Tien zu. »Oder er hat ein Sprengsel. Leben Sprengsel auch in Steinen?«
»Sie leben in allem«, antwortete Hesina.
»Sie können nicht in allem leben«, wandte Kal ein und ließ eine Schale in den Eimer zu seinen Füßen fallen. Er warf einen Blick aus dem Fenster und betrachtete die Straße, die von dem Ort zum Haus des Stadtherrn führte.
»Doch«, sagte Hesina. »Sprengsel erscheinen, wenn sich etwas verändert – wenn Angst entsteht oder es zu regnen beginnt. Sie sind das Herz allen Wandels und daher auch das aller Dinge.«
»Diese Langwurzel«, sagte Kal und hielt sie misstrauisch hoch.
»Hat ein Sprengsel.«
»Und wenn ich sie entzweischneide?«
»Dann hat jedes Stück ein Sprengsel, aber ein kleineres.«
Kal runzelte die Stirn und betrachtete die lange Knolle. Langwurzeln wuchsen in Felsspalten, wo sich das Wasser sammelte. Sie schmeckten schwach nach Mineralien, waren aber einfach anzubauen. Seine Familie brauchte in diesen Tagen Nahrungsmittel, die nicht viel kosteten.
»Also essen wir Sprengsel«, sagte Kal geradeheraus.
»Nein«, entgegnete seine Mutter. »Wir essen die Wurzeln.«
»Weil wir es müssen«, fügte Tien mit einer Grimasse hinzu.
»Und die Sprengsel?«, bohrte Kal nach.
»Sie werden befreit. Sie kehren an den Ort zurück, wo die Sprengsel leben – wo immer das sein mag.«
»Habe ich ein Sprengsel?«, fragte Tien und schaute auf seine Brust.
»Du hast eine Seele, mein Lieber. Du bist ein Mensch. Aber die Teile deines Körpers könnten durchaus lebende Sprengsel besitzen. Allerdings sehr kleine.«
Tien kniff seine Haut, als wollte er die winzigen Sprengsel herauspulen.
»Mist«, sagte Kal plötzlich.
»Kal!«, fuhr ihn Hesina an. »So spricht man nicht beim Kochen!«
»Mist«, wiederholte Kal jedoch stur. »Hat er auch Sprengsel?«
»Ich vermute ja.«
»Mistsprengsel«, sagte Tien und kicherte.
Seine Mutter zerkleinerte weiterhin die Knollen. »Was sollen denn plötzlich all diese Fragen?«
Kal zuckte mit den Schultern. »Ich … ich weiß nicht. Einfach so.«
In der letzten Zeit dachte er oft über die Welt nach – und wo sein Platz darin war. Die anderen Jungen in seinem Alter stellten sich solche Fragen nicht. Die meisten wussten, wie ihre Zukunft aussah. Sie würden auf den Feldern arbeiten.
Aber Kal konnte wählen. Und in den letzten Monaten hatte er seine Wahl getroffen. Er würde Soldat werden. Er war jetzt fünfzehn Jahre alt und konnte mit dem nächsten Anwerber gehen, der durch den Ort kam. Und genau das hatte er auch vor. Für ihn stand es fest. Er würde zu kämpfen lernen. Das war das Ende seiner Unschlüssigkeit.
Oder?
»Ich will verstehen«, sagte er. »Ich will, dass alles einen Sinn ergibt.«
Seine Mutter lächelte. Sie stand in ihrem braunen Arbeitskleid da und hatte das Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden; der obere Teil war unter ihrem gelben Kopftuch verschwunden.
»Was ist los?«, wollte er wissen. »Warum lächelst du?«
»Du willst, dass alles einen Sinn ergibt?«
»Ja.«
»Wenn die Feuerer das nächste Mal durch den Ort kommen, um Gebete zu verbrennen und die Berufungen der Leute zu erheben, werde ich dir Bescheid geben.« Sie lächelte noch immer. »Aber bis dahin schälst du weiter Wurzeln.«
Kal seufzte, doch dann gehorchte er. Er blickte wieder aus dem Fenster und hätte vor Entsetzen beinahe die Knolle fallen lassen. Die Kutsche. Sie kam die Straße vom Herrenhaus herunter. Er spürte ein nervöses Zögern in sich. Er hatte geplant, er hatte nachgedacht, aber jetzt, da es so weit war, wollte er nur noch hier sitzen und weiterschälen. Bestimmt würde es noch eine andere Gelegenheit geben …
Nein. Er stand auf und versuchte die Angst aus seiner Stimme herauszuhalten. »Ich muss mich waschen.« Er hielt seine krembedeckten Finger hoch.
»Du hättest die Wurzeln vorher abspülen sollen, so wie ich es dir gesagt habe«, bemerkte seine Mutter.
»Ich weiß«, sagte Kal. Klang sein Seufzer des Bedauerns echt genug? »Ich sollte sie jetzt alle gleichzeitig abspülen.«
Hesina sagte nichts, als er die drei verbliebenen Wurzeln nahm, den Raum durchquerte, mit klopfendem Herzen die Tür aufstieß und in das Abendlicht hinaustrat.
»Sieh mal«, sagte Tien hinter ihm. »Von dieser Seite aus ist er grün. Ich glaube nicht, dass es ein Sprengsel ist, Mutter. Es ist das Licht. Es verändert den Stein …«
Die Tür schwang zu. Kal setzte die Knollen ab und rannte durch die Straßen von Herdstein. Er kam an Männern vorbei, die Holz hackten, an Frauen, die das Spülwasser ausschütteten, und an einer Gruppe von alten Männern, die auf einer Treppe saßen und in den Sonnenuntergang blickten. Er steckte die Hände in eine Regentonne, zog sie wieder heraus, schüttelte das Wasser ab und lief weiter. Er lief an Mabrow Schweineherders Haus vorbei, kam zum Dorfwasser, dem großen, in den Fels geschnittenen Loch in der Mitte des Ortes, wo sich das Regenwasser sammelte, und rannte an dem Bruchwall vorbei, dem steilen Hang, gegen den das Dorf errichtet worden war – zum Schutz vor den Stürmen.
Hier fand er einen kleinen Hain aus Stumpfwichtbäumen. Sie waren knollenförmig und so groß wie ein Mensch. Ihre Blätter wuchsen nur an der windabgewandten Seite. Wie die Sprossen einer Leiter hingen sie auf der gesamten Länge des Baumes herab und bewegten sich leise im Wind. Als Kal sich ihnen näherte, drängten sich die großen, fahnenartigen Blätter eng an die Stämme und verursachten peitschende Geräusche dabei.
Kals Vater stand auf der anderen Seite und hatte die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Er wartete dort, wo die Straße, die vom Herrenhaus herüberführte, eine Biegung nach Herdstein hinein machte. Lirin drehte sich ruckartig um und erkannte Kal. Er trug seine beste Kleidung: einen blauen Mantel, der an den Seiten wie der eines Hellauges geknöpft war. Aber er verdeckte zur Hälfte eine weiße Hose, die starke Anzeichen von Abnutzung zeigte. Dabei betrachtete er Kal durch seine Brille hindurch.
»Ich gehe mit dir«, platzte Kal heraus. »Hoch zum Herrenhaus.«
»Woher weißt du …?«
»Jeder weiß es«, sagte Kal. »Glaubst du, es wird nicht darüber geredet, wenn Hellherr Roschone dich zum Abendessen einlädt? Ausgerechnet dich?«
Lirin wandte den Blick ab. »Ich habe deiner Mutter gesagt, sie solle dich beschäftigen.«
»Das hat sie auch versucht.« Kal grinste. »Ich werde vermutlich etwas zu hören bekommen, wenn sie die Langwurzeln vor der Tür findet.«
Darauf sagte Lirin nichts. Die Kutsche hielt nicht weit von ihm entfernt an; die Räder knirschten über den Stein.
»Das wird kein angenehmes Mahl, Kal«, sagte Lirin.
»Ich bin kein Dummkopf, Vater.« Als Hesina erfahren hatte, dass sie im Ort keine Arbeit mehr bekam … Es gab schließlich einen guten Grund, warum sie Langwurzeln essen mussten. »Wenn du ihm gegenübertrittst, dann solltest du jemanden dabeihaben, der dich unterstützt.«
»Und dieser Jemand bist du?«
»Ich bin so ziemlich alles, was du hast.«
Der Kutscher räusperte sich. Er stieg nicht ab, um die Tür zu öffnen, so wie er es für den Hellherrn Roschone tat.
Lirin sah Kal an.
»Wenn du mich zurückschickst, gehe ich«, sagte Kal.
»Nein. Komm mit, wenn du es unbedingt willst.« Lirin ging zur Kutsche und zog die Tür auf. Es war nicht das modische, vergoldete Gefährt, das Roschone benutzte. Dies hier war die zweite Kutsche, die ältere – eine braune. Kal kletterte hinein und spürte angesichts dieses kleinen Sieges eine Woge der Erregung – und ein gleiches Maß an Panik.
Sie würden Roschone gegenübertreten. Endlich.
Die Sitzbänke im Inneren waren erstaunlich; das rote Tuch, mit dem sie bespannt waren, fühlte sich weicher an als alles, worauf Kal jemals gesessen hatte. Als er Platz nahm, stellte er fest, dass der Sitz außergewöhnlich stark federte. Lirin setzte sich Kal gegenüber, zog die Tür zu, und der Kutscher schlug mit der Peitsche nach den Pferden. Das Gefährt wendete und ratterte die Straße zurück. Trotz der weichen Sitze wurde es doch eine schrecklich holprige Fahrt. Kals Zähne schlugen gegeneinander. Es war schlimmer, als in einem Karren zu fahren, auch wenn das vermutlich nur daran lag, dass die Kutsche so schnell war.
»Warum wolltest du nicht, dass wir davon erfahren?«, fragte Kal.
»Ich war mir noch gar nicht sicher, ob ich überhaupt gehen würde.«
»Was hättest du denn sonst tun können?«
»Wegziehen«, sagte Lirin. »Euch nach Kharbranth bringen, aus diesem Ort und diesem Königreich fliehen und dadurch Roschones Missgunst entkommen.«
Entsetzt kniff Kal die Augen zusammen. An eine solche Möglichkeit hatte er gar nicht gedacht. Plötzlich schien alles größer zu werden. Seine Zukunft veränderte sich, gestaltete sich um und nahm ein völlig anderes Aussehen an. Vater, Mutter, Tien – zusammen mit ihm. »Wirklich?«
Lirin nickte geistesabwesend. »Selbst wenn wir nicht nach Kharbranth gegangen wären – ich bin mir sicher, dass uns viele Alethi-Städte willkommen geheißen hätten. Sie müssen mit ihren örtlichen Heilern auskommen, die den größten Teil ihrer Kenntnisse aus dem Aberglauben oder ihren gelegentlichen Arbeiten an einem verwundeten Chull beziehen. Wir könnten sogar nach Kholinar gehen. Ich bin erfahren genug, um dort als Arzthelfer zu arbeiten.«
»Warum gehen wir dann nicht? Warum sind wir noch nicht weg?«
Lirin sah aus dem Fenster. »Ich weiß nicht. Wir sollten tatsächlich wegziehen. Es wäre sinnvoll. Wir haben ja das Geld dazu. Und wir sind hier nicht erwünscht. Der Stadtherr hasst uns, die Menschen misstrauen uns, und der Sturmvater selbst scheint geneigt zu sein, uns fertigzumachen.« Was war es, das in Lirins Stimme lag? Bedauern?
»Ich habe einmal versucht zu gehen«, sagte Lirin sanfter. »Aber es spannt sich ein starkes Band zwischen der Heimat eines Menschen und seinem Herzen. Mir sind die Menschen hier nicht gleichgültig, Kal. Ich habe ihre Kinder zur Welt gebracht, ihre Knochen eingerenkt und ihre Wunden geheilt. In den letzten Jahren hast du das Schlimmste von ihnen zu sehen bekommen, aber davor gab es auch gute Zeiten.« Er drehte sich zu Kal um und faltete die Hände. Die Kutsche ratterte voran. »Sie gehören zu mir, mein Sohn. Und ich gehöre zu ihnen. Ich bin für sie verantwortlich, vor allem jetzt, da Wistiow nicht mehr da ist. Ich kann sie doch nicht an Roschone ausliefern.«
»Obwohl ihnen gefällt, was er tut?«
»Besonders deswegen.« Lirin fasste sich an den Kopf. »Sturmvater! Jetzt, wo ich es laut ausspreche, klingt es richtig dumm.«
»Nein. Ich verstehe schon. Das glaube ich jedenfalls.« Kal zuckte die Achseln. »Sie kommen ja noch immer zu uns, wenn sie verletzt sind. Zwar beschweren sie sich darüber, dass es unnatürlich ist, einen Menschen aufzuschneiden, aber sie kommen trotzdem. Ich habe mich immer gefragt, warum sie das tun.«
»Und – bist du zu einem Ergebnis gekommen?«
»Ein bisschen schon. Ich glaube, am Ende wollen sie lieber weiterleben und dich dafür noch ein paar Tage länger verfluchen. Das machen sie eben. So wie du sie heilst. Und sie haben dir Geld gegeben. Die Menschen sagen alles Mögliche, aber dort, wo sie ihre Kugeln hinlegen, ist ihr Herz.« Kal runzelte die Stirn. »Ich vermute, dass sie dich wirklich geschätzt haben.«
Lirin lächelte. »Weise Worte. Ich vergesse immer wieder, dass du schon fast ein Mann bist, Kal. Wann bist du eigentlich erwachsen geworden?«
In jener Nacht, als wir fast ausgeraubt worden wären, dachte Kal sofort. In jener Nacht, als du die Männer draußen beleuchtet und gezeigt hast, dass Tapferkeit nichts mit einem Speer zu tun hat, den man in der Schlacht festhält.
»In einer Hinsicht hast du allerdings Unrecht«, sagte Lirin. »Du hast gesagt, dass sie mich geschätzt haben. Das tun sie doch noch immer. O ja, sie knurren zwar – das haben sie seit jeher getan. Aber sie bringen uns immer wieder Nahrungsmittel.«
»Wirklich?«, fragte Kal erstaunt.
»Was hätten wir denn sonst in den letzten vier Monaten essen sollen?«
»Aber …«
»Sie haben Angst vor Roschone, und deshalb sprechen sie nicht darüber. Sie legen es für deine Mutter zurecht, wenn sie saubergemacht hat, oder sie hinterlassen es in der Regentonne, wenn sie leer ist.«
»Sie haben versucht, uns auszurauben.«
»Das waren dieselben Männer, die uns das Essen geben.«
Kal dachte darüber nach, bis die Kutsche vor dem Herrenhaus anhielt. Es war lange her, seit er das große, zweistöckige Gebäude zum letzten Mal besucht hatte. Es trug so ein übliches, an der Sturmseite abfallendes Dach, das aber viel größer war als die Dächer der gewöhnlichen Häuser. Die Wände bestanden aus dickem weißem Stein, und auf der windabgewandten Seite befanden sich majestätische viereckige Säulen.
Würde er Laral hier antreffen? Manchmal schämte er sich, weil er nur noch so selten an sie dachte.
Der Vorgarten des Hauses wurde von einer niedrigen Steinmauer eingefasst, an der alle Arten von exotischen Pflanzen gediehen. Steinknospen säumten die Krone, und ihre Ranken hingen an der Mauer herab. Knollenartige Schieferborke wuchs in Büschen an der Innenseite und zeigte eine Vielzahl kräftiger Farben: Orange, Rot, Gelb und Blau. Einige Auswüchse wirkten wie Kleiderhaufen mit Falten, die sich wie Fächer spreizten. Andere sprossen gleich Hörnern hervor. Die meisten hatten Fortsätze, die im Wind wie Fäden schwankten. Hellherr Roschone schenkte seinem Besitz eine viel größere Aufmerksamkeit als sein Vorgänger.
Sie gingen auf das Haus zu und kamen dabei an gekalkten Säulen vorbei. Dann betraten sie das Innere durch die dicken hölzernen Sturmtüren. Die Eingangshalle hatte eine niedrige Decke; die Zirkonkugeln unter ihr tauchten sie in ein hellblaues Licht. Sie war mit Kunstkeramik geschmückt.
Ein großer Diener in einem langen schwarzen Mantel und mit einer purpurfarbenen Krawatte begrüßte sie. Es war Natir, der nun Haushofmeister war, nachdem Miliv gestorben war. Er stammte aus Dalilak, einer großen Küstenstadt im Norden.
Natir führte sie in einen Speisesaal mit einem langen Tisch aus dunklem Holz. Dort saß bereits Roschone. Er hatte an Gewicht zugelegt, aber nicht so sehr, dass man ihn als fett hätte bezeichnen können. Er trug noch immer diesen grau gesprenkelten Bart und hatte sich die Haare eingeölt, die ihm bis auf den Kragen hingen. Er trug eine weiße Hose und eine enge rote Weste über einem weißen Hemd.
Er hatte bereits mit seinem Mahl begonnen, und die würzigen Düfte verursachten ein Knurren in Kals Magen. Wie lange war es her, seit er zum letzten Mal Schweinefleisch gegessen hatte? Fünf verschiedene Tunken standen auf dem Tisch, und Roschones Wein hatte eine tiefe, kristallartige Orangefärbung. Er aß allein; von Laral und seinem Sohn war nichts zu sehen.
Der Diener deutete auf einen kleinen Tisch, der in einem Raum neben dem Speisesaal aufgestellt war. Kals Vater warf einen Blick dorthin, ging dann zu Roschones Tisch und setzte sich daran. Roschone erstarrte, hatte den Spieß gerade auf halbem Weg zum Mund geführt, eine würzige braune Soße tropfte von dem Fleisch auf die Tischplatte vor ihm.
»Ich bin aus dem zweiten Nahn«, sagte Lirin, »und ich habe eine persönliche Einladung erhalten, mit Euch zu speisen. Gewiss befolgt Ihr die Rangordnung genau und werdet mir daher einen Platz an Eurem Tisch einräumen.«
Roschone biss die Zähne zusammen, machte aber keine Einwände. Kal holte tief Luft und setzte sich neben seinen Vater. Bevor er in den Krieg auf der Zerbrochenen Ebene zog, musste er es wissen. War sein Vater ein Feigling oder ein mutiger Mann?
Im Licht der Kugeln zu Hause war ihm Lirin immer als schwach erschienen. Er arbeitete in seinem Arztzimmer und achtete nicht darauf, was die Leute aus dem Ort über ihn sagten. Seinem Sohn hatte er verboten, mit dem Speer zu üben und in den Krieg zu ziehen. War das etwa nicht das Verhalten eines Feiglings? Aber vor fünf Monaten hatte Kal bei diesem Mann einen Mut beobachtet, den er ihm niemals zugetraut hätte.
Und in dem ruhigen blauen Licht von Roschones Palast sah Lirin nun einem Mann in die Augen, der an Rang, Reichtum und Macht weit über ihm stand. Und er wich nicht zurück. Wie machte er das bloß? Kals Herz schlug wie unbändig. Er musste die Hände in den Schoß legen, damit er seine Nervosität nicht verriet.
Roschone winkte einem Diener zu, und nach kurzer Zeit waren Teller und Besteck an den Tisch des Stadtherrn gebracht. Am Rande des Saales war es dunkel. Es wirkte, als wäre Roschones Tisch eine erhellte Insel inmitten eines ausgedehnten schwarzen Meeres.
Fingerschalen mit Wasser standen auf dem Tisch, daneben lagen gestärkte weiße Servietten. Es war das Mahl eines Hellauges. Kal hatte nur selten so feine Speisen gekostet; er versuchte, sich nicht lächerlich zu machen, indem er zögernd einen Spieß ergriff und Roschone nachahmte. Er nahm sein Messer, um den untersten Teil des Fleisches abzuschneiden, dann hob er das Stück an den Mund und biss hinein. Das Fleisch war zart und herzhaft, aber die Gewürze waren schärfer, als er es gewöhnt war.
Lirin aß nicht. Er stützte die Ellbogen auf den Tisch und beobachtete den Hellherrn bei dessen Mahlzeit.
»Ich wollte dir die Möglichkeit geben, in Ruhe zu essen, bevor wir über ernstere Dinge sprechen«, sagte Roschone schließlich. »Aber du scheinst meine Großzügigkeit nicht annehmen zu wollen.«
»Nein.«
»Also gut«, sagte Roschone, während er ein Stück Flachbrot aus dem Korb nahm und es um seinen Spieß wickelte. Dann riss er mehrere Gemüsestücke gleichzeitig ab und aß sie zusammen mit dem Brot. »Dann sag mir, wie lange du dich mir – deiner Meinung nach – noch widersetzen kannst. Deine Familie ist mittellos.«
»Es geht uns gut«, warf Kal ein.
Lirin sah ihn kurz an, tadelte ihn wegen seiner Bemerkung aber nicht. »Mein Sohn hat Recht. Wir können gut leben. Und falls es eines Tages doch nicht mehr gehen sollte, dann werden wir fortziehen. Ich werde mich nicht Eurem Willen beugen, Roschone.«
»Wenn ihr geht«, sagte Roschone und hob den Finger, »dann werde ich mich mit deinem neuen Stadtherrn in Verbindung setzen und ihm von den Kugeln berichten, die du mir gestohlen hast.«
»Ich würde eine gerichtliche Untersuchung darüber unbeschadet überstehen. Außerdem genieße ich als Arzt und Chirurg wegen der meisten Anschuldigungen, die Ihr gegen mich vorbringen könnt, Immunität.« Das stimmte. Diejenigen Personen und deren Gehilfen, die in den Städten wichtige Funktionen für das Gemeinwohl ausübten, erhielten einen besonderen Schutz, sogar vor den Hellaugen. Die Vorin-Bürgerrechte waren so kompliziert, dass Kaladin sie noch immer nicht ganz begriffen hatte.
»Ja, du würdest einen solchen Prozess gewinnen«, sagte Roschone. »Du warst sehr gründlich und hast genau die richtigen Dokumente vorbereitet. Du warst als Einziger dabei, als Wistiow sie gestempelt hat. Seltsam, dass keine seiner Schreiberinnen zugegen war.«
»Die Schreiberinnen haben ihm die Dokumente vorgelesen. «
»Und dann sind sie aus dem Zimmer gegangen.«
»Weil Hellherr Wistiow es ihnen befohlen hatte. Sie haben das bezeugt, soweit ich weiß.«
Roschone zuckte die Achseln. »Ich brauche gar nicht zu beweisen, dass du die Kugeln gestohlen hast, Arzt. Ich muss einfach nur so weitermachen wie bisher. Ich weiß, dass deine Familie von Abfall lebt. Wie lange willst du sie noch um deines Stolzes willen leiden lassen?«
»Ihr könnt sie genauso wenig einschüchtern wie mich.«
»Ich will nicht wissen, ob ihr von mir eingeschüchtert seid. Ich will wissen, ob ihr verhungert.«
»Keineswegs«, erwiderte Lirin mit trockener Stimme. »Falls uns etwas zu essen fehlen sollte, können wir uns an der Aufmerksamkeit mästen, die Ihr uns schenkt, Hellherr. Wir spüren Eure Augen auf uns ruhen, wir hören das, was Ihr den Leuten im Ort zuflüstert. Da Ihr uns so eingehend beobachtet, könnte man auf den Gedanken kommen, dass Ihr derjenige seid, der eingeschüchtert ist.«
Roschone schwieg. Den Spieß hielt er schlaff in der Hand, während er die strahlend grünen Augen zusammenkniff und die Lippen schürzte. Kal musste sich zusammenreißen, damit er unter diesem missbilligenden Blick nicht immer kleiner wurde. Hellaugen wie Roschone verbreiteten eine Aura der Herrschergewalt.
Er ist kein richtiges Hellauge. Er ist ein Zurückgewiesener. Bald werde ich richtige sehen. Ehrenmänner.
Lirin hielt Roschones Blick stand. »Jeder Monat, den wir Widerstand leisten, ist ein Schlag gegen Eure Autorität. Ihr könnt mich nicht verhaften lassen, denn ich würde den Prozess gewinnen. Ihr habt versucht, andere Leute gegen mich aufzubringen, aber tief in ihrem Innern wissen sie, dass sie mich brauchen.«
Roschone beugte sich vor. »Ich mag eure kleine Stadt nicht.«
Lirin runzelte die Stirn, als er diese seltsame Antwort hörte.
»Ich mag es nicht, wie ein Verbannter behandelt zu werden«, fuhr Roschone fort. »Und es gefällt mir auch nicht, so weit weg von allem, was wichtig ist, zu leben. Und vor allem mag ich keine Dunkelaugen, die sich über ihren Rang zu erheben versuchen.«
»Es fällt mir schwer, Mitleid mit Euch zu empfinden.«
Roschone schnaubte verächtlich. Er schaute auf sein Mahl, als hätte es plötzlich jeden Geschmack verloren. »Also gut. Wir sollten eine … Übereinkunft treffen. Ich nehme neun Zehntel der Kugeln, und du kannst den Rest behalten.«
Entrüstet stand Kal auf. »Mein Vater wird niemals …«
»Kal«, unterbrach ihn Lirin, »ich kann für mich selbst sprechen. «
»Aber du wirst diesen Handel doch nicht eingehen!«
Lirin antwortete nicht sofort. »Geh in die Küche, Kal«, sagte er schließlich. »Frag nach, ob man dort etwas zu essen für dich hat, das dir besser schmeckt.«
»Vater, nein …«
»Geh, Sohn«, sagte Lirin mit fester Stimme.
Konnte das wahr sein? Würde sein Vater nach alldem einfach kapitulieren? Kal spürte, wie sein Gesicht rot anlief, und er floh aus dem Speisesaal. Er kannte ja den Weg in die Küche. Dort hatte er als Kind oft mit Laral gegessen.
Er ging nicht, weil es ihm befohlen worden war, sondern weil er nicht wollte, dass sein Vater oder Roschone seine Gefühle bemerkten. Er schämte sich, weil er Roschone hatte bloßstellen wollen, während sein Vater plante, ein Abkommen mit ihm zu treffen. Er fühlte sich gedemütigt, weil sein Vater ein solches Abkommen in Erwägung zog, und er war enttäuscht, weil er weggeschickt worden war. Es demütigte Kal noch weiter, als er feststellen musste, dass er weinte. Er ging an einigen von Roschones Haussoldaten vorbei, die neben der Tür standen und von einer Öllampe mit niedrigem Docht nur schwach beleuchtet wurden. Ihre großen Gesichter waren bernsteinfarben.
Kal hastete an ihnen vorbei und umrundete eine Ecke, bevor er sich in einem Alkoven ausruhte und mit seinen Gefühlen kämpfte. In dieser Nische stand auf einem Postament eine Rankenknospe, die für Innenräume gezüchtet worden war und ihre Schale immer offen hielt. Aus ihr wuchsen einige kegelförmige Blumen heraus. Eine Lampe an der Wand verbreitete schwaches, gedrosseltes Licht. Dies waren die Hinterzimmer des Herrenhauses, die sich in der Nähe der Dienerquartiere befanden, und hier wurden keine Kugeln als Leuchtmittel verwendet.
Kal lehnte sich zurück und atmete tief ein und aus. Er fühlte sich wie einer der zehn Narren – insbesondere wie Cabine, der sich wie ein Kind verhielt, obwohl er ein Erwachsener war. Wie sollte er Lirins Verhalten denn beurteilen?
Er wischte sich die Augen, ging weiter und betrat die Küche. Roschone hatte Wistiows Küchenmeister behalten. Barm war ein schlanker, großer Mann mit dunklem Haar, das er zu einem Zopf geflochten trug. Er ging an der Anrichte vorbei, gab seinen Küchendienern verschiedene Anweisungen, und einige Parscher kamen durch die Hintertür herein und brachten Kisten mit Nahrungsmitteln. Barm trug einen langen Metalllöffel, mit dem er jedes Mal, wenn er einen Befehl erteilte, gegen einen Topf oder eine Pfanne schlug, die in der Nähe von der Decke hingen.
Er schenkte Kal nur einen kurzen Blick aus seinen braunen Augen und trug einem seiner Diener auf, etwas Flachbrot und Fruchtreis zu holen. Das war ein Kinderessen. Kal fühlte sich noch beschämter, weil Barm sofort erraten hatte, warum er in die Küche geschickt worden war.
Kal ging zu der Essecke und wartete auf das Mahl. Er befand sich nun in einem gekalkten Alkoven, in dem ein Tisch mit Schieferplatte stand. Er setzte sich, stützte sich mit den Ellbogen auf dem Schiefer ab und legte den Kopf in die Hände.
Warum machte ihn der Gedanke so wütend, dass sein Vater den größten Teil der Kugeln im Austausch für Sicherheit weggeben könnte? Wenn das geschah, dann würde nicht mehr genug für Kal übrig bleiben, sodass er nicht nach Kharbranth gehen konnte. Aber er hatte sich entschieden, Soldat zu werden. Also war es egal. Oder?
Ich werde in die Armee eintreten, dachte Kal. Ich werde weglaufen und …
Doch plötzlich erschien ihm dieser Traum – dieser Plan – unsagbar kindisch. Er passte eher zu einem Jungen, der es verdient hatte, Fruchtspeisen zu essen und weggeschickt zu werden, wenn die Erwachsenen über wichtige Dinge redeten. Zum ersten Mal machte ihn der Gedanke, keine Ausbildung durch die Ärzte von Kharbranth zu bekommen, zutiefst traurig.
Die Tür zur Küche flog auf. Roschones Sohn Rillir stürmte herein und plauderte dabei mit einer Person hinter ihm: »… keine Ahnung, warum Vater darauf beharrt, dass hier alles immer so düster ist. Öllampen in den Gängen! Könnte es etwas provinzielleres geben? Es würde ihm wirklich gut tun, wenn ich ihn auf die Jagd mitschleifen könnte. Wir könnten unsere Stellung in diesem hinterweltlerischen Ort doch für irgendwas Gutes einsetzen.«
Da bemerkte Rillir Kal und ging an ihm vorbei, wie man an einem Schemel oder einem Weinregal vorbeigeht: Man bemerkt es, beachtet es aber nicht weiter.
Kals Blick war auf die Person gerichtet, die Rillir folgte. Es war Laral, Wistiows Tochter.
So vieles hatte sich verändert. Es war schon so lange her, und als er sie jetzt sah, kamen alte Gefühle in ihm hoch. Scham. Erregung. Wusste sie, dass seine Eltern gehofft hatten, sie mit Kal verheiraten zu können? Allein der Umstand, dass er sie jetzt sah, brachte ihn in die höchste Verlegenheit. Aber nein. Sein Vater war in der Lage, Roschone in die Augen zu sehen. Er konnte doch dasselbe mit ihr tun.
Kal stand auf und nickte ihr zu. Sie sah ihn an, errötete schwach und kam mit einem alten Kindermädchen im Schlepptau herbei – einer Anstandsdame.
Was war mit der Laral geschehen, die er gekannt hatte – jenem Mädchen mit gelbem und schwarzem Haar, das gern auf Felsen kletterte und durch die Felder lief? Nun war sie in gelbe Seide eingehüllt, die zu dem glatten Kleid einer helläugigen Frau genäht worden war – und sie hatte die Haare schwarz gefärbt, um die helle Farbe darin zu verbergen. Die linke Hand hatte sie schicklich in ihrem Ärmel versteckt. Laral sah tatsächlich wie ein Hellauge aus.
Wistiows Vermögen – zumindest das, was noch davon übrig war – war auf sie übergegangen. Roschone hatte die Macht über Herdstein erlangt und das Haus sowie das angrenzende Land erhalten. Hochprinz Sadeas hatte Laral dafür eine Mitgift gegeben.
»Du«, sagte Rillir mit glattem städtischem Akzent und nickte Kal zu. »Sei ein guter Junge und hol uns was zu essen. Wir speisen hier in diesem Winkel.«
»Ich bin kein Küchendiener.«
»Nein?«
Kal errötete.
»Wenn du ein Trinkgeld oder eine Belohnung dafür erwartest, dass du mir mein Essen holst …«
»Ich bin kein … ich meine …« Kal sah Laral an. »Sag es ihm, Laral.«
Sie wandte den Blick ab. »Na los, Junge. Tu, was man dir befohlen hat. Wir sind hungrig.«
Kal starrte sie mit offenem Mund an, dann errötete er noch stärker. »Ich … ich werde euch gar nichts holen!«, brachte er schließlich heraus. »Egal wie viele Kugeln ihr mir dafür auch bietet. Ich bin kein Botenjunge, sondern Arzt.«
»Ach, du bist der Sohn von dem da.«
»Ja, das bin ich«, sagte Kal und war erstaunt, wie stolz er sich bei diesen Worten fühlte. »Ich lasse mich nicht von dir herumjagen, Rillir Roschone. Genauso wenig, wie sich mein Vater von deinem Vater herumscheuchen lässt.«
Es sei denn, sie treffen jetzt gerade ein Abkommen …
»Vater hatte gar nicht erwähnt, wie lustig du bist«, sagte Rillir und lehnte sich gegen die Wand. Da schien er nicht nur zwei, sondern zehn Jahre älter zu sein als Kal. »Du findest es also beschämend, einem Mann sein Essen zu holen? Bist du etwas Besseres als das Küchenpersonal?«
»Nein. Es ist bloß nicht meine Berufung.«
»Und was ist deine Berufung?«
»Menschen zu heilen, die krank sind.«
»Wenn ich nicht esse, werde ich doch krank, oder etwa nicht? Sollte es daher nicht deine Pflicht sein, mich bei Kräften zu halten?«
Kal runzelte die Stirn. »Das … das ist nicht dasselbe.«
»Ich betrachte es als etwas sehr Ähnliches.«
»Warum holst du dir dein Essen nicht einfach selbst?«
»Das ist nicht meine Berufung.«
»Und was ist deine Berufung?«, gab Kal zurück und richtete damit die Worte des jungen Mannes gegen diesen selbst.
»Stadterbe zu sein«, gab Rillir zurück. »Meine Pflicht ist es, zu führen und dafür zu sorgen, dass die Arbeit getan wird und die Menschen etwas Sinnvolles zu tun haben. Und deshalb betraue ich müßige Dunkelaugen mit wichtigen Aufgaben, damit sie sich nützlich machen können.«
Kal zögerte und wurde immer wütender.
»Da siehst du, wie dieser kleine Verstand funktioniert«, sagte Rillir zu Laral. »Wie ein erlöschendes Feuer, das seinen geringen Vorrat an Brennstoff schnell verzehrt und dabei Rauch ausstößt. Ah, sieh mal, sein Gesicht wird wegen der Hitze schon ganz rot.«
»Rillir, bitte«, sagte Laral und legte ihm die Hand auf den Arm.
Rillir sah sie kurz an und rollte dann mit den Augen. »Du bist ja ganz genauso provinziell, wie es mein Vater manchmal ist, meine Liebe.« Er richtete sich auf und führte sie mit einem resignierten Blick an dem Alkoven vorbei bis in die Küchenmitte.
Kal setzte sich mit heftigen Bewegungen und schlug sich dabei die Knie an der Bank an. Ein Diener brachte ihm sein Essen und stellte es auf den Tisch, doch das erinnerte Kal nur an sein kindliches Verhalten. Deshalb wollte er nicht essen; er starrte den Teller an, bis sein Vater plötzlich in die Küche kam. Rillir und Laral waren inzwischen verschwunden.
Lirin trat zum Alkoven und betrachtete Kal. »Du hast nichts gegessen.«
Kal schüttelte den Kopf.
»Das hättest du aber tun sollen. Es ist kostenlos. Komm.«
Schweigend verließen sie das Herrenhaus und gingen in die dunkle Nacht hinaus. Die Kutsche wartete auf sie, und bald saß Kal wieder in dem plüschigen Abteil, während sein Vater ihm gegenüber Platz genommen hatte. Der Kutscher kletterte auf den Bock, das Gefährt erzitterte dabei, und dann trieb er die Pferde mit der Peitsche an.
»Ich will Arzt werden«, sagte Kal plötzlich.
Die Miene seines Vaters, dessen Gesicht im Schatten verborgen war, erschien nun undeutbar. Aber als er sprach, klang er verwirrt. »Das weiß ich, mein Sohn.«
»Nein. Ich will Arzt werden. Ich will nicht mehr weglaufen und in die Armee eintreten.«
Schweigen in der Dunkelheit.
»Hast du ernsthaft darüber nachgedacht?«, fragte Lirin.
»Ja«, gab Kal zu. »Es war kindisch. Aber ich habe beschlossen, stattdessen Medizin zu studieren.«
»Warum? Was hat diese Meinungsänderung in dir bewirkt?«
»Ich muss wissen, wie sie denken«, sagte Kal und deutete mit dem Kopf auf das Herrenhaus. »Sie haben gelernt, in verklausulierten Sätzen zu sprechen, und ich muss in der Lage sein, mich ihnen entgegenzustellen und genauso reden zu können wie sie. Ich will nicht einknicken wie …« Er zögerte.
»Wie ich?«, fragte Lirin mit einem Seufzer.
Kal biss sich auf die Lippe, doch er musste es einfach fragen. »Wie viele Kugeln hast du ihm gegeben? Haben wir noch genug, um nach Kharbranth gehen zu können?«
»Ich habe ihm gar nichts gegeben.«
»Aber …«
»Roschone und ich haben eine Weile über die Höhe der Summe gestritten. Dann habe ich so getan, als könnte ich mich nicht mehr beherrschen und bin gegangen.«
»So getan?«, fragte Kal verwirrt.
Sein Vater beugte sich vor und flüsterte, damit ihn der Kutscher nicht hören konnte. Doch wegen des Klapperns und Knirschens der Kutsche bestand diese Gefahr ohnehin kaum. »Er muss glauben, dass ich bereit bin, mich ihm zu beugen. Die heutige Zusammenkunft sollte den Anschein erwecken, ich sei verzweifelt. Zuerst heftige Gegenwehr, dann Enttäuschung, damit er glaubt, er habe mich in der Tasche. Und schließlich Rückzug. In ein paar Monaten wird er mich wieder einladen, nachdem er mich seiner Meinung nach hat schwitzen lassen.«
»Aber du wirst nicht einknicken, oder?«, flüsterte Kal zurück.
»Nein. Wenn ich ihm auch nur eine einzige Kugel gebe, will er den ganzen Rest haben. Dieses Land erzeugt nicht mehr so viel Reichtum wie früher, und Roschone ist fast bankrott, weil er einige politische Schlachten verloren hat. Ich weiß noch nicht, welcher Großprinz ihn hierhergeschickt hat, um uns zu quälen, aber ich wünschte, ich wäre für ein paar Minuten mit ihm allein in einer dunklen Kammer …«
Die Leidenschaft, mit der Lirin die letzten Worte ausgesprochen hatte, schockierte Kal. Nie zuvor hatte sein Vater so offen mit Gewalt gedroht.
»Warum willst du das alles durchmachen?«, fragte Kal leise. »Du hast gesagt, dass wir uns ihm widersetzen können. Mutter glaubt das auch. Wir haben zwar nicht viel zu essen, aber wir werden nicht verhungern.«
Sein Vater antwortete nichts darauf, wirkte aber beunruhigt.
»Du musst ihn glauben machen, dass wir aufgeben«, sagte Kal. »Oder dass wir kurz davorstehen. Dann wird er nicht mehr versuchen, uns fertigzumachen. Er wird ein Abkommen mit uns treffen wollen und nicht …«
Kal erstarrte. Er erkannte etwas Unvertrautes im Blick seines Vaters. Etwas wie Schuld. Plötzlich ergab alles einen Sinn. Einen kalten, schrecklichen Sinn.
»Sturmvater«, flüsterte Kal. »Du hast die Kugeln tatsächlich gestohlen, oder?«
Sein Vater saß schweigend in der alten, holprigen Kutsche; die Schatten ließen ihn schwarz erscheinen.
»Deswegen warst du so nervös, als Wistiow gestorben ist«, fuhr Kal fort. »Das Trinken, die Sorgen … Du bist ein Dieb! Wir sind eine Familie von Dieben.«
Die Kutsche fuhr durch eine Kurve, und das violette Licht von Salas beleuchtete Lirins Gesicht. Aus diesem Blickwinkel heraus sah er nicht mehr halb so unheilvoll aus – eher wirkte er zerbrechlich. Er faltete die Hände vor sich, und in seinen Augen spiegelte sich das Mondlicht. »Wistiow war während der letzten Tage nicht mehr bei klarem Verstand, Kal«, flüsterte er. »Ich wusste, dass wir mit seinem Tod das Versprechen einer Verbindung mit seiner Familie verlören. Laral war noch nicht volljährig, und der neue Stadtherr würde es nicht zulassen, dass ein Dunkelauge ihr Erbe durch eine Heirat an sich bringt.«
»Also hast du ihn ausgeraubt?« Kal sank in sich zusammen.
»Ich habe dafür gesorgt, dass seine Versprechen eingehalten werden. Ich musste doch etwas unternehmen. Ich konnte mich nicht auf die Großzügigkeit des neuen Stadtherrn verlassen. Und das war auch klug, wie du inzwischen bemerkt haben wirst.«
Die ganze Zeit hindurch hatte Kal angenommen, dass Roschone sie nur aus bösem Willen und Gehässigkeit verfolgte. Aber nun stellte sich heraus, dass er durchaus im Recht war. »Ich kann das einfach nicht glauben.«
»Ändert es denn so viel?«, flüsterte Lirin. Sein Gesicht wirkte in dem schwachen Licht unheimlich. »Was ist jetzt anders als vorher?«
»Alles.«
»Und nichts. Roschone will die Kugeln noch immer haben, und sie stehen uns noch immer zu. Wenn Wistiow im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte gewesen wäre, hätte er sie uns gegeben. Dessen bin ich mir sicher.«
»Aber er hat es nicht getan.«
»Nein.«
Alles war wie vorher und doch ganz anders. Ein Schritt, die Welt hatte sich gedreht und stand nun kopf. Der Schurke war zum Helden geworden und der Held zum Schurken. »Ich …«, sagte Kal. »Ich habe keine Ahnung, ob das, was du getan hast, nun unglaublich mutig oder unfassbar feige war.«
Lirin seufzte. »Ich weiß, wie du dich fühlst.« Er lehnte sich zurück. »Bitte sag Tien nichts von dem, was wir getan haben.« Was wir getan haben. Kals Mutter hatte ihm geholfen. »Wenn du älter bist, wirst du es verstehen.«
»Vielleicht«, meinte Kal und schüttelte den Kopf. »Aber eine Sache hat sich nicht verändert. Ich will nach Kharbranth gehen.«
»Mit den gestohlenen Kugeln?«
»Ich werde einen Weg finden, sie zurückzuzahlen. Nicht an Roschone, aber an Laral.«
»Sie wird bald eine Roschone sein«, sagte Lirin. »Sie wird mit Rillir verlobt sein, noch bevor das Jahr vorbei ist. Roschone wird sie nicht mehr aus den Fingern lassen, jetzt wo er in Kholinar seinen politischen Einfluss verloren hat. Laral ist eine der wenigen Möglichkeiten für seinen Sohn, eine Verbindung mit einem guten Haus einzugehen.«
Bei der Erwähnung von Laral drehte sich Kals Magen um. »Ich muss lernen. Vielleicht kann ich …«
Was?, dachte er. Zurückkommen und sie davon überzeugen, dass sie Rillir für mich verlassen soll? Lächerlich.
Plötzlich hob er den Blick und sah seinen Vater an, der den Kopf geneigt hatte und sorgenvoll aussah. Er war ein Held. Und gleichzeitig ein Schurke. Aber für seine Familie war er ein Held. »Ich werde es Tien nicht sagen«, versprach Kal leise. »Und ich werde die Kugeln benutzen, um nach Kharbranth zu reisen und zu studieren.«
Sein Vater schaute auf.
»Ich will lernen, den Hellaugen gegenüberzutreten, so wie du es tust«, sagte Kal. »Sie alle können mich zum Narren halten, wenn sie es wollen. Ich werde lernen, wie sie zu reden und wie sie zu denken.«
»Du sollst lernen, damit du den Menschen helfen kannst, mein Sohn, und nicht damit du dich an den Hellaugen rächst.«
»Ich glaube, ich werde beides tun. Falls ich lernen kann, schlau genug dafür zu sein.«
Lirin schnaubte verächtlich. »Du bist schon sehr schlau, mein Sohn. Du hast genug von deiner Mutter in dir, um ein Hellauge erfolgreich zu beschwatzen. Die Universität wird dir zeigen, wie du es genau anstellen musst.«
»Ich will damit anfangen, dass ich meinen vollen Namen benutze«, erwiderte er und überraschte sich selbst damit. »Kaladin. « Das war der Name eines Mannes. Es hatte ihm nie gefallen, dass er sich wie der Name eines Hellauges anhörte, aber jetzt schien er genau zu passen.
Er war kein dunkeläugiger Bauer, aber er war auch kein helläugiger Herr, sondern irgendetwas dazwischen. Kal war ein Kind gewesen, das darum in die Armee hatte eintreten wollen, weil das auch die anderen Jungen wollten. Kaladin hingegen würde ein Mann sein, der sowohl Medizin als auch die Lebensweise der Hellaugen studierte. Und eines Tages würde er in seine Heimatstadt zurückkehren und Roschone, Rillir und auch Laral beweisen, dass es falsch gewesen war, ihn als unbedeutend abzutun.
»Also gut«, sagte Lirin. »Kaladin.«
2
DER VORAUSSEHENDE
»Geboren aus der Dunkelheit, tragen sie noch ihren Makel auf dem Körper, so wie sie die Brandmale auf der Seele tragen. «
Ich betrachte Gaschasch-Sohn-Navammis als vertrauenswürdige Quelle, bin mir aber nicht so sicher, was die Übersetzung betrifft. Vielleicht gelingt es mir, das ursprüngliche Zitat im vierzehnten Buch von Seld zu finden und es selbst zu übersetzen?
Kaladin schwebte.
Hartnäckiges Fieber, begleitet von kaltem Schweiß und Halluzinationen. Vermutliche Ursache sind entzündete Wunden. Säubern mit Desinfektionsmitteln, um die Fäulnissprengsel abzuwehren. Dem Patienten ausreichend Wasser geben.
Er befand sich wieder in Herdstein bei seiner Familie. Nun aber war er ein erwachsener Mann. Er war Soldat geworden. Und er passte nicht mehr zu ihnen. Sein Vater fragte immer wieder, wie es dazu hatte kommen können. Du hast doch gesagt, du willst Arzt werden. Arzt …
Gebrochene Rippen. Verursacht von Wunden in der Seite, die wiederum durch Schläge zugefügt wurden. Brust umwickeln und dafür sorgen, dass der Patient keine anstrengenden Tätigkeiten unternimmt.
Gelegentlich öffnete er die Augen und sah einen dunklen Raum. Es war kalt, die Wände bestanden aus Stein, und das Dach befand sich hoch über ihm. Andere Personen lagen in einer Reihe nebeneinander, von Laken bedeckt. Leichen. Es waren Leichen. Dies hier war ein Lagerhaus, wo sie zum Verkauf ausgelegt waren.
Wer kaufte Leichen?
Großprinz Sadeas. Er kaufte Leichen. Sie gingen noch aufrecht, nachdem er sie gekauft hatte, aber sie waren schon Leichen. Die Dummen weigerten sich, das hinzunehmen und taten so, als lebten sie noch.
Risswunden an Gesicht, Armen und Brust. Äußere Hautschichten an verschiedenen Stellen abgezogen. Ursache ist langes Hängen im Großsturm. Verwundete Bereiche verbinden und Denocax-Salbe auftragen, um das Wachstum neuer Haut zu fördern.
Die Zeit verging. Viel Zeit. Er sollte doch tot sein. Warum war er nicht tot? Er wollte sich zurücklehnen und es geschehen lassen.
Aber nein. Nein. Er hatte bei Tien versagt. Er hatte bei Goschel versagt. Er hatte bei seinen Eltern versagt. Er hatte bei Dallet versagt. Der liebe, arme Dallet.
Bei Brücke Vier würde er nicht versagen! Er würde nicht …
Unterkühlung, verursacht durch extreme Kälte. Patient wärmen und ihn zwingen, in sitzender Haltung zu bleiben. Darf nicht schlafen. Wenn er ein paar Stunden überlebt, wird er vermutlich keine bleibenden Schäden davontragen.
Wenn er ein paar Stunden überlebt …
Brückenmänner sollen nicht überleben.
Warum hatte Lamaril das gesagt? Welche Armee stellte denn Männer ein, die sterben sollten?
Sein Blickwinkel war zu eng gewesen. Er musste die Ziele der Armee verstehen. Entsetzt hatte er dem Fortgang der Schlacht zugesehen. Was hatte er getan?
Er musste zurückgehen und es ändern. Aber nein. Er war verwundet, oder? Er blutete auf den Boden. Er war einer der gefallenen Speermänner. Er war ein Brückenmann von Brücke Zwei, verraten von diesen Narren in Brücke Vier, die die Aufmerksamkeit der Bogenschützen von sich abgelenkt hatten.
Wie konnten sie es wagen? Wie konnten sie es wagen?
Wie können sie es wagen zu überleben, indem sie mich umbringen?
Überdehnte Sehnen, zerrissenes Muskelgewebe, angebrochene und gebrochene Knochen und tiefe Wunden, verursacht durch extreme Bedingungen. Erzwungene Bettruhe ist unter allen Umständen erforderlich. Suchen nach großen und nicht zurückgehenden Quetschungen oder blassen Stellen, hervorgerufen durch innere Blutungen. Sie können lebensbedrohend sein. Auf mögliche Operation vorbereitet sein.
Er sah die Todessprengsel. Sie waren faustgroß und schwarz, hatten viele Beine und rot glühende Augen und sandten Streifen aus brennendem Licht in die Luft. Sie drängten sich um ihn herum und huschten hierhin und dorthin. Ihre Stimmen glichen einem Flüstern; es klang, als werde dünnes Papier zerrissen. Sie ängstigten ihn, aber er konnte ihnen nicht entkommen. Er vermochte sich kaum zu bewegen.
Nur die Sterbenden sahen die Todessprengsel. Man sah sie, dann starb man. Nur sehr, sehr wenige Glückliche lebten danach weiter. Die Todessprengsel wussten, wann das Ende nahe war.
Blasen an Fingern und Zehen, verursacht durch Erfrierungen. Desinfektionsmittel auf alle aufplatzenden Blasen streichen. Die natürlichen Heilkräfte des Körpers unterstützen. Dauerhafte Schäden sind unwahrscheinlich.
Vor den Todessprengseln stand eine winzige Lichtgestalt. Sie war nicht mehr so durchscheinend, wie sie Kaladin bisher erschienen war, sondern aus reinem, weißem Licht. Das sanfte weibliche Gesicht war nun kantiger geworden. Edler, wie das eines Kriegers aus vergangenen Zeiten. Keineswegs mehr kindlich. Sie stand auf seiner Brust Wache und hielt ein Schwert aus Licht in den winzigen Händen.
Dieses Strahlen war so rein, so süß. Es schien das Glühen des Lebens zu sein. Wann immer ihm eines der Todessprengsel zu nahe kam, schoss sie darauf zu und schwang ihre strahlende Klinge.
Das Licht wehrte sie ab.
Aber es waren viele Todessprengsel. Immer wenn sein Blick wieder klar genug geworden war, waren es schon mehr geworden.
Ernste Halluzinationen, verursacht durch Kopfverletzungen. Patient muss unter Beobachtung bleiben. Alkoholgenuss verboten. Ruhe muss erzwungen werden. Lotborke verabreichen, damit Hirnschwellungen zurückgehen. Feuermoos kann in Extremfällen angewendet werden, der Patient darf aber nicht davon abhängig werden.
Wenn Medikamente nicht helfen, mag eine Schädeltrepanation nötig werden, um den Druck zu senken.
Oft tödlich.
Am Mittag betrat Teft die Baracke. Das Eintreten in die Schatten war wie das Hineinschlüpfen in eine Höhle. Er blickte nach links, wo für gewöhnlich die anderen Verwundeten schliefen. Im Augenblick waren sie aber alle draußen und genossen die Sonne. Allen fünf ging es gut, sogar Leyten.
Teft ging an den aufgerollten Laken am Rande des Raumes vorbei zum hinteren Teil, in dem Kaladin lag.
Armer Kerl, dachte Teft. Was ist wohl schlimmer: dem Tode nahe zu sein oder hier hinten ohne Licht zu liegen? Aber es war nötig. Brücke Vier spielte ein gefährliches Spiel. Es war ihnen erlaubt worden, Kaladin abzuschneiden, und bisher hatte ihnen niemand verboten, sich um ihn zu kümmern. Fast die gesamte Armee hatte gehört, wie Sadeas Kaladin dem Gericht des Sturmvaters übergeben hatte.
Gaz war gekommen, hatte sich Kaladin angesehen und in sich hineingekichert. Vermutlich hatte er seinen Vorgesetzten gesagt, dass Kaladin sterben würde. Mit solchen Wunden konnte kein Mensch lange überleben.
Aber Kaladin hielt durch. Vom Holzplatz her kamen ungewöhnlich oft Soldaten und warfen einen Blick in die Baracke. Es war unglaublich, dass er noch lebte. Die Leute im Lager redeten darüber. Er war dem Sturmvater übergeben und von ihm verschont worden. Ein Wunder. Das würde Sadeas nicht gefallen. Wie lange würde es dauern, bis eines der Hellaugen beschloss, seinen Hellherrn von diesem Problem zu erlösen? Sadeas konnte offiziell nichts unternehmen – nicht ohne seine Glaubwürdigkeit zu verlieren –, aber ein heimliches Vergiften oder Ersticken würde ihn aus seiner unangenehmen Lage befreien.
Also schirmte Brücke Vier Kaladin so weit wie möglich von neugierigen Blicken ab. Und es war immer jemand bei Kaladin. Immer.
Was für ein Sturmkerl, dachte Teft, als er neben dem fiebernden Kaladin niederkniete, der auf einem zerwühlten Laken lag. Er hatte die Augen geschlossen, sein Gesicht glänzte vor Schweiß, und der Körper war mit einer beängstigenden Menge von Verbänden umwickelt. Die meisten wiesen rote Flecken auf. Sie hatten nicht genug Geld, um die Verbände oft zu wechseln.
Narb hielt gerade Wache. Der kleine Mann mit dem kantigen Gesicht saß zu Kaladins Füßen.
»Wie geht es ihm?«, fragte Teft.
Narb antwortete leise: »Es scheint schlimmer zu werden, Teft. Ich habe gehört, wie er etwas von dunklen Gestalten gemurmelt hat. Er hat um sich geschlagen und ihnen befohlen, fortzugehen. Dann hat er die Augen geöffnet. Er hat mich nicht gesehen, aber irgendetwas hat er gesehen. Das schwöre ich.«
Todessprengsel, dachte Teft, und es lief ihm kalt den Rücken herunter. Kelek möge uns beschützen.
»Ich übernehme«, sagte Teft und setzte sich. »Hol dir was zu essen.«
Narb stand auf, er war blass. Es würde die Männer vernichten, wenn Kaladin zwar den Großsturm überlebt hatte, dann aber an den Wunden starb. Narb schlurfte mit gesenkten Schultern aus dem Raum.
Teft sah Kaladin lange an und versuchte seine Gedanken und Gefühle zu sammeln. »Warum jetzt?«, flüsterte er. »Warum hier? Nachdem so viele Ausschau gehalten und gewartet haben, kommst du ausgerechnet hierher?«
Aber Teft war natürlich etwas vorschnell. Er wusste es nicht mit Gewissheit. Er hatte nur Vermutungen und Hoffnungen. Nein, keine Hoffnungen, sondern Ängste. Er hatte die Voraussehenden zurückgewiesen. Und doch war er jetzt hier. Er fischte in seiner Tasche herum und holte drei kleine Diamantkugeln hervor. Es war lange her, seit er zum letzten Mal etwas von seinem Lohn hatte sparen können. Aber diese drei hatte er stets behalten. Er dachte nach, war besorgt. Ihr Sturmlicht glühte in seiner Hand.
Wollte er es wirklich wissen?
Teft biss die Zähne zusammen, bewegte sich näher an Kaladin heran und betrachtete das Gesicht des Bewusstlosen. »Du Bastard«, flüsterte er. »Du sturmverfluchter Bastard. Du hast einem Haufen von Gehängten ein wenig Erleichterung verschafft, sodass sie wieder atmen konnten. Und jetzt willst du sie allein lassen? Davon will ich nichts wissen, hörst du? Nichts.«
Er drückte die Kugeln in Kaladins Hand, schloss seine schlaffen Finger darum und legte ihm die Hand auf den Bauch. Dann lehnte sich Teft zurück. Was würde nun geschehen? Alles, was die Voraussehenden besaßen, waren Geschichten und Legenden. Narrengeschichten, wie Teft sie nannte. Müßige Träume.
Er wartete. Natürlich geschah nichts. Du bist ein genauso großer Narr wie sie, Teft, sagte er zu sich selbst. Er griff nach Kaladins Hand. Mit diesen Kugeln konnte er sich eine Menge Schnaps kaufen.
Plötzlich keuchte Kaladin auf und holte kurz und kräftig Luft.
Das Glühen in seiner Hand verblasste.
Teft erstarrte und riss die Augen auf. Lichtstreifen traten aus Kaladins Körper. Sie waren zwar schwach, aber es konnte kein Zweifel darüber herrschen, dass weißes Sturmlicht aus seinem Körper aufstieg. Es war, als würde Kaladin in plötzlicher Hitze baden. Seine Haut dampfte.
Ruckartig öffnete Kaladin die Augen, und auch aus ihnen floss Licht. Es hatte eine schwache Bernsteinfärbung. Er keuchte erneut laut auf, und die treibenden Lichtfetzen wirbelten um die offen liegenden Schnittwunden an seiner Brust. Einige versiegelten die Ränder und zogen sie zusammen.
Dann war es vorbei; das Licht aus den kleinen Diamantstücken erlosch. Kaladin schloss die Augen und entspannte sich. Seine Wunden waren zwar noch immer schlimm, und das Fieber tobte in ihm, aber in seine Haut war doch ein wenig Farbe zurückgekehrt. Und die Röte um die aufgedunsenen Wunden hatte abgenommen.
»Mein Gott«, sagte Teft und bemerkte, dass er zitterte. »Allmächtiger, aus dem Himmel geworfen, um in unseren Herzen zu wohnen … Es ist wahr.« Er neigte den Kopf zum Steinboden hinunter, kniff die Augen zu, und Tränen rannen aus den Winkeln.
Warum jetzt?, dachte er abermals. Warum hier?
Und warum im Namen des ganzen Himmels gerade ich?
Er kniete hundert Herzschläge lang, zählte, dachte nach, sorgte sich. Schließlich kämpfte er sich wieder auf die Beine und nahm die matt gewordenen Kugeln aus Kaladins Hand. Er musste sie gegen Kugeln mit Licht darin eintauschen. Dann würde er zurückkehren, damit Kaladin sie ebenfalls aussaugen konnte.
Er musste vorsichtig sein. Ein paar Kugeln am Tag, nicht zu viele. Wenn der Junge zu schnell gesund wurde, würde das eine zu große Aufmerksamkeit erregen.
Und ich muss es den Voraussehenden sagen, dachte er. Ich muss …
Die Voraussehenden waren aber fort. Tot, wegen dem, was er getan hatte. Falls es noch andere gab, so wusste er nicht, wie er sie finden sollte.
Wem sollte er es sagen? Wer würde ihm glauben? Vermutlich wusste nicht einmal Kaladin selbst, was er da tat. Es war das Beste, Stillschweigen zu bewahren, zumindest bis er sich vollkommen sicher war.
Und bis er wusste, was er tun sollte.
3
IN SIE EINGEBRANNT
»Innerhalb eines Herzschlages war Alezarv da und brachte eine Entfernung hinter sich, die eine Fußreise von mindestens vier Monaten darstellte.«
Ein weiteres Märchen, diesmal verzeichnet in Unter den Dunkeläugigen, von Calinam, Seite 102. Diese Geschichten sind von Berichten über Eidtore und Reisen zu fernen Orten durchdrungen, die nur einen Augenblick dauern.
Schallans Hand flog über das Papier, bewegte sich wie aus eigenem Antrieb, zeichnete, radierte. Zuerst dicke Striche wie Blutschlieren von einem aufgerissenen Daumen, der über rauen Granit fuhr. Dann winzige Linien wie die Kratzer einer Nadel.
Sie saß in ihrem schrankähnlichen steinernen Gemach im Konklave. Keine Fenster, kein Schmuck an den Granitwänden. Nur das Bett, der Nachttisch, ihre Truhe und ihr kleiner Zeichentisch, der ihr auch als Schreibtisch diente.
Ein einzelner Rubinbrom warf blutiges Licht auf ihre Zeichnung. Wenn sie für gewöhnlich eine lebenssprühende Szenerie schuf, musste sie sich bewusst daran erinnern, musste die Welt mit einem Blick eingefroren und in ihren Kopf gepresst haben. Sie hatte dies aber nicht getan, als Jasnah die Diebe umgebracht hatte. Sie war zu starr vor Entsetzen und kranker Faszination gewesen.
Trotzdem sah sie die ganze Szenerie genauso lebendig vor sich, als hätte sie sie sich eingeprägt. Und diese Erinnerungen verschwanden auch nicht, wenn sie sie auf das Papier bannte. Sie konnte sie einfach nicht loswerden. Die Morde waren in sie eingebrannt.
Sie rückte ein Stück von ihrem Zeichentisch weg. Ihre Hand zitterte. Das Bild vor ihr war eine genaue Kohlenachbildung der erstickenden Nachtlandschaft zwischen den Gassenmauern, in der sich eine Gestalt aus lodernden Flammen in den Himmel erhob. Das Gesicht war noch zu erkennen – mit Schatten anstelle der Augen, und die brennenden Lippen standen offen. Jasnahs Hand war gegen die Gestalt ausgestreckt, als wollte die Prinzessin sie abwehren oder anbeten.
Schallan hielt die kohlefleckigen Finger vor die Brust und starrte ihre Schöpfung an. Es war eine von jenen Dutzenden von Zeichnungen, die sie in den letzten Tagen angefertigt hatte. Der eine Mann verwandelte sich in Feuer, der andere erstarrte zu Kristall, die zwei weiteren lösten sich in Rauch auf. Sie konnte nur einen der beiden zeichnen, denn sie hatte in diesem Augenblick lediglich den östlichen Teil der Gasse gesehen. Ihre Zeichnungen von dem vierten Mann bestanden aus aufsteigendem Rauch; seine Kleidung lag bereits auf dem Boden.
Sie fühlte sich schuldig, weil sie seinen Tod nicht aufzeichnen konnte. Und sie kam sich wegen dieser Schuldgefühle dumm vor.
Die Logik verdammte Jasnahs Tat nicht. Ja, die Prinzessin hatte sich absichtlich in Gefahr begeben, aber das nahm denjenigen, die ihr hatten wehtun wollen, nicht die Verantwortung. Die Männer hatten vorsätzlich gehandelt. Schallan hatte in den letzten Tagen über philosophischen Büchern gebrütet, von denen die meisten die Prinzessin entlasteten.
Aber Schallan war dabei gewesen. Sie hatte diese Männer sterben sehen. Sie hatte den Schrecken in ihren Augen gesehen, und deswegen fühlte sie sich ganz entsetzlich. Hatte es denn keine andere Möglichkeit gegeben?
Töten oder getötet werden. Das war die Philosophie des Stärkeren. Sie entschuldigte Jasnahs Verhalten.
Handlungen sind nicht böse. Die Absicht ist böse, und Jasnahs Absicht war es gewesen, diese Männer davon abzuhalten, anderen Menschen wehzutun. Das war die Philosophie des Zwecks. Sie lobte Jasnah sogar.
Moral ist etwas, das von den Idealen der Menschen getrennt existiert. Sie besteht als Ganzes, und die Menschen können sich ihr annähern, sie aber niemals vollkommen verstehen. Die Philosophie der Ideale. Sie behauptete, die Entfernung des Bösen sei letztlich moralisch, und daher war Jasnahs Vernichtung der bösen Männer vollkommen gerechtfertigt.
Das Ziel muss gegen die Mittel abgewogen werden. Wenn das Ziel gut ist, dann sind die Schritte zu seiner Erreichung ebenfalls gut, auch wenn einige von ihnen für sich genommen verwerflich sein mögen. Die Philosophie des Strebens. Mehr als alle anderen philosophischen Richtungen nannte sie Jasnahs Handlungen ethisch.
Schallan zog das Blatt von ihrem Zeichenbrett und warf es neben die anderen, die auf ihrem Bett verstreut lagen. Ihre Finger bewegten sich wieder, packten den Kohlestift und begannen mit einem neuen Bild auf dem weißen Blatt Papier, das auf dem Brett festgebunden war und ihr nicht entkommen konnte.
Ihr Diebstahl nagte ebenso an ihr wie die Todesfälle. Jasnahs Befehl, Schallan möge nun Moralphilosophie studieren, zwang sie auch, über ihre eigene schlimme Tat nachzudenken. Sie war nach Kharbranth gekommen, um das Fabrial zu stehlen und mit ihm sowohl ihre Brüder als auch ihr Haus vor den gewaltigen Schulden und einer völligen Vernichtung zu bewahren. Doch am Ende war das nicht der Grund gewesen, warum Schallan den Seelengießer gestohlen hatte. Sie hatte ihn an sich genommen, weil sie wütend auf Jasnah gewesen war.
Falls die Absicht wichtiger als die Handlung selbst war, dann musste sich Schallan dafür verdammen. Vielleicht würde die Philosophie des Strebens – die behauptete, die Ziele seien wichtiger als die Schritte zu deren Erlangung – mit dem, was sie getan hatte, übereinstimmen. Aber das war die Philosophie, die sie am abscheulichsten fand. Schallan saß hier, zeichnete die Bilder in ihrem Kopf und verdammte Jasnah. Aber Schallan war diejenige, die diese Frau hintergangen hatte, eine Frau, die ihr vertraut und sie aufgenommen hatte. Und nun plante sie, mit dem Seelengießer eine Häresie zu begehen, indem sie ihn benutzen wollte, obwohl sie nicht zu den Feuerern gehörte.
Der Seelengießer war in einer Ecke von Schallans Truhe versteckt. Der Diebstahl lag drei Tage zurück, und noch hatte Jasnah nichts darüber gesagt. Sie trug den falschen Seelengießer jeden Tag. Sie sagte nichts und verhielt sich auch nicht anders als sonst. Möge der Allmächtige es geben, dass sie nicht wieder hinausging und sich in Gefahr brachte, damit sie ihre Angreifer töten konnte.
Natürlich gab es da noch etwas anderes an dieser Nacht, worüber Schallan nachdenken musste. Sie besaß jetzt eine versteckte Waffe, die sie noch nie eingesetzt hatte. Sie kam sich dumm vor, weil sie in jener Nacht nicht einmal daran gedacht hatte, sie hervorzuholen. Aber sie war noch nicht daran gewöhnt …
Schallan erstarrte und erkannte erst jetzt, was sie da zeichnete. Es war keine weitere Szene aus der Gasse, sondern ein üppig ausgestatteter Raum mit einem dicken, reich gemusterten Teppich und Schwertern an den Wänden. Ein langer Esstisch mit den Überresten eines Mahls.
Und ein toter Mann in feiner Kleidung, der mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden lag, während das Blut um ihn herum Lachen bildete. Sie sprang zurück, warf die Kohle beiseite und zerknüllte das Papier. Zitternd setzte sie sich auf das Bett zwischen die Zeichnungen. Sie ließ das zerknitterte Blatt fallen, hob die Finger an die Stirn und spürte kalten Schweiß.
Etwas stimmte nicht mit ihr – und mit den Zeichnungen.
Sie brauchte frische Luft. Sie musste dem Tod, der Philosophie und den Fragen entkommen. Also stand sie auf und eilte in das Hauptzimmer von Jasnahs Gemächern. Die Prinzessin befand sich bei ihren Nachforschungen, wie immer. Sie hatte nicht verlangt, dass Schallan heute zum Schleier kam. Hatte sie erkannt, dass ihr Mündel Zeit zum Nachdenken brauchte? Oder verdächtigte sie Schallan bereits, den Seelengießer gestohlen zu haben und vertraute ihr nicht länger?
Schallan eilte durch das Zimmer. Es war nur mit den wenigen Möbeln ausgestattet, die König Taravangian bereitgestellt hatte. Schallan zog die Tür zum Korridor auf und wäre beinahe mit einer Dienerin zusammengestoßen, die gerade den Klopfer ergreifen wollte.
Die Frau fuhr zusammen, und Schallan stieß einen spitzen Schrei aus. »Hellheit«, sagte die Frau und verneigte sich sofort. »Ich bitte um Entschuldigung, aber eine Eurer Spannfedern blitzt.« Die Frau hielt die Feder hoch, die an der Seite mit einem blinkenden Rubin versehen war.
Schallan atmete tief ein und aus und beruhigte sich. »Danke«, sagte sie. Wie Jasnah ließ sie ihre Spannfedern in der Obhut der Dienerschaft, da sie oft nicht in ihrem Zimmer war und es ihr deshalb schnell entgehen konnte, wenn jemand Verbindung mit ihr aufnehmen wollte.
Heute aber war sie versucht, das Ding in Ruhe zu lassen und weiterzugehen. Sie fühlte sich noch immer ganz durcheinander. Aber sie musste mit ihren Brüdern sprechen, insbesondere mit Nan Balat, und er war bei den letzten Malen, da sie mit ihrem Zuhause gesprochen hatte, nicht zugegen gewesen. Sie nahm die Spannfeder und schloss die Tür. Sie wagte es nicht, in ihr Zimmer zurückzukehren, wo sie von all den Zeichnungen angeklagt wurde. Im Hauptraum befand sich ein Schreibtisch mit Spannfederbrett. Dorthin begab sie sich und drehte den Rubin.
Schallan?, schrieb die Feder. Hast du es bequem? Das war ein Kodesatz, der anzeigte, dass sich tatsächlich Nan Balat – oder wenigstens seine Verlobte – auf der anderen Seite befand.
Mein Rücken tut weh, und mein Handgelenk juckt,
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: