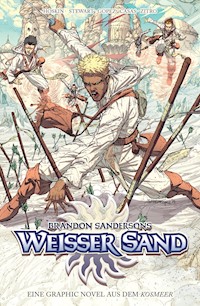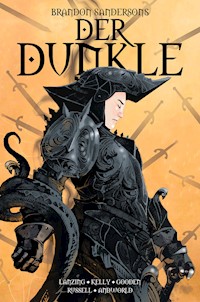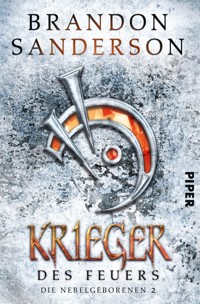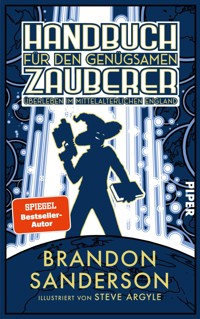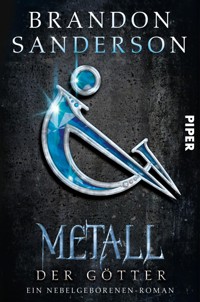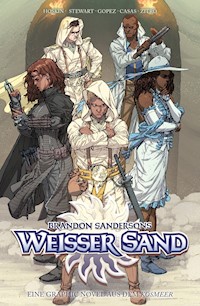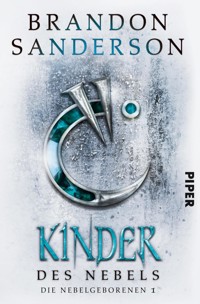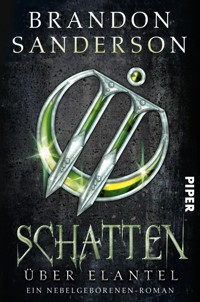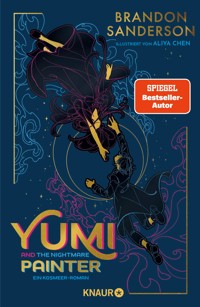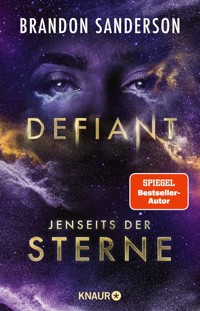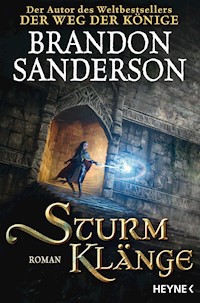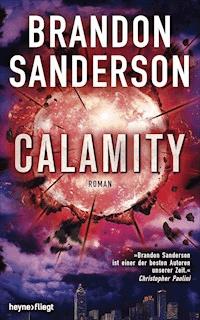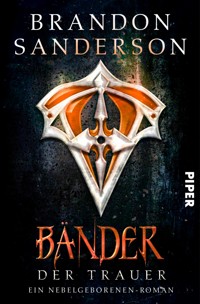
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Superstar Brandon Sanderson kehrt erneut in die Welt der Nebelgeborenen zurück: Die Bänder der Trauer sind ein Mythos. Sie sollen einst dem Obersten Herrscher selbst gehört haben, aber für die meisten ist dies nur eine Legende. Die metallenen Armreife, die ihrem Träger unvorstellbare Macht verleihen, existieren nicht. Oder doch? Als sich die Anzeichen verdichten, dass südlich von Elantel Hinweise auf den Verbleib der magischen Bänder gefunden wurden, müssen Wax und Wayne ermitteln. Und ihre Mission erweist sich schnell als weitaus größer und gefährlicher als gedacht ... Weitere Bände der Reihe: Erstes Zeitalter der Nebelgeborenen: Kinder des Nebels (Band 1) Krieger des Feuers (Band 2) Held aller Zeiten (Band 3) Zweites Zeitalter der Nebelgeborenen (»Wax & Wayne«-Reihe): Hüter des Gesetzes (Band 4) (vormals erschienen als: Jäger der Macht) Schatten über Elantel (Band 5) Bänder der Trauer (Band 6) Metall der Götter (Band 7)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 675
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy!
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Bänder der Trauer« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Für Ben Olsen, der einen Haufen verrückter Schriftsteller als Freunde aushält und immer die Zeit findet, unsere Bücher besser zu machen.
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Karen Gerwig
ISBN 978-3-492-97885-9
© 2016 by Dragonsteel, LLC
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Bands of Mourning. A Mistborn Novel« bei Tor Books, New York
Deutschsprachige Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München 2017
Covergestaltung und -motiv: www.buerosued.de
Karten und Illustrationen: Isaac Stewart und Ben McSweeney
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Dank
Prolog
Teil 1
1
2
3
4
Teil 2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Teil 3
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Epilog
Nachwort
Ars Arcanum
Über die drei metallischen Künste
Dank
Dieses Buch erscheint in dem Jahr, in dem die Nebelgeborenen-Reihe zehn Jahre alt wird. Wenn ich bedenke, was ich alles sonst noch getan habe, kommen mir sechs Bücher in zehn Jahren wie eine große Leistung vor! Ich kann mich immer noch an die frühen Monate erinnern, in denen ich wie wild an der Trilogie schrieb und versuchte, etwas zu schaffen, das wirklich zeigen sollte, was ich als Schriftsteller kann. Die Nebelgeborenen wurden zu meinem Markenzeichen, und ich hoffe, ihr werdet diesen Band für einen würdigen Einstieg in den Kanon halten.
Wie immer haben in dieses Buch viele Leute Arbeit hineingesteckt. Zunächst einmal ist da die hervorragende Kunst von Ben McSweeney und Isaac Stewart – die Karten und Symbole sind von Isaac, und Ben hat sich um die Zeitungskunst gekümmert. Beide haben mir auch sehr mit dem Text der Zeitung geholfen; Isaac hat sogar persönlich den Nicki-Savage-Artikel dafür geschrieben – da die Idee war, Jak jetzt seine Arbeit anpreisen zu lassen, wollten wir ihm eine andere Stimme geben. Ich finde, es ist toll geworden!
Das Cover stammt in den USA von Chris McGrath und bei der UK-Ausgabe von Sam Green. Beide arbeiten als Künstler schon lange an dieser Serie, und ihre Arbeit wird immer besser. Für das Lektorat war Moshe Feder von Tor zuständig, während Simon Spanton das Projekt zu Gollancz in Großbritannien gebracht hat. An diesem Unternehmen beteiligte Agenten waren Eddie Schneider, Sam Morgan, Krystyna Lopez, Christa Atkinson und Tae Keller bei JABberwocky in den USA; geleitet wurde alles von dem erstaunlichen Joshua Bilmes. In Großbritannien könnt ihr John Berlyne von der Zeno Agency danken, ein rundherum großartiger Typ, der viele Jahre hart dafür gearbeitet hat, bis meine Bücher endlich auch Großbritannien knacken konnten.
Bei Tor Books möchte ich außerdem Tom Doherty, Linda Quinton, Marco Palmieri, Karl Gold, Diana Pho, Nathan Weaver und Rafal Gibek danken. Die Textredaktion wurde von Terry McGarry übernommen, und der Hörbuchsprecher ist Michael Kramer, mein persönlicher Lieblingserzähler – der jetzt vermutlich gerade rot wird, weil er das euch allen, die ihr gerade zuhört, vorlesen muss. Bei Macmillan Audio möchte ich Robert Allen, Samantha Edelson und Mitali Dave danken.
Für die Kontinuität, allgemeines Lektoratsfeedback und zahllose andere Jobs war Peter Ahlstrom der Tadellose verantwortlich. In meinem Team arbeiten außerdem Kara Stewart, Karen Ahlstrom und Adam Horne. Und natürlich meine wundervolle Ehefrau Emily.
Wir haben uns diesmal besonders auf unsere Betaleser verlassen, denn das Buch konnte nicht die Schreibgruppe durchlaufen. Das Team besteht aus: Peter Ahlstrom, Alice Arneson, Gary Singer, Eric James Stone, Brian T. Hill, Kristina Kugler, Kim Garrett, Bob Kluttz, Jakob Remick, Karen Ahlstorm, Kalyani Poluri, Ben »Wooow, das Buch ist mir gewidmet, schaut mal, ich bin wichtig!« Olsen, Lyndsey Luther, Samuel Lund, Bao Pham, Aubree Pham, Megan Kanne, Jory Philips, Trae Cooper, Christi Jacobsen, Eric Lake und Isaac Stewart. (Für alle, die sich wundern: Ben war Gründungsmitglied meiner ursprünglichen Schreibgruppe mit Dan Wells und Peter Ahlstrom. Im Hauptberuf ist er Computermensch und war dann der Einzige von uns in der Originalgruppe, der keine Ambitionen hatte, im Verlagswesen zu arbeiten. Dafür ist er seit vielen Jahren geschätzter Leser und Freund. Er hat mich außerdem auf die Fallout-Reihe gebracht, das also auch noch.) Korrekturleser waren die meisten der oben Erwähnten, plus: Kerry Wilcox, David Behrens, Ian McNatt, Sarah Fletcher, Matt Wiens und Joe Dowswell.
Tja, das waren einige! Diese Leute sind wunderbar, und wenn ihr meine frühen Bücher mit den späteren vergleicht, nehme ich an, ihr werdet feststellen, dass die Hilfe dieser Leute nicht nur beim Ausmerzen von Tippfehlern unschätzbar war, sondern dass sie mir auch geholfen haben, dichter zu erzählen. Zu guter Letzt möchte ich euch Lesern danken, dass ihr es zehn Jahre mit mir ausgehalten habt und bereit wart, die seltsamen Ideen zu akzeptieren, die ich euch um die Ohren gehauen habe. Die Nebelgeborenen sind noch nicht mal zur Hälfte mit ihrer Entwicklung durch, die ich für sie geplant habe. Ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, was noch auf euch zukommt, und in diesem Buch wird ein Teil davon endlich langsam enthüllt.
Viel Spaß damit!
Prolog
»Telsin!«, zischte Waxillium, während er aus der Trainingshütte kroch.
Mit einem kurzen Blick zurück verzog Telsin das Gesicht und duckte sich tiefer. Mit ihren sechzehn Jahren war Waxilliums Schwester ein Jahr älter als er. Ihre langen dunklen Haare umrahmten eine Stupsnase und volle Lippen, und bunte, v-förmige Streifen zierten ihre traditionelle Terris-Robe. Diese Gewänder standen ihr irgendwie viel besser als ihm. An Telsin sahen sie elegant aus. Waxillium hingegen fühlte sich, als hätte er einen Sack an.
»Geh weg, Asinthew«, sagte sie, während sie sich an der Seite der Hütte entlang vorwärtsschob.
»Du verpasst noch den Abendvortrag.«
»Sie werden gar nicht merken, dass ich weg bin. Sie prüfen es nie nach.«
In der Hütte schwadronierte Meister Tellingdwar über die angemessene Terris-Haltung. Gehorsam, Sanftmut und was sie »respektvolle Würde« nannten. Er sprach zu den jüngeren Schülern; die älteren, wie Waxillium und seine Schwester, sollten meditieren.
Telsin kroch durch das baumbewachsene Viertel von Elantel, das man schlicht das Village nannte. Waxillium zögerte leicht beunruhigt, dann eilte er seiner Schwester hinterher.
»Du bekommst nur Ärger«, sagte er, als er sie eingeholt hatte. Er folgte ihr um den Stamm einer riesigen Eiche. »Deinetwegen bekomme ich noch Ärger.«
»Na und?«, entgegnete sie. »Was hast du überhaupt immer mit den Regeln?«
»Nichts. Ich finde nur ...«
Sie stolzierte in den Wald davon. Seufzend folgte er ihr, und irgendwann trafen sie auf drei andere Terris-Jugendliche: zwei Mädchen und einen hochgewachsenen Jungen. Kwashim, eines der Mädchen, musterte Waxillium von oben bis unten. Sie war schmal und hatte dunkle Haut. »Du hast ihn mitgebracht?«
»Er ist mir gefolgt«, verteidigte sich Telsin.
Waxillium lächelte Kwashim hoffnungsvoll an, dann Idashwy, das andere Mädchen. Sie hatte weit auseinanderstehende Augen und war so alt wie er. Und beim Einträchtigen ... sie war umwerfend. Sie bemerkte seinen Blick und blinzelte ein paarmal, dann wandte sie mit einem züchtigen Lächeln den Blick ab.
»Er wird uns verraten«, sagte Kwashim und riss damit seine Aufmerksamkeit von dem anderen Mädchen los. »Das weißt du genau.«
»Werde ich nicht!«, blaffte Waxillium.
Kwashim warf ihm einen finsteren Blick zu. »Es könnte sein, dass du den Abendunterricht versäumst. Wer wird dann die ganzen Fragen beantworten? Es wird rostruhig im Klassenzimmer, wenn keiner die Lehrerin wortreich anhimmelt.«
Forch, der große Junge, stand gerade so im Schatten. Waxillium schaute ihn nicht an, mied seinen Blick. Er weiß es nicht, oder? Er kann es nicht wissen. Forch war der Älteste von ihnen, sprach aber wenig.
Er war ein Zwillingsgeborener, genau wie Waxillium. Nicht, dass einer von ihnen in diesen Zeiten Allomantie benutzt hätte. Im Village wurde ihre Terris-Seite – ihre Ferrochemie – betont. Die Tatsache, dass sowohl er als auch Forch Münzwerfer waren, bedeutete den Terris nichts.
»Los, gehen wir«, sagte Telsin. »Keine Diskussionen mehr. Wir haben wahrscheinlich nicht viel Zeit. Wenn mein Bruder mitkommen will, dann von mir aus.«
Sie folgten ihr unter dem Blätterdach hindurch; Laub raschelte unter ihren Füßen. Bei so viel Grün überall konnte man leicht vergessen, dass man sich mitten in einer riesigen Stadt befand. Die Geräusche von rufenden Männern und eisenbeschlagenen Hufen auf Kopfsteinpflaster drangen nur gedämpft zu ihnen, und man konnte den Rauch hier weder sehen noch riechen. Die Terris gaben sich große Mühe, ihren Teil der Stadt ruhig, beschaulich und friedlich zu halten.
Waxillium hätte das Viertel eigentlich lieben müssen.
Die fünf Jugendlichen erreichten bald die Loge der Synode, wo die Terris-Ältesten ihre Büros hatten. Telsin bedeutete den anderen zu warten, während sie zu einem bestimmten Fenster huschte, um zu lauschen. Waxillium ertappte sich dabei, wie er sich besorgt umblickte. Der Abend brach an, im Wald schwand das Licht, aber es konnte jederzeit irgendwer vorbeikommen und sie entdecken.
Mach dir nicht so viele Sorgen, ermahnte er sich selbst. Er musste wie seine Schwester bei ihren Eskapaden mitmachen, dann würden sie ihn als einen der ihren betrachten. Oder?
Schweiß lief ihm seitlich am Gesicht herab. Nicht weit von ihm lehnte Kwashim vollkommen unbekümmert an einem Baum, und ein Grinsen verzog ihre Lippen, als sie bemerkte, wie nervös er war. Forch stand im Schatten, duckte sich nicht, aber Rost – er hätte einer der Bäume sein können, so viel Gefühl zeigte er. Waxillium warf einen Seitenblick auf Idashwy mit ihren großen Augen, und sie wurde rot und wandte den Blick ab.
Telsin schlich zu ihnen zurück. »Sie ist da drin.«
»Das ist das Büro unserer Großmutter«, sagte Waxillium.
»Natürlich ist es das«, erwiderte Telsin. »Und sie wurde wegen eines Notfalls in ihr Büro gerufen. Stimmt’s, Idashwy?«
Das ruhige Mädchen nickte. »Ich habe die Älteste Vwafendal an meinem Meditationsraum vorbeirennen sehen.«
Kwashim grinste. »Also passt sie nicht auf.«
»Worauf passt sie nicht auf?«, fragte Waxillium.
»Das Zinntor«, sagte Kwashim. »Wir können in die Stadt hinaus. Das wird sogar noch einfacher als sonst!«
»Also sonst?«, fragte Waxillium und blickte entsetzt von Kwashim zu seiner Schwester. »Ihr habt das schon mal gemacht?«
»Na klar«, antwortete Telsin. »Im Village kriegt man ja nur schwer was Gutes zu trinken. Zwei Straßen weiter ist aber ein echt guter Pub.«
»Du bist ein Außenseiter«, sagte Forch, als er zu ihnen trat. Er sprach langsam, mit Bedacht, als erforderte jedes Wort gesonderte Beachtung. »Warum sollte es dich kümmern, wenn wir gehen? Sieh dich nur an, du zitterst. Wovor hast du Angst? Du hast den größten Teil deines Lebens da draußen gelebt.«
Du bist ein Außenseiter, sagten sie. Warum konnte sich seine Schwester in jede Gruppe einschleichen? Warum musste er immer draußen bleiben?
»Ich zittere nicht«, sagte er zu Forch. »Ich will nur keinen Ärger bekommen.«
»Der verrät uns ganz sicher«, erklärte Kwashim.
»Werde ich nicht!« Nicht deswegen jedenfalls, dachte Waxillium.
»Gehen wir«, sagte Telsin und führte das Rudel durch den Wald zum Zinntor, was ein hochtrabender Name war für etwas, das eigentlich eine ganz normale Straße war – auch wenn sie zugegebenermaßen einen steinernen Torbogen besaß, in den antike Terris-Symbole für die sechzehn Metalle eingemeißelt waren.
Dahinter lag eine andere Welt. Leuchtende Gaslampen säumten die Straßen, Zeitungsjungen trotteten mit unter den Arm geklemmten, unverkauften Zeitungen nach Hause, Arbeiter steuerten die lauten Pubs an. Er hatte diese Welt eigentlich nie richtig kennengelernt; er war in einer noblen Villa voller feiner Kleider, Kaviar und Wein aufgewachsen.
Etwas an diesem einfachen Leben sprach ihn an. Vielleicht würde er es hier finden. Das, was er nie gefunden hatte. Das, was alle zu haben schienen, das er selbst aber nicht einmal benennen konnte.
Die anderen vier Jugendlichen eilten hinaus, an dem Gebäude mit den dunklen Fenstern vorbei, wo zu dieser Zeit am Abend normalerweise Waxilliums und Telsins Großmutter saß und las. Die Terris beschäftigten keine Wachleute an den Eingängen zu ihrem Bereich – und dennoch wachten sie.
Waxillium ging nicht, noch nicht. Er blickte nach unten und zog die Ärmel seiner Robe zurück, um die Metallgeist-Armspangen zu sehen, die er darunter trug.
»Kommst du?«, rief ihm Telsin zu.
Er antwortete nicht.
»Natürlich nicht. Du willst eben nie Ärger riskieren.«
Sie führte Forch und Kwashim fort. Überraschenderweise zögerte aber Idashwy. Das ruhige Mädchen blickte fragend zu ihm zurück.
Ich schaffe das, dachte Waxillium. Es ist keine große Sache. Der Spott seiner Schwester klang ihm noch in den Ohren, als er sich weiterzugehen zwang und zu Idashwy aufschloss. Ihm war übel, aber er ging neben ihr her und genoss ihr schüchternes Lächeln.
»Und, was war das für ein Notfall?«, fragte er Idashwy.
»Hm?«
»Der Notfall, zu dem meine Großmutter gerufen wurde?«
Idashwy zuckte die Achseln und zog ihre Terris-Robe aus, was ihn kurz erschreckte, bis er sah, dass sie darunter einen gewöhnlichen Rock und eine Bluse trug. Sie warf die Robe in die Büsche. »Ich weiß nicht viel. Ich habe deine Großmutter zur Loge der Synode laufen sehen und gehört, wie Tathed sie danach fragte. Irgendeine Krise. Wir hatten ohnehin vor, heute Abend hinauszuschleichen, deshalb dachte ich mir, das wäre ein guter Zeitpunkt.«
»Aber der Notfall ...«, sagte Waxillium mit einem Blick über die Schulter.
»Etwas von einem Polizisten, der kommt, um sie zu befragen.«
Ein Polizist?
»Na komm, Asinthew«, sagte sie und nahm seine Hand. »Deine Großmutter macht bestimmt kurzen Prozess mit dem Außenseiter. Es kann sein, dass sie schon auf dem Weg hierher ist!«
Er war auf der Stelle erstarrt.
Idashwy schaute ihn an. Ihre lebhaften braunen Augen erschwerten ihm das Denken. »Komm schon«, drängte sie. »Hinauszuschleichen ist ja wohl kaum ein Verbrechen. Hast du nicht vierzehn Jahre hier draußen gelebt?«
Rost.
»Ich muss gehen«, sagte er, drehte um und rannte auf den Wald zu.
Idashwy blieb stehen, wo er sie verlassen hatte. Waxillium betrat den Wald und rannte zur Loge der Synode. Jetzt hält sie dich für einen Feigling, das weißt du, gab ein Teil von ihm zu bedenken. Die anderen auch.
Waxillium kam mit hämmerndem Herzen und in geduckter Haltung vor dem Bürofenster seiner Großmutter zum Stehen. Er presste sich an die Wand, und ja, er konnte durch das offene Fenster etwas hören.
»Wir sind unsere eigene Polizei, Constable«, sagte drinnen Großmutter Vwafendal. »Das wissen Sie.«
Waxillium wagte es, sich hochzudrücken und durchs Fenster zu spähen, wo er seine Großmutter an ihrem Schreibtisch sitzen sah, ein Sinnbild der Terris-Rechtschaffenheit mit geflochtenen Haaren und in makelloser Robe.
Der Mann, der ihr gegenüber vor dem Tisch stand, hielt als Zeichen des Respekts seinen Constable-Hut unter dem Arm. Er war ein älterer Mann mit hängendem Schnurrbart, und die Abzeichen auf seiner Brust wiesen ihn als Captain und Detective aus. Hochrangig. Wichtig.
Ja!, dachte Waxillium und fummelte in seiner Tasche nach seinen Notizen.
»Die Terris überwachen sich selbst«, sagte der Polizist, »weil sie selten Überwachung brauchen.«
»Und auch jetzt brauchen sie keine.«
»Mein Informant ...«
»Dann haben Sie also einen Informanten?«, fragte Großmutter. »Ich dachte, es sei ein anonymer Tipp gewesen.«
»Anonym, ja«, sagte der Polizist und legte ein Blatt Papier auf den Schreibtisch. »Aber ich betrachte das als mehr als nur einen ›Tipp‹.«
Waxilliums Großmutter nahm das Blatt in die Hand. Waxillium wusste, was darauf stand. Er selbst hatte es der Polizei geschickt, zusammen mit einem Brief.
Ein Hemd, das nach Rauch riecht, hängt hinter seiner Tür.
Schlammige Stiefel, die zur Größe der Spuren vor dem abgebrannten Gebäude passen.
Flaschen mit Öl in der Lade unter seinem Bett.
Die Liste umfasste ein Dutzend Hinweise auf Forch als Brandstifter des Speisesaals. Es bereitete Waxillium einen Nervenkitzel zu sehen, dass die Polizei seine Untersuchungsergebnisse ernst nahm.
»Verwirrend«, sagte Großmutter, »aber ich sehe nichts auf dieser Liste, was Ihnen das Recht gäbe, in unseren Bereich einzudringen, Captain.«
Der Polizist beugte sich herab, um die Hände auf der Tischkante abzustützen und ihr so die Stirn bieten zu können. »Sie haben unsere Hilfe nicht so schnell zurückgewiesen, als wir die Feuerwehr geschickt haben, um den Brand zu löschen.«
»Ich nehme immer Hilfe an, wenn sie Leben rettet«, sagte Großmutter. »Aber ich brauche keine Hilfe dabei, jemanden einzusperren. Danke.«
»Liegt es daran, dass dieser Forch ein Zwillingsgeborener ist? Haben Sie Angst vor seinen Kräften?«
Sie schenkte ihm einen spöttischen Blick.
»Älteste«, begann er und holte tief Luft. »Sie haben einen Kriminellen in Ihren Reihen ...«
»Falls dem so sein sollte«, sagte sie, »werden wir uns selbst um dieses Individuum kümmern. Ich habe die Häuser des Leids und der Zerstörung gesehen, die ihr Außenseiter Gefängnisse nennt, Captain. Ich werde nicht zulassen, dass einer von uns auf der Grundlage von Hörensagen und anonymen, per Post verschickten Fantastereien dort eingeschlossen wird.«
Der Polizist atmete aus und richtete sich wieder auf. Mit einem lauten Knall legte er etwas Neues auf den Tisch. Waxillium kniff die Augen zusammen, konnte aber nichts erkennen, weil er den Gegenstand mit der Hand verdeckte.
»Wissen Sie viel über Brandstiftung, Älteste?«, fragte der Polizist leise. »Sie wird oft von mehreren Tätern verübt. Häufig, um einen Diebstahl zu verschleiern oder einen Betrug zu begehen, oder es handelt sich lediglich um einen ersten Angriff. In solch einem Fall ist das Feuer üblicherweise nur ein Vorbote. Im besten Fall haben Sie einen Pyromanen, der bloß darauf wartet, wieder etwas anzuzünden. Im schlimmsten ... nun ja, dann kommt etwas Größeres, Älteste. Etwas, das Sie alle bedauern werden.«
Großmutters Mund wurde zu einer schmalen Linie. Der Polizist nahm die Hand weg und enthüllte, was er auf den Tisch gelegt hatte. Eine Patrone.
»Was ist das?«, fragte Großmutter.
»Eine Erinnerung.«
Großmutter wischte die Patrone vom Tisch; sie flog ganz in der Nähe von Waxilliums Versteck gegen die Wand. Er sprang zurück und kauerte sich mit hämmerndem Herzen tiefer hin.
»Bringen Sie Ihre Instrumente des Todes nicht an diesen Ort!«, fauchte Großmutter.
Waxillium war gerade rechtzeitig wieder am Fenster, um zu sehen, wie der Constable seinen Hut aufsetzte. »Wenn der Junge noch einmal etwas anzündet«, sagte er leise, »lassen Sie mich holen. Hoffentlich ist es dann nicht schon zu spät. Guten Abend.«
Er ging ohne ein weiteres Wort. Waxillium kauerte sich neben das Gebäude, besorgt, dass sich der Polizist umschauen und ihn sehen würde. Doch das passierte nicht. Der Mann schritt den Weg entlang und verschwand in den abendlichen Schatten.
Aber Großmutter ... sie hatte es nicht geglaubt. Sah sie es nicht? Forch hatte ein Verbrechen verübt. Und sie würden ihn einfach in Ruhe lassen? Warum ...
»Asinthew«, sagte Großmutter und benutzte damit Waxilliums Terris-Namen, wie sie es immer tat. »Würdest du bitte zu mir kommen?«
Sofort spürte er einen ängstlichen Stich, gefolgt von Scham. Er stand auf. »Woher wusstest du es?«, fragte er durch das Fenster.
»Reflektion in meinem Spiegel, Kind«, antwortete sie. Sie hielt eine Tasse Tee in beiden Händen und schaute ihn nicht an. »Tu, was ich dir sage. Wenn es dir recht ist.«
Missmutig trottete er um das Gebäude herum und durch die Vordertür der Holzhütte. Der ganze Raum roch nach der Holzbeize, die er kürzlich aufzutragen geholfen hatte. Das Zeug klebte immer noch unter seinen Fingernägeln.
Er betrat den Raum und schloss die Tür. »Warum hast du ...«
»Setz dich bitte, Asinthew«, sagte sie leise.
Er ging zum Schreibtisch, setzte sich aber nicht auf den Gästestuhl. Er blieb stehen, genau dort, wo auch der Polizist gestanden hatte.
»Deine Handschrift«, sagte Großmutter und strich das Papier glatt, das der Polizist dagelassen hatte. »Habe ich dir nicht gesagt, dass das Thema Forch unter Kontrolle ist?«
»Du sagst viel, Großmutter. Ich glaube, wenn ich Beweise sehe.«
Vwafendal beugte sich vor; Dampf stieg aus der Tasse in ihren Händen auf. »Oh, Asinthew«, sagte sie. »Ich dachte, du hättest dich entschlossen, zu uns zu passen.«
»Habe ich auch.«
»Warum horchst du dann an meinem Fenster, statt an den Abendmeditationen teilzunehmen?«
Er wurde rot und wandte den Blick ab.
»Beim Weg der Terris geht es um Ordnung, Kind«, erklärte Großmutter. »Wir haben unsere Regeln aus gutem Grund.«
»Und Gebäude niederzubrennen ist nicht gegen die Regeln?«
»Natürlich ist es das«, sagte Großmutter. »Aber Forch ist nicht deine Verantwortung. Wir haben mit ihm gesprochen. Er ist reumütig. Sein Verbrechen war das eines fehlgeleiteten Jugendlichen, der zu viel Zeit allein verbringt. Ich habe einige der anderen gebeten, sich mit ihm anzufreunden. Er wird für sein Vergehen Buße tun – auf unsere Art. Würdest du ihn lieber im Gefängnis verrotten lassen?«
Waxillium zögerte, dann seufzte er und ließ sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch seiner Großmutter fallen. »Ich will herausfinden, was richtig ist«, flüsterte er, »und es dann tun. Warum ist das so schwer?«
Großmutter runzelte die Stirn. »Richtig und falsch sind leicht zu unterscheiden, Kind. Aber ich gebe zu, dass die Wahl, dem zu folgen, von dem man weiß, dass es ...«
»Nein«, unterbrach Waxillium sie. Dann zuckte er innerlich zusammen. Es war nicht weise, Großmutter V. zu unterbrechen. Sie schrie nie, aber ihre Missbilligung konnte sich anfühlen wie ein bevorstehendes Gewitter. Er fuhr leiser fort: »Nein, Großmutter. Herauszufinden, was richtig ist, ist nicht leicht.«
»Es steht in unseren Regeln geschrieben. Du bekommst es jeden Tag in deinem Unterricht gelehrt.«
»Das ist eine Stimme«, sagte Waxillium, »eine Philosophie. Es gibt so viele ...«
Großmutter streckte die Hand über den Tisch und legte sie auf seine. Ihre Haut war warm von der Teetasse. »Ach, Asinthew«, sagte sie. »Ich verstehe, wie schwer es für dich sein muss. Ein Kind zweier Welten.«
Zwei Welten, dachte er sofort, aber kein Zuhause.
»Doch du musst beherzigen, was man dich lehrt«, fuhr Großmutter fort. »Du hast mir versprochen, du würdest unseren Regeln gehorchen, solange du hier bist.«
»Ich habe es versucht.«
»Ich weiß. Ich höre gute Berichte von Tellingdwar und deinen anderen Lehrern. Sie sagen, du hast den Stoff besser gelernt als alle anderen – dass man meinen könnte, du hättest dein ganzes Leben lang hier gelebt! Ich bin stolz auf deine Bemühungen.«
»Die anderen Schüler akzeptieren mich nicht. Ich habe versucht, zu tun, was du sagst – mehr Terris zu sein als alle anderen, ihnen mein Blut zu beweisen. Aber die anderen ... Ich werde nie einer von ihnen sein, Großmutter.«
»›Nie‹ ist ein Wort, das Jugendliche oft benutzen«, sagte Großmutter und nippte an ihrem Tee, »aber sie verstehen es selten. Lass die Regeln zu deinem Wegweiser werden. In ihnen wirst du Frieden finden. Wenn manche dir deinen Eifer übel nehmen, lass sie. Irgendwann werden sie durch Meditation Frieden mit solchen Gefühlen schließen.«
»Könntest du vielleicht ... einigen von den anderen befehlen, sich mit mir anzufreunden?«, fragte er unwillkürlich und schämte sich, wie schwach das klang. »Wie du es bei Forch getan hast?«
»Mal sehen«, sagte Großmutter. »Und jetzt ab mit dir. Ich werde diese Indiskretion nicht melden, Asinthew, aber versprich mir bitte, dass du diese Besessenheit von Forch ablegen und die Bestrafung anderer der Synode überlassen wirst.«
Waxillium wollte aufstehen, da glitt sein Fuß von etwas ab. Er bückte sich. Die Patrone.
»Asinthew?«, fragte Großmutter.
Er verbarg die Patrone in seiner Faust, als er sich aufrichtete, dann eilte er zur Tür hinaus.
»Metall ist dein Leben«, sagte Tellingdwar vor der Hütte und kam damit zum Schluss der Abendrezitation.
Waxillium kniete in Meditation und lauschte den Worten. Um ihn herum waren in Reihen friedliche Terris ähnlich wie er in Andacht geneigt und brachten dem Retter Lob dar, dem antiken Gott ihres Glaubens.
»Metall ist deine Seele«, sagte Tellingdwar.
So viel war perfekt in dieser ruhigen Welt. Warum fühlte sich Waxillium manchmal, als schleppte er nur durch seine Anwesenheit Schmutz herein? Als wären sie alle Teil einer großen weißen Leinwand und er ein Schmierfleck an der Unterkante?
»Du bewahrst uns«, sagte Tellingdwar, »und so werden wir dein sein.«
Eine Patrone, dachte Waxillium und umklammerte noch immer das Stück Metall. Warum hat er eine Patrone als Erinnerung dagelassen? Was bedeutet das?
Als die Rezitation zu Ende war, standen Jugendliche, Kinder und Erwachsene auf und streckten sich. Herzlich wurde ein bisschen geplaudert, aber der Zapfenstreich stand bevor, was bedeutete, dass die Jüngeren sich auf den Weg nach Hause machen mussten – oder in Waxilliums Fall zu den Schlafsälen. Er blieb trotzdem auf den Knien.
Tellingdwar begann, die Matten einzusammeln, auf denen die Leute gekniet hatten. Er rasierte sich regelmäßig den Kopf; seine Robe war in leuchtenden Gelb- und Orangetönen gehalten. Die Arme voller Matten, blieb er stehen, als er bemerkte, dass Waxillium nicht mit den anderen gegangen war. »Asinthew? Geht es dir gut?«
Waxillium nickte müde, rappelte sich auf, seine Beine taub vom langen Knien. Er stapfte zum Ausgang, wo er stehen blieb. »Tellingdwar?«
»Ja, Asinthew?«
»Hat es im Village je ein Gewaltverbrechen gegeben?«
Der klein gewachsene Verwalter erstarrte, sein Griff um die Matten wurde fester. »Warum fragst du das?«
»Neugier.«
»Du musst dir keine Sorgen machen. Das war vor langer Zeit.«
»Was war vor langer Zeit?«
Tellingdwar sammelte die restlichen Matten ein, jetzt schneller als zuvor. Jemand anders wäre der Frage vielleicht ausgewichen, aber Tellingdwar war so freimütig, wie man nur sein konnte. Eine klassische Terris-Tugend – in seinen Augen wäre einer Frage auszuweichen so schlimm wie zu lügen.
»Es überrascht mich nicht, dass immer noch darüber geflüstert wird«, sagte Tellingdwar. »Fünfzehn Jahre können das Blut wohl nicht wegwaschen. Die Gerüchte sind aber falsch. Nur eine Person wurde getötet. Eine Frau, von der Hand ihres Ehemanns. Beide Terris.« Er zögerte. »Ich kannte sie.«
»Wie hat er sie umgebracht?«
»Musst du das wissen?«
»Na ja, die Gerüchte ...«
Tellingdwar seufzte. »Eine Pistole. Eine Waffe von draußen. Wir wissen nicht, wie er sie hereingebracht hat.« Tellingdwar schüttelte den Kopf und ließ die Matten auf einen Stapel an der Seitenwand des Raumes fallen. »Ich schätze, es sollte uns nicht überraschen. Menschen sind überall gleich, Asinthew. Das darfst du nicht vergessen. Halte dich nicht für besser als andere, weil du eine Robe trägst.«
Natürlich verwandelte Tellingdwar auch dieses Gespräch wie immer in eine Lektion. Waxillium nickte ihm zu und schlüpfte in die Nacht hinaus. Über ihm grollte der Himmel, sagte Regen voraus, aber es war noch nicht neblig.
Menschen sind überall gleich, Asinthew ... Was war dann der Sinn all dessen, was sie hier lehrten? Wenn es Menschen nicht davon abhalten konnte, sich wie Monster zu verhalten?
Er erreichte den Jungenschlafsaal, in dem es ruhig war. Es war kurz nach dem Zapfenstreich, und Waxillium musste entschuldigend den Kopf vor dem Schlafsaalmeister neigen, bevor er den Flur entlang in sein Zimmer im Erdgeschoss hastete. Waxilliums Vater hatte darauf bestanden, dass er wegen seiner adligen Abstammung ein Zimmer für sich bekam, was ihn nur noch mehr von den anderen abgesondert hatte.
Er zog seine Robe aus und riss den Kleiderschrank auf. Darin hingen seine alten Kleider. Der Regen begann gegen die Fenster zu prasseln, als er sich eilig eine Hose und ein Hemd anzog, die er bequemer fand als diese rostigen Roben. Er kürzte den Docht seiner Lampe, setzte sich auf seine Pritsche und schlug ein Buch auf, um noch ein bisschen zu lesen.
Draußen rumorte der Himmel wie ein leerer Magen. Waxillium versuchte ein paar Minuten zu lesen, dann schleuderte er das Buch zur Seite – fast hätte er dabei seine Lampe umgeworfen – und sprang auf. Er ging zum Fenster und beobachtete, wie das Wasser trotz des dichten Blätterdachs daran herabströmte. Er streckte sich aus und löschte die Lampe.
Waxillium starrte in den Regen hinaus, während sich in seinem Kopf die Gedanken überschlugen. Er würde bald eine Entscheidung treffen müssen. Die Vereinbarung zwischen seiner Großmutter und seinen Eltern verlangte, dass er ein Jahr im Village verbrachte, und davon blieb nur noch ein Monat. Danach konnte er entscheiden, ob er bleiben oder gehen wollte.
Was erwartete ihn draußen? Weiße Tischtücher, blasierte Leute mit nasalen Akzenten und Politik.
Was erwartete ihn hier? Stille Räume, Meditation und Langeweile.
Ein Leben, das er hasste, oder ein Leben, das von eintöniger Wiederholung gekennzeichnet war. Tag für Tag für Tag ... und ...
Bewegte sich da etwas zwischen den Bäumen?
Waxillium war sofort wachsam und drückte die Nase an das kühle Glas. Da stapfte wirklich jemand durch den nassen Wald, eine schattenhafte Gestalt mit vertrauter Größe und Statur, gebückt und mit einem Sack über der Schulter. Forch warf einen Blick zu den Schlafsälen, doch dann ging er weiter in die Nacht.
Sie waren also wieder da. Das war schneller gegangen, als er gedacht hatte. Was war Telsins Plan, um in die Schlafräume zu gelangen? Durch die Fenster hineinschlüpfen und so tun, als wären sie Stunden vor dem Zapfenstreich zurückgekommen und der Wächter hätte sie nur nicht gesehen?
Waxillium wartete und fragte sich, ob er auch die drei Mädchen entdecken würde, aber er sah nichts. Nur Forch, der in den Schatten verschwand. Wo wollte er hin?
Noch ein Feuer, dachte Waxillium sofort. Doch im Regen würde Forch das nicht tun, oder?
Waxillium schaute auf die Uhr, die ruhig an seiner Wand tickte. Eine Stunde nach dem Zapfenstreich. Ihm war nicht bewusst gewesen, dass er so lange in den Regen gestarrt hatte.
Forch ist nicht mein Problem, sagte er sich nachdrücklich. Er hatte vor, sich wieder hinzulegen, ging jedoch kurz darauf in seinem Zimmer auf und ab. Lauschte dem Regen, besorgt, unfähig, seinen Körper zur Ruhe zu bringen.
Zapfenstreich ...
Lass die Regeln zu deinem Wegweiser werden. In ihnen wirst du Frieden finden.
Er blieb neben dem Fenster stehen. Dann drückte er es auf und sprang hinaus, seine nackten Füße sanken in die nasse, zähe Erde ein. Er stolperte vorwärts. Wasser strömte ihm über den Kopf und tropfte über den Rücken seines Hemdes. Wohin war Forch gegangen?
Er versuchte es abzuschätzen und kam unter riesigen Bäumen vorbei, die an behauene Monolithen erinnerten; das Rauschen des Regens und des strömenden Wassers übertönte alles andere. Ein Stiefelabdruck im Schlamm in der Nähe eines Baumstamms verriet ihm, dass er auf der richtigen Spur war, aber er musste sich tief hinunterbeugen, um ihn zu sehen. Rost! Es wurde dunkel hier draußen.
Wohin jetzt? Waxillium drehte sich im Kreis. Da, dachte er. DieLagerhalle. Ein alter Schlafsaal, jetzt unbenutzt, wo die Terris zusätzliche Möbel und Teppiche lagerten. Das wäre doch das perfekte Ziel für eine Brandstiftung, oder? Haufenweise Sachen zum Verbrennen, und niemand würde es bei diesem Regen erwarten.
Aber Großmutter hat mit ihm gesprochen, dachte Waxillium, während er weiter durch den Regen stolperte, mit kalten Füßen, die gefallenes Laub und Moos aufwühlten. Sie werden wissen, dass er es war. Machte ihm das nichts aus? Wollte er absichtlich Ärger bekommen?
Waxillium trat an den alten Schlafsaal heran, ein dreistöckiger schwarzer Klotz in der bereits dunklen Nacht, von dessen Dachtraufen das Wasser strömte. Waxillium probierte die Türklinke aus, und die Tür war natürlich unverschlossen – das hier war das Village. Er schlüpfte hinein.
Da. Eine Pfütze auf dem Boden. Hier war vor Kurzem tatsächlich jemand hereingekommen. Gebückt folgte er der Spur, berührte die Fußabdrücke einen nach dem anderen, bis er die Treppe erreichte. Ein Stockwerk nach oben, dann noch eines. Was war da oben? Er erreichte den obersten Stock und sah vor sich Licht. Waxillium schlich durch einen Flur mit einem Teppichläufer in der Mitte und näherte sich, wie sich herausstellte, einer flackernden Kerze auf einem Tisch in einem kleinen Raum, der vollgestopft war mit Möbeln, mit dunklen, schweren Stoffen an den Wänden.
Waxillium trat an die Kerze heran. Sie flackerte, schwach und einsam. Warum hatte Forch sie hiergelassen? Was ...
Etwas Schweres krachte gegen Waxilliums Rücken. Er schnappte vor Schmerz nach Luft, als er von dem Schlag nach vorn geworfen wurde und gegen zwei aufeinandergestapelte Stühle stolperte. Stiefel donnerten hinter ihm auf den Boden. Waxillium schaffte es, sich zur Seite zu werfen, und rollte sich auf dem Boden ab, als Forch mit einem Holzpfosten auf die Stühle einschlug und sie zerbrach.
Waxillium rappelte sich mit vor Schmerzen pochenden Schultern auf. Forch drehte sich zu ihm um, sein Gesicht ganz im Schatten.
Waxillium wich zurück. »Forch! Schon gut! Ich will nur reden.« Er zuckte zusammen, als er mit dem Rücken die Wand berührte. »Du musst nicht ...«
Forch kam mit drohend erhobenem Pfosten auf ihn zu.
Waxillium schrie auf und floh in den Flur. »Hilfe!«, rief er, als Forch ihm folgte. »Hilfe!«
Waxillium hatte vorgehabt, zur Treppe zu gelangen, aber er hatte sich gedreht und war jetzt in die falsche Richtung unterwegs, weg von der Treppe. Er warf sich mit der Schulter gegen die Tür am Ende des Flurs. Die würde zum oberen Gemeinschaftsraum führen, wenn dieses Wohnheim so aufgebaut war wie sein eigenes. Und vielleicht gab es noch eine Treppe?
Waxillium stürzte durch die Tür in einen helleren Raum. Alte Tische waren um eine offene Fläche in der Mitte gestapelt, wie bei einer Tribüne.
Dort, in der Mitte und beleuchtet von einem Dutzend Kerzen, lag ein Junge von vielleicht fünf Jahren auf einem Holzbrett, das über zwei Tische gelegt worden war. Sein Hemd hatte man aufgeschnitten und auf den Boden geworfen. Seine Schreie wurden durch einen Knebel gedämpft, und er wehrte sich schwach gegen seine Fesseln.
Waxillium kam stolpernd zum Stehen, sah den Jungen, die Reihe von schimmernden Messern, die auf einem Tisch in der Nähe ausgelegt waren, die Blutspuren von Schnitten auf der Brust des Jungen.
»Oh, verdammt«, flüsterte Waxillium.
Forch trat hinter ihm ein und schloss mit einem Klicken die Tür.
»Oh, verdammt«, sagte Waxillium und drehte sich mit weit aufgerissenen Augen um. »Forch, was ist los mit dir?«
»Keine Ahnung«, erwiderte der junge Mann leise. »Ich muss nur sehen, was darin ist. Verstehst du?«
»Du bist mit den Mädchen gegangen«, sagte Waxillium, »damit du ein Alibi hast. Wenn dein Zimmer leer vorgefunden wird, wirst du sagen, dass du bei ihnen warst. Ein geringeres Vergehen, um dein wahres Verbrechen zu verbergen. Rost! Meine Schwester und die anderen wissen nicht, dass du zurückgeschlichen bist, oder? Sie sind betrunken irgendwo da draußen und werden sich nicht einmal daran erinnern, dass du nicht mehr da warst. Sie werden schwören, dass du ...«
Waxillium hielt inne, als Forch aufblickte. In seinen Augen spiegelte sich das Kerzenlicht, sein Gesicht vollkommen ausdruckslos. Er hob eine Handvoll Nägel.
Ach ja. Forch ist ein ...
Waxillium schrie auf und stürzte zu einem Stapel Möbel, als Nägel von Forchs Hand schossen, angeschoben von seiner Allomantie. Sie schlugen ein wie Hagelkörner, knallten gegen Holztische, Stuhlbeine und den Boden. Ein plötzlicher Schmerz schoss Wax durch den Arm, während er rückwärts stolperte.
Er schrie auf, hielt sich den Arm, ging in Deckung. Einer der Nägel hatte ihm in der Nähe des Ellbogens ein Stück Fleisch herausgerissen.
Metall. Er brauchte Metall.
Es war Monate her, seit er das letzte Mal Stahl verbrannt hatte. Großmutter wollte, dass er seine Terris-Seite lebte. Er hob die Arme und stellte fest, dass sie nackt waren. Seine Armbänder ...
In deinem Zimmer, Idiot, dachte Waxillium. Er fischte in seiner Hosentasche. Dort hatte er immer ...
Einen Beutel mit Metallspänen. Er zog ihn heraus, während er vor Forch davonstolperte, der Tische und Stühle umwarf, um an ihn heranzukommen. Im Hintergrund wimmerte das gefangene Kind.
Waxilliums Finger zitterten, als er versuchte, den Beutel mit den Metallspänen aufzumachen, doch er sprang ihm plötzlich aus den Fingern und schoss durch den Raum. Wax wirbelte verzweifelt zu Forch herum und sah gerade noch, wie dieser eine Metallstange von einem Tisch nahm und nach ihm schleuderte.
Waxillium versuchte, sich zu ducken. Zu langsam. Forch hatte der Stange Stahlschub gegeben, und sie knallte gegen seine Brust und warf ihn nach hinten. Forch taumelte und knurrte. Er war nicht so geübt mit seiner Allomantie und hatte sich nicht richtig angespannt. Sein Schub warf ihn genauso rückwärts wie Waxillium.
Dennoch knallte Waxillium mit einem Ächzen gegen die Wand und spürte, wie etwas in ihm knackte. Er schnappte nach Luft, ihm wurde schwarz vor Augen, und er sank auf die Knie. Der Raum schwankte.
Der Beutel. Du musst an den Beutel herankommen!
Hektisch suchte er den Boden um sich herum ab; er konnte kaum denken. Er brauchte dieses Metall! Seine blutigen Finger streiften den Beutel. Eilig griff er danach und zog ihn auf. Er legte den Kopf in den Nacken, um sich die Späne in den Mund zu kippen.
Über ihm tauchte plötzlich ein Schatten auf und trat ihm in den Magen. Der gebrochene Knochen in Waxillium gab nach, und er schrie. Er hatte nur eine Prise Metall in seinen Mund bekommen. Forch schlug ihm den Beutel aus der Hand, die Späne flogen in alle Richtungen, dann zog er ihn hoch.
Der Jugendliche sah bulliger aus normal. Er zapfte seinen Metallgeist an. Ein Teil von Waxilliums Gehirn versuchte fieberhaft, Schub auf die Armbänder seines Gegners auszuüben, aber ferrochemische Metallgeister waren berüchtigterweise schwer mit Allomantie zu beeinflussen. Sein Schub war nicht stark genug.
Forch stieß Waxillium zum offenen Fenster hinaus und ließ ihn am Hals baumeln. Regen strömte auf Waxillium herab, und er konnte kaum atmen. »Bitte ... Forch ...«
Forch ließ ihn los.
Waxillium fiel mit dem Regen.
Drei Stockwerke nach unten, durch die Äste eines Ahornbaums, nasse Blätter stoben davon.
In ihm erwachte der Stahl brennend zum Leben und sprühte blaue Linien von seiner Brust zu Metallquellen in der Nähe. Alle oben, keine unten. Nichts, wovon er sich hätte abdrücken können, um sich zu retten.
Bis auf ein Stück in seiner Hosentasche.
Waxillium stieß sich verzweifelt davon ab, während er durch die Luft taumelte. Das Metallstück schoss durch seine Hose, sein Bein entlang und schnitt ihm seitlich in den Fuß, bevor es durch sein Gewicht in den Boden getrieben wurde. Sobald das Metallstück den Boden berührte, ging ein Ruck durch Waxillium, und er fiel langsamer.
Mit den Füßen voran knallte er auf den nassen Pfad, und der Schmerz schoss ihm die Beine hinauf. Er sank zu Boden, benommen, aber lebendig. Sein Schub hatte ihn gerettet.
Regen fiel ihm aufs Gesicht. Er wartete, aber Forch kam nicht herunter, um ihm den Rest zu geben. Der Jugendliche hatte die Fensterläden zugeknallt, vielleicht aus Sorge, jemand könnte sein Kerzenlicht sehen.
Wax tat alles weh. Die Schultern vom ersten Schlag, die Beine vom Sturz, die Brust von der Stange – wie viele Rippen hatte er sich gebrochen? Hustend blieb er im Regen liegen, bis er sich schließlich herumrollte, um das Metallstück zu suchen, das ihm das Leben gerettet hatte. Er fand es mühelos, indem er seiner allomantischen Linie folgte, grub im Schlamm, zog etwas heraus und hielt es hoch.
Die Patrone des Polizisten. Regen lief über seine Hand und säuberte das Metall. Er erinnerte sich nicht einmal mehr, sie in die Tasche gesteckt zu haben.
In solch einem Fall ist das Feuer üblicherweise nur ein Vorbote ...
Er sollte Hilfe holen. Aber der Junge da oben blutete schon. Die Messer lagen bereit.
Etwas Größeres kommt auf Sie zu, Älteste. Etwas, das Sie alle bedauern werden.
Plötzlich hasste Waxillium Forch. Dieses Viertel hier war perfekt, ruhig und gelassen. Schön. Hier sollte es keine Düsternis geben. Wenn Waxillium ein Schmutzfleck auf einer weißen Leinwand war, dann war dieser Mann ein Abgrund tiefster Schwärze.
Mit einem Schrei kam Waxillium auf die Beine und stürzte durch die Hintertür in das alte Gebäude. Benommen vor Schmerz stieg er nach oben, bevor er die Tür zum Gemeinschaftsraum aufriss. Forch stand mit einem blutigen Messer in der Hand über dem weinenden Kind. Langsam drehte er den Kopf und zeigte Waxillium ein Auge, die Hälfte seines Gesichts.
Waxillium warf die einzelne Patrone zwischen ihnen in die Luft, die Hülle funkelte im Kerzenlicht, dann drückte er mit aller Kraft dagegen. Forch wandte sich um und drückte zurück.
Die Reaktion trat sofort ein. Die Patrone blieb mitten in der Luft hängen, nur Zentimeter von Forchs Gesicht entfernt. Beide Männer wurden nach hinten geworfen, aber Forch stützte sich an einer Tischgruppe ab und blieb stehen. Waxillium wurde neben der Tür gegen die Wand geschleudert.
Forch lächelte, und seine Muskeln schwollen an: Kraft, die er aus seinem Metallgeist zog. Er nahm die Metallstange von dem Tisch mit den Messern und schleuderte sie nach Waxillium, der mit einem Aufschrei dagegendrückte, damit sie ihn nicht zerschmetterte.
Er war nicht stark genug. Forch übte weiter Schub aus, und Waxillium hatte nur so wenig Stahl. Die Stange glitt weiter durch die Luft, traf Waxilliums Brust und drückte ihn gegen die Wand.
Die Zeit blieb stehen. Eine Patrone hing direkt vor Forch, doch ihr Hauptaugenmerk galt der Stange, die – Stück für Stück – Waxillium zu zerquetschen drohte. In seiner Brust loderte der Schmerz, und ihm entschlüpfte ein Schrei.
Er würde hier sterben.
Ich will nur das Richtige tun. Warum ist das so schwer?
Forch kam grinsend auf ihn zu.
Waxillims Blick war auf die Patrone fixiert, die golden glänzte. Er konnte nicht atmen. Aber diese Patrone ...
Metall ist dein Leben.
Eine Patrone. Drei Teile Metall. Die Spitze.
Metall ist deine Seele.
Die Hülse.
Du bewahrst uns ...
Und die Bodenkappe hinten. Die Stelle, wo der Hahn einschlug.
In diesem Moment teilten sie sich für Waxilliums Augen in drei Linien, drei Teile. Er sah alles gleichzeitig. Und dann, als ihn die Stange zu zerquetschen begann, ließ er zwei Teile los.
Und drückte gegen die Bodenkappe.
Die Patrone explodierte. Die Hülle schnellte rückwärts in die Luft, geschoben von Forchs Allomantie, während die Kugel selbst unberührt nach vorn schoss und sich in Forchs Schädel bohrte.
Als die Stange weggeschleudert wurde, fiel Waxillium zu Boden. Er brach zusammen, schnappte nach Luft, Regenwasser strömte von seinem Gesicht auf den Holzboden.
Wie im Nebel hörte er unten Stimmen. Endlich reagierte jemand auf den Tumult. Er zwang sich aufzustehen und hinkte durch den Raum, ohne auf die Stimmen der Terriser zu achten, die die Treppe heraufstiegen. Er erreichte das Kind, riss die Fesseln ab und befreite es. Statt vor Angst davonzulaufen, umklammerte der kleine Junge Waxilliums Bein und hielt sich schluchzend daran fest.
Leute strömten in den Raum. Waxillium beugte sich hinab, schnappte sich die Patronenhülse vom nassen Boden, dann richtete er sich hoch auf und blickte ihnen entgegen. Tellingdwar. Seine Großmutter. Die Ältesten. Er erfasste ihr Entsetzen und wusste in diesem Moment, dass sie ihn hassen würden, weil er Gewalt in ihre Gemeinschaft gebracht hatte.
Sie würden ihn hassen, weil er recht gehabt hatte.
Er stand neben Forchs Leichnam und schloss die Hand um die Patronenhülse; die andere ruhte auf dem Kopf des zitternden Kindes.
»Ich werde meinen eigenen Weg finden«, flüsterte er.
Achtundzwanzig Jahre später
Die Tür des Unterschlupfs knallte gegen die Wand und wirbelte eine Staubwolke auf. Nebel umhüllte den Mann, der sie mit einem Tritt geöffnet hatte, und umriss seine Silhouette: einen Nebelmantel, dessen Fransen sich von der Bewegung blähten, eine an der Seite gehaltene Schrotflinte.
»Feuer!«, schrie Migs.
Die Typen schossen. Acht Männer, bis an die Zähne bewaffnet, feuerten von ihrem Platz hinter der Barrikade in dem alten Pub auf die schattenhafte Gestalt. Kugeln schwärmten wie Insekten, teilten sich aber vor dem Mann im langen Mantel. Sie prasselten an die Wand, bohrten Löcher in die Tür und zersplitterten den Türrahmen. Sie schnitten Spuren in den Nebel, doch der Gesetzeshüter, ganz schwarz in der Finsternis, zuckte nicht einmal.
Migs feuerte immer verzweifelter Schuss um Schuss. Er leerte eine Pistole, dann eine zweite, dann hob er seine Flinte an die Schulter und feuerte, so schnell er das Gewehr spannen konnte. Wie waren sie hier hineingeraten? Rost, wie war das passiert? So hätte es eigentlich nicht laufen sollen.
»Es ist sinnlos!«, schrie einer der Kerle. »Der bringt uns alle um, Migs!«
»Weshalb stehst du da nur so herum?«, rief Migs dem Sheriff zu. »Nun mach schon!« Er feuerte noch zweimal. »Was ist los mit dir?«
»Vielleicht will er uns nur ablenken«, sagte einer der Männer, »damit sich sein Kumpel von hinten anschleichen kann.«
»Hey, das ist ...« Migs zögerte und schaute zu demjenigen hinüber, der gesprochen hatte. Rundes Gesicht. Einfacher, runder Kutscherhut, wie ein Bowler, aber oben flacher. Wer war der Mann noch mal? Er zählte seine Mannschaft.
Neun?
Der Typ neben Migs lächelte, tippte sich an den Hut und boxte ihm dann ins Gesicht.
Es war schnell vorbei. Der Typ mit dem Kutscherhut erledigte Slink und Guillian im Handumdrehen. Dann war er plötzlich näher bei den anderen auf der entgegengesetzten Seite und schlug sie mit einem Paar Duellstäbe nieder. Als sich Migs umdrehte – und nach der Waffe tastete, die er fallen gelassen hatte –, sprang der Sheriff mit wehenden Fransen über die Barrikade und trat Drawers gegen das Kinn. Der Gesetzeshüter wirbelte herum und richtete seine Schrotflinte auf die Männer auf der anderen Seite.
Sie ließen die Waffen fallen. Migs kniete schwitzend neben einem umgeworfenen Tisch. Er wartete auf die Schüsse.
Sie kamen nicht.
»Bereit, Captain!«, rief der Sheriff. Ein Haufen Polizisten stürmte durch die Tür und verwirbelte den Nebel. Draußen löste das Morgenlicht den Nebel sowieso langsam auf. Rost. Hatten sie sich hier wirklich die ganze Nacht verkrochen?
Der Sheriff schwang seine Schrotflinte in Richtung Migs. »Ich glaube, du willst deine Waffe fallen lassen, mein Freund«, sagte er im Plauderton.
Migs zögerte. »Erschieß mich einfach, Sheriff. Ich stecke zu tief drin.«
»Du hast auf zwei Constables geschossen«, sagte der Mann mit dem Finger am Abzug. »Aber sie werden überleben, Sohn. Wenn es nach mir geht, wirst du nicht hängen. Lass die Waffe fallen.«
Diese Worte hatten sie schon von draußen gerufen. Diesmal glaubte sie Migs. »Warum?«, fragte er. »Du hättest uns alle ohne Probleme töten können. Warum?«
»Weil ihr es offen gesagt nicht wert seid«, antwortete der Gesetzeshüter. Er lächelte jovial. »Ich habe bereits genug auf dem Gewissen. Lass die Waffe fallen. Wir klären das schon.«
Migs legte die Waffe zu Boden und stand auf, dann winkte er Drawers zurück, der sich mit einer Pistole in der Hand hochrappeln wollte. Der Mann legte seine Waffe widerwillig ebenfalls hin.
Der Sheriff drehte sich um, schwang sich mit einem allomantischen Sprung über die Barrikade und rammte seine abgesägte Schrotflinte in ein Holster an seinem Bein. Der jüngere Mann mit dem Kutscherhut gesellte sich leise pfeifend zu ihm. Er schien Guillians Lieblingsmesser geklaut zu haben; der Elfenbeingriff ragte aus seiner Tasche.
»Sie gehören Ihnen, Captain«, sagte der Sheriff.
»Bleiben Sie nicht für die Verhaftung, Wax?«, fragte der Captain und drehte sich nach ihm um.
»Leider nein«, antwortete der Sheriff. »Ich muss zu einer Hochzeit.«
»Wessen?«
»Meine, fürchte ich.«
»Sie sind am Morgen Ihrer Hochzeit zu einer Razzia gekommen?«, fragte der Captain.
Der Gesetzeshüter, Waxillium Ladrian, blieb in der Tür stehen. »Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass es nicht meine Idee war.« Er nickte den versammelten Polizisten und Bandenmitgliedern zu und schlenderte dann in den Nebel hinaus.
TEIL 1
1
Waxillium Ladrian eilte die Stufen vor dem Bandenversteck hinunter, das einmal eine Bar gewesen war, und kam an Constables in Braun vorbei, die hierhin und dorthin hasteten. Die Nebel verzogen sich bereits, die Morgendämmerung verkündete das Ende ihrer Wache. Er untersuchte seinen Arm, wo eine Kugel ein ansehnliches Loch in seine Manschette und die Seite seines Jacketts gerissen hatte. Er hatte sie vorbeifliegen gespürt.
»Hey!« Wayne tauchte neben ihm auf. »Ein guter Plan war das, was?«
»Es war derselbe Plan, den du immer hast«, erwiderte Wax. »Der, in dem ich den Lockvogel spiele.«
»Ist nicht meine Schuld, dass die Leute gern auf dich schießen, Mann«, sagte Wayne, als sie die Kutsche erreichten. »Du solltest froh sein, du benutzt deine Talente. Meine Oma hat immer gesagt, das sollte ein Mann tun.«
»Ich finde ›Beschießbarkeit‹ kein besonders erstrebenswertes Talent.«
»Tja, man muss benutzen, was man hat«, erklärte Wayne und lehnte sich an die Seite der Kutsche, während Cob der Kutscher Wax die Tür öffnete. »Deshalb hab ich auch immer ein paar Stücke Ratte in meinem Eintopf.«
Wax schaute in die Kutsche mit ihren feinen Kissen und der prächtigen Polsterung, stieg aber nicht ein.
»Kriegst du das hin?«, fragte Wayne.
»Natürlich«, erwiderte Wax. »Das ist meine zweite Hochzeit. Ich bin inzwischen ein alter Hase.«
Wayne grinste. »Ach, so läuft das? Meiner Erfahrung nach ist Heiraten nämlich das Einzige, bei dem die Leute anscheinend immer schlechter werden, je öfter sie’s tun. Na ja, das und am Leben bleiben.«
»Wayne, das war fast schon tiefsinnig!«
»Verdammt. Hätte eigentlich einfühlsam sein sollen.«
Wax stand still und schaute wieder in die Kutsche. Cob, der ihm immer noch die Tür aufhielt, räusperte sich.
»Ist aber schon ’ne hübsche Schlinge«, bemerkte Wayne.
»Sei nicht melodramatisch«, sagte Wax und machte Anstalten einzusteigen.
»Lord Ladrian!«, rief eine Stimme von hinten.
Wax warf einen Blick über die Schulter und bemerkte einen großen Mann in einem dunkelbraunen Anzug mit Fliege, der sich zwischen zwei Constables hindurchdrängte. »Lord Ladrian«, sagte der Mann, »dürfte ich bitte einen Moment haben?«
»Nehmen Sie sie alle«, antwortete Wax. »Allerdings ohne mich.«
»Aber ...«
»Wir treffen uns dort«, sagte Wax mit einem Nicken zu Wayne. Er ließ eine gebrauchte Patronenhülse fallen und erhob sich mit ihrer Hilfe in die Luft. Warum Zeit mit einer Kutsche verschwenden?
Mit dem angenehmen Brennen von Stahl in seinem Magen drückte er sich von einer nahen elektrischen Straßenlaterne ab – die immer noch leuchtete, obwohl es inzwischen Morgen war – und stieg höher in die Luft hinauf. Elantel breitete sich vor ihm aus, ein rußbeflecktes Wunderwerk von einer Stadt. Aus hunderttausend verschiedenen Häusern und Fabriken strömte Rauch. Wax stieß sich von dem Stahlrahmen eines halb fertiggestellten Gebäudes ab und katapultierte sich dann mit einer Reihe von Sprüngen quer über den Vierten Oktanten.
Er kam über einem Platz für Mietkutschen vorbei, wo Gefährte ruhig in Reihen warteten, und Morgenarbeiter blickten zu ihm auf, wenn er vorbeikam. Jemand zeigte auf ihn; vielleicht hatte der Nebelmantel seine Aufmerksamkeit geweckt. Münzwerfer-Kuriere waren kein ungewöhnlicher Anblick in Elantel, und Menschen, die durch die Luft segelten, waren selten sehenswert.
Ein paar weitere Sprünge brachten ihn über einige Lagerhäuser, die enge Reihen bildeten. Wax freute sich an jedem Sprung. Es war unglaublich, dass sich das immer noch so wunderbar anfühlte. Der Wind in seinem Gesicht, der kleine Moment der Schwerelosigkeit, wenn er den Scheitel eines Bogens erreichte.
Viel zu schnell verschafften sich jedoch sowohl Schwerkraft als auch Pflichtgefühl wieder Geltung. Er verließ das Industriegebiet und kreuzte vornehmere Straßen, gepflastert mit Pech und Kies, um eine glattere Oberfläche als Kopfsteinpflaster für all diese verflixten Automobile zu schaffen. Er entdeckte die Kirche des Überlebenden sofort; sie war mit ihrer Kuppel aus Stahl und Glas kaum zu übersehen. Damals in Wettering hatte eine einfache Kapelle aus Holz genügt, aber das war für Elantel natürlich nicht prachtvoll genug.
Die Bauweise erlaubte den Gottesdienstbesuchern einen freien Blick auf die Nebel bei Nacht. Wax fand, wenn sie die Nebel sehen wollten, konnten sie auch einfach nach draußen gehen. Aber vielleicht war er zu zynisch. Schließlich konnte man die Kuppel, die aus Glassegmenten zwischen Stahlstützen bestand – wodurch sie aussah wie eine geteilte Orange – für besondere Gelegenheiten nach innen öffnen und den Nebel hereinströmen lassen.
Er landete auf dem Wasserturm eines Gebäudes gegenüber der Kirche. Vielleicht war die Kuppel bei ihrer Erbauung hoch genug gewesen, um die Häuser der Umgebung zu überschatten – das hatte sicherlich hübsch ausgesehen. Jetzt wuchsen die Gebäude höher und höher, und die Kirche wurde durch ihre Umgebung in den Schatten gestellt. Wayne hätte eine Metapher dafür gefunden. Vermutlich eine vulgäre.
Er hockte auf dem Wasserturm, der drohend über der Kirche aufragte. Nun war er also endlich hier. Er spürte, wie sein Auge zu zucken begann, und ein Schmerz stieg in ihm auf.
Ich glaube, ich habe dich schon an diesem Tag geliebt. So lächerlich, aber so ernsthaft ...
Vor sechs Monaten hatte er abgedrückt. Er konnte den Schuss immer noch hören.
Er riss sich zusammen und stand auf. Er hatte diese Wunde schon einmal geheilt. Dann konnte er es auch wieder tun. Und wenn sein Herz deswegen mit Narbengewebe verkrustet war, dann brauchte er das vielleicht. Er machte einen Satz von dem Wasserturm und verlangsamte seinen Sturz, indem er eine Patronenhülse fallen ließ und Schub darauf ausübte.
Er kam auf der Straße an und schritt an einer Reihe von Kutschen vorbei. Die Gäste waren bereits anwesend – die Lehren des Überlebenden verlangten Hochzeiten entweder früh am Morgen oder spät in der Nacht. Wax nickte im Vorbeigehen mehreren Leuten zu und konnte es sich nicht verkneifen, seine Schrotflinte aus dem Holster zu ziehen und sich über die Schulter zu legen, während er die Stufen emporsprang und die Doppeltür vor sich mit einem Stahlschub aufdrückte.
Steris ging im Vorraum auf und ab; sie trug ein schmales weißes Kleid, das gewählt worden war, weil die Zeitschriften sagten, es sei modisch. Für diesen speziellen Anlass hatte sie ihr Haar flechten und sich professionell schminken lassen und sah damit sogar richtig hübsch aus.
Er lächelte, während er sie musterte. Seine Anspannung und Nervosität fielen ein Stück weit von ihm ab.
Steris blickte auf, sobald er eintrat, dann eilte sie an seine Seite. »Und?«
»Ich wurde nicht umgebracht«, erwiderte er. »Das hätten wir also schon mal.«
Sie warf einen Blick auf die Uhr. »Du bist spät dran«, sagte sie, »aber nicht sehr spät.«
»Es ... tut mir leid?« Sie hatte darauf bestanden, dass er zu der Razzia ging. Tatsächlich hatte sie es sogar eingeplant. So war das Leben mit Steris.
»Ich bin mir sicher, du hast dein Bestes gegeben«, sagte Steris und legte ihm die Hand auf den Arm. Sie war warm und zitterte sogar. Steris mochte reserviert sein, aber im Gegensatz zu der Annahme einiger war sie nicht gefühllos.
»Und wie lief die Razzia?«, fragte sie.
»Gut. Keine Toten oder Schwerverletzten.« Er ging mit ihr in einen Seitenraum, wo Drewton – sein Hausdiener – neben einem Tisch wartete, auf dem Wax’ weißer Hochzeitsanzug ausgebreitet lag. »Dir ist schon klar, dass ich, wenn ich am Morgen meiner Hochzeit zu einer Razzia gehe, nur das Bild bestätige, das die Gesellschaft von mir hat.«
»Was für ein Bild?«
»Das eines Raufbolds«, sagte er, während er seinen Nebelmantel ablegte und ihn Drewton übergab. »Ein kaum zivilisierter Rüpel aus dem Rauland, der in der Kirche flucht und bewaffnet zu Empfängen geht.«
Sie warf einen Blick auf seine Schrotflinte, die er aufs Sofa geworfen hatte. »Du genießt es, mit der Wahrnehmung der Leute zu spielen, nicht wahr? Du legst es darauf an, dass sie sich unbehaglich fühlen, damit sie aus dem Gleichgewicht geraten.«
»Das ist eine der einfachen Freuden, die mir noch geblieben sind, Steris.« Er lächelte, während Drewton seine Weste aufknöpfte. Dann zog er sie mitsamt dem Hemd aus und stand mit nacktem Oberkörper da.
»Wie ich sehe, gehöre ich auch zu denen, die du durcheinanderbringen willst«, sagte Steris.
»Ich arbeite mit dem, was ich habe«, erwiderte Wax.
»Hast du deshalb immer auch ein paar Stücke Ratte im Eintopf?«
Wax wollte seine Kleidung gerade Drewton geben und hielt inne. »Hat er das zu dir auch gesagt?«
»Ja. Ich bin zunehmend überzeugt davon, dass er seine Sprüche an mir testet.« Sie verschränkte die Arme. »Der kleine Straßenköter.«
»Willst du nicht gehen, während ich mich umziehe?«, fragte Wax belustigt.
»In nicht einmal einer Stunde werden wir verheiratet sein, Lord Waxillium«, sagte sie. »Ich glaube, ich halte es aus, dich mit nacktem Oberkörper zu sehen. Im Übrigen bist du der Pfader. Prüderie gehört zu deinem Glaubenssystem, nicht zu meinem. Ich habe von Kelsier gelesen. Meiner Analyse nach bezweifle ich, dass er ein Problem damit hätte, wenn ...«
Wax knöpfte die Holzknöpfe seiner Hose auf. Steris wurde rot, dann drehte sie sich weg und wandte ihm schließlich den Rücken zu. Kurz darauf sprach sie weiter, klang aber verlegen. »Na ja, wenigstens hast du einer anständigen Zeremonie zugestimmt.«
Wax lächelte, setzte sich in der Unterhose hin und ließ sich von Drewton eine schnelle Rasur verpassen. Steris blieb, wo sie war, und hörte zu. Als Drewton ihm schließlich den Rasierschaum vom Gesicht wischte, fragte sie: »Du hast die Anhänger?«
»Hab sie Wayne gegeben.«
»Du ... Was?«
»Ich dachte, du wolltest ein bisschen Unruhe bei der Hochzeit«, sagte Wax, stand auf und nahm die neue Hose von Drewton entgegen. Er schlüpfte hinein. Er hatte nicht oft Weiß getragen, seit er aus dem Rauland zurückgekehrt war. Dort draußen war es schwieriger gewesen, sauber zu bleiben, deshalb war es das Tragen wert gewesen. »Ich dachte, das könnte funktionieren.«
»Ich wollte geplante Störungen, Waxillium«, blaffte Steris. »Es ist nicht so ärgerlich, wenn es vereinbart, vorbereitet und kontrolliert wurde. Wayne ist eher das Gegenteil von alledem, meinst du nicht?«
Wax knöpfte die Hose zu, und Drewton nahm sein Hemd vom Bügel.
Steris drehte sich um, sobald sie das Geräusch hörte, die Arme immer noch verschränkt, und verlor keine Zeit – und weigerte sich zuzugeben, dass sie verlegen gewesen war. »Ich bin froh, dass ich Kopien habe machen lassen.«
»Du hast Kopien von unseren Hochzeitsanhängern gemacht?«
»Ja.« Sie kaute kurz auf der Unterlippe. »Sechs Paar.«
»Sechs?«
»Die anderen vier kamen nicht rechtzeitig.«
Wax grinste, während er sein Hemd zuknöpfte, dann ließ er seinen Diener die Manschetten übernehmen. »Du bist schon einzigartig, Steris.«
»Genau genommen ist Wayne das auch – und Ruin war es übrigens ebenfalls. Wenn man genauer darüber nachdenkt, ist es kein großes Kompliment.«
Wax schnallte die Hosenträger um, dann ließ er Drewton an seinem Kragen herumfingern. »Ich verstehe es nicht, Steris«, sagte er und blieb steif stehen, während der Hausdiener arbeitete. »Du bereitest dich so gründlich darauf vor, dass etwas schiefläuft – als würdest du davon ausgehen, dass das Leben unvorhersehbar ist.«
»Ja, und?«
»Und das Leben ist unvorhersehbar. Das Einzige, was du also tust, wenn du dich auf Störungen vorbereitest, ist sicherzugehen, dass etwas anderes schiefgeht.«
»Das ist eine ziemlich fatalistische Sichtweise.«
»Das macht das Leben im Rauland mit einem.« Er musterte sie, wie sie da prächtig in ihrem Kleid stand, die Arme verschränkt, und mit dem rechten Zeigefinger auf ihren linken Arm trommelte.
»Mir ... geht es nur besser dabei, wenn ich es versuche«, sagte Steris schließlich. »Wenn etwas schiefgeht, habe ich es wenigstens versucht. Klingt das nachvollziehbar?«
»Ja, das tut es, finde ich.«
Drewton trat zufrieden zurück. Zu dem Anzug gehörten eine Weste und ein sehr hübsches schwarzes Halstuch. Traditionell, wie es Wax am liebsten war. Fliegen waren etwas für Verkäufer. Er schlüpfte in den Frack; die Schöße streiften die Rückseite seiner Beine. Nach kurzem Zögern schnallte er sich dann noch seinen Pistolengurt um und steckte Vindikator ins Holster. Er hatte bei seiner letzten Hochzeit eine Waffe getragen, warum also nicht auch bei dieser? Steris nickte zustimmend.
Die Schuhe kamen als Letztes. Ein neues Paar. Sie waren sicher fürchterlich unbequem. »Sind wir schon spät genug dran?«, fragte er Steris.
Sie schaute auf die Uhr in der Ecke. »Ich habe geplant, dass wir in zwei Minuten hineingehen.«
»Ah, herrlich«, sagte er und nahm ihren Arm. »Das heißt, wir können spontan sein und früher kommen. Also, früher verspätet.«
Sie klammerte sich an seinen Arm und ließ sich von ihm zum Eingang zur Kuppel und der eigentlichen Kirche führen. Drewton folgte ihnen.
»Bist du ... sicher, dass du weitermachen möchtest?« Steris hielt ihn am Eingang der Kuppel zurück.
»Hast du Zweifel?«
»Absolut nicht«, sagte Steris sofort. »Diese Vereinigung ist recht vorteilhaft für mein Haus und meinen Status.« Sie nahm Wax’ linke Hand in beide. »Aber Waxillium«, sagte sie leise. »Ich möchte nicht, dass du dich gefangen fühlst, vor allem nicht nach dem, was dir vor einiger Zeit passiert ist. Wenn du dich doch noch zurückziehen möchtest, werde ich deinen Wunsch akzeptieren.«
Die Art, wie sie seine Hand umklammerte und diese Worte sagte, sandte eine ganz andere Botschaft aus, aber sie schien es nicht zu merken. Als er sie anschaute, wunderte sich Wax unwillkürlich. Die Zustimmung zu der Hochzeit hatte er ursprünglich aus Pflichtgefühl seinem Haus gegenüber gegeben.
Jetzt spürte er, wie sich seine Gefühle veränderten. Wie sie für ihn da gewesen war in den letzten Monaten, als er getrauert hatte ... Wie sie ihn jetzt ansah ...
Rost und Ruin. Er mochte Steris. Es war keine Liebe, aber er bezweifelte, dass er jemals wieder lieben würde. Das hier würde genügen.
»Nein, Steris«, sagte er. »Ich möchte mich nicht zurückziehen. Das ... würde deinem Haus und dem Geld, das du ausgegeben hast, nicht gerecht.«
»Das Geld ist ...«
»Schon gut«, sagte Wax und drückte leicht ihre Hand. »Ich habe mich ausreichend von meiner Prüfung erholt. Ich bin stark genug.«
Steris öffnete den Mund für eine Antwort, doch ein Klopfen an der Tür kündigte Marasi an, die den Kopf hereinstreckte, um nach ihnen zu sehen. Zu ihren dunklen Haaren und weicheren, runderen Zügen als Steris trug Marasi leuchtend roten Lippenstift und die Kleidung einer fortschrittlichen Frau – einen Faltenrock mit einem engen, geknöpften Jackett.
»Na endlich«, sagte sie. »Die Gäste werden langsam unruhig. Wax, hier ist ein Mann, der dich sehen will. Ich habe versucht, ihn wegzuschicken, aber ... na ja ...«