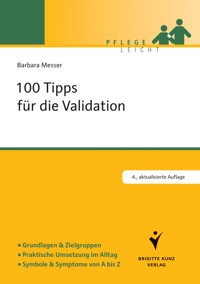Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schlütersche
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
kurz und knapp: Das erste Anti-Helfersyndrom-Buch für Pflegende Mit vielen praktischen Tipps für den Berufsalltag Sensibel, unterhaltsam und hilfreich Wer in der Pflege arbeitet, will anderen Menschen helfen. Das ist eine gute Einstellung. Doch manchmal macht sich das Helfen sozusagen selbstständig: Die Pflegekraft gibt ständig mehr, beachtet weder ihre eigenen Grenzen noch die der anderen. Aus dem Willen zu helfen wird das Helfersyndrom. Das aber ist ein machtvolles Spiel, das für Helfer und Pflegebedürftigen leidvoll wird. In diesem Buch werden Ursachen, typische Verhaltensweisen und vor allem geeignete Strategien zur tiefgreifenden Verbesserung und Veränderung im Umgang mit dem Helfersyndrom vorgestellt. Helfen ist okay, wenn es verantwortungsbewusst geschieht. Und das lässt sich lernen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Barbara Messer
Helfersyndrom?
Strategien für verantwortungsvolle Pflegekräfte
Barbara Messer
»Gib einem Menschen nur dann die Hand, wenn er sie wirklich braucht.«
(SCHOTTISCHE WEISHEIT)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
ISBN 978-3-89993-304-8 (Print) ISBN 978-3-8426-8493-5 (PDF)
© 2014 Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG,Hans-Böckler-Allee 7, 30173 Hannover
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der gesetzlich geregelten Fälle muss vom Verlag schriftlich genehmigt werden. Alle Angaben erfolgen ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Autoren und des Verlages. Für Änderungen und Fehler, die trotz der sorgfältigen Überprüfung aller Angaben nicht völlig auszuschließen sind, kann keinerlei Verantwortung oder Haftung übernommen werden.Die im Folgenden verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen stehen immer gleichwertig für beide Geschlechter, auch wenn sie nur in einer Form benannt sind. Ein Markenzeichen kann warenrechtlich geschützt sein, ohne dass dieses besonders gekennzeichnet wurde.
Reihengestaltung:
Groothuis, Lohfert, Consorten | glcons.de
Titelbild:
picsfive – fotolia.com
Satz:
PER Medien+Marketing GmbH, Braunschweig
Druck:
Druck Thiebes GmbH, Hagen
INHALT
1Einleitung
»Die kranken Schwestern«
2Der hilflose Helfer
2.1Das Helfersyndrom – fünf Komponenten eines Phänomens
2.1.1Das abgelehnte Kind
2.1.2Die Identifizierung mit dem Über-Ich
2.1.3Die narzisstische Unersättlichkeit
2.1.4Die Vermeidung von Gegenseitigkeit
2.1.5Die indirekte Aggression
3Helfersyndrom – Wie gefährdet sind Sie?
3.1Berufsschicksal »Helfer ohne Grenzen«
3.1.1Die Übermutter
3.1.2Der Aggressor
3.1.3Die Chefin
3.1.4Die Enttäuschte
3.2Helfersyndrom bei Pflegekräften – durchaus politisch gewollt
3.3Interviews zum Thema »Helfersyndrom«
3.3.1»Unser Team ist noch jung und unerfahren«
3.3.2»Man muss es erst mal selbst erkennen«
3.3.3»Unser Problem ist die Arbeitsverdichtung«
4Strategien für verantwortungsvolle Pflegekräfte
4.1Veränderungen beginnen im Kopf
4.1.1Schritt 1: Bestimmen Sie Ihre aktuelle Situation
4.1.2Schritt 2: Geben Sie Ihrer Situation einen Namen
4.1.3Schritt 3: Entdecken Sie Ihre Antreiber
4.2Warum wir anderen so gern die Schuld geben
4.2.1Strategien gegen den Ärger
4.2.2Glauben Sie nicht alles, was Sie denken
4.3Ihr Selbstbild – Wie gut kennen Sie sich?
4.3.1Von Auslösern und wunden Punkten
4.3.2Das emotionale Erfahrungsgedächtnis
4.3.3Innehalten – und den Teufelskreis durchbrechen
4.4Selbstführung – So werden Sie der Manager Ihres inneren Teams
4.4.1Von Kindern und Kritikern
4.4.2Ihr Team braucht Sie
4.4.3Ihr inneres Team und das Helfersyndrom
4.5Die glückliche Kindheit – Wie Sie alte, schmerzhafte Erinnerungen verändern
4.5.1Übung
4.6Wie Sie Kränkungen lockerer begegnen
4.6.1Übung
4.7Spielen Sie das Worst Case-Szenario durch
4.7.1Übung
4.8Nutzen Sie die Kraft der guten Absicht
4.9Stärken Sie Ihr Selbstbild
4.9.1Übung
4.10Übernehmen Sie die Initiative
4.10.1Ihre Haltung entscheidet
4.10.2Das Modell der logischen Ebenen
4.10.3Die Lösung ist oft Teil des Problems
4.11Kommunizieren Sie erfolgreicher
4.11.1Gewaltfreie Kommunikation
4.12Auch eine Strategie – professionelle Hilfe
5Von der Theorie zur Praxis: Wenn aus Gedanken Handlungen werden
5.1»Ich lernte, Nein zu sagen«
5.2Wenn Führungskräfte ihre Gestaltungsspielräume nutzen
5.3Wussten Sie eigentlich, dass Sie unentbehrlich sind?
Schlusswort
Literatur
Register
1EINLEITUNG
Als ich 1984 mit der Ausbildung zur Altenpflegerin anfing, brannte ich vor Eifer – und wurde gleich aus vollem Lauf gestoppt. »Mach doch mal ein Referat über das Helfersyndrom, Barbara!«, forderte mich meine Lehrerin auf. Die erfahrene Pflegekraft kannte ihre Pappenheimer. Mein zweiter Vorname hätte auch »Helfersyndrom« lauten können. Denn letztendlich gehöre ich zu den Menschen, die potenziell gefährdet sind: Ich fühle mich oft besser, wenn ich anderen helfen kann, scheinbar unersetzlich bin, ein Dankeschön bekomme, und mich vor allem nicht um mich selbst kümmern muss. Im privaten Bereich kann das mal eine Weile funktionieren. Für jemanden, der in der Pflege arbeitet, wird es mit dieser Einstellung gefährlich.
Diese erste Auseinandersetzung mit dem Thema Helfersyndrom war für mich deshalb ein wichtiger Schritt in meiner Entwicklung zu einer professionellen Altenpflegerin. Ich erkannte die Gefahr und konnte gezielt gegensteuern. Ich war sensibilisiert – dank meiner Lehrerin.
In den folgenden Jahren konnte ich mehr und mehr an meinen wunden Punkten arbeiten und Veränderungsbedarf entdecken. So wandelte ich mein potenzielles Helfersyndrom mit den Jahren in eine klare Grundhaltung um: Ich will Menschen wirksam in ihrer Selbstpflege unterstützen. Aber ich ziehe dabei klare Grenzen, denn auch ich bin es wert, dass sich jemand um mich kümmert – und zwar in erster Linie ich selbst!
Als Dozentin und Trainerin treffe ich viele Menschen aus der Pflege. Besonders in den Schulungen zur Pflegeplanung und zum Pflegeprozess macht sich das Helfersyndrom schnell bemerkbar: Den Betroffenen ist es oft nicht mehr möglich, einen Bewohner weitgehend neutral zu beschreiben. Sehr häufig finden sich in den Planungen nicht etwa die Ressourcen des Bewohners, sondern die Anliegen, Sorgen und Ängste einer Pflegekraft – projiziert auf den Bewohner. Die Notizen in den Pflegeplanungen sprechen dann Bände:
• »Der Bewohner wehrt sich gegen meine Hilfe!« Im Umkehrschluss kann es durchaus sein, dass die Pflegekraft es nicht aushält, dass ein Bewohner ihre Hilfe nicht annehmen möchte, weil er sie evtl. gar nicht braucht.
• Eine Pflegekraft notiert bei einem Bewohner eine Fülle von Problemen. Ihre Kollegen dagegen sehen kein einziges. In einem kollegialen Gespräch kann die betreffende Pflegekraft anschließend keines ihrer festgestellten Probleme begründen. »Aber das kann doch gar nicht sein! – Der braucht doch X! Und der braucht doch Y!« Die Verzweiflung steht der Pflegekraft ins Gesicht geschrieben. Ungläubig muss sie erkennen, dass sie viel mehr tun will, als wirklich nötig ist.
Angst, Verzweiflung und später Wut und Ungeduld – diese Emotionen bewegen viele Pflegekräfte angesichts ihrer Patienten/Bewohner, denen sie helfen wollen. Auf Biegen und Brechen! In einem Gespräch mit Dr. Markus Dobler sprach ich kürzlich über unterschiedliche Aspekte des Selbstmanagements von Frauen. Markus Dobler coacht unter anderem Führungskräfte und eines seiner Hauptwerkzeuge ist der Satz: »Sie sind ein Dieb und Sie sind ungerecht!« Damit konfrontiert er seine Coachees recht unmittelbar im Gespräch. Nicht weiter verwunderlich, wenn diesen dann tatsächlich der Mund offen bleibt.
Natürlich hat diese Intervention einen besonderen Sinn: »Sie sind ein Dieb!« meint: »Sie stehlen die Probleme anderer und nutzen diese für sich selber.«
Ist es Ihnen schon passiert, dass Sie sich Probleme anderer zu Eigen gemacht haben? Vielleicht aus Fürsorge oder Liebe für jemanden, der Ihnen anvertraut ist, oder aus dem Wunsch heraus, sich lieber nicht um Ihre eigenen Belange zu kümmern?
»Sie sind ungerecht!« meint: »Sie gehen mit anderen Menschen besser um als mit sich selber!« Wie oft und wie gern sind wir zu anderen Menschen liebevoller, toleranter, ausdauernder, verständnisvoller und hilfsbereiter als zu uns selbst? Wie oft gehen wir zur Arbeit, obwohl wir eigentlich krank sind und dringend Ruhe brauchen? Aber: »Wir wollen die Kollegen ja nicht hängen lassen.«
Auf dem Pflegekongress CareDate 2013 sprach Martin Jansen, Gesundheitswissenschaftler aus Bamberg, zu einem besonderen Phänomen, das viele Pflegekräfte auszeichnet, die am Helfersyndrom leiden, dem »Präsentismus«. Präsentismus bedeutet, dass jemand zur Arbeit geht, obwohl er krank ist. »Wenn kranke Pflegende Kranke pflegen« überschrieb Jansen seinen Vortrag. Der Saal war voll, das Interesse groß und die Betroffenheit einmütig. Für viele war es erstaunlich, dass man krank sein »darf«, wenn man krank ist.
Es kann sein, dass es Ihnen so geht wie den beiden Frauen in der Geschichte von Franz Hohler.1
»Die kranken Schwestern«
In einem Dorf, in welchem es weder einen Arzt noch ein Spital gab, wurden vor langer Zeit zwei Schwestern gleichzeitig krank, und da sie keine Angehörigen mehr hatten, blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich gegenseitig zu pflegen. An einem Tag machte zum Beispiel die erste den Tee und die zweite die Umschläge, und am nächsten Tag umgekehrt. Sie wurden zwar nicht richtig gesund, blieben aber doch am Leben.
Später wurde ein Bauer im Dorf krank, und niemand wusste, was ihm fehlte. »Fragt doch die kranken Schwestern«, sagte der Schmied. Daraufhin holte man die kranken Schwestern zu diesem Bauern, und sie blieben bei ihm und machten ihm Tee und Umschläge, und schon nach kurzer Zeit war er wieder gesund und konnte aufs Feld gehen.
Von jetzt an fragte man immer, wenn jemand im Dorf krank wurde, die kranken Schwestern um Hilfe, und sie kamen und pflegten den Kranken. Das gab ihnen so viel zu tun, dass sie gar nicht merkten, dass sie eigentlich krank waren, und ihr Ruf verbreitete sich so weit, dass man die Frauen, welche die Kranken pflegen, noch heute die Krankenschwestern nennt, obwohl sie weder Schwestern noch krank sind, wenigstens die meisten von ihnen.2
Ich möchte Ihnen, meinen Berufskolleginnen und -kollegen in der Pflege, einige Strategien zeigen, die Ihnen helfen können, vom Helfersyndrom loszukommen; Strategien, die viel diskutiert und vielfach erprobt sind.
Ich möchte Ihnen helfen,
• Ihre eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen;
• neutral und bewusst in den Pflege- und Beziehungsprozess mit Patienten/Bewohnern zu gehen;
• dass Sie Patienten/Bewohnern ihre eigene Situation so weit wie möglich selbst regeln und gestalten lassen;
• sich vor einem Burnout zu schützen;
• Ihr Helfersyndrom zu mindern oder sogar abzulegen.
_____________
1 Franz Hohler gilt als einer der bedeutendsten Erzähler der Schweiz. Er schreibt seit über 40 Jahren und hat zahlreiche Preise gewonnen.
2 Zit. n. Messer, B. (2008). Die Expertenstandards im Pflegealltag. Hannover: Schlütersche, S. 13
2DER HILFLOSE HELFER
Wer einen pflegerischen Beruf ergreift, möchte helfen. Das ist eine Grundvoraussetzung für diesen schweren, belastenden, aber auch erfüllenden und schönen Beruf.
Das Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen, ist ein Impuls, der zu den wichtigsten und schönsten menschlichen Beweggründen gehört. Helfen bedeutet etwas Gutes tun. In unserer Kultur ist es normal, anderen, auch Fremden, zu helfen.
Die Hilfsbereitschaft ist eine zentrale Komponente in vielen sozialen Berufen. Die pflegerisch-sozialen Berufe heben sich hier besonders hervor. Das kann ja auch gar nicht anders sein, denn durch die professionelle Hilfe einer Pflegekraft kompensiert ein Patient/Bewohner etwas, das er nicht (mehr) selbst tun kann. »Florence Nightingale (1820–1910) schrieb einmal dazu: »Krankenpflege ist keine Ferienarbeit. Sie ist eine Kunst und fordert ... eine ebenso große Hingabe, eine ebenso große Vorbereitung wie das Werk eines Malers oder Bildhauers. Denn was bedeutet die Arbeit an toter Leinwand oder kaltem Marmor im Vergleich zu dem lebendigen Körper, dem Tempel Gottes? Krankenpflege ist eine der schönsten Künste, fast hätte ich gesagt – die schönste aller Künste.«3
Zur Kunst gehört aber das notwendige Handwerkszeug. Wer ein wahrer Meister in der Pflege anderer werden will, der muss auch über Selbstschutz verfügen. Wenn Pflege das kompensieren soll, was ein anderer nicht mehr selbst für sich tun kann, dann ist sie auch die Kunst, das Notwendige zu erkennen – und eben nicht mehr zu tun als das. Doch manchmal mündet das empathische Helfen-Wollen in die rigide Übernahme von Tätigkeiten, die der Patient/Bewohner durchaus noch tun könnte, wenn man ihn nur ließe.
Es entsteht ein krasses Machtgefälle: Aus der Rolle der Pflegekraft als Unterstützerin der Selbstpflege wird mehr und mehr die Rolle der Gebenden, der Stärkeren und Versorgenden. Der Patient/Bewohner wird zur Passivität gezwungen, in seiner Selbstpflege beschränkt und schlussendlich sogar dafür verantwortlich gemacht, dass »man ja alles selber tun müsse«. Die Pflegekraft wird zum hilflosen Helfer. Aus dem Helfen-Wollen wird ein Helfen-Müssen, ein Gar-nicht-mehr-anders-Können, kurzum: ein Helfersyndrom.
Was steckt dahinter? Warum sind viele Pflegekräfte so gefährdet, ihre unterstützende Rolle zugunsten einer fragwürdigen und selbstschädigenden Machtposition aufzugeben?
Die Gründe sind vielfältig. Zum einen fällt es manchen Pflegekräften schwer, Patienten- oder Bewohnerschicksale hinzunehmen, einen klaren Pflegeprozess zu planen und umzusetzen, der aus vielen kleinen Schritten besteht. Schritten, die Geduld brauchen, Zeit und immer wieder das Zurücknehmen der Pflegekraft.
Zum anderen steckt hinter dem Helfersyndrom auch ein psychologisches Phänomen, das der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer in seinem Ansatz des »hilflosen Helfers« so beschreibt:
»Eigene Bedürfnisse nach Versorgung durch Zuwendung und offenes Geben und Nehmen von Gefühlen werden nicht angemessen befriedigt, weil die Helfer starr auf die Rolle der Autorität festgelegt sind. Da Abhängigkeit und Bedürftigkeit schambesetzt sind und vom bewussten Erleben wenig zugelassen werden, bleiben die entsprechenden Bedürfnisse auf einer primitiven, wenig entwickelten Stufe. ... Der hilflose Helfer kompensiert durch seinen beruflichen Übereinsatz Gefühle innerer Leere und Wertlosigkeit, welche durch seine Armut an Ausdrucksmöglichkeiten und emotionalem Austausch mit anderen Menschen entstehen. ... In keiner Berufsgruppe werden eigene (psychische) Störungen so vertuscht und bagatellisiert wie in jener, die unmittelbar mit der Behandlung solcher Störungen befasst ist. Schwäche, Hilfslosigkeit, das offene Eingestehen emotionaler Probleme werden nur bei anderen begrüßt und unterstützt, während das eigene Selbstbild von solchen »Flecken« frei bleiben soll.«4
Die Offenheit, mit der Schmidbauer schreibt, wirkt auf viele seiner Leser äußerst kränkend. Tatsächlich ließen und lassen sich viele Leser, Pflegekräfte und auch Ärzte, nur ungern diesen Spiegel vorhalten. Schmidbauers Erklärungsversuche, die bereits 1977 erschienen, wurden nicht etwa begeistert begrüßt. »Das Buch wurde zum Bestseller, vielen seiner Kollegen galt Schmidbauer damals als Nestbeschmutzer. Doch der heute 69-Jährige hatte in Therapiegruppen beobachtet, dass professionelle Helfer ihren Beruf oft aus einer unbewussten Abwehr gegen einen meist in der Kindheit erlebten Liebesentzug wählen. Sie delegieren die eigene Verletzbarkeit an Patienten, die sie überbeschützen; als Gegenleistung erhoffen sie die so sehnlich vermisste Zuneigung. Nach dem Motto: Weil mir nicht geholfen wurde, werde ich Helfer. Die Kombination macht verwundbar, nicht selten führt sie zum Burnout.«5
2.1Das Helfersyndrom – fünf Komponenten eines Phänomens
Schmidbauer erklärt das Helfersyndrom also biografisch – als Prägung einer Person in der Kindheit. In dieser Zeit ihrer Entwicklung hätten Betroffene die Erfahrung machen müssen, dass ihre kindlichen Bedürfnisse nicht befriedigt wurden. Sie erlebten, dass sie nicht einfach so Aufmerksamkeit und Zuwendung bekamen und blieben emotional hungrig. Als Kinder hatten sie keine andere Wahl, als diesen Hunger zu kompensieren, indem sie sich die Zuwendung durch unermüdlich angebotene Hilfeleistung sozusagen »erarbeiteten«. Die so verzweifelt nach Liebe und Anerkennung strebenden Kinder litten an der Angst, ungeliebt und unerwünscht zu sein.
Schmidbauer spricht im Zusammenhang mit dem Helfersyndrom von fünf Komponenten:
1. »Das abgelehnte Kind,
2. die Identifizierung mit dem Über-Ich (Ich-Ideal, Größen-Selbst),
3. die narzisstische Unersättlichkeit,
4. die Vermeidung von Gegenseitigkeit,
5. die indirekte Aggression.«6
2.1.1Das abgelehnte Kind
Manche Kinder haben nie die Erfahrung gemacht, um ihrer selbst willen geliebt zu werden. Sie durften nie Kind sein, sondern hatten stets die Bürde der Verantwortung zu tragen. Es gab keine Rückzugsmöglichkeiten, keine spielerisch-freie Zeit, sondern eine stete Habacht-Stellung. Wie ein kleiner Seismograph registrierten diese Kinder jede Regung der anderen, vor allem der Erwachsenen. Sie lernten zu beschwichtigen und ihre eigenen Gefühle zu unterdrücken. Als Folge davon fiel es ihnen schwer, »ein Über-Ich (also eine normative Instanz, eine »Stimme des Gewissens«) zu entwickeln, die freundlich mit ihren Trieben und Emotionen umgeht.«7
Die Gründe für die Ablehnung eines Kindes sind und bleiben vielfältig:
• Das Kind ist (anfänglich) unerwünscht.
• Die Bezugsperson nimmt das Kind auf der Ebene des Über-Ich an, es fehlt eine gefühlsmäßige Bindung.
• Die Bezugsperson betreibt andere Aktivitäten in einem derartigen Ausmaß, dass für das Kind kein Platz in ihrem Leben bleibt.
So gibt das solchermaßen eingeengte Kind Zuneigung und Verständnis im Übermaß, um Liebe und Nähe zu erringen, die aber größtenteils versagt bleiben. Das Bedürfnis danach bleibt ungestillt und im Erwachsenenleben sind diese Kinder, die nicht Kind sein durften, extrem verletzlich. Kränkungen sind sie für sie fast eine Existenzvernichtung. Sie fühlen sich sofort verantwortlich – auch wenn sie gar nicht angesprochen sind, geschweige denn verantwortlich. Sie leiden unter dem Gefühl, abgelehnt, zurückgelassen und unerwünscht zu sein.
Diese Verletzungen haben Konsequenzen:
• Die Suche nach Bestätigung und Anerkennung ist ein ständig nagender Hunger. In der Helferrolle werden alte Verletzungen kompensiert und das in der Kindheit Gelernte – »Wenn ich tue, was die anderen wollen, bin ich in Ordnung« – stets neu befeuert. Die Betroffenen sehnen sich nach Bestätigung. Immer wieder müssen sie erfahren, dass sie gebraucht werden.
• Es gibt starre Vorstellungen von »falsch« und »richtig«. Abweichende Vorstellungen, Haltungen, Gedanken und Glaubenssätze anderer können nicht angenommen werden.
• Aggressionen sind eine Bedrohung und werden deshalb oft verleugnet und ignoriert. Dies erlebe ich seit Jahren in Teamtrainings, wo einige Pflegekräfte so tun, als wäre alles in Ordnung. Ihnen fehlt das stabile Selbstvertrauen, um zu Konflikten und Aggressionen stehen zu können. Toleriert werden dagegen passive Aggressionen wie Klatsch und Tratsch und auch das abwertende Sprechen über Patienten/Bewohner und deren Anliegen. Tratsch ist ein verbindendes, ein kollegiales Element. Er macht den Einzelnen zum Mitglied eines Teams. Tratsch verbindet.
• Beziehungen und Freundschaften sind nicht ausbalanciert, da es immer darum geht, der Gebende zu sein. Die schwere Lektion aus der Kindheit macht es fast unmöglich, Schwächen einzugestehen und Hilfe zu erbitten.
• Das selbst gesetzte Ideal ist es, heroisch, uneigennützig und bedürfnislos zu sein. Doch die Erfüllung dieses Ideals können nur andere geben: Bestätigung ist stets wichtig. Kritik ist eine vernichtende Entwertung.
2.1.2Die Identifizierung mit dem Über-Ich
Hier gilt es, erst einmal die Begriffe von Über-Ich, Es und Ich zu klären. Es war Sigmund Freud, der diese drei Instanzen als erster benannte.
Freud sah das Über-Ich als moralische Instanz an. Es ist das Gewissen und der Gegenspieler der Lusttriebe, des Es. Das Über-Ich bildet sich in den ersten sechs Lebensjahren eines Kindes. Es enthält die moralischen Vorgaben, die verinnerlichten Wertvorstellungen des sozialen und kulturellen Umfeldes des Kindes. Insbesondere prägend sind die Eltern, denn sie sagen dem Kind, was »gut« ist und was »schlecht«.
Das Über-Ich wird auch beeinflusst durch die Umgebung, durch die Menschen, die eine Bedeutung haben und mit denen sich das Kind identifiziert.
Auch der Prozess des Denkens geschieht unter dem Einfluss des Über-Ichs. Die Bewertung von Ereignissen, Erfahrungen und Informationen unterliegt der sich bildenden Moral und prägt somit auch das Denken.
Das Es steht für den unbewussten, triebhaften Teil einer Persönlichkeit. Hierhin gehören sexuelle Begierde sowie aggressive Impulse, die Freud als angeboren ansieht.
»Das Über-Ich, der Sitz aller Erfahrungen, die das Lebewesen individuell sammelt, und mit diesen auch der sozialen Normen, und der Sitten und des Gewissens, ist eine Art Kontrollinstanz gegenüber dem an sich ungehemmten, nach unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung strebenden Es. Das Über-Ich wirkt auf das Ich, indem es die Impulse des Es gefühlsmäßig mit Unbehagen, Angst oder Ablehnung einfärbt, oder sie für das Ich (Bewusstsein) sogar ganz unkenntlich macht (»Zensur«), damit es den »animalischen« Versuchungen des Es nicht erliege.«8
Das Ich, die individuelle Identität, umfasst das Denken, Fühlen und Handeln. Alles, was wir wahrnehmen und betrachten können, geht von unserem Ich, unserer individuellen Persönlichkeit aus, das zwischen Über-Ich und Es angesiedelt ist.
Es gibt Menschen, bei denen sich diese Dreiteilung des Selbst harmonisch ergänzt und miteinander verzahnt. Gerät diese Dreiteilung jedoch aus der Balance, können ganz unterschiedliche Folgen entstehen, wie zum Beispiel das Helfersyndrom: Hier wird das Über-Ich zu stark betont. Der Mensch verliert seine Empathie. Er urteilt unsensibel, hart und abweisend.
2.1.3Die narzisstische Unersättlichkeit
Mit dem Begriff Narzissmus verbinden sich Worte wie Egoismus, Arroganz und ausgeprägte Selbstsüchtigkeit. Der Begriff geht auf den griechischen Mythos von Narzissus zurück, der sich – der Sage nach – in sein eigenes Spiegelbild verliebte.
Doch in der Psychologie wird mit dieser Selbstverliebtheit auch eine zutiefst empfundene Unzulänglichkeit verbunden. Narzisstische Menschen sind oft sehr unsicher und suchen verzweifelt nach Bestätigung von außen, nach Bewunderung