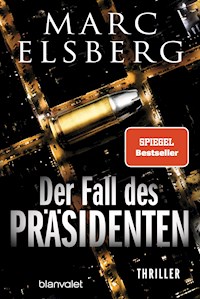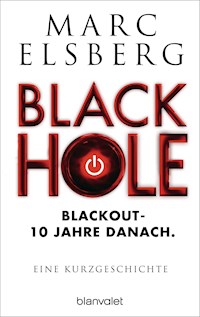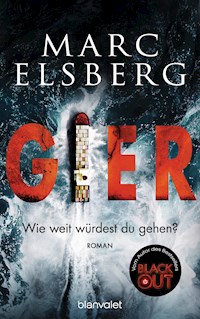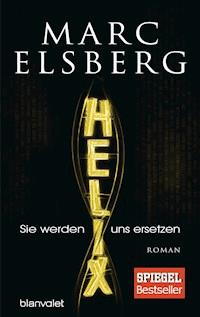
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»›Helix‹ ist ein Pageturner. Wer Thriller mag und sich ein wenig für Wissenschaft interessiert, kommt an diesem Buch nicht vorbei.« Deutschlandfunk »Auslese kompakt«
Sie sind perfekt. Sie sind außer Kontrolle. Sie werden dich ersetzen!
Der US-Außenminister stirbt bei einem Staatsbesuch in München. Während der Obduktion wird auf seinem Herzen ein seltsames Zeichen gefunden – von Bakterien verursacht? In Brasilien, Tansania und Indien entdecken Mitarbeiter eines internationalen Chemiekonzerns Nutzpflanzen und –tiere, die es eigentlich nicht geben kann. Zur gleichen Zeit wenden sich Helen und Greg an eine Kinderwunschklinik in Kalifornien. Der Arzt erzählt ihnen von einem inoffiziellen Forschungsprogramm, das über hundert »sonderbegabter« Kinder hervorgebracht hat. Doch dann verschwindet eines dieser Kinder, und alles deutet auf einen Zusammenhang mit sonderbaren Ereignissen überall auf der Welt hin …
»Große Fragen, großes Kino.« ZEIT Wissen
»Diesmal geht es um Gentechnik, und wieder überkommt einen beim Lesen das pure Grauen …« NDR Kultur
Lesen Sie auch den aktuellen Thriller von Marc Elsberg: °C - Celsius! Ein Klimathriller, der alles auf den Kopf stellt.
Außerdem erhältlich:
BLACKOUT. Morgen ist es zu spät. Auch als Premiumausgabe – mit einer exklusiven Kurzgeschichte von Marc Elsberg und weiteren Extras!
ZERO. Sie wissen, was du tust.
GIER. Wie weit würdest du gehen?
Der Fall des Präsidenten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 651
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch:
Der US-Außenminister stirbt bei einem Staatsbesuch in München. Während der Obduktion wird auf seinem Herzen ein seltsames Zeichen gefunden – von Bakterien verursacht? In Brasilien, Tansania und Indien entdecken Mitarbeiter eines internationalen Chemiekonzerns Nutzpflanzen und -tiere, die es eigentlich nicht geben kann. Zur gleichen Zeit wenden sich Helen und Greg, ein Paar Ende dreißig, die auf natürlichem Weg keine Kinder zeugen können, an eine Kinderwunschklinik in Kalifornien. Der Arzt macht ihnen Hoffnung, erklärt sogar, er könne die genetischen Anlagen ihres Kindes deutlich verbessern. Er erzählt ihnen von einem – noch inoffiziellen – privaten Forschungsprogramm, das bereits an die hundert solcher »sonderbegabter« Kinder hervorgebracht hat, und natürlich wollen Helen und Greg ihrem Kind die besten Voraussetzungen mitgeben, oder? Doch dann verschwindet eines dieser Kinder – und alles deutet auf einen Zusammenhang mit den sonderbaren Ereignissen nicht nur in München, sondern überall auf der Welt …
Autor:
Marc Elsberg wurde 1967 in Wien geboren. Er war Strategieberater und Kreativdirektor für Werbung in Wien und Hamburg sowie Kolumnist der österreichischen Tageszeitung »Der Standard«. Heute lebt und arbeitet er in Wien. Mit seinen internationalen Bestsellern BLACKOUT und ZERO etablierte er sich auch als Meister des Science-Thrillers. Beide Thriller wurden von »bild der wissenschaft« als Wissensbuch des Jahres in der Rubrik Unterhaltung ausgezeichnet und machten ihn zu einem gefragten Gesprächspartner von Politik und Wirtschaft.
Weitere Informationen unter: www.marcelsberg.com
Von Marc Elsberg bereits erschienen
BLACKOUT – Morgen ist es zu spät; ZERO – Sie wissen, was du tustBesuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Marc Elsberg
HELIX
Sie werden uns ersetzen
Roman
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Dieses Buch erhebt keinen Faktizitätsanspruch, obwohl reale Unternehmen erwähnt und realistische Abläufe thematisiert werden, die es so oder so ähnlich geben könnte. Die beschriebenen Personen, Begebenheiten, Gedanken und Dialoge sind fiktiv.
Copyright © Marc Elsberg, vertreten durch Literarische Agentur Michael Gaeb
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2016 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Angela Kuepper
Covergestaltung: © www.buerosued.de
ED · Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-17587-0 V015 www.blanvalet.de
Wie immer,für Ursula
»Panta rhei« (Alles fließt).
Heraklit von Ephesus, griechischer Philosoph (zugeschrieben)
»Nur ein Narr macht keine Experimente.«
Charles Darwin, britischer Naturforscher
»Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.«
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
»Reach out and touch faith. Your own personal Jesus.«
Depeche Mode, britische Popband
Am ersten Tag
1
Dann stand nur mehr das Rednerpult auf der Bühne des voll besetzten Hotelsaals, und der US-Außenminister lag reglos daneben. Die Zuhörer in den ersten Reihen sprangen auf, der Rest folgte. Ein paar Anzugträger stürzten zum Podium, Securitymänner in Schwarz hinterher, andere beugten sich schützend über einzelne Anwesende. Die deutsche Kanzlerin, erkannte Jessica Roberts von ihrem Platz in einer der hintersten Reihen, der britische Premier, der französische. Jessica hatte keinen Schuss gehört. Doch der Schwarm denkt nicht. Jeder folgt seinem Vordermann oder der Nachbarin, steckt die Nächsten an. Jetzt wollten alle hinaus. Jessica stürmte gegen den Strom Richtung Podium. Wich in die sich leerenden Stuhlreihen aus, kletterte trotz Rock und Stöckelschuhen über Lehnen. Aus den Lautsprechern rief eine Männerstimme auf Englisch: »Bitte, bewahren Sie Ruhe!«
Niemand folgte der Anweisung. Wenigstens waren die Sitzreihen jetzt fast leer. Nur ein paar Verlorene standen noch vor ihren Stühlen und schauten ratlos oder neugierig. Eine kleine Traube dunkler Anzüge in verschiedenen Schattierungen verdeckte den Körper des Außenministers. Einer der muskulösen Securitymänner stellte sich Jessica in den Weg.
»Stopp!«
»Lassen Sie mich durch!«, forderte sie auf Englisch. »Ich bin eine Mitarbeiterin des Ministers!«
Sie wies auf ihr Namensschild.
Dr. Jessica Roberts
US National Security Advisor’s Team
msc Munich Security Conference
Münchner Sicherheitskonferenz
»Sorry, Ma’am.«
»Ihr Job ist es, Menschenleben zu retten!«, rief sie. »Gerade tun Sie das Gegenteil! Der Mann dort vorne stirbt!« Das wusste sie zwar nicht, aber die Augen des Securitymonsters zeigten einen Moment der Verunsicherung. Jessica nutzte ihn, um an seinem schweren Arm vorbeizuhuschen. Groß und stark, diese Typen, aber schwerfällig.
Ein Mann nestelte an der Krawatte des Ministers. Ein zweiter fingerte unbeholfen an seinem Handgelenk herum. Suchte den Puls. Jessica stieß sie zur Seite. Kein Blut. Den Zusammenbruch musste etwas anderes ausgelöst haben. Mit einem Griff hatte sie den Schlips gelöst und aus dem Kragen gezogen. Riss die oberen Knöpfe auf. Suchte den Puls an der Halsschlagader. Beugte sich dicht über den schlaffen Mund, um Atem an ihrem Ohr zu spüren.
Kein Atem. Kein Puls.
Ohne lange nachzudenken, stemmte sie ihr ganzes Gewicht auf den Brustkorb des Ministers, dessen Torso unter dem Druck bebte. Und zwei! Und drei! Richtig rein! Rippen durften brechen. Jessica fand ihren Rhythmus. In ihrem ersten Erste-Hilfe-Kurs bei den Pfadfinderinnen vor über zwanzig Jahren hatte sie gelernt: Herzmassage und beatmen. Bei ihrer letzten Auffrischung vor einem Jahr hatte sie die neueste Methode erfahren: nur Herzmassage. Die heftige Bewegung des Brustkorbs beförderte ausreichend Sauerstoff in die Lunge.
Sie wusste nicht, wie oft sie den Druck wie in Trance wiederholt hatte, als eine Stimme neben ihr etwas auf Deutsch sagte und jemand sie sachte, aber bestimmt an den Schultern zurückzog. Ein junger Mann in roter Jacke kniete mit einer Atemmaske in der Hand neben dem Minister nieder. Ein zweiter packte die Metallplatten des Defibrillators aus.
Die Ärztin prüfte Pupillen, Atmung, Puls. Ein kurzer Befehl an die Sanitäter. Der eine zog dem Minister die Atemmaske über das Gesicht. Der andere riss das Hemd auf, Knöpfe flogen in alle Richtungen. Legte den bleichen Ministerbauch frei, dessen Haut trotz Trainings altersbedingt an einigen Stellen zu erschlaffen begann. Er legte die zwei Defi-Platten an die beiden Brustseiten. Die Ärztin nickte. Jessica zuckte zusammen, als der Körper sich unter dem elektrischen Schlag aufbäumte. Die Ärztin wartete kurz, gab noch einmal einen Befehl auf Deutsch, den Jessica nicht verstand. Wieder hob es den Rumpf des Ministers vom Boden. Jessica schauderte.
Durch den Mittelgang eilten zwei weitere Sanitäter mit einer Trage auf einem Fahrgestell herbei. Zu viert hoben sie den Körper auf die Trage. Das bleiche Gesicht unter der Maske, das wirre, verschwitzte Haar, die Hemdfetzen, der blasse Körper, die Hose verrutscht, mit einem großen nassen Fleck im Schritt, so sah man die Herren der Welt nur auf seltenen Kriegsbildern. Wenn sie zu den Verlierern zählten.
Rasch blickte Jessica sich im Saal um. Der war jetzt fast leer. Sie entdeckte keine Journalisten, auch oben nicht, auf den Rängen, von wo sie einen guten Fotowinkel gefunden hätten. Ihr linker Handrücken und ihr rechter Handballen pulsierten. Die Trage setzte sich in Bewegung, umringt von Sanitätern, der Ärztin, Securityleuten, einigen der Ersthelfer und Jessica. Eine kleine Gruppe blieb am Podium zurück, blickte ihnen betroffen nach, flüsterte. Einer, der sein Jackett ausgezogen und auf den Boden geworfen hatte, hob es auf, klopfte es ab und zog es wieder an. Schob den Krawattenknoten zurecht. Strich sich über das Haar.
Der Defi-Sanitäter legte die Elektroden wieder an. Der Stromschlag beutelte den Körper so heftig, dass Jessica fürchtete, er würde von der Trage stürzen. Die Ärztin beugte sich über ihn, hielt das Tempo. Im Hotelflur pflügten die Securitys vor ihnen mit entschiedenen Bewegungen und knappen, scharfen Befehlen durch die wartende Menge. Die Diplomaten und ihre Entouragen drängten sich erschrocken gegen die Wände, um sie durchzulassen. Die Securityleute hielten die Journalisten vom Fotografieren und Filmen ab. Jessica streckte sich, um mehr zu sehen, hatte Mühe, Schritt zu halten.
»Wie geht es ihm?«, rief sie der Ärztin zu. Die blickte nicht einmal auf. Vielleicht verstand sie kein Englisch.
Vor dem Hotel wartete ein Krankenwagen. Die Sanitäter schoben die Trage mit dem Minister durch die geöffnete Hecktür. Hinter Jessica sammelten sich weitere Mitglieder der Delegation und andere Konferenzbesucher. Nur aus den Augenwinkeln nahm sie wahr, dass die Security die anderen vom Geschehen fernhielt. Als Jessica einsteigen wollte, hielt die Ärztin sie auf.
»Sie können nicht mit«, erklärte sie in flüssigem Englisch.
»Wo bringen Sie ihn hin?«
»In die Universitätsklinik.«
»Er ist der US-Außenminister.«
»Ich weiß.« Ein Blick auf Jessicas Namensschild. »Wir tun, was nötig und möglich ist. Die besten Ärzte werden sich um ihn kümmern.«
Im Wageninneren massierte ein Sanitäter wieder das Herz des Ministers. Die Ärztin zog die Tür zu. Das Polizeiauto davor schaltete die Sirene an und raste los. Der Rettungswagen schloss sich mit Blaulicht und Sirene an, ein weiterer Polizeiwagen folgte blinkend und lärmend.
Als die Wagen hinter der nächsten Ecke verschwunden waren, umklammerten mit einem Mal Jessicas Rippen wie eiserne Krallen ihre Lunge. Erschrocken kämpfte sie gegen den ehernen Griff, ohne auch nur das geringste bisschen Luft einsaugen zu können.
Beruhige dich! In kritischen Situationen das Gegenteil von dem tun, was der Reflex gebietet!
Statt eines weiteren Atemversuchs stieß sie mit einem heftigen Keuchen das letzte bisschen Luft aus. Ihre Rippen lockerten sich, und mit einem tiefen Zug füllte sie ihre Lunge mit dem dringend benötigten Sauerstoff. Keine Panik jetzt! Es war vorbei.
Langsam wurde Jessica bewusst, dass sie in Kostüm und Stöckelschuhen bei Minusgraden im Schnee stand, der die Münchner Fußgängerzone mit einer dünnen Schicht überzog. Vereinzelt fielen Flocken, als hätte jemand sie da oben verloren.
2
Jegors Fahrer Andwele lenkte den Landcruiser von der staubigen Sandpiste auf eine Seitenstraße, die den Namen kaum verdiente. Die Schlaglöcher hämmerten direkt in Jegors Kreuz, sein Arm schlug gegen die Tür.
Aus dem Radio quasselte ein Moderator Englisch mit schwerem tansanischem Zungenschlag. Jegor hörte nicht hin. Sein Blick flog abwesend über die einfachen einstöckigen Häuschen an der Strecke, die Farben von der Witterung ausgebleicht, gesprungener und abblätternder Putz, gedeckt mit Wellblech oder zerfledderten Palmwedeln. Manche noch unverputzt, doch die Ziegel wirkten schon alt. Davor windschiefe, beschattete Tischchen mit Obst oder Gemüse, hinter denen eine Frau saß, manchmal auch zwei. Dazwischen eine Werkstatt, vor der ein paar Männer im Sand hockend brüteten, ein Krämerladen, aus dem eine Frau mit zwei prallen Plastiktüten und drei Kindern im Schlepptau stapfte und bei jedem Schritt eine kleine Staubwolke aufwirbelte. Seit zwölf Jahren lebte Jegor in Afrika, seit sechs in Tansania. Auf diesem Kontinent sah fast alles Menschengemachte entweder halb fertig oder halb verfallen aus, fand er.
Andwele wich einem Schlagloch aus, ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren. Jegor klammerte sich fester an den Haltgriff über der Tür. Kinder in zerfaserten Pullovern, kurzen Hosen und bloßen Füßen winkten ihnen lachend zu. Die Häuser wurden weniger, Mais-, Maniok- und andere Felder übernahmen, unterbrochen von Dickicht, ab und zu gesäumt von Palmen. In der Ferne stieg eine breite Rauchwolke in den wolkenlosen Himmel, vermutlich Brandrodung.
An einem tristen Maisfeldrest lenkte Andwele den Wagen an den Rand der Straße, wo er schief zum Stehen kam. Sie sprangen hinaus in die süßlich-erdig riechende Hitze, traten an den Rand des Feldes. Oder was davon übrig war. Die verkümmerten, halb vertrockneten Pflanzen waren durchlöchert und zerfranst. Jegor begutachtete einige Blätter, bog die Deckblätter eines armseligen Maiskolbens auseinander. Überall wuselten kleine Raupen.
»Armyworm«, murmelte er. Als ob die vorangegangene Dürre nicht genügt hätte. In manchen Jahren zerstörte Spodoptera exempta bis zu dreißig Prozent der Maisernte befallener Gebiete. Teile der Pwaniregion westlich von Daressalam hatte es dieses Jahr besonders schlimm erwischt. Trotz der laufenden Beobachtung, Vorbeugung, Gräben gegen die Raupenkolonnen und intensivem Pestizideinsatz hatten weder Behörden noch Bauern das Desaster verhindern können. Hatten die Raupen ein Feld verwüstet, zogen sie in langen Reihen nebeneinander zum nächsten. Daher der Name.
Jegor warf die Blätter zu den anderen auf den Boden und kehrte zurück zum Wagen. Mais war eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel weltweit, auch hier in Tansania. Ein Befall mit dem Armyworm oder anderen Schädlingen konnte für den betroffenen Bauern den Ruin und für die Region eine Hungersnot bedeuten.
»So sieht es hier überall aus«, erklärte Andwele in seinem Singsangakzent, während er den Motor startete. »Dieses Jahr ist es besonders schlimm. Fast überall. Nur an einem Flecken nicht. Inzwischen nennen ihn alle nur noch das Wunder.«
Zwanzig Kilometer durch den Staub und zahllose Schlaglöcher weiter fuhr Andwele auf den breiten Streifen ab, der die Straße von den verstreut stehenden Häuschen trennte, und bremste vor einem so heftig, dass er den Wagen in eine Staubwolke hüllte.
»Ganz toll gemacht«, brummte Jegor.
»Wir sind da!« Andwele sprang hinaus, umrundete den Landcruiser und öffnete Jegors Tür.
»Verd…«, setzte Jegor zu einem Fluch an, als der Staub ins Wageninnere drang. Seufzend hievte er sich ins Freie. Er kniff die Augen zusammen und sah zu, dass er aus der heißen Wolke kam, die sich langsam setzte.
Im Schatten eines mit trockenen Palmblättern gedeckten Vordachs musterte sie eine ausgemergelte Frau. Sie trug ein ausgewaschenes T-Shirt, einen ehemals bunten Rock und Flip-Flops. Hinter ihr lugten zwei neugierige Kinder mit verschmierten Gesichtern aus dem Dunkel. Ein Jugendlicher lehnte am Türrahmen.
»Das ist Najuma Mneney, von der ich Ihnen erzählt habe!«, stellte Andwele die Hausherrin vor, die Jegor misstrauisch beäugte. Im Gegenzug plapperte Andwele mit Najuma auf Suaheli, von dem Jegor noch immer nur einzelne Wörter verstand. Erst jetzt entdeckte er die Machete in der Hand des Jugendlichen. Leise wies er Andwele darauf hin. Der schien nicht sonderlich beeindruckt.
»Gegen Diebe«, erklärte er Jegor. »Die Wunderpflanzen sind sehr begehrt, wie man sich vorstellen kann.« Ungerührt verhandelte er weiter mit der Frau.
Najumas Blick flog zwischen Andwele und Jegor hin und her. Dann trat sie vor und gab ihnen ein Handzeichen, ihr zu folgen. Sie hatte den steifen Gang schwer arbeitender Menschen. Ein Blick über die Schulter überzeugte Jegor, dass der Machetenjunge auf seinem Posten blieb, sie jedoch wachsam beäugte. Hinter dem Haus befand sich eine kleine, bröcklige Terrasse mit verwitterten Plastikstühlen und einem wackeligen Holztisch unter einem zerfledderten Palmenblattdach. Daneben warteten zwei Kisten mit Mais auf dessen Verarbeitung oder den Verkauf. Andwele nahm einen Kolben heraus und reichte ihn Jegor. Gelb, groß, prall, gesund. Jegor nickte Najuma anerkennend zu. Die lächelte schüchtern.
Unmittelbar hinter der Terrasse begann Najumas Garten. Oder Feld, je nachdem, wie man es betrachtete. Für einen tansanischen Kleinbauern war oft schon ein Fleck von der Größe eines durchschnittlichen europäischen Vorgartens viel.
Najuma erklärte Andwele, der übersetzte: »Sie bewirtschaftet hier etwa zweitausend Quadratmeter Grund.« Najuma grenzte das Land mit ein paar Gesten ab. Dreißig Meter in der Breite, schätzte Jegor, enden musste es demnach in knapp siebzig Metern Entfernung hinter dem Gemüsegarten und den übermannshohen Maisstauden.
Najuma führte sie zwischen dichten Reihen hüfthoher Tomaten- und Paprikastauden voll halb reifer Früchte hindurch zum Mais. Dicht und in saftigem Grün ragte er über zwei Meter hoch. Noch nie hatte Jegor in dieser Gegend so vitale Maispflanzen gesehen. Najuma sagte etwas, ihr Arm beschrieb einen Kreis, doch Jegor hörte nicht zu und untersuchte stattdessen die Blätter und Kolben.
»Keine Raupen, nirgends«, erklärte Andwele. »Im Umkreis von etwa vier Kilometern leidet kein einziger Maisbauer unter den Schädlingen. Wenn einmal ein paar auftauchen, lassen sie die Pflanzen in Frieden, sterben oder ziehen weiter. Und«, erklärte Andwele mit einer Geste auf einen Kolben, »die Früchte sind viel größer als sonst.«
Nachdenklich wanderte Jegors Blick die Maispflanze aufwärts und wieder herunter. Seit er in Afrika für internationale Landwirtschaftskonzerne arbeitete, beschäftigte sich Jegor mit der Erforschung und Entwicklung von Nutzpflanzen, die ertragreicher, genügsamer, widerstandsfähiger und gegen Schädlinge resistenter waren als ihre Vorfahren. Mais war eigentlich nicht sein Spezialgebiet, auch nicht von seinem Arbeitgeber, der Saudi-Arabischen ArabAgric, die in Afrika Gemüse und Getreide für den Export in ihr Heimatland anbaute. Doch die Nachricht von der kleinen Insel der Seligen inmitten der katastrophalen Raupenpest und Dürre dieser Saison hatte Jegors Aufmerksamkeit erregt.
»Woher hat sie das Saatgut?«
»So wie alle anderen Kleinbauern hier«, erklärte Andwele nach Rückfrage an Najuma. »Korn aus der Ernte des Vorjahrs.«
»Verwendet sie Dünger und Pestizide? Womöglich andere als die betroffenen Bauern in der Umgebung?«
Kurzer Dialog, Najuma schüttelte den Kopf.
»Nein«, bestätigte Andwele.
»Weißt du, ob der Boden im heilen Gebiet eine andere Beschaffenheit hat?«
»Unsere Bodenkarten sagen Nein. Trotzdem habe ich Proben genommen und ins Labor gebracht«, erklärte der Afrikaner.
»Gut. Andere Bewässerungsmethoden? Diese Pflanzen sehen nicht aus, als litten sie unter der Dürre.«
Fragen auf Suaheli. Kopfschütteln.
»Hat sie sonst irgendetwas anders gemacht als früher?«
Nein.
»Bitte Najuma um ein paar Blätter und Kolben als Proben.«
Andwele diskutierte wieder mit Najuma, drückte ihr schließlich ein paar zerknitterte Scheine in die Hand und empfing im Gegenzug ein Büschel Blätter und einen Arm voll Maiskolben. Auf dem Weg zurück zur Terrasse unterhielten sich die zwei angeregt, während Jegor ihnen durch die schwüle Hitze folgte. Abwesend verfolgte er, wie die Diskussion der beiden aufgeregter wurde. Auf der Terrasse wandte sich Andwele an Jegor.
»Najumas Nachbarn machen die Geister für das Wunder verantwortlich.«
Natürlich. Geister. An allem in diesem Kontinent waren Geister, Ahnen oder Zauberer schuld. Jegor wollte es gar nicht so genau wissen. Er fragte trotzdem.
»Welche Geister?«
Es entspann sich ein Trilog auf Suaheli und Englisch.
»Niemand hat sie richtig gesehen, nur von Weitem. Vor ein paar Monaten, zur Blütezeit, flogen in der Morgendämmerung über die Felder. Jetzt noch ab und zu.«
»Wie haben sie ausgesehen, die Geister?«
»Sehr komisch. Luftgeister. Noch größer als eine Riesentrappe oder ein Helmperlhuhn. Aber wer weiß, was sie redet«, meinte Andwele mit einer abfälligen Handbewegung. Sie umrundeten das Haus, während Najuma weiter auf Andwele einredete.
»Geklungen haben sie wie Insekten. Gesummt, gebrummt«, übersetzte Andwele, nun bereits sichtlich genervt. Als sie den Wagen erreichten, wechselte Andwele zu ein paar Dankesfloskeln, die auch Jegor verstand. Wortreich und mit freundlichen Verbeugungen verabschiedete sie die Bäuerin.
»Summende Geister«, grummelte Jegor kopfschüttelnd und öffnete die Tür. Er freute sich auf das klimatisierte Wageninnere.
3
Jessica hasste den Geruch in Krankenhäusern, diese Mischung aus Reinigungsmitteln, Medikamenten und einem Anflug von Urin. Auf dem Flur vor ihnen tauchten gelegentlich Menschen in weißen Kitteln auf. Der Botschafter telefonierte fast ununterbrochen, lief dabei auf und ab. Auch Jessica erreichten immer wieder Anrufe. Meistens Konferenzteilnehmer, die sie kannten und die Auskunft über den Gesundheitszustand des Ministers haben wollten. Bald nahm sie keine Anrufe mehr entgegen. Die Sensationslust der Leute nervte sie. Sie konnte auch nicht mehr sagen, als der Flurfunk längst verbreitet hatte.
In einer gesicherten Limousine war sie gemeinsam mit dem US-Botschafter, dem Büroleiter des Ministers und dem Sicherheitschef der Delegation zehn Minuten nach dem Abtransport des Außenministers diesem in die Klinik gefolgt. Begrüßt hatte sie ein weiß bekittelter älterer Mann mit ernstem Blick. Der Außenminister sei in einem kritischen Zustand. Herzversagen. Derzeit befinde er sich im Operationssaal. Das war vor eineinhalb Stunden gewesen. Seitdem warteten sie in einem für solche Fälle vorgesehenen abgeschirmten Bereich des Gebäudes.
Der Botschafter gab der Öffentlichkeitsabteilung der Gesandtschaft mehrmals Anweisungen. Im Wesentlichen beschränkten sie sich auf eine Mischung aus Verbreitung von Optimismus und Vorbereitung auf den schlimmsten Fall. Er hing gerade wieder an seinem Handy, als zwei Ärzte auf sie zukamen. Jessica erhob sich. Beim Näherkommen erkannte sie den vorderen als den Mann, der sie empfangen hatte. Seinen Gesichtsausdruck hatte Jessica oft genug gesehen. Eine positive Nachricht verbargen Ärzte in solch einer Situation nicht. Sein Pokerface war so eindeutig, wie es eine bedauernde Miene gewesen wäre.
»Es tut mir leid …«, sagte er mit deutschem Akzent. »Sein Herz …«
Der Botschafter nickte stumm. In Jessica wühlte das Gefühl, versagt zu haben. Sie hatte Jack nicht retten können.
An Jessica gewandt, fuhr der Mediziner fort: »… zumal Sie sich noch ausgezeichnet um ihn bemüht haben, wie ich hörte.«
Nun nickte Jessica. Was sollte sie auch sonst tun?
»Wir werden eine Obduktion durchführen müssen«, erklärte der Sicherheitschef. Der Botschafter warf ihm einen befremdeten Blick zu. Doch der Sicherheitschef ging ein paar Schritte zur Seite und begann zu telefonieren.
Der Büroleiter des Ministers schaute zuerst den Botschafter, dann Jessica an. »Die offizielle Todesnachricht wird vom Außenministerium ausgegeben«, erklärte er dem Botschafter. »Ich kümmere mich gleich darum.«
Der Sicherheitschef trat wieder zu ihnen.
»Die Obduktion findet so bald wie möglich statt«, verkündete er dem verdutzten Arzt, als sei er in den USA und Herr im Haus. »Uns ist bewusst, dass örtliche Mediziner daran teilnehmen müssen. Von unserer Seite werden ebenfalls Fachleute anwesend sein. Zwei machen sich gerade auf den Weg von Stützpunkten in Europa. In vier Stunden sollten sie hier sein.« Er schaute auf die Uhr. »Also etwa gegen neunzehn Uhr. Bereiten Sie bitte alles dafür vor.«
»Das muss ich erst mit …«, setzte der Angesprochene an.
»Das wird der Herr Botschafter mit den Verantwortlichen klären«, schnitt ihm der Sicherheitschef das Wort freundlich, aber bestimmt ab.
Jessica sah Wangen und Stirn des Mannes vor unterdrücktem Zorn erröten. Doch er schwieg.
Der Büroleiter des Ministers griff die Hand des Arztes und schüttelte sie.
»Vielen Dank, Doktor, für alles, was Sie und Ihr Team versucht haben.«
Der überrumpelte Arzt murmelte: »Bitte. Natürlich. Ist ja unser Job.«
Der Büroleiter drückte die Hand noch einmal, dann wandte er sich an Jessica: »Eine weitere Teilnahme an der Konferenz schließt sich für uns aus Pietätsgründen aus. Ich lasse die Maschine für den Rückflug vorbereiten. Lou« – ein Kopfnicken zum Sicherheitschef – »kümmert sich um den Rest.«
4
Jim schielte in den Rückspiegel des Tesla. Das Mädchen starrte gedankenverloren aus dem Seitenfenster. Eine kleine, leicht nach oben gerichtete Nase, riesige blaue Augen mit endlosen Wimpern, die sanft geschwungene Stirn mit dem dunkelblonden Haaransatz, die vollen Lippen. Als hätte ein Bildhauer das Idealbild der Schönheit entworfen. Jim konzentrierte sich wieder auf den Verkehr. Jill war erst fünfzehn. Schön anzusehen, aber ein Kind. Auch wenn sie nicht so aussah.
Aus dem Radio dudelte Reklame. Neben Jim scannte Erin die Umgebung. Über Nacht waren ein paar Flocken gefallen. Der Vormittagsverkehr am Rande Bostons war dicht, aber nicht undurchdringlich.
»Heute Route vier?«, fragte Jill von der Rückbank, als Jim an einer Kreuzung abbog. Sie war ein cleveres Mädchen.
»Ja«, sagte er. »Mit Variationen.«
»Natürlich«, bemerkte sie.
»Guten Morgen, es ist zehn Uhr«, verkündete der Nachrichtensprecher, »und es ist kein guter Morgen. Gerade erreicht uns aus dem Weißen Haus die Nachricht vom überraschenden Tod des Außenministers Jack Dunbraith. Der Außenminister …«
»Was war das?«, fragte das Mädchen von hinten mit sich überschlagender Stimme. »Mach lauter!«
Überrascht gehorchte Jim. Er interessierte sich nicht für Politik und Politiker.
»… Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen, als er zusammenbrach.«
Im Rückspiegel sah Jim das Gesicht des Mädchens. Sie hatte sich zwischen die beiden Vordersitze gebeugt. Ihre weit aufgerissenen Augen wirkten puppenhaft, der halb geöffnete Mund zuckte kaum merklich. Am meisten irritierte Jim aber ihre Gesichtsfarbe. Der sonst blassrosa Teint war kalkweiß. So hatte er sie noch nie gesehen.
»Sag schon«, flüsterte sie. »Sag schon, woran.«
Jill sah aus, als wäre sie zu Tode erschrocken. Aber soweit Jim wusste, kannte sie weder den Verstorbenen, noch hatte sie irgendwelche Verbindungen zu ihm.
»Als offizielle Todesursache gaben die Ärzte Herzversagen bekannt.«
Das Mädchen im Rückspiegel schloss die Augen und ließ sich in den Sitz zurücksinken. Ihre Kiefermuskeln arbeiteten. Dann biss sie sich auf die Lippen. Jim runzelte die Stirn und fragte sich, worüber Jill sich so aufregte.
»… die Gebete der Präsidentin sind bei dem Verstorbenen und seiner Familie.«
Jill hatte die Augen wieder geöffnet. Ihre Miene hatte sich verändert. Der Mund fest geschlossen, ihr Blick konzentriert nach unten auf das Smartphone in ihrer Hand gerichtet, auf dem sie fieberhaft herumwischte.
Jim hielt vor dem imposanten Haupteingang des Massachusetts Institute of Technology.
»Wir sind da«, sagte er. Er stieg aus, sah sich um und öffnete die rückwärtige Tür der Fahrerseite. Ohne von ihrem Screen aufzusehen, packte Jill mit der freien Hand ihren Rucksack und warf ihn über die linke Schulter, während sie sich elegant aus dem viel zu niedrigen Wagen wand. Aufgerichtet war sie fast so groß wie der einen Meter fünfundachtzig große Jim. Allerdings hatte sie mit Abstand die bessere Figur. Dass sie diese Beine in hautenge Leggings stecken durfte, über die nur ein oberschenkellanger Parka hing, fand Jim unvernünftig. Aber er war ihr Leibwächter, nicht ihr Modeberater.
»Jede Stunde melden«, erinnerte Jim sie. »Nicht vergessen.«
»Mhm«, grummelte sie. Ihre Miene hatte sie wieder unter Kontrolle, bemerkte Jim. Die Gesichtsfarbe nicht. Sie war noch immer völlig blutleer.
»Alles in Ordnung?«, fragte er.
Jetzt sah sie hoch. Wirkte überrascht.
»Ja, wieso?«
Sie wandte sich zum Eingang, winkte ihnen, den Rücken zugewandt.
»Bis heute Nachmittag!«
Jim zog sein Smartphone hervor und aktivierte die versteckte App. Auf dem Screen erschien ein Satellitenbild seines Standorts. Mehrere einander überlagernde rote Punkte entfernten sich langsam von ihm auf das Gebäude zu.
5
Wie üblich hatte Colins Gesicht auf Jessicas Smartphone eine zu große Nase und eine ungesunde Gesichtsfarbe. Über den Knopf in ihrem Ohr hörte sie seine Stimme leicht verrauscht.
»Ich habe die Nachricht gerade gelesen«, erklärte er. »Warst du dabei?«
»Ja«, sagte sie in das Mikro am Kopfhörerkabel. Die ganze Geschichte konnte sie ihrem Ehemann immer noch nach ihrer Heimkehr erzählen.
»Unschön«, meinte er.
Ein »Wie geht es dir?« hätte Jessica passender gefunden.
»Ich kann damit umgehen«, erklärte sie.
»Wie ist das Prozedere?«
»Vorzeitige Abreise für uns«, sagte sie. »Sind die Kinder in der Nähe?« In Washington war es kurz nach elf Uhr morgens. Samstag, die Kinder hatten schulfrei.
Colin wandte sich ab. Leise hörte sie ihn »Jamie, Amy!« rufen, »Mami will euch sprechen!«
Jessicas Blick verlor sich für einen Moment in der Flughafenlounge, die für die Passagiere der staatlichen Maschine reserviert war. Mit Jessica waren es siebzehn Mitglieder der Delegation. Sie standen oder saßen in kleinen Gruppen beisammen, unterhielten sich leise oder saßen stumm über ihren Computern. Die restlichen Delegationsmitglieder würden in den nächsten Tagen Linienflüge nehmen.
»Hallo, Mami!«
Das Gesicht ihrer Jüngeren war ganz Augen, Nase und strahlendes Lachen, so nahe steckte sie es vor die Linse. »Kommst du nach Hause?«, krähte Amy. Jessica musste lächeln, zum ersten Mal seit dem Morgen. Sie drehte das Smartphone in Breitbildansicht. Irgendwo musste auch Jamie zu sehen sein. Tatsächlich tauchte er direkt neben Amy auf, den Kopf an den seiner kleinen Schwester gedrückt.
»Hi, Mami!«
»Hallo, Schätzchen! Ich bin bald zu Hause. Das Flugzeug startet in einer halben Stunde. Ich vermisse euch!«
»Wir dich auch Mami!«
»Wir freuen uns schon sooo, wenn du wieder da bist!«
»Ich mich auch! Bis dann! Ich liebe euch!«
»Einen guten Flug«, meldete sich Colin aus dem Hintergrund.
Zum Abschied schickte ihnen Jessica einen Kussmund. Dann beendete sie die Verbindung. Sie wurden zum Boarding gerufen. Sie hoffte, ihre Aufregung und Verstörung über die Ereignisse des Tages in München zurückzulassen, wie Gepäck, das man nicht mehr brauchte.
6
Von dem Großbildschirm an der Wand funkelten Helge Jacobsen zwei kleine schwarze Augen entgegen. Der Mann sah aus wie ein Philosoph aus dem Bilderbuch, ein lebenslustiger Philosoph. Das graue Lockengestrüpp und der Bart überwucherten fast seinen ganzen Kopf inklusive Gesicht.
»… nicht nur resistent gegen den Armyworm, sondern auch gegen die Dürre«, erklärte Stavros Patras auf dem Monitor und hielt zwei dicke Maiskolben so weit in die Kamera, dass sie unscharf fast das ganze Bild ausfüllten.
»Gibt es eine Erklärung dafür?«, fragte einer aus der Runde an dem langen Besprechungstisch, an dessen Ende der Monitor hing. Horst Pahlen, Chefentwicklung bei Santira, einem der größten Chemie- und Biotechkonzerne der Welt. Zwanzigtausend Mitarbeiter weltweit, über zehn Milliarden Dollar Umsatz, Zentrale in Zug, Schweiz, gelistet in Frankfurt und New York.
Der bärtige Wuschelkopf auf dem Bildschirm lehnte sich zurück und ließ ein zweites Gesicht in das Bild. Ein vierschrötiger Kerl mit eckigem Kopf, schiefer Nase, die einmal gebrochen gewesen sein musste, und kurz geschorenen Haaren.
»Das ist Jegor Melnikow, einer unserer leitenden Feldtechniker«, erklärte er. »Er bekam von einheimischen Mitarbeitern den Hinweis auf die Pflanzen. Jegor, Erklärung?«
»Die Bauern sagen, dass sie das Saatgut aus der Ernte des Vorjahres verwendeten«, antwortete Jegor Melnikow mit osteuropäischem Akzent. »Ich habe noch nie so fruchtbaren Mais in der Gegend gesehen. Rundherum wütet der Armyworm, und die Dürre ist so schlimm wie seit Jahrzehnten nicht. Und mittendrin das.« Er zeigte auf den Kolben in Stavros Patras’ Hand. »Normal ist das nicht.«
»Sie glauben nicht, dass es natürlich ist?«, fragte Pahlen.
»Eigentlich nicht«, sagte Jegor.
»Ich habe mit der Analyse des Erbguts begonnen«, erklärte der Grieche. »Erste Ergebnisse habe ich frühestens morgen.«
»Danke«, sagte Helge. »Wir reden wieder morgen achtzehn Uhr.«
Er beendete die verschlüsselte Verbindung.
Von den sechzehn komfortablen Lederlehnstühlen waren sieben besetzt. Helge selbst, Vorstandsvorsitzender Santiras, Horst Pahlen, drei weitere Forscher, Micah Fox, Leiter der Konzernsicherheit, sowie Jacques Cantini, Leiter der Abteilung für internationale Partnerschaften.
»Und?«, fragte Helge in die Runde.
»Schwer zu sagen«, meinte Simon Vierli, einer der Wissenschaftler. »Wir müssen uns auf das Urteil dieses Typen verlassen.«
»Mit ArabAgric und dem Griechen arbeiten wir seit Jahren zusammen«, erklärte Pahlen. »Kein Genie, aber zuverlässig.«
»Resistenz gegen den Armyworm und Dürre hatten wir noch nicht«, sagte Yannick van der Bloem, ein anderer Wissenschaftler. »Könnte der dritte Fall sein.«
Zum Glück hatten sie bereits vor Jahren ein dichtes internationales Netz von Scouts etabliert. Ihre Aufgabe war unter anderem die Suche nach unbekannten Wirkstoffen oder Eigenschaften von Pflanzen oder Tieren, die eventuell synthetisch und industriell hergestellt werden konnten. Vielleicht wurde daraus einst ein Waschmittel, ein Schädlingsvernichter, ein Medikament, ein Nahrungsmittelzusatz, ein Treibstoffersatz oder ein neuer Werkstoff. Wer seine Entdeckung diskret und schnell genug entwickelte und patentierte, konnte damit Unsummen verdienen.
Santira war vor elf Jahren durch den Zusammenschluss zweier großer Chemiekonzerne entstanden. Einer war stärker auf das klassische Geschäft konzentriert gewesen, der andere hatte bereits stark auf Biotech gesetzt. Diese Sparte hatte Helge Jacobsen in den vergangenen Jahren nach vorn getrieben. Dabei hatte er eine andere Strategie verfolgt als der Marktführer Monsanto. Deren Geschäftsmodell bestand die längste Zeit in der Beherrschung der gesamten Verwertungskette. Monsantos genetisch veränderte Baumwolle etwa erzeugte einen Wirkstoff gegen einen bestimmten Schädling und versprach damit weniger Arbeit und Risiko bei mehr Ertrag. Dafür war das Saatgut wesentlich teurer als normales. Und musste jedes Jahr aufs Neue gekauft werden. Die herkömmliche Methode der Baumwollbauern, Samen der Ernte als Saatgut für die nächste Aussaat zu verwenden, verletzte das Recht Monsantos an dem Saatgut. Ähnlich lief es mit Sojapflanzen, die immun gegen ein von Monsanto entwickeltes Unkrautvernichtungsmittel waren. Die Bauern pflanzten Soja und vernichteten mit dem Gift alle anderen Pflanzen auf dem Feld, was die Ernte deutlich vereinfachte. Zumindest so lange, bis die Unkräuter Resistenzen entwickelten. Der Konzern verdiente sowohl am Verkauf des Saatguts als auch des Unkrautvernichtungsmittels. Jede Saison wieder. Weil auch in diesem Fall Monsanto das alleinige Recht an den Produkten besaß. Wer dagegen verstieß, wurde wahrscheinlich sogar bis zum Bankrott verklagt. Ein brillantes Geschäftsmodell, dessen unerklärtes Ziel kein geringeres als die Beherrschung der weltweiten Nahrungsketten zu sein schien.
Helge hatte darin jedoch keine Zukunft gesehen. Lange hatte er sich dafür kritisieren lassen müssen. Monsantos Strategieschwenk in den letzten Jahren vom Gentech-Behemot hin zum datenbasierten Landwirtschaftsmanagementkonzern schien ihm nun recht zu geben. Aber was wusste man schon über die Zukunft?
Helge wollte Santira zum führenden Unternehmen der biologisierten Industrie beziehungsweise sogar der Bioeconomy machen. Weltweit wetteiferten Unternehmen aus allen Lebensbereichen um die Entwicklung neuer Stoffe, Materialien und Anwendungen, hergestellt von speziell dafür genetisch veränderten Mikroorganismen wie Bakterien, Hefen oder Pilzen – ob für Kunst- oder Treibstoffe, Farben, Industrie- oder Baumaterialien. Sie sollten zum Beispiel erdölbasierte Produkte umweltfreundlich und nachhaltig ersetzen. Von der Natur für die Natur, sozusagen. Dieses Narrativ zumindest hatte sich der neue Industriezweig ausgedacht.
Biotechnologie war längst zu einer zentralen Technologie des jungen Jahrtausends geworden. Und während sich, vor allem in Europa, die Menschen in der öffentlichen Diskussion über gentechnisch veränderte Nahrungsmittel erregten, ließen sie längst Wäsche an ihre Haut, die durch Enzyme aus gentechnisch veränderten Organismen im Waschmittel schon bei vierzig Grad Wassertemperatur statt bei sechzig oder neunzig Grad sauber wurde, oder rieben sich in dieselbe Haut Kosmetika, deren Wirkstoffe teilweise von gentechnisch manipulierten Organismen produziert wurden, ganz zu schweigen von Medikamenten, die sie schluckten und spritzten und die ohne die kleinen Helferlein kaum produziert werden konnten.
Frühzeitig hatte Santira auf die Erforschung vielfältiger natürlicher Stoffe aus aller Welt gesetzt und besaß heute eines der größten entsprechenden Archive.
»In Brasilien und Indien hat es genauso begonnen«, sagte Helge und widmete sich wieder der Diskussion. Auf dem Tisch verteilt lagen Fotos und Berichte. Sojabohnenfelder und -pflanzen, Ziegen. »Unsere Scouts hatten Proben geschickt und die betroffenen Landwirte mit ausreichend Geld zum Stillschweigen verpflichtet. So sind die Neuigkeiten bislang nicht an die Öffentlichkeit gelangt.«
»Den ersten Hinweis bekam vor ein paar Wochen ein Scout in Brasilien von einem Mitarbeiter einer regionalen Hilfsorganisation für Campesinos«, erklärte Horst Pahlen. »Deren Sojabohnen waren ertragreicher und robuster als jene, die genetisch verändert sind und inzwischen aus fast allen lateinamerikanischen Märkten Europas Rinderfutter stellen. Zu diesem Zeitpunkt sind wir noch nach dem üblichen Prozedere vorgegangen«, rechtfertigte er die späte Reaktion. »Die Sequenzierung und die Genanalyse der Proben haben bis gestern gedauert. Sonst wären wir jetzt vielleicht gar nicht so alarmiert. Vor vier Tagen sind von einem anderen Scout in Indien Hinweise zu Ziegen gekommen, denen die Ziegenpest nichts anhaben konnte. Die äußeren Umstände waren die gleichen: arme Region, arme Bauern. Niemand hatte die Geschichte bislang registriert oder gar gebracht, der Scout stieß zufällig darauf. Die Parallele zu den brasilianischen Sojapflanzen fiel intern noch nicht auf« – er zuckte mit den Schultern –, »Tiere sind eben eine andere Abteilung als Soja.«
»Da müssen wir unbedingt etwas an den Strukturen ändern«, forderte Helge. »So etwas darf nicht wieder passieren. Ich habe erst gestern davon erfahren, nach den Ergebnissen der Sojapflanzenanalyse.«
»Diese Pflanzen wurden genmanipuliert«, sagte Pahlen. »Wir wissen nicht, von wem. Nicht, warum. Nicht, wie. Nicht, wie sie zu den Bauern gekommen sind. Wir fanden bloß Gene, die nicht in die Pflanze gehören.«
»Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen«, übernahm Helge, »doch diese ersten Erkenntnisse genügen uns. Wir haben sofort ein Team hingeschickt, das der Sache auf den Grund gehen soll. Fast gleichzeitig erfuhr Horst von den indischen Ziegen. Das kam mir seltsam vor, weshalb ich eine Beschleunigung der Analysen anordnete und gezielt nach Genmanipulationen suchen ließ. Das Ergebnis erhielten wir gestern Abend. Auch die indischen Ziegen wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit manipuliert. Und wieder: Niemand weiß, von wem oder wie. Also schickten wir das nächste Team auf Reisen. Wir müssen nicht nur die neuen Entdeckungen untersuchen, sondern vor allem auch deren Urheber finden.
Gratis verteilte genetische Verbesserungen gefährden unser Geschäftsmodell und das der gesamten Branche!
Noch besitzen wir nicht genug Erkenntnisse, ob in den Sojapflanzen oder Ziegen bestehende Patente verletzt wurden. Das ergäbe immerhin einen Angriffspunkt, um die Ausbreitung zu verhindern.«
»Noch in der Nacht haben wir eine Sonderarbeitsgruppe eingerichtet, die konzernweit nach vergleichbaren Nachrichten suchen soll«, erklärte Pahlen. »Dazu wurden sämtliche Mitarbeiter und auch Vertragspartner in einer kurzen Nachricht unverfänglich zu noch mehr Neugier und Entdeckerlust angeregt. Als Anreiz winken hohe Boni. Einer der Angesprochenen war Stavros Patras bei ArabAgric. Nun haben wir die erste Antwort.«
»Das ging schnell«, bemerkte Helge. »Beunruhigend schnell. Wer ist am nächsten dran?«, fragte Helge. Ein Blick auf den Globus. Santira unterhielt Forschungslabore weltweit. Los Angeles, Boston, London, São Paulo, Mumbai, Singapur, Kobe. Von jedem konnte jederzeit ein Team losgeschickt werden. Buchstäblich ins Feld.
»Singapur«, antwortete Pahlen.
7
»Okay, wir haben lang genug gewartet.«
Jim Delrose warf einen letzten Blick auf den Screen seines Smartphones. Die Ansammlung blinkender Punkte in der Gebäudegrafik bewegte sich nicht. Er setzte die Sonnenbrille und die Schirmkappe auf.
»Du bleibst hier«, befahl er Erin.
Im Freien war die Temperatur nahe null. Sein Atem dampfte. Er eilte über die Massachusetts Avenue und betrat das Massachusetts Institute of Technology über die Lobby 7. Während er die Kuppelhalle durchquerte, suchte sein Blick zwischen Studenten und Besuchern. Weiter durch die historischen Maclaurin Buildings, durch das Gebäude 8, zum Dorrance Building und zum Whitaker Building mit seinen ineinander verschachtelten schiefen Türmen. Wer sich so etwas ausdachte. Nun, er musste hier ja nicht studieren. Jede Menge junger Leute in Freizeitkleidung, viele Jungs mit Bärten, aber nirgends der dunkelblonde Pferdeschwanz. Er folgte den Zeichen auf seinem Smartphone. Über Flure im Whitaker Building führten sie ihn zu – einer Toilette. Damen, klar. Für Bedenken hatte er jetzt keine Zeit. Kurzerhand betrat er die Sanitärräume, hob den empört protestierenden Anwesenden seinen Ausweis entgegen – Uralttrick, wer schaute in so einem Moment schon genau hin –, brüllte: »Security, das ist ein Notfall!« und fand die Kabine, die ihm das Smartphone wies. Ohne zu zögern, stieß er die Tür mit seiner mächtigen Schulter auf.
Auf dem geschlossenen Klodeckel fand er sorgfältig zusammengelegt Parka, Leggings, T-Shirt, Hoodie, Unterwäsche, Schuhe, Strümpfe, Rucksack und obenauf das Smartphone.
Auf dem Smartphone klebte ein Post-it, darauf gekritzelt:
Achtet auf Gene! Er ist gemeingefährlich!
Wer war Gene? Er kannte keinen Gene in Jills Umfeld. Musste er später klären. Er überprüfte das Gerät. Ausgeschaltet. Gut. So konnte es nicht verfolgt werden.
»Sie ist weg«, sagte er in sein Headset, während er mit seinem Telefon hastig ein paar Schnappschüsse der Situation anfertigte und danach den Kram rasch in den Rucksack packte. »Aber ihr ganzes Zeug ist da.«
Jetzt musste er zusehen, dass er davonkam, bevor ihn die Campuspolizei erwischte und Fragen zu stellen begann. Die würden noch früh genug aufkreuzen.
Während er im Vorbeilaufen den verärgerten Damen den Rucksack als Beweis für den Notfall entgegenstreckte, erklärte er Erin über das Headset: »Ich kann nicht länger bleiben. Du musst hier weitermachen.«
Der Campus des MIT erstreckte sich über achtundsechzig Hektar am Nordufer des Charles River. Auf dem Riesenareal hatte Jim nicht die leiseste Chance, das Mädchen zufällig zu finden. Als ehemaliger Navy Seal hatte er automatisch auf Kampfmodus umgeschaltet: kühlen Kopf und die Konzentration bewahren, geschärfte Sinne. Den Tesla hatte Erin bereits verlassen. Jim sprang hinein und fuhr mit dem Wagen um ein paar Ecken. Sobald er sich in Sicherheit wähnte, entpackte er den Rucksack und untersuchte jedes einzelne Teil noch einmal. Olivgrünes T-Shirt, dunkle Leggings, blaues Hoodie, weiß-blaue Sneaker. Kesse Unterwäsche für eine Fünfzehnjährige, fand Jim. Die Kleidungsstücke schienen ihm unversehrt. Keine Hinweise auf gewalttätiges Entkleiden. Zur Sicherheit entfernte er die winzigen Sender, die sie in allen Kleidungsstücken von Jill angebracht hatten, und verstaute sie fürs Erste im Handschuhfach. Falls die Polizei auftauchte und das Zeug mitnehmen wollte.
Was trug Jill jetzt? Jim überlegte fieberhaft: Falls sie in den kommenden Stunden verschwunden blieb, würden auch andere sie vermissen. Personen, auf die Jim und sein Team keinen Einfluss hatten. Kommilitonen, Professoren, Onlinekontakte. Spätestens dann würden Fragen auftauchen. Und irgendwann die Behörden eingeschaltet werden.
Er warf die Kleidung auf den Rücksitz und überprüfte auf seinem Smartphone noch einmal ihren Kalender. Der letzte Termin des Mädchens hatte im Whitaker Building stattgefunden. Treffen mit einer ihrer Arbeitsgruppen. Jim überflog die Liste der Mitglieder. Sechs Personen. Er rief die erste Studentin an.
»Hi, Jinjin, hier ist Jim Delrose. Du warst doch gerade mit Jill in eurer Lerngruppe.« Sie kannten ihn alle als einen von Jills Leibwächtern. »Ist sie bei dir?«
»Nein, ich bin auf dem Weg nach Hause. Ist was?«
»Nein. Danke. Schönen Tag noch.«
Der Nächste, Zhongbo. Studierten hier nur noch Chinesen?
Zhongbo hatte Jill ebenfalls zuletzt vor einer halben Stunde im Institut gesehen. Die Nächste.
»Mariah.«
»Hi, Jim, wie geht’s?«
»Danke. Ist Jill bei dir?«
»Ist sie nicht bei dir? Sie wollte doch heim. Sie sagte, ihr holt sie ab, wie üblich.«
»Natürlich. Bye.«
Zwei Namen noch auf der Liste. Newele.
»Ich bin noch im Institut«, sagte sie auf seine Frage. »Soll ich nachsehen?«
»Danke, nicht nötig.«
Blieb Amira. Sie hob nicht ab. Jim sandte eine Textnachricht. Hi, Amira, Jim Delrose, weißt schon, Jills Security. Ist sie bei dir?
Wenige Sekunden später die Antwort.
Nein. Probleme?
Mach dir keine Sorgen.
Fuck! Er rief Erin an.
»Irgendwas Neues?«
»Habe mich umgehört. Nichts.«
»Mist! Geh zurück zum Eingang, für den Fall, dass sie doch noch kommt.«
»Wir müssen ihr Verschwinden melden.«
»Noch nicht. Vielleicht wieder einmal nur eine ihrer Launen.«
»Ihre komplette Kleidung liegen gelassen und keine Spuren hinterlassen hat sie noch nie.«
Jim knirschte mit den Zähnen.
»Ich weiß. Hat sie dir einmal von einem Gene erzählt?«
»Nein. Wer soll das sein?«
Mühsam beherrscht bog Jim in die Einfahrt des Colonials in West Cambridge. Am Straßenrand lagen noch letzte dünne Schneereste vom Vortag. Mit dem routinierten Blick des ehemaligen Elitesoldaten scannte Jim das Umfeld. Das historische Haus im nobelsten Viertel der Universitätsstadt fügte sich unauffällig zwischen seine Nachbarn aus derselben Zeit oder stilähnliche Nachahmungen. Vor den Häusern, wenn man sie hinter den hohen Hecken oder Zäunen überhaupt sehen konnte, parkten Mittelklasse- und Luxuslimousinen wohlhabender Professoren, Manager, Unternehmer und Politiker. Er hatte die Wagentür kaum geöffnet, schon kam ihm Jills Mutter Hannah Pierce von der Haustür entgegen. Eine schlanke, sportliche Enddreißigerin in Jeans und Bluse. Die Kälte schien sie nicht zu kümmern.
»Ist sie hier?«, fragte er.
»Nein«, erwiderte Hannah nervös. Jim unterdrückte einen Fluch. Er wollte sie umarmen, doch sie schob ihn von sich. »Nicht«, sagte sie.
Er nahm Jills Kleidung, das Smartphone und den Rucksack von der Rückbank. An Hannahs Seite hastete er ins Haus. Die Sachen legte er in der Eingangshalle ab. Der Raum war ebenso geschmackvoll wie steril eingerichtet, fand Jim, wie in einem Wohnmagazin. Viel Weiß, Antiquitäten mischten sich mit modernen Designermöbeln, ein großes Blumenbouquet. Seine eigene Jacke warf er achtlos über einen Haken. Ohne die Schuhe auszuziehen, stürmte er in den ersten Stock. Hannah folgte ihm.
Jills Zimmer war leer und wie immer sehr aufgeräumt. Der Raum maß über dreißig Quadratmeter, große Fenster und eine Tür führten auf eine Terrasse. Links das große Bett, Regale, Schränke im Kolonialstil, unter jedem der Fenster zu beiden Seiten der Terrassentür große, moderne Schreibtische, eigentlich nur Platten auf Gestellen. Auf dem linken ein Bildschirm, ein paar Papiere, Bücher, Schreibzeug, eine Lampe, ebenso auf dem rechten, dort noch Clipboards. An den Wänden zwei große Landschaftsaquarelle, sie sahen sehr teuer aus, angeblich hatte Jill sie selbst gemalt. Er kannte wenige so aufgeräumte Teenagerzimmer. Aber Jill war schließlich kein normaler Teenager. Jim öffnete die Kleiderschränke.
»Fehlt etwas?«, fragte er Hannah.
»Nichts, so weit ich das sehe.«
Jim überflog die Notizen auf den Schreibtischen. Später würde er sie sich genauer ansehen müssen.
Jim zeigte auf eine leere Stelle auf dem Tisch.
»Der Laptop. Ist er irgendwo im Haus?«
»Ich habe ihn nicht gesehen. Ich glaube, den hat sie wie üblich heute Morgen in ihren Rucksack gepackt.«
»Darin war er nicht.«
Auf dem Weg hinunter rief er noch einmal Erin an.
Nein, keine Spur von dem Mädchen.
Verflucht.
Er zeigte Hannah Jills Kleidung, den Rucksack, das Smartphone. Als Hannah die Nachricht auf der Haftnotiz las, stutzte sie.
»Jills Schrift«, meinte Jim. »Kennst du einen Gene?«
Hannah starrte auf das Zettelchen. Jim meinte, ihre zarten Schultern erschauern zu sehen. Vielleicht täuschte er sich.
»Nein«, sagte sie schließlich.
»Ist sie womöglich vor diesem Gene geflüchtet?«
»Weshalb sollte sie?«, fragte Hannah fast unwirsch. Sie schien etwas Fassung wiedergewonnen zu haben. »In dem Fall könnte sie zu uns kommen.«
»Und was jetzt?«, fragte er Hannah.
Ihr Kiefer arbeitete, ihre Lippen wurden schmal.
»Ich muss ihren Vater anrufen«, sagte sie sehr beherrscht. Ihren Exmann. »Du informierst deinen Chef.«
Hannah wählte schneller auf ihrem Mobiltelefon. Während Jim noch dem Freizeichen in seinem Gerät lauschte, sagte sie: »Ja. Ich bin es. Wir haben ein Problem«, und verschwand im Wohnzimmer nebenan, dessen Tür sie hinter sich schloss, sodass er ihre Stimme nur mehr als Murmeln vernahm.
8
So eine Autopsie hatte Doktor Elias Heschke noch nicht durchgeführt. Dabei hatte er als einer der angesehensten Forensiker Deutschlands in seiner über zwanzigjährigen Karriere bereits genug hinter sich gebracht. Der Obduktionsraum des Instituts für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München glich einer Kreuzung aus Fernsehstudio und Verhörraum. Normalerweise stand Heschke mit einem Kollegen an dem Metalltisch. In seltenen Fällen zog er ein, zwei mehr hinzu.
Heute umringten ihn fünfzehn weitere Personen. Den inneren Zirkel bildeten fünf Kollegen. Zwei davon waren amerikanische Militärärzte von US-Stützpunkten in Deutschland. Die beiden anderen waren ebenfalls US-Spezialisten, einer aus London, der andere aus Madrid eingeflogen. Drei Namen hatte Heschke schon öfter in wissenschaftlichen Publikationen gelesen, vom vierten hatte er noch nie gehört. Wahrscheinlich arbeitete er für irgendeinen Geheimdienst, spekulierte Heschke. Weshalb auch er als Forensiker gerufen worden war, vermutete er, obwohl der Mann vor ihnen auf dem Tisch laut Diagnose eines natürlichen Todes gestorben war. Jeder von ihnen trug wie Heschke ein Namensschild an der Brust. Als wäre diese Übernahme seines Instituts durch die Fremden nicht demütigend genug, ragten als weiteres Zeichen des offenen Misstrauens gegen die deutsche Forensik an jeder Tischseite hohe Gestelle hervor. Von ihrem oberen Ende zeichneten die schwarzen Linsen aus vier Kameras jeden ihrer Handgriffe auf. Den äußeren Ring bildeten im Abstand von etwa vier Metern zehn pechschwarz gekleidete Securityleute. Passte zum Anlass, dachte Heschke. Und zum Gehabe.
Den Mann auf dem Tisch vor ihnen kannte er aus den Medien. Wenn auch nicht so, wie er jetzt da lag.
Der aufgeklappte Schädelhautlappen bedeckte das Gesicht. Untersuchung und Präparation von Hirn und Schädelraum hatten sie abgeschlossen. Auch wenn die erste und vorerst offizielle Todesursache Herzversagen gelautet hatte. Erst jetzt hatte der – federführende konnte man hier nicht sagen, wohl eher skalpellführende – amerikanische Kollege den Y-Schnitt über Brust und Bauch durchgeführt, vorbei an der frisch vernähten Operationsnarbe vom Mittag. In knappen Sätzen kommentierte er für die Kameras sein Tun. Er trennte das Gewebe von den Knochen. Schnitt die Bauchmuskeln vom Rippenansatz. Mit einer kleinen hydraulischen Säge durchschnitt er Rippenknorpel, löste das Sternoclavikulargelenk und hob das Brustbein ab.
Vor ihnen lagen Teile des Herzens und der Lunge, effizient auf engstem Raum angeordnet. Fast sechs Jahrzehnte lang hatten sie dem Mann als zuverlässige Antriebsmaschinen gedient. Was hatte sie gestoppt?
Der Amerikaner schob das Herz zurecht und trennte es mit den notwendigen Schnitten von den Gefäßen. Dann löste er es aus seinem weichen Umfeld, nahm es heraus und legte das Organ auf ein Tablett. Einer seiner Kollegen setzte das Skalpell für die Detailuntersuchung an.
»Was ist das?«
Heschke streckte den Zeigefinger ins Licht über dem Organ.
Der Kollege hielt inne. Teile des bleichen Gewebes wiesen einen ungewöhnlichen Fleck auf. Er hob das Herz ans Licht. Der Fleck wurde heller, bildete eine Kontur.
»Was …?«, setzte der Amerikaner an, verstummte dann aber.
Im Lauf seiner Karriere hatte Heschke fehlgebildete Herzen gesehen, überdimensionierte, entzündete und einige seltene Krankheitsbilder. Aber noch nie ein Herz, auf dem bei der Entnahme langsam Muster erschienen, als hielte man ein mit Zitronensaft beschriebenes Blatt Papier über eine Kerzenflamme.
Je heller sich die Flecken auf Jack Dunbraiths totem Herzen färbten, desto deutlicher erkannte Heschke die Form. Die zwei Kreise, der dritte Fleck, darunter eine Art grinsende Linie.
»Ist das …?«, begann der Amerikaner noch einmal. »Das … das ist unmöglich!«
9
Kurz vor halb sieben Uhr abends hörte Jim die Türglocke. Auf dem Bildschirm neben der Gegensprechanlage zwei Polizisten, eine Frau, ein Mann.
»Officer Luís Hernandez. Das ist meine Kollegin Officer Gardner. Sie haben eine vermisste Jugendliche gemeldet.«
Die jetzt irgendwo da draußen allein war. Ohne Geld, ohne Handy. Er schob alle Selbstvorwürfe beiseite. Sein Auftrag, Jill auf der Uni nicht überallhin zu begleiten, war eindeutig gewesen. Jim ließ sie ein.
»Die zurückgelassene Kleidung und das Handy erwähnen wir nicht und diesen mysteriösen Gene nur wie besprochen«, erinnerte ihn Hannah leise, während ihnen die zwei übergewichtigen Gestalten auf dem Gartenweg entgegenwackelten. Jim fragte sich, wie die beiden einen Verdächtigen zu Fuß verfolgen wollten. Und er fragte sich, warum sie diese Details der Polizei vorenthalten sollten. Aber Hannah war der Boss.
Die Unterlagen hatten Jim und Hannah in der Küche vorbereitet. Der exklusiv eingerichtete Raum war wahrscheinlich größer als die gesamten Wohnungen der Beamten. Sie setzten sich an das Ende des riesigen Holztischs neben der Glastürenfront zum Garten. Gardner begnügte sich mit einem Glas Wasser, Hernandez nahm eine Cola.
Jim öffnete die schmale Papiermappe. Obenauf lag das große Brustbild einer jungen Frau.
»Ihr Modelagenturportfolio?«, fragte Hernandez.
»Das ist Jill Pierce.« In der Tat hätte das Porträt mit dem ebenmäßigen Gesicht, den schüchtern lächelnden, vollen Lippen und riesigen blauen Augen vom Cover eines Hochglanzmagazins stammen können. Jim legte das Foto beiseite und beförderte weitere hervor. Jill in Jeans und Parka, die ihre Modelfigur nicht verbergen konnten, neben Hannah vor dem Washington Monument. Sie überragte ihre Mutter um einen halben Kopf.
Gardner schätzte Hannah mit einem Blick ab.
»Eins achtzig?«, fragte sie.
»Einundachtzig«, entgegnete Hannah angespannt. »Und sie ist bei keiner Modelagentur. Sie studiert am MIT.«
Jim präsentierte Unterlagen zu Jill. Laut ihnen war das Mädchen fünfzehn Jahre, zwei Monate und drei Tage alt. Geboren in Los Angeles. Eltern Hannah und Rodney Pierce, geschieden.
»Okay«, sagte Gardner. »Was ist geschehen?«
»Sie müssen wissen, dass Jill keine normale Studentin ist«, erklärte Hannah mit kippender Stimme. »Sie ist erst fünfzehn.«
Gardner griff sich das Porträt, runzelte die Stirn.
»Fünfzehn? Und schon am MIT?«
»Da ist sie weder die Einzige noch die Jüngste. Für Hochbegabte gibt es immer wieder Ausnahmen«, sagte Hannah.
»Was studiert sie?«
»Mathematik, Philosophie und Naturwissenschaften.«
»Mit fünfzehn«, stellte Hernandez ungläubig fest.
»Sie ist ein cleveres Mädchen«, erwiderte Hannah.
Hernandez sah sich in der Küche um.
»Wo ist ihr Vater?«
»Ich habe ihn informiert. Er ist auf Geschäftsreise in Asien. Da schafft er es selbst mit dem nächsten Flieger erst übermorgen nach Boston.«
»Und Sie sind …?«, fragte Gardner Jim.
»Security.«
»Aufpasser. Für das Mädchen.«
»Ja. Leider darf ich nicht überallhin mit.«
»Was ist geschehen?«
»Heute Morgen brachte ich Jill zur Uni. Da ich dort nicht permanent neben ihr herlaufen kann, hat sie Order, sich stündlich per Telefon zu melden. Am Nachmittag wollte ich sie abholen, wie jemand aus unserem Team das immer macht, wenn sie fertig ist. Aber sie tauchte nicht auf.«
»Wann war das?«
»Gegen drei Uhr.«
»Was haben Sie dann gemacht?«
»Zuerst haben wir sie gesucht. Auf dem Campus. Ich wusste ja, wo sie ihre letzte Veranstaltung hatte.« Er musste an seinen Auftritt auf den Damentoiletten denken. »Ich habe ihre Kommilitonen angerufen. Dann ging ich zur Campuspolizei.«
Hernandez macht sich ein paar Notizen.
»Hat sie ein Mobiltelefon?«
»Ja.«
»Haben Sie versucht, sie anzurufen?«
»Was denken Sie?«
»Wir brauchen die Nummer.«
Jim gab sie ihnen. Das Gerät selbst hatte Hannah an sich genommen. Wenn sie es nicht wieder eingeschaltet hatte, konnte man es nicht zu ihnen zurückverfolgen.
»Ist das schon einmal vorgekommen?«
»Jill hat ihre Launen wie jede Jugendliche«, erklärte Hannah. »Aber so lange war sie noch nie weg.«
»Sie sind geschieden«, sagte Gardner zu Hannah. »Kann es sein, dass Jill zu ihrem Vater …?«
»Nein. Die beiden haben kein besonders enges Verhältnis.«
»Das hört man bei Geschiedenen vom hauptbetreuenden Elternteil recht oft«, entgegnete Gardner. »Hatten Sie in letzter Zeit Streit mit Jill?«
»Wie man mit Kindern – ähm – Teenagern streitet«, sagte Hannah. »Nichts Exzessives, kein Anlass abzuhauen.«
»Meinen Sie.«
»Ich bin mir sicher.«
Gardner nickte.
»Wo waren Sie, als Jill verschwand? Wir müssen das fragen, das wissen Sie.«
»Arbeiten«, erwiderte Hannah. »Ich bin Biologin.«
»Irgendetwas anderes Auffälliges?«, fragte Gardner.
Hannah legte die Notiz vor ihnen auf den Tisch.
»Das fanden wir in ihren Sachen.«
»›Achtet auf Gene! Er ist gemeingefährlich!‹«, las Gardner laut. »Wer ist Gene?«
»Keine Ahnung.«
»Vielleicht weiß einer von Jills Studienkollegen, wer dieser Gene ist«, meinte Jim. »Wenn Sie die ohnehin befragen.«
»Werden wir sehen.«
»Gab es für Jill sonst einen Anlass zu verschwinden?«
»Sie beschwerte sich regelmäßig über die Sicherheitsmaßnahmen ihres Vaters«, sagte Hannah.
»Sie meinen ihn hier und seine Leute«, meinte Gardner mit einer Kopfbewegung zu Jim.
»Sie wollte eben ihren Freiraum. Aber, wie gesagt, so lange war sie noch nie weg.«
»Als Sie nach ihr suchten«, fragte Gardner, »haben Sie da irgendetwas gesehen oder gefunden, das Jill gehört? Einen Rucksack, einen Laptop?«
»Nein«, log Jim, wie von Hannah befohlen.
»Gemeldet hat sie sich nicht bei Ihnen, nehme ich an«, sagte Gardner und kritzelte in einen kleinen Block.
»Nein.«
»Hat sich jemand anderer bei Ihnen gemeldet?«
»Sie meinen Entführer«, sagte Jim. »Nein.«
»Was werden Sie als Nächstes tun?«, fragte Hannah mit belegter Stimme. Jim sah Tränen in ihren Augen. Gardner sah sie auch.
»Alles, was wir tun können und müssen.«
»Es wäre mir angenehm, wenn wir die Medien raushalten könnten«, sagte Hannah.
»Sie sprachen von Ihrem Team«, sagte Hernandez zu Jim.
»Vier Securityleute inklusive mir, die sich bei Jills Bewachung abwechseln.« Er legte seine Hand auf die aufgeschlagene Mappe. »Ihre Identitäten finden Sie da drin. So wie meine. Die anderen suchen momentan Jill.«
Die Polizisten packten die Mappe zusammen, bedankten sich für die Getränke und wandten sich zum Gehen.
»Wir halten Sie auf dem Laufenden«, sagte Gardner. »Und Sie uns.«
»Selbstverständlich.«
Als sie gegangen waren, sah Hannah Jim mit einer Mischung aus Wut und Sorge an.
»Wir finden sie«, sagte er.
10
Die zwei großen blauen Augen sollten Helen eigentlich aus einer Wiege anstrahlen statt von einem Foto. Über den blonden Flaum oberhalb der kleinen Stirn wollten ihre Finger streifen und nicht nur ihr Blick. Sie stellte sich vor, wonach der zarte Scheitel duftete. Ein bisschen nach Milch, Vanille, Veilchen und warmer Haut. Vielleicht würde sie ihr Baby für die Geburtsanzeige auch in so ein rosa Kleidchen mit Spitzenkragen stecken.
Vom Nebenbild blinzelte ihr ein bronzehäutiges Neugeborenes entgegen. Seine Würmchenfinger würden kaum ihren Zeigefinger umfassen und hätten sie doch fest im Griff. Wäre es ihr Mädchen, sie würde es Sonia nennen, sie fand, es sah aus wie eine Sonia. Vor ihrem inneren Auge sah sie Sonia als Siebenjährige: In einem rot-weiß gestreiften Kleid saß sie auf einer Schaukel und lachte in die Kamera. Mit zwölf schaute Sonia von einem Pferd zu ihr herunter, auf dem Kopf einen großen schwarzen Reithelm. Sie würden gemeinsam ausreiten. In der Pubertät würde Sonia mit ihr streiten, wie alle Töchter mit ihren Müttern stritten. An der Versöhnung würden sie den Rest ihres Lebens arbeiten. Sie fragte sich, welchen Namen Sonias Eltern dem Kind wirklich gegeben hatten.
Und dem Kleinen, das über dem Blauäugigen hing, mit den zusammengekniffenen Augen und den dunklen Fransen am Kopf? Dem roten Lockenkopf da drüben mit den Sommersprossen, dem Pausbäckchen dort mit den asiatischen Augen. Wo tollten sie heute herum? Mit wem lachten sie? Was fürchteten sie in ihrem Leben, und was wünschten sie sich?
»… alle Befunde bestens und können die befruchteten Eizellen einsetzen«, sagte der Mann mit sonorer Stimme.
Vor Helens Augen lösten sich die Szenen mit Sonia in einem Schleier auf, hinter dem nur die stummen Bilder an der Wand übrig blieben. Ungern verließ sie ihre Träume und lenkte ihre Aufmerksamkeit zurück in den Raum. Es roch nach gewachstem Holz, Desinfektionsmittel und Meeresduftpotpourri.
Wohin sie schaute, begegneten ihr staunende oder verträumte Blicke, lachende Münder, winzige Hände. Babyfotos dankbarer Eltern bedeckten die Wand bis zur Decke. Jede Klinik hängte sie ihr vor die Nase, Belege ärztlicher Kunst, Versprechen an sehnsüchtige Kinderlose. Seit vier Jahren musste sie solche Bilder ertragen. Vier Jahre voll Diäten, minutenberechneter Fortpflanzungsmechanik statt Sex, Hormonbehandlungen, Versuchen künstlicher Insemination und den nach wiederholten Misserfolgen immer häufiger wiederkehrenden Abstürzen in schwarze Löcher der Seele. Bald würde damit Schluss sein! Hoffentlich!
Vor den vielen Fotoköpfen fand sie kaum den echten des Arztes. Sein Gesicht war braun gebrannt, das gewellte dunkelblonde Haar nach hinten gegelt, der weiße Kittel über Anzug und Krawatte Show, nicht Notwendigkeit. Der Mann, die Babyköpfe an der Wand dahinter, ein Jäger vor seinen Trophäen, fand Helen. Mit Helen und Greg hatte er sich auf den Designerstühlen in der Sitzecke seines großzügigen Büros niedergelassen.
»Wir haben die Präimplantationsdiagnose durchgeführt«, erklärte er. »Dank des DNA-Tests konnten wir befruchtete Eizellen ohne Risiken für Erbkrankheiten und heute bereits bekannte riskante Mutationen wie etwa auf den Genen BRCA1 und BRCA2 für Brustkrebs auswählen. Schwangerschaftserschwerende Faktoren liegen auch keine vor.«
Helens Gefühle wirbelten durcheinander, Erleichterung, Freunde, Hoffnung, und doch … Technik als Quelle des Lebens. Tief in Helen presste der Gedanke immer noch etwas ab. Aber hatte sie eine Wahl, wenn sie schwanger werden wollte? Dem Leben half Technik heute überall, seien es die künstliche Hüfte ihrer Großmutter oder die Geräte im Operationssaal nach dem Autounfall ihres Vaters. Warum also nicht bei ihr und ihrem zukünftigen Kind?
Die Methode funktionierte nur in Verbindung mit einer Befruchtung im Reagenzglas. Nach drei Tagen außerhalb des Körpers hatten sich Helens befruchtete Eizellen zu Gebilden aus acht Zellen entwickelt. Je eine davon war entnommen und geprüft worden. Die übrigen sieben würden sie nicht vermissen.
»Das Geschlecht wollten Sie ja nicht wissen, deshalb lassen wir hier den Zufall entscheiden.«
Family balancing nannte man in den USA eine ausgewogene Zusammenstellung von Geschlechtern innerhalb einer Familie, hatte Helen erfahren. Wir verstehen was von Vermarktung, hatte sie mit einer Mischung aus Bewunderung und Abscheu gedacht.
Eine Freundin war ihr eingefallen, die drei Jungen geboren hatte und sich sehnlich ein Mädchen wünschte. Dagegen ließen sich Asiatinnen, die es sich leisten konnten, männliche Nachkommen einpflanzen. Mädchen galten dort nicht viel und bedeuteten hohe Mitgiftkosten.
Helen wäre mit einem Jungen so glücklich wie mit einem Mädchen.
Deshalb hatten die Ärzte bei ihnen vor allem nach Unregelmäßigkeiten der Chromosomen gesucht. Die menschliche DNA setzte sich unendlich kompliziert zusammen, das hatte Helen während ihrer Beschäftigung mit dem Thema begriffen. Jedes Teilchen musste an der richtigen Stelle sitzen, um seine Aufgaben ordentlich erfüllen zu können. Wenn Eizelle und Spermium verschmolzen, fügte sich ein neues dieser gigantischen Minikonstrukte Schritt für Schritt ineinander wie ein langer, langer Reißverschluss.
Dieser Tanz der Moleküle verlief nicht immer ohne Stolpern.
Abermillionen Fehlkonstruktionen und Defekte waren möglich. Translokationen, Inversionen, Deletionen, dreifache Chromosomen … Je mehr Helen über die Komplexität des Lebens erfahren hatte, desto unfassbarer erschien ihr, dass sich ein so aufwändiges Gebilde wie der Mensch überhaupt entwickeln konnte und funktionierte. Eigentlich war es ein Wunder.
Bereits eine winzige Abweichung der Gene oder Chromosomen konnte gravierende Auswirkungen auf ihr Kind haben. Manche davon verursachten Behinderungen, deren bekannteste vielleicht die Trisomie 21 war, ausgelöst von einem dreifachen Chromosom 21. Andere führten nur zu einem verkürzten Daumen oder zeigten gar keine Auswirkung. Die Liste der Syndrome und ihrer Folgen füllte medizinische Enzyklopädien.
Doch Helen interessierte sich nur in zweiter Linie für Fehler, die immerhin Leben schufen, mochte es auch eingeschränkt sein. Denn klar geworden war ihr auch: Die Grenzen zwischen »normal« und »abnormal«, »krank« oder »behindert« waren fließend, durchlässig, und jede Zeit und Kultur definierte sie auf ihre Weise.
Die große Mehrheit der Chromosomenabweichungen aber bedingte so schwere Schäden, dass sie die Einnistung der befruchteten Eizelle verhinderten oder zu einer frühen Fehlgeburt führten. Meistens bemerkten die Frauen sie gar nicht oder hielten sie für eine Monatsblutung. Helen hatte von Schätzungen gelesen, wonach sich nur ein Drittel aller natürlich befruchteten Eizellen schließlich zu einem Kind entwickelte.
Manche Mediziner behaupteten deshalb, dass künstliche Befruchtung inzwischen erfolgreicher sei als die Natur.
Darin lag Helens und Gregs Hoffnung. Deshalb saßen sie hier. Darum war Helen bereit gewesen, die Quälerei mit der Hormonbehandlung auf sich zu nehmen und ihre Ersparnisse zu investieren.
»Sie werden ein gesundes Kind bekommen«, erklärte Doktor Benson und löste in Helens Körper einen neuen Strom warmer Gefühle aus. »Bloß Olympiasieger im Sprinten wird es nicht.«
»Muss es auch nicht«, erwiderte Helen. Wie kam er darauf?
»Warum nicht?«, fragte Greg neben ihr. Er fing Helens irritierten Blick auf.
»Entschuldige, Schatz, ich meine nicht, dass unser Kind Olympiasieger werden muss. Mich interessiert bloß, wie Doktor Benson das wissen will.«
»Das ist relativ einfach«, erwiderte der Mediziner. »Schon vor der Jahrtausendwende wurde in den Medien die sogenannte ›Schwarzenegger-Maus‹ bekannt. Deren Muskelwachstum hatte man mit einem bestimmten Gen – Insulin-like Growth factor 1, kurz IGF-1 – um dreißig Prozent gesteigert.«
Wovon schwafelte der? Schwarzenegger-Mäuse? Sie würde ein gesundes Kind bekommen! Musste! Nach Jahren der Mühen und Frustrationen! Alles andere war nebensächlich!
»Bei erfolgreichen Spitzensportlern fand man in den letzten Jahren Gene, die für die Entwicklung der Muskelarten mitverantwortlich sind«, fuhr der Doktor fort. »Solche für schnelle, starke Kraftentwicklung, wie sie etwa ein Sprinter braucht, oder eher Ausdauermuskeln für Marathonläufer. Am bekanntesten wurde das sogenannte Sprinter-Gen ATCN3. Schon 2008 etwa begann ein Unternehmen kommerzielle Tests zu verkaufen, mit denen man sein Erbgut oder das seiner Kinder auf Varianten von ATCN3 untersuchen konnte – eine Zeit lang ein beliebtes Angebot für überambitionierte Football-Väter. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Inzwischen wissen wir, dass wesentlich mehr Gene und andere Faktoren mitspielen.«
»Dann wird es eben kein Olympiasieger«, sagte Helen.