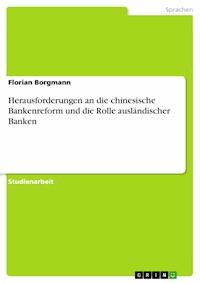
Herausforderungen an die chinesische Bankenreform und die Rolle ausländischer Banken E-Book
Florian Borgmann
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Südasienkunde, Südostasienkunde, Note: 1,7, Ruhr-Universität Bochum, Veranstaltung: Ausgewählte Entwicklungsprobleme des ostasiatischen Raumes, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Präsenz ausländischer Banken hat in den letzten Jahren dank fallender Restriktionen v.a. in Entwicklungsländern und Transformationswirtschaften stark an Gewicht gewonnen (Anlage 1) und die Reformbemühungen hin zu einem leistungsfähigeren Wirtschaftssystem begleitet. Außerdem ist die Liberalisierung von Finanzsystemen zumeist Vorraussetzung für den Beitritt zu internationalen Vereinigungen2. So auch in China: Ende 2001 ist China nach langjährigen Verhandlungen der WTO beigetreten und führt damit die mehr als 20 Jahre andauernde "Politik der offenen Tür" hin zu mehr marktwirtschaftlich orientierten Strukturen fort. Diese bilaterale Vereinigung geht auch einher mit der weitergehenden Öffnung des chinesischen Marktes, der historisch gesehen durch zahlreiche Bestimmungen vom Wettbewerb mit ausländischen Firmen ferngehalten wurde. Jene Form der Abschottung wurde v.a. im Bankensektor deutlich. Doch mit dem Beitritt zur WTO muss China laut der bilateralen Vertrage bis zum Dezember 2006 alle bedeutenden Zulassungsbeschränkungen zum chinesischen Bankensektor für ausländische Banken aufheben. Angesichts der systemimmanenten Probleme einer notwendigen Konsolidierung des Bankensystems stellt sich nun also die Frage, welche Rolle den ausländischen Banken im sich verändernden Wettbewerbsumfeld Chinas zukommt (siehe Entwicklungsprozess des chinesischen Bankensystems in Anlage 2). Hierzu soll im weiteren Verlauf dieser Arbeit aufgezeigt werden, auf welche Art und Weise ausländische Banken Inlandsmärkte durchdringen und welchen Einfluss sie auf Wettbewerb und Stabilität haben. Daran anschließend wird die Analyse auf China ausgeweitet. Im Vordergrund steht dabei die Frage, ob ausländische Banken auch in China den Reformprozess positiv katalysieren können oder ob in China gar die Gefahr einer Krise besteht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Page 1
Page 1
Einleitung
Als Intermediär zwischen Sparern und potentiellen Investoren können Banken das Problem asymmetrischer Informationsverteilung lösen, Transaktionskosten reduzieren und so zur Funktionsfähigkeit und Effizienz einer Volkswirtschaft beitragen1.
Dies macht deutlich, welch essentielle Bedeutung ein funktionsfähiges Bankensystem im volkswirtschaftlichen Entwicklungsprozess hat. Gerade sich entwickelnde Länder leiden wegen unzureichend funktionsfähiger Bankensysteme unter den Folgen jahrzehntelanger Fehlallokation von Ressourcen und Kapital in Form von „faulen Krediten“ und fehlender Disziplinierung ihrer Kunden. Vor dem Hintergrund gefährlicher systemischer Krisen wird häufig die Liberalisierung und weitergehende Öffnung des inländischen Bankensektors für ausländische Banken und ihre Wirkung auf Wettbewerb und Stabilität diskutiert.
Die Präsenz ausländischer Banken hat in den letzten Jahren dank fallender Restriktionen v.a. in Entwicklungsländern und Transformationswirtschaften stark an Gewicht gewonnen (Anlage 1) und die Reformbemühungen hin zu einem leistungsfähigeren Wirtschaftssystem begleitet. Außerdem ist die Liberalisierung von Finanzsystemen zumeist Vorraussetzung für den Beitritt zu internationalen Vereinigungen2.
So auch in China: Ende 2001 ist China nach langjährigen Verhandlungen der WTO beigetreten und führt damit die mehr als 20 Jahre andauernde „Politik der offenen Tür“ hin zu mehr marktwirtschaftlich orientierten Strukturen fort. Diese bilaterale Vereinigung geht auch einher mit der weitergehenden Öffnung des chinesischen Marktes, der historisch gesehen durch zahlreiche Bestimmungen vom Wettbewerb mit ausländischen Firmen ferngehalten wurde.
Jene Form der Abschottung wurde v.a. im Bankensektor deutlich. Doch mit dem Beitritt zur WTO muss China laut der bilateralen Vertrage bis zum Dezember 2006 alle bedeutenden Zulassungsbeschränkungen zum chinesischen Bankensektor für ausländische Banken aufheben. Angesichts der systemimmanenten Probleme einer notwendigen Konsolidierung des Bankensystems stellt sich nun also die Frage, welche Rolle den ausländischen Banken im sich verändernden Wettbewerbsumfeld Chinas zukommt (siehe Entwicklungsprozess des chinesischen Bankensystems in Anlage 2).
1Vgl. Mishkin, Frederic S. (1992): The economics of money, banking and financial markets. 3rdEdition. Harper Collins Publishers, S.157 ff.
2Vgl. Hawkins, John / Turner, Philip (1999): Bank restructuring in practice: an overview, S. 77 f.
Page 2
Hierzu soll im weiteren Verlauf dieser Arbeit aufgezeigt werden, auf welche Art und Weise ausländische Banken Inlandsmärkte durchdringen und welchen Einfluss sie auf Wettbewerb und Stabilität haben. Daran anschließend wird die Analyse auf China ausgeweitet. Im Vordergrund steht dabei die Frage, ob ausländische Banken auch in China den Reformprozess positiv katalysieren können oder ob in China gar die Gefahr einer Krise besteht.
1. Effekte der Penetration ausländischer Banken in Gastländern
In Entwicklungsländern gelten ausländische Banken gegenüber dem inländischen Bankensystem als leistungsfähigere, gesündere (bezogen auf Bilanzen und Kreditportfolios) Strukturen, die sowohl über eine größere Managementerfahrung, als auch über ausgereiftere Technologien verfügen, welche Sie dazu verwenden, eine diversifizierte Bandbreite bankbezogener Dienstleistungen anzubieten. Ausländische Banken können zudem schneller und günstiger auf internationale Kapitalmärkte zurückgreifen3und so Kapitalströme anregen. Weiterhin kann die Partizipation ausländischer Banken dazu beitragen, die Finanzsystemarchitektur des Gastlandes zu verbessern, die Gründung von Prüfungsinstitutionen anzuregen und so Verbesserungen in der Rechnungslegung und Transparenz des inländischen Bankensektors und der gesamten Volkswirtschaft begünstigen. Dank ihrer leistungsfähigeren internationalen Überwachungsstrukturen und ihrer „rechtlichen Untermalung“ kann die Partizipation ausländischer Banken im Gastland zudem eine Vorbildfunktion übernehmen, den Wettbewerb anregen und damit verbundene Anpassungsprozesse freisetzen. In einer systemischen Bankenkrise des Gastlandes kann die Übernahme inländischer durch ausländische Banken zudem positive Effekte erzeugen, denn gerade bei Veränderungen in den Besitzstrukturen zugunsten ausländischer Unternehmen können Anreize geschaffen werden, notwendige Technologien und Managementfähigkeiten zu transferieren4und so die Qualität der inländischen Banken und die Verfügbarkeit finanzieller Dienstleistungen zu stärken.
Neben diesen möglichen positiven Effekten gibt es auch immer wieder Befürchtungen, dass ein inländisches Bankensystem dem Wettbewerb durch ausländische Banken nicht standhalten kann. Trotz der massiven Einflussnahme auf die Zentralbanken und den
3Vgl. ebd.
4Vgl. Cornelli, Francesca: The sale of shares to foreign companies. In: Alfred Schipke (Hrsg. 1994): The economics of transformation: theory and practice in the new market economies (eds.) Berlin u.a. : Springer, S. 113.
Page 3
Staat weichen ausländische Banken von ihren Versprechungen ab, das Finanzsystem zu stärken und investieren nur in leistungsfähige multinationale Konzerne, während dem inländischen Bankensystem nur die Verstrickung in risikoreichere Geschäfte verbleibt5. Um die Gefahr zu bannen, dass infolge der Intensivierung des Wettbewerbs inländische Banken versagen, sollte der Eintritt ausländischer Banken deshalb reguliert werden, um den „Franchise Value“ des inländischen Bankensystems zu erhalten und inländische Anleger zu animieren, neue Gelder zu investieren6.
Im folgenden werden diese Ausführungen anhand der Kriterien Markteintrittsmethode, Stabilität und Wettbewerb untersucht. Zu diesem Zweck werden im wesentlichen Quellen der Sekundärliteratur (Montgomery, Ferri, Hawkins/Turner) verwandt, welche die wichtigsten Forschungsergebnisse unterschiedlichster Autoren (Pigott, Barth, Levine, Berger, Claessens, Clarke, Demirguc-Kunt, Pomerleano, Peek, Mathieson und weitere) zusammengetragen und systematisiert haben.
1.1. Markteintrittsmethode
Die Wahl der Eintrittsmethodik hängt stark von den politischen Restriktionen und den individuellen Absichten der ausländischen Banken ab. Wir unterscheiden:
dieVersorgung ausländischer Unternehmen mit Krediten, Vermögen und „Liability Management“ (Verwaltung der Passivkonten) in Form grenzüberschreitender Aktivitäten multinationaler Bankenkonzerne (OffShore); dieÖffnung von Filialen;
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:





























