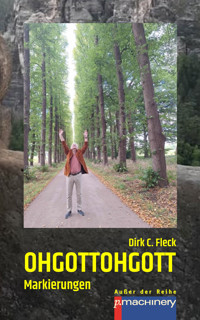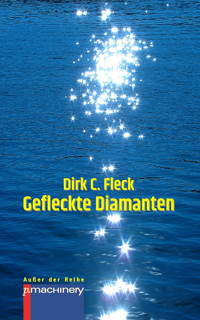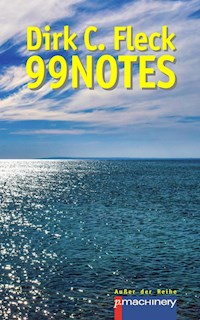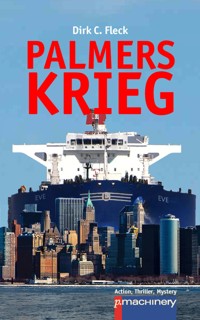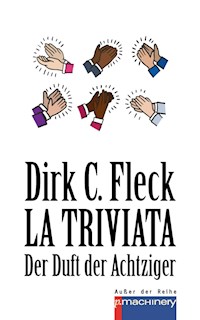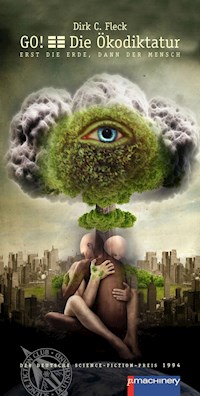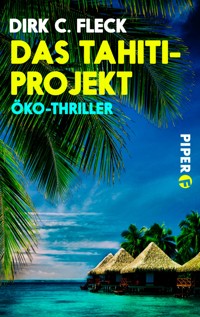8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mit seinem Buch überrascht der Autor Dirk C. Fleck – erneut. Er ist kein politischer Journalist, sondern ein Schriftsteller, dessen Kunst politische Wirkung entfaltet. Seine »Helden« sind Menschen, die unser aller Leben verändert haben. Persönlichkeiten, die auch ohne PR-Abteilung lebensfähig waren oder sind, solitäre Juwelen, die in gestalteten Leben zu dem wurden, was ihnen vorbestimmt war. Ich ziehe meinen Hut vor dem Menschen und Künstler Dirk C. Fleck. Wieder einmal. [Dirk Pohlmann]
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Dirk C. Fleck
HEROES
Mut, Rückgrat, Visionen
Außer der Reihe 85
Dirk C. Fleck
HEROES
Mut, Rückgrat, Visionen
Außer der Reihe 85
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: August 2023
p.machinery Michael Haitel
Titelbild: Raphael Maksian
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 346 8
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 757 2
Für Rosalie
Einige Worte vorweg
Die Idee zu diesem Buch gab es schon lange. Irgendwann begann sie zu nerven, sie lechzte nach Gestalt und erinnerte beharrlich daran, dass da noch etwas zu erledigen sei. Ausschlaggebend dafür, dass ich mit der Schreibarbeit endlich begann, war ein Zitat, das ich zufälligerweise fand. Es stammt von dem römischen Kaiser und Philosophen Marc Aurel, der uns vor fast zweitausend Jahren folgende Worte ins Stammbuch geschrieben hat:
»Das Ziel des Lebens besteht nicht darin, auf der Seite der Mehrheit zu stehen, sondern zu vermeiden, sich in den Reihen der Wahnsinnigen wiederzufinden.«
Meine HEROES haben sich dem systemimmanenten Wahnsinn unter hohen Risiken entzogen oder widersetzt und für eine Gesellschaft gekämpft, deren Zusammenhalt durch Toleranz und Verständnis geprägt ist. Wobei ich bewusst nicht ins oberste Regal gegriffen habe, dort wo die prominenten Namen lagern. Ich wollte auf jene Menschen aufmerksam machen, deren Geschichte nicht schon überall breitgetreten wurde.
Eines habe ich während der Beschäftigung mit diesen außergewöhnlichen Persönlichkeiten gelernt: Solange wir unsere wahre Natur verleugnen, solange wir nicht mehr die Sprache des Herzens sprechen und uns stattdessen in mörderischer Konkurrenz gegenseitig die Zeit stehlen, um schließlich als willfährige Erfüllungsgehilfen einer skrupellosen, aber gut organisierten Elite zu enden, werden wir miteinander nie frei sein. Wird sich an dem Höllenritt, der uns vom wahren Leben fortführt, nichts ändern.
Einige dieser Porträts wurden bereits vor Erscheinen des Buches wechselseitig auf den Internetplattformen apolut.de, neue-debatte.com und manova.news veröffentlicht. Aus den vielen Kommentaren, von denen ich hier zwei zitieren möchte, wird deutlich, wir groß das Interesse an HEROES ist.
Zu dem Artikel »Lichte Wesen in Dunkeldeutschland« schreibt Nevyn: »Danke für diese berührende Geschichte. Sie zeigt mir erneut, dass die Hoffnung für diesen Planeten nicht von den Krakeelern, ›Aktivisten‹ und sonstigen Rambos ausgeht, auch nicht von den vielen Gutmenschen-NGOs, sondern von den meist unbekannt bleibenden Stillen im Lande, die ihre ganz persönliche Verantwortung auf ihrem Weg erkennen und annehmen, statt einer wie auch immer gearteten Bewegung nachzulaufen.«
Und Hans J. K. schickte mir über meine Website eine Mail, aus der ich folgende Sätze zitieren möchte: »Mit großem Interesse und großer Dankbarkeit habe ich von Ihrem Projekt gelesen, ein Buch über die von ihnen ausgewählten ›Helden‹ zu schreiben. Ich bin von Ihren Artikeln tief beeindruckt. Wir haben fünf Kinder, die uns wiederum durch ihre Familien zehn Enkel schenkten. Ich freue mich schon jetzt darauf, ihnen an ihren Geburtstagen Ihr Buch mit den wirklichen Helden zu schenken. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Grundhaltung, Klarheit, Ehrlichkeit und den Mut, uns interessierten Lesern das zu zeigen, was im Leben wirklich wichtig ist.«
Fünfzig Porträts sind es geworden. Es sollten viel mehr sein, aber das hätte den Rahmen dieses Buches gesprengt. Es wäre mir jedoch lieb, wenn die Leser eigene HEROES hinzufügten. Dafür ist am Ende des Buches eine Seite mit Linien freigehalten worden, auf der die Namen handschriftlich vermerkt werden können. Damit die Familie unserer Seelenverwandten noch umfassender wird – damit wir eine geistige Verbindung zu den weitgehend vergessenen Menschen herstellen. Sie haben es verdient.
Mein Dank gilt meinem Verleger, der die Idee zu HEROES ohne zu zögern akzeptiert hat. Er gilt ebenso meiner Freundin Marina Silalahi, die mir einige Heroes ans Herz gelegt hat und mir die Möglichkeit gab, das Buch auf ihrem wundervollen Anwesen in Ostfriesland zu beenden. Die dritte Politur an den Texten haben wir gemeinsam vorgenommen.
Dirk C. Fleck
im Juli 2023
Michael & Cäcilia Köhldorfner
Lichte Wesen in Dunkeldeutschland
Mitte der Achtzigerjahre war ich mit einer Freundin auf einem Wochenendausflug im Landkreis Lüchow-Dannenberg unterwegs, als mir eine Geschichte einfiel, die mir meine Eltern dreißig Jahre zuvor erzählt hatten. Sie musste sich ganz in der Nähe abgespielt haben, in einem kleinen Nest namens Starrel. Das Dorf, so war es mir berichtet worden, bestand lediglich aus drei Bauernhäusern. Ich wollte ihm seit Jahren einen Besuch abstatten, hatte mich aber nie getraut. Doch jetzt, wo wir schon einmal in der Göhrde rumturnten, konnte ich nicht anders, als das Auto nach Starrel umzulenken. Fünfhundert Meter waren es noch, als ich die Geschwindigkeit erkennbar drosselte. Es war, als hätte der Strich-Achter, den ich damals fuhr, auf meinen schneller werdenden Herzschlag reagiert. Nach weiteren vierhundert Metern fuhr ich rechts ran. Da waren sie, die Bauernhäuser und die Eichen. Unangetastet und wie aus der Zeit gesprungen. Näher ran zu fahren war mir unmöglich, es fühlte sich an, als würden zwei Magnete aneinander abgleiten.
Warum erzähle ich das? Weil ich dort, wo ich jetzt stand, niemals gestanden hätte, wenn es diese eine Familie nicht gegeben hätte, von der ich nicht einmal wusste, welches der Häuser ihres war. Von der ich nicht wusste, ob sie überhaupt noch existierte. Aber zum Kern der Geschichte. Mein Großvater war Jude, er starb im KZ. Mein Vater war »Halbjude«. Als ruchbar wurde, dass er mit einer Arierin liiert war und sie sogar heiraten wollte, wurde er in Hamburg zur Gestapo bestellt, wo man ihm eine sogenannte »Trennungsauflage« aushändigte. Sie besagte, dass er meine Mutter nicht mehr sehen, geschweige denn heiraten durfte. Damals war meine Mutter bereits mit mir schwanger, was den Behörden auf keinen Fall bekannt werden durfte. Einige Monate später erblickte ich das düstere Licht der Welt. Illegal. Ich musste also versteckt werden, aber wo?
Meine Großmutter mütterlicherseits wusste von einer Schulfreundin in der Göhrde, die mit den Nazis nichts am Hut hatte. Also fuhr sie nach Starrel und versuchte herauszufinden, ob sie sich dieser Freundin und ihrem im Krieg schwer verwundeten Mann anvertrauen könnte. Konnte sie. Mit dem Ergebnis, dass mich diese beiden Menschen vierzehn Monate in ihrem Haus versteckt hielten, was die Nachbarsfamilien natürlich nicht wissen durften.
Das gab es eben auch in Dunkeldeutschland. Und nicht zu knapp. Überall im Land, vor allem in den Großstädten, fanden sich selbstlose Menschen, die sich in einem Volk von potenziellen Denunzianten kaum vorstellbaren Risiken aussetzten. Wenn sie ertappt worden wären, hätten sie vermutlich auch das Leben ihrer eigenen Familie aufs Spiel gesetzt. Mithilfe dieser couragierten Deutschen überlebten Tausende Juden den Naziterror – auf Dachböden, in Kellern und Scheunen, hinter aufgebrochenen und wieder zugestellten Mauern. Dieser Teil unserer Geschichte wird kaum erzählt. Das liegt auch daran, weil ein Großteil derjenigen, die ihr Gewissen nicht im Gleichschritt verloren hatten, anonym geblieben sind.
Stellvertretend für sie alle möchte ich Michael und Cäcilia Köhldorfner in die Riege meiner HEROES aufnahmen. Am 23. September 2019 wurden die beiden in ihrer oberbayerischen Heimatgemeinde Schnaitsee von der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem posthum für die Rettung verfolgter Juden geehrt. Die beiden gelten damit offiziell als »Gerechte unter den Völkern«.
Es war der 3. Mai 1945, wenige Tage vor Kriegsende, als Michael Köhldorfner im alten Sägewerk von Stangern, einem Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, verdächtige Geräusche hörte. Mit geladener Pistole kletterte der Zimmerer auf den Dachboden. Die zwei Gestalten, die er dort entdeckte, boten ein Bild des Jammers. »Ich sehe die beiden heute noch vor mir«, erzählt Köhldorfners Sohn Michael, der den Vater als Siebenjähriger begleitet hatte. »Sie trugen nur noch Fetzen am Körper, waren verlaust und zum Skelett abgemagert. Anstelle von Schuhen trugen sie abgeschnittene Zementsäcke an den Füßen, die sie mit Schnüren zugebunden hatten. So ein Elend habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen.«
Bei den Gestalten handelte es sich um die aus Polen stammenden Juden Henrick Gleitman und Bernhard Hampel. Ihnen war es gelungen, einem Todesmarsch zu entfliehen, der die Häftlinge des Konzentrationslagers Flossenbürg ins KZ Dachau führte. Wer von den geschundenen Kreaturen unterwegs schlappmachte, wurde an Ort und Stelle liquidiert. Indem das Ehepaar Köhldorfner sich verpflichtet sah, den Flüchtigen zu helfen, gingen sie ein tödliches Risiko ein. Deutsche wurden schon für weitaus geringere »Vergehen« standrechtlich erschossen oder gehenkt.
Henrick Gleitman war ein junger Mann, erst achtzehn Jahre alt, Hampel war dreißig. Noch tagelang blieben sie den Köhldorfners gegenüber misstrauisch, sie fürchteten, am Ende doch verraten zu werden. Dass Deutsche sie freundlich behandelten und ihnen sogar halfen, waren sie nicht gewohnt. »Alle Deutschen, denen ich zuvor begegnet war, haben nur schikaniert, gefoltert und gemordet«, sagte Gleitman später, »ich habe nicht geglaubt, dass es auch andere Deutsche gibt.«
Doch, gab es. Unter anderem in Starrel, einem kleinen Dorf im Südwesten des Landkreises Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen, das zur Gemeinde Schnega in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) gehört. Zurzeit wohnen dort fünfzehn Einwohner.
Rosa Louise Parks (1913–2005)
Manchmal genügt ein schlichtes NEIN, um die Welt zu verändern
James Blake. Ja, so hieß er. Blake gehörte zu jenen Menschen, die als beflissene Staatsdiener zu autoritären Arschlöchern werden, wenn es die Gesetzeslage erlaubt. Und die Gesetzeslage im US-Bundesstaat Alabama erlaubte in den Fünfzigerjahren eine ganze Menge an Schweinereien, sie schrieb sie sogar verbindlich fest. Und so wunderte es nicht, dass der Busfahrer James Blake am 1. Dezember 1955 pflichtbewusst von seinem Fahrersitz aufstand, um eine afroamerikanische Frau aufzufordern, ihren Sitzplatz für einen weißen Fahrgast zu räumen. Bisher hatte er beim Herstellen der »natürlichen Ordnung«, wie sie in den Südstaaten selbstverständlich war, nie ein Problem gehabt. In diesem Fall jedoch reagierte die Frau auf seine Aufforderung mit einem simplen NEIN.
NEIN!? Blake drohte mit der Polizei. Die Frau ließ sich nicht beirren und blieb sitzen. Ihr Name war Rosa Louise Parks. Natürlich konnte sie nicht wissen, dass ihr NEIN in die Geschichte eingehen würde. Genau genommen war es der Beginn der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, die, so muss man ehrlicherweise sagen, ohne das beflissene Handeln des James Blake wohl noch ein wenig hätte auf sich warten lassen. Denn der Busfahrer machte seine Drohung wahr und rief tatsächlich die Polizei. Rosa Parks wurde noch an Ort und Stelle wegen Störung der öffentlichen Ruhe verhaftet, was den sogenannten Busboykott von Montgomery zur Folge hatte.
Der Busfahrer James Blake und Parks hatten bereits 1943 eine Auseinandersetzung, als Parks sich weigerte, nach dem Ticketkauf wieder auszusteigen und hinten erneut einzusteigen, was für Schwarze verbindlich vorgeschrieben war. Seither hatte sie darauf geachtet, in keinen Bus einzusteigen, der von Blake gefahren wurde. Nun, das Schicksal wollte es anders.
Nachdem Rosa Parks festgenommen worden war, weigerten sich viele Schwarze mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Die Aktion zeigte Wirkung. Die fehlenden Einnahmen stellten die öffentlichen Verkehrsbetriebe vor ein Liquiditätsproblem, denn siebzig Prozent ihrer Einnahmen steuerten die farbigen Fahrgäste bei. Diese bildeten jetzt Fahrgemeinschaften und nutzten Taxis, die ihre Preise aus Solidarität auf zehn Cent pro Fahrt gesenkt hatten. Ein großer Teil der Protestierenden ging auch einfach zu Fuß. Außerdem fanden sich in Montgomery über dreihundert Autofahrer, die eigene Stationen festlegten, an denen sie die Menschen abholten. Unterstützung kam auch von Martin Luther King, der die Proteste in eine friedliche Richtung lenkte.
Die Busunternehmen standen plötzlich vor dem Bankrott, sie mussten ihre Preise enorm anheben, um die starken Verluste zu kompensieren. Unterdessen bekamen viele Autofahrer, die kostenlose Fahrten anboten, Probleme mit ihren Versicherungen. Reine Schikane. Immer häufiger kam es zu Verhaftungen und Anklagen. Auch Martin Luther King wurde angeklagt, was international für ein enormes Medienecho sorgte. Und wieder ging der Schuss nach hinten los …
Der vierzehnte Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten besagte, dass jeder das Recht auf einen gleichwertigen Schutz hat, ungeachtet der Rasse. Am 20. Dezember 1955 erklärte das Oberste Gericht die Rassentrennung in den Bussen für rechtswidrig. Der von Rosa Parks ausgelöste Montgomery-Bus-Boykott war somit ein voller Erfolg und beendet.
Rosa hatte sich schon vor ihrem NEIN positioniert und in der Bürgerrechtsbewegung »Platz genommen«. Sie, die 1913 in Tuskegee (Alabama) geboren worden war, musste schon früh erfahren, was es bedeutet, nicht von weißer Hautfarbe zu sein. Nachdem man ihr sogar das Wahlrecht verweigerte, engagierte sie sich in der Bürgerrechtsbewegung National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Die NAACP wurde 1909 gegründet und setzte sich seitdem für die Chancengleichheit farbiger Bürger ein. Dieses Ziel verfolgte sie sowohl in kultureller, politischer als auch wirtschaftlicher Hinsicht. Der größte Erfolg der Bewegung war die Aufhebung der Rassentrennung in den Schulen 1954.
Parks Ehemann hatte sie davon abhalten wollen, für die Bürgerrechtsbewegung tätig zu werden, da er um ihre Sicherheit besorgt war. Seine Einwände blieben jedoch ohne Erfolg. Rosa war bei der NAACP zunächst als Sekretärin, ab 1943 auch als Sozialarbeiterin tätig. Die meisten Fälle, die sie bearbeitete, betrafen Männer, denen »unrechtmäßige Straftaten« vorgeworfen wurden. Häufig wurden diese Männer Opfer von Lynchjustiz.
Der wohl spektakulärste Fall, den Rosa Parks betreute, war der von Recy Taylor. Die Vierundzwanzigjährige war 1944 von sieben weißen Männern gemeinschaftlich vergewaltigt worden. Trotz mehrfacher Zeugenaussagen, die sich mit der Aussage von Recy Taylor deckten, weigerte sich die Justizbehörde, die Männer anzuklagen. Die NAACP wurde auf den Fall aufmerksam und schickte Parks nach Abbeville in Alabama, wo sich der Vorfall ereignet hatte. Nachdem Rosa genügend Informationen gesammelt hatte, reiste sie nach Montgomery zurück. Die NAACP erreichte zwar, dass der Fall nationale Aufmerksamkeit erregte, dennoch landete er bei den Akten. Keiner der Männer wurde je angeklagt.
Als Präsident Clinton sie später bei einem Empfang im Weißen Haus fragte, ob sie ihren Ruhestand genießen würde und wie glücklich sie sei, antwortete sie: »Ich glaube nicht, dass es so etwas wie komplettes Glück gibt. Es ist schrecklich, dass der Ku-Klux-Klan noch immer aktiv ist und dass es nach wie vor Rassismus gibt. Wenn jemand glücklich ist, gibt es nichts mehr, was man braucht und sich wünscht. An diesem Punkt in meinem Leben bin ich noch nicht angekommen.«
Rosa Parks starb am 24. Oktober 2005. Ihr schlichtes NEIN im Linienbus von Montgomery gab der Bürgerrechtsbewegung den entscheidenden Schub. Er stärkte das Selbstbewusstsein der Schwarzen und sorgte in der Folge für gravierende Veränderungen in der US-amerikanischen Gesellschaft. Nicht mehr und nicht weniger.
Musik
Rosa Parks wurde in zahlreichen Songs verewigt, so z. B.:
The Neville Brothers: Sister Rosa. A&M, 1989
James »JT« Taylor: Sister Rosa. MCA, 1989
Feargal Sharkey: Sister Rosa. Virgin, 1991
Nits: Sister Rosa. Columbia, 1998
OutKast: Rosa Parks. LaFace/Arista, 1998
Hannibal Lokumbe (Hannibal Marvin Peterson) Dear Mrs. Parks. Oratorium. Janice Chandler-Eteme, Sopran; Jevetta Steele, Mezzosopran; Detroit Symphony Orchestra; Thomas Wilkins, Dirigent (The American Spirit: Roots and Transformations: Dear Mrs. Parks)
José Bové (*1953)
Globalnix gegen Monsanto und andere Verbrecher
Plötzlich hat es RUMMS gemacht und vor dem Tresen, an dem schon bald die jungen Leute von Millau anstehen sollten, um ihre Cheeseburger und Chicken McNuggets zu bestellen, stand ein tuckernder Traktor in den Trümmern, dem unter dem Jubel von dreihundert Bauern und Schafzüchtern aus der Roquefort-Region ein Mann entstieg, den die »Rückbau-Aktion« einer McDonald’s-Filiale weltweiten Ruhm einbringen sollte.
Wir schreiben den 12. August 1999, als der Landwirt José Bové den kurz vor der Fertigstellung befindlichen Fast-Food-Tempel auf dem direkten Weg durch die Außenmauer betrat. Grund für die Proteste gegen die Burgerkette waren die US-Strafzölle, die für bestimmte Produkte wie zum Beispiel den Roquefortkäse eingeführt wurden, weil sich die EU-Staaten weigerten, hormonbehandeltes Rindfleisch aus den USA zu importieren.
Die regionalen Zeitungen taten den Vorfall zunächst als eine Aktion von Spinnern ab. Doch unter den Bauern Frankreichs avancierte José Bové schnell zum Helden. Natürlich wollte die Fast-Food-Kette ihm und den an der »Rückbau«-Aktion beteiligten Bauerngewerkschaftern den Prozess machen. Doch dann schwante dem McDonald’s-Konzern, dass die Sache dem eigenen Image mehr schaden als nützen würde, also ließ man die Klage wieder fallen. Es blieb der Strafprozess vor dem Amtsgericht in Millau. Vor dem Gerichtsgebäude war die Hölle los; in Manier der Französischen Revolution und unter tosendem Beifall ließen sich die Angeklagten in einem Ochsenkarren mit Holzrädern vom Hochplateau zum Palais de Justice fahren …
McDonald’s wurde in der Folgezeit über Wochen ein beliebtes Ziel für Protestaktionen der Landwirte. In der Dordogne verteilte man vor den Schnellrestaurants Wurst und Gänseleberpastete, anderenorts wurden Rotwein und Schmalzbrote gereicht. All dies waren Solidaritätsbekundungen für den mittlerweile inhaftierten José Bové.
Die Botschaft der Aktionen aber war weitreichender, wie Bové in einem Interview betonte: »Es ging uns um gutes Essen und gegen den undefinierbaren Drecksfraß (Malbouffe). Und um die bäuerliche Landwirtschaft als Gegenmodell zur multinationalen Konzernmacht.« Bald kannte man José Bové nur noch unter den Spitznamen Globalnix. Die Kaution für seine Haftentlassung im September 1999 zahlte übrigens eine US-Bauerngewerkschaft. Eine Weinbar in Brooklyn (New York) trägt seitdem den Namen José Bovés.
Ein knappes Jahr später stand Bové unweit des Tatortes in einem Stadion am Mikrofon und sprach zu hunderttausend Menschen. In dem im Jahre 2000 veröffentlichten Bestseller »Die Welt ist keine Ware. Bauern gegen Agromultis«, den er zusammen mit dem Bauernvertreter Francois Dufour verfasste, zeigen die beiden Autoren, wie man dem Trend zur Globalisierung erfolgreich ausweichen kann. Auf dem Larzac, ihrem Wohn- und Schaffensort, hatten inzwischen genossenschaftliches Arbeiten und eine »bäuerliche Landwirtschaft« Einzug gehalten. Die Bauern wollten nicht mehr zu industriellen Fleisch- und Käseerzeugern degradiert werden. Die Klein- und Biobauern sind auf ihrem Hof immer »Herr der Lage«, erzeugen Klasse statt Masse. Man gründete verschiedene Vereinigungen und hebelte das Erbrecht aus: Auf dem Larzac bekommen nur diejenigen auf Lebenszeit das Recht, den Boden zu bearbeiten, die sich in die Gemeinschaft einfügen und sich zu der bäuerlichen Landwirtschaft bekennen.
Während ihrer gewerkschaftlichen Tätigkeit deckten Bové und Doufour etliche Lebensmittelskandale auf. Zusammen mit ATTAC wehrt sich die Bauernbewegung gegen die Verbreitung von genmanipuliertem Saatgut, das die Artenvielfalt zerstört und die Bauern abhängig macht von den patentierten »Einmalsamen« der Industrie.
2005 wurde José Bové wegen der Verwüstung von Genmais-Plantagen im Rahmen einer sogenannten »Feldbefreiung« zu vier Monaten Haft verurteilt. Ein Jahr später verurteilte man ihn zu hundertachtzig Tagessätzen, weil er eine Plantage mit dem Monsanto-Produkt MON810 zerstört hatte. 2007 kandidierte Globalnix für das Amt des französischen Staatspräsidenten und erhielt 1,3 Prozent der abgegebenen Stimmen. Zwei Jahre später wurde José Bové als Spitzenkandidat des Bündnisses Europe Écologie in Südwestfrankreich in das Europäische Parlament gewählt.
Der Mann mit dem unbeugsamen Widerstandswillen durfte schon Jahre früher erfahren, was es heißt, sich mit den großen Jungs anzulegen. Es ist Sonntag, der 22. Juni 2003, 6 Uhr morgens. Die Sonne wirft ein mildes Licht auf das Larzac-Massiv. Auf dem Schafzüchterhof in Pontensac kräht inbrünstig der Hahn, als sich ein Helikopter nähert und die Erde um den Schreihals herum aufwirbelt. Achtzig geharnischte Polizisten entsteigen den heranfahrenden Mannschaftswagen und stoßen durch die Staubwolke ins Haus. Einige stürmen ins Schlafzimmer und zerren den Hausherrn mit gezogenen Maschinenpistolen aus dem Bett. Ein solcher Aufmarsch ist normalerweise für »Affaires du Grand Banditisme«, für schwere Bandenkriminalität, sowie Terrorismusprozesse reserviert.
In diesem Fall wurde die Ehre einem wehrhaften Schafzüchter zuteil, der bereits 1973 auf der Hochebene Larzac gegen die Pläne der französischen Armee kämpfte, die das Paradies durch einen Truppenübungsplatz ersetzen wollte. Globalnix Bové ließ sich in den letzten dreißig Jahren weltweit blicken. Man sah ihn auf der Rainbow Warrior von Greenpeace, fand ihn an der Seite von Tjibaou, dem Führer der kanadischen Unabhängigkeitsbewegung, bei Gewerkschaftskämpfen. Er war bei den Unabhängigkeitskämpfen auf Tahiti, in Mexiko-Stadt stand er an der Seite der Zapatisten: kurz, er war und ist überall dort, wo der Wind der Revolte weht. Die großen Jungs wissen schon, vor wem sie Angst haben müssen …
Emma Goldman (1869–1940)
Tausend Kämpfe, aber nur ein Ziel
Als hätte man einen Riesenquirl in dieses Leben gehalten – so etwa ließen sich die einundsiebzig Jahre der Emma Goldman beschreiben. Hin und her geschleudert zwischen dem eigenen Gerechtigkeitssinn und den festgebackenen Verwerfungen ihrer Zeit. Ein Leben voller Verzweiflung über die Beharrlichkeit einer falsch konditionierten Gesellschaft. Angetrieben von einer unbändigen Sehnsucht nach Toleranz, Verständnis und Liebe unter den Menschen. Emma Goldman ließ sich in ihrem unermüdlichen Kampf für eine bessere Gesellschaft auch nicht durch die bitteren Zwischenbilanzen entmutigen, die sie immer wieder hat ziehen müssen. Wie diese zum Beispiel: »Selbst ohne Ehrgeiz und Initiative hasst die kompakte Mehrheit nichts so sehr wie Neuerungen. Sie hat dem Neuerer, dem Pionier einer neuen Wahrheit immer Widerstand geleistet, ihn verurteilt und verfolgt.«
Um mich in ihrer wilden Biografie nicht zu verheddern, reihe ich zu Anfang einige Stichworte aneinander, die dem Leser eine Ahnung von Emma vermitteln sollen:Anarchistin, Agitatorin, Frauenrechtlerin und Friedensaktivistin, ist Sigmund Freud, Peter Kropotkin, Ernest Hemingway und Lenin begegnet, hat sich gegen die Wehrpflicht eingesetzt und für die Rechte der Arbeiter, der Frauen und Kinder und für die freie Liebe. So. Der 1989 verstorbene US-amerikanische Philosoph und Nature-Writer Edward Abbey (in diesem Buch ebenfalls vertreten) kommentierte Emma Goldmans Engagement übrigens mit den Worten: »Anarchismus ist kein romantischer Irrglaube, sondern die nüchterne, auf fünftausend Jahren Erfahrung beruhende Erkenntnis, dass wir die Verwaltung unseres Lebens nicht Königen, Priestern, Politikern und Generälen anvertrauen können.«
Emma Goldman wird 1869 als Tochter eines jüdischen Theaterdirektors in Kowno (Litauen) geboren. Sie ist dreizehn, als die Familie nach Sankt Petersburg zieht, wo der Vater arbeitslos wird und sie als Korsettmacherin arbeiten muss. Mit sechzehn Jahren emigriert sie in die USA und schlägt sich als Näherin durch. Wieder erlebt sie Armut, die Allmacht von Unternehmern und Politikern sowie die Brutalität, mit der die Staatsgewalt gegen die für ihre Rechte kämpfenden Arbeiter vorgeht. Sie schließt sich der anarchistischen Bewegung an, deren Ideen sie bereits in Russland kennengelernt hatte.
Im August 1893, auf dem Höhepunkt einer grassierenden Wirtschaftskrise, stellt sich die gerade Vierundzwanzigjährige im New Yorker Union Square auf eine Kiste und ruft einer fünftausendköpfigen Menge von Arbeitslosen zu:»Guckt euch die 5th Avenue an! Jedes Haus ist eine Festung des Geldes und der Macht. Wacht auf! Traut euch endlich, eure Rechte zu verteidigen! Geht hin und fordert Arbeit! Wenn sie euch keine Arbeit geben, fordert Brot! Wenn sie es euch verweigern, holt es euch! Es ist euer Recht!«Für diesen Auftritt wird sie wegen »Anstiftung zum Aufruhr« zu einem Jahr Gefängnis verurteilt.
Doch Emma wäre nicht Emma, wenn sie sich davon hätte beirren lassen. Sie gibt eine Zeitschrift mit dem prophetischen Titel MOTHER EARTH heraus, opponiert gegen die Zwangsrekrutierung von Männern während des Ersten Weltkriegs, verficht weiterhin mutig das Recht auf freie Rede und vertritt das Ideal der »freien Liebe«, die auf gegenseitiger Achtung, nicht aber auf bürgerlichen Zwängen basieren sollte. 1916 wird sie erneut verhaftet, weil sie Informationsmaterial über Geburtenkontrolle verteilt hatte. Am 15. Juni 1917 verabschiedet der US-Kongress ein neues Spionagegesetz. Goldman und ihr Freund und Mitstreiter Alexander Berkman werden postwendend verhaftet und zu zwei Jahren Haft verurteilt. Nach Verbüßung dieser Strafe schob man sie in die Sowjetunion ab.
Irritiert von der politischen Repression im sowjetischen Alltag und von der Niederschlagung des Kronstädter Matrosenaufstandes durch die Rote Armee 1921, verlassen Goldman und Berkman Russland. Sie leben in England und später in Frankreich. Es folgen Aufenthalte in Schweden, Deutschland und Kanada. Nach dem Suizid ihres Freundes Berkman (1936) wird der spanische Bürgerkrieg Emmas neues Aktionsfeld. Sie reist von Katalonien aus nach London, um dort für das republikanische Spanien zu werben. In Kanada sammelt die Rastlose Geld. Während dieser Tour erleidet sie einen Schlaganfall und stirbt siebzigjährig in Toronto. Erst der Tod sorgte dafür, dass der Riesenquirl, den der Gott der Ruhelosigkeit in ihr Leben gehalten hat, zum Stillstand kam.
Emma Goldmanns bewegtes Leben bestand aber nicht nur aus ihrem politischen Engagement. Daher empfehle ich dringend, die Autobiografie dieser umtriebigen Frau mit dem großen Herzen zu lesen: »Living my Life«. In ihr finden sich Sätze, die sich so mancher Politwurm, Wirtschaftsgangster oder Medienschaffende von heute hinter die Ohren schreiben sollte:
»Wir Amerikaner behaupten, ein friedliebendes Volk zu sein. Doch wir schäumen über vor Freude über die Möglichkeit, Bomben aus Flugzeugen auf hilflose Zivilisten werfen zu können. Unsere Herzen schwellen vor Stolz bei dem Gedanken, dass Amerika im Laufe der Zeit seinen eisernen Fuß auf den Nacken aller anderen Nationen setzen wird. Das ist die Logik des Patriotismus.«
»Ich mag verhaftet werden, ich mag ins Gefängnis geschmissen werden, aber ich werde nie Ruhe geben! Ich werde nie Autoritäten dulden oder mich ihnen fügen, noch werde ich Frieden machen mit einem System, das Frauen zu nichts als einem Brutkasten degradiert!«
»Heute wie damals ist die öffentliche Meinung der allgegenwärtige Tyrann; heute wie damals ist die Mehrheit eine Masse von Feiglingen, die bereit ist, den zu akzeptieren, der ihre eigene elende seelische und geistige Verfassung widerspiegelt.«
»Die Menschen würden politisch noch immer in absoluter Sklaverei verharren, wenn es die John Balls (ein englischer Priester, der für die soziale Gleichheit aller Menschen eintrat und die Aufhebung der Standesgrenzen forderte), die Wat Tylers (ein englischer Bauernführer, der den Bauernaufstand von 1381 in England anführte), die Wilhelm Tells (ein Schweizer Freiheitskämpfer um 1300) nicht gäbe – die unzähligen Giganten, die Schritt für Schritt gegen die Macht von Königen und Tyrannen kämpften.«
Und wenn es Emma Goldmann nicht gegeben hätte, möchte man hinzufügen, die in einem verzweifelten Stoßseufzer Folgendes formulierte:
»Das Prinzip der Brüderlichkeit, dass der Agitator von Nazareth gelehrt hat, behielt den Keim des Lebens, der Wahrheit und der Gerechtigkeit so lange, als es das Leuchtfeuer der wenigen war. Indem sich die Mehrheit seiner bemächtigte, wurde dieses große Prinzip ein Erkennungszeichen und Vorbote von Blut und Feuer, das Leiden und Verderben verbreitete.«
Schriften
Anarchismus & andere Essays. Unrast Verlag, Münster
Living my Life. 2 Bände. Alfred A. Knopf, 1931.
Gelebtes Leben. Übersetzung Renate Orywia, Sabine Vetter. Karin Kramer Verlag, Berlin 1978.
Niedergang der russischen Revolution. K. Kramer Verlag, Berlin 1987
Meine zwei Jahre in Russland – V. Lenzer Verlagskollektiv, München 2020
Michael Unterguggenberger (1884–1936)
Ein Lokomotivführer gegen die Hochfinanz
Kennen Sie das österreichische Wörgl? Liegt im Inntal, fünfundfünfzig Kilometer Luftlinie von Innsbruck entfernt. Sie kennen es nicht? Okay. Anfang der Dreißigerjahre kannte es die halbe Welt. Das »Wunder von Wörgl« machte in den von einer Wirtschaftskrise gebeutelten Industriestaaten blitzartig die Runde. Es gab also einen Ausweg aus Arbeitslosigkeit, Inflation und sozialem Elend! Und der wurde in der Region eines 14.000-Einwohner-Nestes in den Alpen aufgezeigt.
Der Name Wörgl ist untrennbar mit einem Mann verbunden, dessen Name so provinziell und heimatverbunden klingt, wie fast alles in Österreich: Unterguggenberger. Der Unterguggenberger Michel hatte bereits eine ungewöhnliche Biografie hinter sich, als er 1932 per Los zum Bürgermeister von Wörgl bestellt wurde, weil niemand das Amt übernehmen wollte. Er arbeitete zunächst als Sägewerkshilfsarbeiter, bevor er eine Lehre zum Mechaniker begann. Nach absolvierter Gesellenzeit erhielt er eine Anstellung bei der Bahn als Lokomotivführer. Als solcher fuhr er ins Amt. Wörgl stand vor dem Bankrott, die Gemeinde sparte auf Teufel komm raus. Vergeblich.
Das Wunder von Wörgl wurde der Jodelnation, um die Fußballersprache zu bemühen, aus der Tiefe des Raumes präsentiert. Vom Bürgermeister persönlich, den die Presse des Landes daraufhin prophylaktisch für verrückt erklärte. Das mussten die Schmierfinken jedoch bald zurücknehmen. Denn während das Elend im Lande, in ganz Europa und auch in Übersee bedenkliche Ausmaße annahm und die Menschen massenhaft in Depressionen stürzte, blühte in einem Tiroler Tal das Leben neu auf.
Auch in Wörgl grassierte Anfang der Dreißigerjahre die Weltwirtschaftskrise. Auch dort war die Verzweiflung der Menschen groß. Bis Bürgermeister Unterguggenberger sich an ein Buch erinnerte, das er einmal gelesen hatte: »Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld«