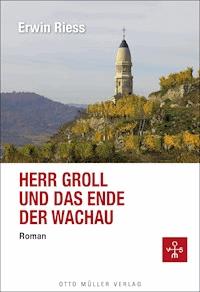Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Müller, Otto
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Herr Groll aus Wien-Floridsdorf ist Liebhaber der Binnenschiffahrt, Rollstuhlfahrer aus Notwendigkeit und Historiker aus Leidenschaft. Wo Groll auftaucht, bringt er die Verhältnisse zum Tanzen. Ob auf den Spuren von Billy Wilder in Österreich, ob im London des Albert Finney, im Gneixendorf des jungen Beethoven oder im New York des österreichischen Bauernbefreiers Kudlich: Groll stellt Zusammenhänge her, von denen die Welt bisher nichts wusste. Solcherart versetzt er nicht nur seinen Freund, den "Dozenten", in ungläubiges Staunen. In Romanen und vielen Groll-Kurzgeschichten versieht Erwin Riess seine beiden Figuren mit Witz und Ironie - eine zeitgenössische Ausgabe der ewig jungen Geschichte von Sancho Pansa und seinem somnambulen Herrn.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erwin RiessHerr Groll auf Reisen
Erwin Riess
Herr Groll auf Reisen
STORYS
Für Pira und die Crew
www.omvs.at
ISBN 978-3-7013-1150-7eISBN 978-3-7013-6150-2
© 2008 OTTO MÜLLER VERLAG, SALZBURG-WIEN Alle Rechte vorbehalten Satz: Media Design: Rizner.at, Salzburg Umschlaggestaltung: Ulrike Leikermoser Druck und Bindung: Druckerei Theiss GmbH., A-9431 St. Stefan
Am Hudson
Groll saß auf einer Bank am Hudson River. Jeden Tag nach dem Mittagessen bei Suzies, einem billigen Chinesen in der Bleecker Street, durchquerte er das Village und rollte auf dem Uferbegleitweg bis zum restaurierten Pier 24, wo er bis zum Einbruch der Dunkelheit las, schrieb und die Flugkunststücke der Möwen beobachtete. Darüber hinaus führte er Buch über die Ozean-Riesen, die den Hudson hinauffuhren, um dort an den Transatlantikpiers anzulegen. Grolls Liste umfaßte den Großteil der von New York operierenden riesigen Casinoschiffe und Karibikliner. Auch die Queen Elisabeth 2 stand auf seiner Liste; Groll schätzte sie nicht nur ihrer schlanken Erscheinung und des berühmten roten Rauchfangs wegen, sondern auch, weil sie als einzige im Linienschiffsverkeh – zwischen Southampton und New York – unterwegs war. Und es schien Groll, daß auch sein Rollstuhl Joseph Freude an der QE 2 hatte. Er hatte Joseph im Verdacht, daß dieser zum roten Rauchfang Hammer und Sichel hinzuträumte.
Die Stunden am Fluß waren geruhsam. Eine stetige Brise kam von der See den Hudson hinauf und linderte die intensive Sonneneinstrahlung, und jedesmal, wenn Groll den Blick von seiner Lektüre hob, erfreute er sich an den Wolkenkratzern des Financial Districts.
Am Himmel zogen unablässig Inlandsjets den Hudson hinauf. Die Maschinen, die im Landeanflug für LaGuardia waren, kamen so pünktlich, daß man die Uhr nach ihnen stellen konnte. Drüben, in New Jersey, starteten im Minutenrhythmus Transatlantikmaschinen vom Flughafen in Newark; es war ein geordnetes Kommen und Gehen, und es war nahezu lautlos. Die Colgate-Uhr am gegenüberliegenden Ufer zeigte fünfzehn Uhr. Angeblich war sie die größte freistehende Uhr der Welt, aber Groll zweifelte nicht daran, daß es irgendwo in Asien eine größere gab. Ob die asiatischen Marketingleute allerdings dem Vorbild folgen und die Uhr auf ein freies Feld an einen Fluß stellen würden, darauf wollte er nicht wetten. Weißgestrichene Schnellfähren pendelten zwischen dem Financial District und dem Nahverkehrsbahnhof in New Jersey-Hoboken; jenem Hoboken, in dem bis 1917 ein Armendoktor lebte, der von der gescheiterten 48-er Revolution in Österreich über den Atlantik getrieben worden war. Hans Kudlich, der „Bauernbefreier“, der als Fünfundzwanzigjähriger im ersten demokratisch gewählten Parlament der Monarchie den Antrag auf das Ende der Leibeigenschaft eingebracht und der im September 1848 die Österreichische Arbeiterzeitung als Organ des Reichstags gegründet hatte, verbrachte die größte Zeit seines Lebens in New Jersey, als geschätzter Armendoktor für in die Neue Welt strömende Europaflüchtlinge.
Zu Kudlichs Patienten zählten viele Italiener, und unter diesen befand sich auch ein Signor Sinatra, ein armer und rechtschaffener Mann, der das Honorar nicht bar, sondern in Naturalien beglich. Das Gemüse und die Eier stammten von illegalen Gärten, die die italienischen Einwanderer am Ufer des Hudson angelegt hatten. Der Bauernbefreier wurde für seine Dienste von freien, aber illegalen Kleinbauern bezahlt, dachte Groll und grübelte darüber nach, ob Kudlich dies wohl als Fortschritt empfunden haben mochte.
New York, Guggenheim-Museum
Seit Tagen beunruhigten Groll starke Vibrationen am Rollstuhl. Auch auf glatten Flächen schien es ihm, als liefen die Reifen über Pflastersteine. Der mit Glasschrot vermischte Asphalt der New Yorker Straßen und die steilen Abschrägungen der Bürgersteige waren reifenmordend und belasteten das Fahrwerk. Groll fürchtete Schlimmes, einen beginnenden Riß im Rahmen oder einen Ermüdungsbruch der Hauptstreben. Es half nichts, um herauszufinden, was die Ursache des schlechten Handlings war, mußte eine Teststrecke aufgesucht werden. Dafür kam nur eine in Frage, und zwar die „geilste Rampe der westlichen Hemisphäre“, wie der Rollstuhlfahrer und Kriegsberichterstatter John Hockenberry in der New York Times das Guggenheim-Museum bezeichnet hatte.
In der Lafayette Street nahm Groll einen Bus in Richtung Uptown. Binnen einer Minute war die Hebeplattform ausgefahren, Groll an Bord geholt und Joseph, der Rollstuhl, mit zwei Stahlklammern fixiert. Obwohl es drückend heiß war, trug Groll einen Pullover und eine Zipfelmütze. Solcherart wappnete er sich immer, wenn er in New York mit dem Bus fuhr, denn unmittelbar hinter den Behindertenplätzen befindet sich eine mächtige Klimaanlage, die unter großer Lärmentwicklung kalte Luft in den Fahrgastraum preßt. Für die Strecke von rund sechs Kilometern brauchte Groll nur eine Stunde, was in der beginnenden Rushhour einen guten Wert darstellte. Er hätte den Weg auch mit dem Rollstuhl zurücklegen können, aber Richtung Uptown steigt die 3rd Avenue die ganze Zeit leicht an, außerdem hätte der schlecht liegende Joseph, der zu dauernden Korrekturen zwang, das Fahren zusätzlich erschwert. Im Guggenheim würde Groll den Fehler finden, und vielleicht würde sich der Schaden schnell beheben lassen, so daß er den Rückweg mit dem reparierten Rollstuhl in einer halben Stunde würde zurücklegen können.
Der Eingang zum Guggenheim war von einer Menschentraube belagert. Die Hitze hatte viele auf die Idee gebracht, ein gut gekühltes Museum zu besuchen. Für Grolls Vorhaben war das ein Rückschlag, aber zwei oder drei Fahrten auf der Schnecke sollten sich ausgehen. Er hoffte nur, daß es ohne Kollision abgehen würde. Es war wichtig, mit einigermaßen hohem, aber gleichmäßigem Tempo zu fahren, um die Ursache des schlechten Fahrverhaltens herauszufinden, und nirgendwo außer in der Wendelschnecke des Guggenheim gab es eine Rampe, deren Neigung ausreichend, andererseits aber auch nicht so groß war, daß ständiges Bremsen mit den Händen die Überprüfung der Straßenlage behindert hätte.
Wie überall in New York wurde Groll an der Schlange vorbeigewinkt. Er löste eine Eintrittskarte und rollte zum Lift, der die Besucher in den siebten Stock brachte, wo Frank Lloyd Wright's Flanierschnecke ihren Ausgang nahm. Die Bilder des deutschen Malers Baselitz bedeuteten Groll nichts, er konnte sich also ganz auf das Fahrverhalten konzentrieren. Er wartete kurz, bis er freie Bahn hatte; dann setzte er sich mit zwei schnellen Armstößen in Bewegung. Er fuhr nahe an der Reling in der Schneckenmitte, die rechte Hand lenkte in die Kurve, die linke lag prüfend auf der Vorderstrebe. Schon nach der ersten Fahrt lag der Fall klar: die Lager des linken Vorderrads waren am Ende. Groll fuhr noch ein zweites Mal die Schnecke hinunter, um die Diagnose zu überprüfen, dann rollte er aus dem Museum und schlug den Weg zum Whitney Museum ein. Er wußte, daß in der Cafeteria ein vorzüglicher Espresso ausgeschenkt wird, und Groll brauchte diese Denkhilfe, denn er stand vor einer schweren Entscheidung: Sollte er den Schaden in Uptown oder im Village beheben lassen? Die Mechaniker in Uptown sind teuer, jene im Village preiswert und zuverlässig. Aber mit dem Bus würde er jetzt zwei Stunden ins Village brauchen, und mit dem angeschlagenen Joseph wäre die Fahrt eine Qual.
Red Hook, Brooklyn
Das Ziegelsteinpflaster war, obschon zwischendurch mit Asphalt geflickt, eine harte Prüfung für Grolls Kreuz und den armen Joseph, der erbärmlich quietschte. Aber Groll war schon so weit nach Red Hook, jenem vergessenen alten Hafenviertel von Brooklyn, vorgedrungen, daß er bis zum Schluß, bis zum Meeresufer durchhalten wollte. Der Anblick der Ozeanriesen, die unter der Verrazano-Narrows Bridge durchstechen und Kurs auf Manhattan nehmen, würde ihn für die harte Anfahrt entschädigen.
Auf dem Gehsteig war schon lange kein Vorwärtskommen mehr gewesen; tapfer hatte Groll sich auf ihm weitergekämpft, trotz dessen starker Querneigung und trotz seines gebrochenen Belags, dann aber, als ihm endlich bewußt geworden war, daß die Straße von Autos gemieden wurde, wahrscheinlich weil die knietiefen Schlaglöcher abschreckend wirkten, war er in der Straßenmitte weitergefahren, vorbei an hölzernen Telegraphenmasten, die aussahen, als stammten sie aus einer Stummfilmkulisse, und leeren Parkplätzen, die durch verbogene und löchrige Drahtzäune begrenzt wurden.
Kein Mensch war auf der Straße zu sehen, und die Häuser schienen sämtlich unbewohnt, jedenfalls deuteten leere Fensterhöhlen und zerschlagene Scheiben darauf hin. Es war heiß und schwül, der Wind war zu schwach, um Abkühlung zu bringen. Groll klebte regelrecht in seinem Rollstuhl fest. Dennoch fuhr er unbeirrt weiter. Wer Schiffe beobachten will, läßt sich von einer staubigen, von der Sonne versengten gottverlassenen Straße nicht unterkriegen, sagte er sich.
Als er mitten in der Straße auf einen blühenden Holunderstrauch stieß, und als er, nachdem er diesen umrundet hatte, feststellen mußte, daß die Straße hier an einer Hausmauer endete, noch weit vom Meeresufer entfernt, war es mit Grolls Beherrschung vorbei. Er fluchte und tobte und warf den Stadtplan und eine leere Dose Selterswasser auf den Boden.
„Wenn du jetzt die Dose aufhebst, Kleiner, und sie mir gibst, dann werd ich so tun, als sei nichts geschehen“, sagte eine Stimme, die klang, als würde das aufgelassene Heizwerk am Ende der Sackgasse zu ihm sprechen. Groll drehte sich um und sah einen alten Schwarzen, der im Schatten des Holunders lag, einen Zigarillo paffte und die Hände über dem Bauch verschränkt hielt. Der Mann trug eine löchrige Kopfbedeckung, die irgendwann einmal ein Panamahut gewesen sein mochte. Der Blick des Mannes war auf die Mauer gerichtet. Vor sich hatte er eine zerrissene schwarze Folie auf die Straße gebreitet, auf ihr lagen zwei Dosen Cola Lite, eine Dose Budweiser, drei Päckchen Kondome, eine Nachfüllpackung Spülmittel, ein Taschenfaltplan von Kalkutta, eine abgegriffene Taschenbuchausgabe von Theodore Dreisers „Amerikanischer Tragödie“ und ein Bügeleisen.
Groll legte die Dose auf die Folie, der Schwarze nickte gnädig. Ob es von hier aus einen anderen Weg zum Meer gebe, fragte Groll. Der Mann verneinte.
„Ein schlechter Platz fürs Geschäft“, sagte Groll, nachdem er eine Dose Cola Lite erworben hatte.
Im Gegenteil, antwortete der Schwarze, jeden Tag kämen zwei oder drei Spinner, die glaubten, die Skyline von New York unbedingt von Red Hook aus sehen zu müssen. Vierzig Jahre lang habe er am Times Square gearbeitet, aber jetzt sei ihm der Trubel zuviel. Er sei aber nicht wegen Manhattan, sondern der Schiffe wegen da, sagte Groll. So etwas habe er noch nicht gehabt, sagte der Schwarze.
Groll erwarb die Stadtkarte von Kalkutta. Die Stadt liegt am Ganges, es war immerhin möglich, daß Groll, der es sich zum Ziel gesetzt hatte, alle schiffbaren Flüsse dieser Erde zu sehen, den Plan noch einmal brauchen könnte. Dann grüßte er und wendete. Immer in der Straßenmitte bleibend fuhr er nach Brooklyn zurück.
Greenwich Village, University Plaza
Jeden Tag gegen Geschäftsschluß trank Groll mit seinem Freund Samuel Waterproof eine Cola an der University Plaza. Samuel war ein großer dunkelhäutiger Mann, er litt an Muskelschwund und saß, besser: er lag in einem vierrädrigen Gefährt, das durch ein baldachinartiges Dach vor Regen und Sonne geschützt war. Dank einer ausgeklügelten Übersetzung war es Samuel möglich, sein Gefährt auch mit geringen Resten von Beinkraft kilometerweit zu bewegen. Samuel stammte aus der Bronx, nicht aus der verrufensten Gegend, aber das Viertel, in dem er aufgewachsen war, hatte ihn allerlei Tricks gelehrt, die es ihm ermöglichten, trotz seiner Behinderung zu überleben. Seit seinem achten Lebensjahr war Samuel Vollwaise. Der Vater war noch vor Samuels Geburt als Unbeteiligter im Zuge eines Raubüberfalls erschossen worden, seine Mutter war eines Tages mit einem indischen Prediger durchgebrannt und hinterließ Samuel, bei dem sich bereits die ersten Anzeichen der Krankheit zeigten, der Großmutter, einer zähen, fast blinden Frau, die Samuel, so gut es ging, von der Straße fernhielt. Mit sechzehn mußte der Bub in den Rollstuhl wechseln, aber da er seine Pubertät nicht mit Schulkram vergeudet, sondern auf der Straße zugebracht hatte, wo er einen schwungvollen Drogenkleinhandel betrieben hatte, war er in der Lage, seiner Großmutter, die sich fortwährend im Glauben wähnte, Samuel versorgen zu müssen, einen Platz in einem gut ausgestatten, rollstuhlgerechten Seniorenheim auf Governors Island zu verschaffen.
Als die Behörden Mitte der achtziger Jahre wieder einmal zu einem Kreuzzug gegen Drogen aufriefen, wurde Samuel der Boden zu heiß. Er beschloß, die Branche zu wechseln. Lange prüfte er die ihm zur Verfügung stehenden Alternativen, dann sattelte er um und wurde Experte für Social Fund Raising. Er hatte herausgefunden, daß im Umfeld der privaten Universitäten Sammelaktionen für soziale Zwecke prächtig gedeihen. Die Studenten, so Samuels Erfahrung, waren noch warmherzig genug, zu helfen, andererseits aber gingen sie die Sache so professionell an, daß schöne Gewinne winkten. Am freigiebigsten erwiesen sich die Söhne und Töchter von italienischen und irischen Selfmademillionären. Zurückhaltender waren Araber und Europäer, richtiggehend zugeknöpft gaben sich aber nur koreanische und vietnamesische Studenten.
Anfangs stellte Samuel sich – gegen gutes Honorar – als Frontman und Sprecher der Kampagnen zur Verfügung. Samuel ist eine vertrauenerweckende Erscheinung, und er versteht es, sich in großbürgerlichen Kreisen gewandt zu bewegen. Auch nützte er den Umstand, daß Muskelschwund damals in Philanthropenkreisen noch als schick galt. Nach zwei Jahren hatte er genug gelernt, um die Kampagnen selber zu organisieren. Er kam damit einer sinkenden Konjunktur von Muskeldistrophikern zuvor, die für ein knappes Jahrzehnt Aids-Kranken und geistig Behinderten weichen mußten.
Seit kurzem betrieb Samuel eine Agentur zur Organisierung von Spendengeldern für Alzheimer-Patienten. Er sammelte Geld für eine Sternfahrt quer durch Amerika, die er in seinem Gefährt, einem Prototyp einer Hilfsmittelfirma, absolvieren wollte. Selbstverständlich dachte Samuel nicht im Traum daran, selber zu fahren, er suchte Piloten und Begleitfahrzeuge für den Trail der Menschenliebe, so nannte Samuel sein Projekt.
Als Groll an der University Plaza ankam, sah er Samuel mit seinem Baldachinrad um die Ecke biegen. Samuel war außer Atem, sein Tritt war schwerfällig, er schien sich zu plagen. Auch er hatte Groll jetzt entdeckt, schon von weitem winkte er ihm mit seiner besseren Hand zu.
Orchard Street
Eines Sonntags machte Groll sich auf den Weg in die Orchard Street. Er hatte gelesen, daß ein Lederwarengeschäft namens Fleischer dort die besten und billigsten Lederjacken der Stadt feilbot. Er überquerte die Houston Street am Broadway und folgte ihr bis zur Allen Street, vor Jahren ein Zufluchtsort Hunderter Unterstandsloser, die im Mittelstreifen logierten und bei Verkehrsstillstand die Autofahrer um Geld anbettelten. Jetzt war die Straße wie ausgestorben. Sonntags um zehn Uhr morgens gehört einem die Stadt fast allein, sagte Groll zu sich und wurde darüber nicht froh. Er hätte es vorgezogen, die Stadt belebt anzutreffen.
In der Orchard Street angelangt, rollte er in das erste Ledergeschäft am Platz. Er wolle eine Lederjacke kaufen, sagte er zum dunkelhäutigen Verkäufer. Ob das Geschäft zufällig Fleischer heiße. Der Verkäufer schüttelte den Kopf, er arbeite seit dreiunddreißig Jahren in der Orchard Street, er könne beschwören, daß es hier kein Geschäft dieses Namens gebe. Groll deutete auf eine einfache schwarze Lederjacke und fragte nach dem Preis. Das sei eine wunderschöne Jacke, es spreche für Grolls Geschmack, daß er dieses Juwel auf den ersten Blick erkannt habe, sagte der Verkäufer. Normalerweise koste die Jacke 235 Dollar, weil er, Groll, aber der erste Kunde an diesem wundervollen Sonntag sei, würde er sie ihm für 160 überlassen. Groll probierte die Jacke, sie war etwas zu lang und warf am Bauch einen häßlichen Wulst. Ob Groll einen Unfall gehabt habe, fragte der Verkäufer. Nein, sagte Groll, einen Schock. Er hätte einen Schock erlitten, als er mitansehen habe müssen, wie ein Fensterputzer von einem Wolkenkratzer zu Tode gestürzt sei. Seither seien seine Beine gelähmt. Groll betrachtete sich im Spiegel und fand den Wulst jetzt nicht mehr so häßlich. Dennoch sagte er, daß der Wulst störe. Das gebe sich nach dem ersten Regen, erwiderte der Verkäufer, er gebe Groll die Jacke für den Vorzugspreis von 150. Und dann fragte er, ob das Leben im Rollstuhl schwierig sei. Nicht sehr, sagte Groll. Nur das Einkaufen von Gewand sei mühsam. 140 sagte der Verkäufer, er wolle an Groll nichts verdienen.
„Wovon leben Sie“, fragte Groll den Verkäufer. „Haben Sie einen zweiten Job?“
Seine Familie, sieben Personen, lebe ausschließlich von seiner Arbeit als Verkäufer, antwortete der Mann.
„Wie können Sie es dann verantworten, mir die Jacke so billig zu geben“, fragte Groll.
Weil er ihm sympathisch sei, sagte der Mann. Außerdem sei Groll der erste Kunde an diesem Sonntag und der Koran lehre, daß man den Sonntag mit einer guten Tat beginnen solle, er gebe Groll daher die Jacke für 120. Groll bedankte sich für das Entgegenkommen und zog die Jacke aus.
„Ich möchte nicht schuld am Untergang Ihrer Familie sein“, sagte er zum Verkäufer. „Sicher haben Sie auch eine alte Mutter oder einen alten Vater zu ernähren.“ Der Vater sei voriges Jahr gestorben, sagte der Verkäufer. Aber die Mutter lebe noch, sie sitze auch im Rollstuhl. „100 Dollar“, sagte der Mann mit einer weinerlichen Stimme. Groll wußte jetzt, daß er die Jacke nicht nehmen konnte. Im nächsten Moment würde der Verkäufer ihm aufschluchzend um den Hals fallen und ihm die Jacke schenken wollen, wenn er ihm dafür das Elend seiner Familie näherbringen dürfte.
„Der Wulst ist zu groß“, sagte Groll und gab die Jacke zurück. Außerdem hasse er schwarze Lederjacken, sie machten ihn älter als er sei, fügte er noch hinzu. Er wünschte dem Verkäufer einen schönen Tag, verließ das Lokal und fuhr einen Block weiter. Bei einem Straßenhändler in der Ludlow Street kaufte er dann eine einzelne Socke in leuchtendem Blau um einen Dollar statt einsfünfzig.
World Financial Center
In der Rushhour verkehren die Fähren zwischen der Stadt und dem Bahnhof von New Jersey am anderen Ufer des Hudson im Dreiminutentakt. Mit hoher Geschwindigkeit nähern sich die breiten Bugpartien der Schiffe, die allesamt nach amerikanischen Präsidenten benannt sind, dem Anlegeponton. Bevor es zu einer Kollision kommt, gibt der Kapitän Gegenschub, Gischt sprudelt hoch, und schon schwebt die Fähre dem hohen Wellengang zum Trotz zielgenau auf die Fangbuchse zu und dockt sanft an. Sofort wuchten zwei muskelbepackte Schwarze Gangways auf die Fähre, worauf sich ein Strom von adrett frisierten, in Maßanzügen oder Modellkleidern steckenden weißhäutigen Finanzanalysten, Brokern und Rating-Spezialisten auf die Fähre ergießt. Hundertachtzig Sekunden später rauscht das Schiff, die Kielwelle einer entgegenkommenden Fähre schneidend, in einer mächtigen Bugwelle in die Flußmitte.
Groll hatte keine Zeit, sich an den Manövern zu erfreuen. Diese Phase des Touristendaseins hatte er überwunden, als er entdeckte, wie leicht es war, den nach Hause, zur family strebenden Bankangestellten, die im World Financial Center bei den weltgrößten Finanzkonzernen und Brokerfirmen arbeiten, einen Dollar abzuluchsen. Zu diesem Zweck deckte er sich in der Zentrale der New York University mit zwei Stößen der studentischen Gratiszeitung New York Press ein, schnappte sich eine Stunde vor Büroschluß ein Taxi und stellte sich vor dem Ponton auf; an einer Stelle, die einem Nadelöhr gleichkam. In einer Hand eine Ausgabe der New York Press und in der anderen eine umgedrehte Mütze, in der sich Dollarscheine stapelten, mußte jedermann an ihm vorbei. Nur der eisernen Disziplin der gut erzogenen Büromenschen war es zu verdanken, daß sie sich am ernst blickenden Groll ohne Murren vorbeizwängten. Im Lauf der Zeit hatte Groll, der die Gutmütigkeit der Kunden und deren Geschäftsinteresse nicht über Gebühr beanspruchen wollte und nur zweimal in der Woche aufkreuzte, seine Verkaufsmethode verfeinert. So hatte sich herausgestellt, daß es besser war, den Kunden, die meist eine Tasche trugen, die Zeitschrift schon gefaltet zwischen Ellbogen und Körper zu stecken, während sie in Hose oder Jacke nach einem Dollar kramten.
In einer knappen Stunde brauchte Groll den Zeitungsvorrat auf. Fünfzig oder siebzig Dollar reicher lud er sich danach im Atrium des World Financial Center auf einen großen Espresso ein und dachte, während er darauf wartete, daß der Zucker sich auflöste, darüber nach, ob er das Geld in einem Chinatown-Restaurant oder weiter nördlich, in Tribeca oder gar im Village in einer Trattoria bei Pasta, Fisch und Barbera anlegen sollte.
Der Dozent hatte ihn einmal tadelnd darauf angesprochen, daß Grolls Vorgangsweise einem dreifachen Betrug gleichkomme: an den Kunden, die für eine frei erhältliche Zeitschrift bezahlten, an den Herstellern des Magazins, deren Werbelinie als Gratiszeitschrift unterlaufen würde, und schließlich, und dies sei ganz besonders verwerflich, an den Behinderten, denn nur die Rücksichtnahme jenen gegenüber würde die Leute abhalten, Groll über den Haufen zu rennen. Er mache ein Geschäft mit der Gutartigkeit der Menschen, hatte der Dozent geklagt. Groll hatte nicht widersprochen, sondern nur darauf hingewiesen, daß erstens in der New York Press