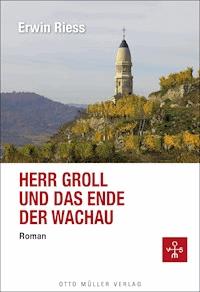Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Müller, Otto
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im Morgengrauen strandet die Leiche einer jungen Frau auf einer Schotterbank. Drei vermögende Herren verfallen in Panik, und ein herzkranker Daubelfischer übernimmt sich mit einem Erpressungsversuch. Mit Hilfe seines Freundes, des Dozenten, versucht Groll, einer höheren Gerechtigkeit zum Durchbruch zu verhelfen. Erwin Riess komponiert eine packende Story um die scharfe Klassentrennung in der Donaumetropole. Vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise entfaltet sich zwischen den Nobelbezirken Hietzing und Döbling und den Arbeiterbezirken an der Donau ein erbitterter Kampf um sexuelle und ökonomische Macht, bürgerliche Reputation und existentielle Würde. Was geschieht, wenn die Angehörigen der unteren Stände ihren Anteil am Glück einfordern und dabei vor ungewöhnlichen Mitteln nicht zurückschrecken, davon weiß Erwin Riess mit Realismus und Witz zu erzählen. In guter Tradition der bisherigen Groll-Romane sind die zum Teil haarsträubenden Unternehmungen der Protagonisten in einen steten Fluss teils skurriler, teils scharfsichtiger Erörterungen der Welträtsel eingebettet. Und nicht zufällig ist es der große Strom, der die Entscheidung herbeiführt. Eine Kriminal-Groteske, packend von der ersten bis zu letzten Seite.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erwin RiessHerr Groll und der rote Strom
Erwin Riess
Herr Groll und der rote Strom
ROMAN
Für Piratessa
www.omvs.at
ISBN 978-3-7013-1170-5eISBN 978-3-7013-6170-0
© 2010 OTTO MÜLLER VERLAG, SALZBURG-WIENAlle Rechte vorbehaltenSatz: Media Design: Rizner.at, SalzburgUmschlaggestaltung: Ulrike LeikermoserDruck und Bindung: Druckerei Theiss GmbH, A-9431 St. Stefan
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
Eine Versorgungsfahrt mit Bedacht und eine Wasserleiche in Rot.
Ein Oberlehrer ohne Namen und ein Jugendamt in Sorge
2. Kapitel
Erinnerung an eine folgenschwere Kollision. Ein Dozent beforscht die Ränder der sozialen Welt. Seine Mutter besitzt eine Fabrik und ist Weltmarktführerin
3. Kapitel
Reger Parteienverkehr in der Kanzlei. Schöne Erfolge in der Drogenberatung und wirksame Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur. Das Floridsdorfer Scheidungsrecht in Aktion
4. Kapitel
Der Fußabdruck eines Jaguars. Ein Donauschiff mit Heimathafen La Valetta. Horst hat ein Geheimnis und ich habe ein Problem
5. Kapitel
Horst bekommt drei Lebensregeln mit auf den Weg.
Eine Schule geht verloren. Der Dozent macht Bekanntschaft mit dem Dschungel
6. Kapitel
Der Dozent arbeitet an einem großen Projekt.
Bürgermeister Lueger besucht Rovinj. Ich treibe Honorare ein. Warum österreichische Gewerkschafter Asphaltseen auf Trinidad-Tobago aufsuchen
7. Kapitel
Eine Kindheit, so schlimm.
Eine Jugend, so hart.
Anitas Geschichte
8. Kapitel
Behinderter Sex und verzweifelte Nazi.
Die Wiener Kriminalpolizei ermittelt.
Vom Elend des Rabatts
9. Kapitel
Der Dozent, emotional überwältigt, hat eine Halluzination, die sich als Wirklichkeit entpuppt.
Ich meinerseits, von der Wirklichkeit überwältigt, glaube zu halluzinieren. Madame Nostitz bewahrt Ruhe und fällt in Ohnmacht
10. Kapitel
Eine Bewährungsprobe für den Dozenten.
Über einige Hauptfehler im Klassenkampf.
Die Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit, auch wenn sie von Horst kommt
11. Kapitel
Ein feudaler Auftritt in Österreich und eine revolutionäre Großtat in Algerien.
Auf dem Weg zum Doppelagenten
12. Kapitel
Von Spießbürgern, Renegaten und Lokomotivführern der Geschichte. Eine patente Geschäftsfrau hat eine anstrengende sexuelle Obsession
13. Kapitel
Warum der flinke Joseph behindert ist.
Der Feldherrenhügel ist eine Gruft mit Richtmikrophon.
Zur Solidarität innerhalb der herrschenden Klasse
14. Kapitel
Blockade im Allgemeinen Krankenhaus.
Madame Nostitz meldet eine weitere Überraschung.
Ein verschlossener Ungar öffnet sein Herz
15. Kapitel
Sewastopol liegt an der Donau. Das Hochwasser steigt.
Juri fährt zur Schule und ist verschollen
16. Kapitel
Vermischte Träume
17. Kapitel
Theorie und Praxis des Hochwassermanagements.
Die Geschäfte der Lumpenbourgeoisie. Ein unerwarteter Sieg und eine fürchterliche Entdeckung
18. Kapitel
Der rote Strom
Epilog
Prolog
Das erste menschliche Wesen, das ich nach meiner Geburt zu sehen bekam, war ein Schiff. Es handelte sich um einen weißen Schlepper namens Sotschi; er war mit einem roten Schornstein und einem in Schwarz gehaltenen Emblem ausgestattet, es zeigte Sichel und Hammer. Seither bin ich der Donau verfallen. Die Verhaltensforschung nennt so etwas Prägung. Ich nenne es Glück. Wohlbehütet von Mutter Schiff und Vater Donau wuchs ich an den Ufern des Stroms auf. Schon früh stand meine Lebensplanung fest. Ich würde lernen, arbeiten, kämpfen und lieben, wie andere Menschen auch. Aber im Gegensatz zu anderen würde ich danach trachten, mein Leben an den Ufern des großen Flusses zu verbringen. Diesem Ziel bin ich recht nahegekommen. Der Fluß blieb mein ständiger Begleiter, und an seinen Gestaden lief mein Leben in halbwegs geordneten Bahnen ab. Daß ein simpler Freundschaftsdienst das Paradies ins Wanken bringen und ich mich in Erpressung, Mord und Totschlag verstrickt sehen würde, war nicht vorauszusehen. Auch wenn das zivilisatorische und menschliche Chaos, von dem in der Folge berichtet wird, eine bornierte Gesellschaft zur Voraussetzung hatte – es bedurfte eines unglücklichen Akteurs, der die Knochenmühle in Bewegung setzte. Mich.
Die Donau führt nicht nur regelmäßig Hochwasser, immer wieder treiben in ihr auch Wasserleichen. Das ist nicht verwunderlich, denn unterhalb von Wien fließt die Donau mit der Strömung eines Gebirgsflusses. Wer ins Wasser fällt und nicht an der Eiseskälte zugrunde geht, wird ein Opfer von Strudeln oder den Schrauben mächtiger Schubschiffe. Oder er zerschellt an den weit in den Strom ragenden Felswürfen. Selbst bei Niederwasser, wenn die weißen Schotterbänke den Fluß säumen und die grünen Weiden und Pappeln ein Bild des Friedens vorgaukeln, ist die Donau gefährlich. Im Jahresschnitt sterben auf ihr zwischen Wien und der slowakischen Grenze ein Dutzend Personen durch Unfälle, dazu kommen die Selbstmörder sowie in der Donau entsorgte Leichen aus Unterweltfehden, Erbschaftskriegen und ehelichen Meinungsverschiedenheiten.
Die Donau ist kein harmloser Fluß.
Daß der Strom die Länder Europas verbindet, zählt zu den Gassenhauern der politischen Folklore, ist aber nachweislich falsch. Das Gegenteil ist der Fall. Zwar stimmt es, daß die Donau durch halb Europa fließt, sie ist aber alles andere als ein einigendes Band. Sie markiert neue Grenzen, gezogen von Neid, Rassismus und nationalistischem Wahn. Ebenso verlogen ist die Behauptung, Mitteleuropa wachse nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zusammen und beglücke seine Bewohner mit einem Leben in sozialer Sicherheit und politischer Gerechtigkeit. Tatsächlich verarmen die Donauanrainer in großer Zahl, und das mit wachsender Geschwindigkeit. Sie mißtrauen einander zutiefst, und nicht selten münden die Aversionen in Gewaltakte. Der Antisemitismus lebt wieder auf, Roma und Sinti können sich ihres Lebens nicht mehr sicher sein, die Sicherheitsbehörden üben sich in wohlwollendem Zusehen. Österreicher und Deutsche, Slowaken und Ungarn, Serben und Kroaten, Bulgaren und Rumänen, Ukrainer und Moldawier – was für ein Ensemble einander in Feindschaft zugetaner Nachbarn! Daß sich die letzten Völkermorde auf europäischem Boden an der Donau und ihren Zubringern ereigneten, ist kein Zufall. Daß auch die kommenden Kriege, die nicht mehr lange auf sich warten lassen, am Strom ausgetragen werden, gilt unter Donaukennern als sicher.
Die Donau ist kein friedlicher Fluß.
1. Kapitel
Eine Versorgungsfahrt mit Bedacht und eine Wasserleiche in Rot.Ein Oberlehrer ohne Namen und ein Jugendamt in Sorge
An einem schwülen Junitag fuhr ich mit meinem klapprigen Renault 5 den Treppelweg bei Stromkilometer neunzehnhundertachtzig bergwärts. In den Alpen hatte es tagelang geregnet, die Donau würde in den kommenden Stunden die Hochwassermarke überschreiten. Die Sonne war durch den Dunst gebrochen, eine steife Brise strich vom Osten her über den Strom und wirbelte weiße Gischtwolken über die Fahrrinne. Es roch nach frischer Erde und moderndem Holz, und in der Luft tanzten weiße, klebrige Flocken – Pappelblüten. Sommerschnee sagen die Menschen am Strom dazu, je dichter der Sommerschnee, desto zarter die Fische und desto fruchtbarer das Land. Ist die Natur freigebig, reagieren die Menschen mit Geiz und Neid. Einige erfreuen sich aber auch am Müßiggang. Ich gehöre weder der einen noch der anderen Gruppe an und sah den kommenden Wochen mit Zuversicht entgegen.
Es würde ein guter Sommer werden. Mit regem Schiffsverkehr, dem einen oder anderen Karpfen aus Horsts Daube, und vielleicht würden Juri und ich Glück haben und einen schönen Hecht an Land bringen, den wir über dem offenen Feuer braten könnten. Eine kleine Rauchfahne würde aufsteigen und zum Fluß hinunterziehen, und es würde eine träge Schwüle über allem hängen, die abends aus dem Auwald kriecht und erst nach Mitternacht verdampft. In manchen Nächten würde die Schwüle bleiben, und es würden gute Nächte sein, in denen die Vögel aufgeregt plappern, wenn sie den Mond wie ein weißes Schild über der schwarzen Phalanx der Pappeln sehen. Musikdampfer und Kreuzfahrtschiffe würden vorüberrauschen, mit bunten Lampions und Girlanden am Tanzdeck, und Musikfetzen würden mit der Heckwelle mitgeschleppt werden und ans Ufer streifen. Und man würde eine Ahnung davon bekommen, daß es noch eine Welt jenseits aller heimischen Spinner, Krisengewinnler und Möchtegern-Nazi gibt, eine bunte Welt mit anmutigen Bewegungen, klirrenden Gläsern und übermütigem Lachen.
Ich fuhr langsam, um meine wertvolle Ladung, vierzehn Doppelliter Wein und einen Korb voll paniertem Fleisch vom Heurigenbuffet, nicht zu gefährden. Zwei Selbstfahrer rauschten mit vollem Schub talwärts, ein Produktentanker aus Belgien und ein kleineres Schiff aus Heilbronn. Es hatte den Anschein, als würde das leichtfüßige kleinere Schiff auf den schwer beladenen Kollegen aufschließen, wohl um die nach der nächsten Biegung folgende Geradeausstrecke für ein Überholmanöver zu nutzen. Lange schaute ich den Schiffen nach, bis mein Blick an einem ungewohnten Bild hängenblieb. Auf einer hoch gelegenen Schotterbank am südlichen Ufer hatten einige Feuerwehrzillen angelegt, und im Kehrwasser dümpelte ein Schnellboot der Strompolizei. Auf der Schotterbank standen Uniformierte im Halbkreis. Ich stoppte und setzte meinen Feldstecher an. Die Männer umringten einen leblos daliegenden Körper, der mit einem leuchtendroten Fetzen nur halb bedeckt war. Einer der Uniformierten hielt einen roten Stöckelschuh in der Hand. Ich schaltete mein Diktaphon ein, nannte Datum und Uhrzeit und sprach: „Katrin und Innovatie talwärts, weibliche Wasserleiche auf Schotterbank.“ Die Frau war nicht bei einem Bootsunfall ums Leben gekommen, dessen war ich mir sicher. Da hatte jemand eine Überdosis erwischt oder war von der Unterwelt beseitigt worden.
Ein gemähtes Rasenstück in saftigem Grün, eine niedergelassene Daube im Wasser. Ein altes Moped, ein Kaps, ein rostiges Damenfahrrad, ein Handrasenmäher. Auf der Veranda Rosenstöcke in allen Farben, an der Außenwand ein Steuerrad und zwei Rettungsringe aus Kork. Die Schrift auf den Ringen unleserlich. Eine Fischerhütte, wie sie zu Hunderten den Lauf der Donau säumen. Für mich aber war diese Hütte mein zweites Zuhause; kein Nagel und keine Pfanne, die nicht von mir im Lauf der Jahre angekarrt worden waren. Und die weit geschwungene Naturrampe, die Horst noch am Tag unserer ersten Begegnung zu bauen begonnen hatte, zähle ich zu den Weltwundern.
Die Sitzbank vor der hochgekurbelten Daube war leer. Horst hatte die weiße Lederbank aus einem Citroën DS 21 ausgebaut, während der Besitzer in der Prater Hauptallee laufen war. Wäre er schneller gelaufen, hätte er seine Göttin gerettet. Er habe sich beim Ausbauen sehr geplagt, bekannte Horst damals; bei einem Citroën sei alles kompliziert, selbst die Verankerung der Sitzbänke. Das war noch in Horsts großer Zeit gewesen; er schuftete damals als Kesselwärter in einem Heizkraftwerk, und in der Freizeit machte er die Wettbüros von Floridsdorf unsicher. Seine Mutter, eine kleine und zähe Person mit einem großen Herzen für ihren wilden Buben, hatte Horst solange es ging unterstützt. Aber eines Tages kippte die betagte Frau in ihrem Schrebergarten um. Als sie im Spital erwachte, konnte sie sich nicht mehr bewegen und erkannte niemanden. Horst besuchte sie alle vierzehn Tage im Pflegeheim, und immer brachte er frische Blumen vom Donauufer und die Bezirkszeitung mit, aus der er ihr dann vorlas. Sie hat sich immer für Weltpolitik interessiert, sagte Horst, da soll sie im Alter nicht darauf verzichten müssen. Juri nahm er nur mit, wenn der Junge heftig darum bat. Mit dem Elend im Heim soll der Bub nicht allzu oft konfrontiert werden, meinte Horst, es reicht schon, wenn er mich Tag für Tag vor Augen hat.
Wahrscheinlich schläft Horst in der Hütte, dachte ich. Er trinkt ja nicht nur Unmengen von Wein, sondern nimmt auch starke Medikamente für sein kaputtes Herz, da schläft man viel. Ich stellte den Motor ab, um Horst nicht aufzuwecken. Da fiel mein Blick auf Juri, der, vom nördlichen Ufer kommend, mit einer Zille die Donau querte. Juri verwendete ein Stechpaddel, er stellte die Zille in einen Fünfundsiebzig-Grad-Winkel und ließ die Strömung die Hauptarbeit verrichten. Die Zille wurde kaum abgetrieben. Mit Freude beobachtete ich die perfekte Technik des Jungen. Im Kehrwasser der kleinen Schotterbank neben Horsts Daube angelangt, fuhr Juri mit eleganten Paddelschlägen ein wenig stromauf, landete bei der Daube an und band die Zille an einer Weide fest. Behende sprang der Bub die Böschung hinauf. In einer Hand hielt er einen Dreizack und in der anderen einen Leinenssack, aus dem Wasser troff.
„Wie viele?“ rief ich.
„Zwei Weißfisch“, sagte Juri keuchend. Seine schwarzen Haare glänzten in der Sonne. „Wir kriegen Hochwasser“, sagte der Bub. „Dann ist’s mit dem Fischen vorbei.“
„Ich hab Nachschub gebracht. Wo ist Horst?“
„Beim Nachbarn. Steigst du nicht aus?“
„Bin spät dran. Muß zur Arbeit.“
Juri schleppte den Wein, das Essen und die Betablocker für Horst in die Fischerhütte. Ein Polizeiboot fuhr langsam stromaufwärts, an der Reling stand ein Beamter und suchte durchs Fernglas die Ufer ab. Als er meinen Wagen sah, winkte er. Ich grüßte zurück. Im Gegensatz zur gewöhnlichen stand ich mit der Strompolizei auf Duzfuß. Dafür gab es einen guten Grund: Ich mußte jährlich die Genehmigung zum Befahren des Treppelweges einholen. Es war streng verboten, den filigranen Damm mit einem Auto zu befahren, es gab schon gar keinen Rechtsanspruch darauf, Rollstuhlfahrer hin oder her. Die Genehmigung war ein Entgegenkommen der Beamten. Ohne das Einverständnis von Strompolizei und Wasserstraßendirektion hätte ich die Versorgung von Horst und Juri nicht aufrechterhalten können. Somit empfahl es sich, mit der Behörde nicht nur pfleglich umzugehen, sondern den Beamten auch die eine oder andere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Im Laufe der Zeit hatte ich manch nützlichen Hinweis parat gehabt; die Strompolizisten wußten es zu schätzen, daß es noch Menschen gab, die sich für die Vorgänge am Fluß interessierten. Manchmal tat auch meine Freundin Anita das Ihre, die Beamten gnädig zu stimmen, aber das sah ich nicht gern. Ich fürchtete, dadurch einem Preisverfall für Anitas Leistungen Vorschub zu leisten, und was Anitas Tauschwert anlangte, war ich ein strikter Anhänger der Grenznutzenlehre der Wiener Schule der Ökonomie. Wenn ein erklecklicher physischer Nutzen keine Zahlung, sondern nur ein bürokratisches Entgegenkommen auslöste, war die Grenze zur Liebhaberei überschritten, und in der Ökonomie gibt es nichts Schlimmeres. Noch dazu, wo Anita allen Grund hatte, ökonomische Disziplin zu wahren, um ihre Schulden abzustottern.
Juri kehrte aus der Hütte zurück. Er ging neben dem Wagen in die Hocke und hielt sich am Fenster an.
„Letzte Nacht war der Vater weg“, sagte er leise. „Beim Nachbarn war wieder Herrenabend. Und wie er zurückgekommen ist, hat er auf der Veranda Schnaps getrunken. Eine halbe Flasche Barack. Das ist nicht gut fürs Herz!“
Ich schaute zur Nachbarhütte, die den Namen Hütte längst nicht mehr verdiente. Das Gebäude war die Designerausgabe einer Fischerhütte, mit Solarzellen, Designermöbeln und Designerrasen. Eine dunkle Benz-Limousine stand auf dem Rasenstück, das sich weit neben dem Treppelweg dahinzog und sorgsam gepflegt war. Von Horst gepflegt. Für ein paar Euro machte Horst dem Eigentümer, dem Nobelwinzer Göttlicher, den Gärtner und Aufseher.
„Du, Groll! Ich hab Angst um den Vater. Er trinkt zu viel Medikament“, sagte Juri.
„Mehr als einen Doppler am Tag?“
Juri nickte. „Wegen denen Gefäßen.“
„Wegen der Gefäße.“
„Wenn ich ihn drauf anred, daß er zuviel trinkt, sagt er, ich soll den Mund halten. Und wenn ich dann nicht locker laß, erzählt er immer dieselbe Geschichte. Daß er einen dritten Herzpatschen nicht überlebt und daß das der Doktor im Gefängnis gesagt hat. Und daß er mehr trinken muß wegen des Gewöhnungsinfekts.“
„Effekts“, korrigierte ich. „Gewöhnungseffekts.“
„Eh“, sagte Juri und schwieg. Ich schwieg ebenso. Was hätte ich schon sagen sollen. Die Diagnose des Gefängnisarztes war richtig. Jeder Monat, der Horst mit dem Buben vergönnt war, sei ein Geschenk des Himmels, hatte ein Kardiologe erklärt, dem Horst über Vermittlung Göttlichers und dessen Freundes Primar Mondl vorgestellt worden war. Immerhin erhielt Horst gute Medikamente, die ich in der „Apotheke zum Weinstock“ an der äußeren Brünner Straße besorgte. „Wenn der Vater ins Spital muß, komm ich ins Heim“, sagte Juri. „Da wär mir schon lieber, er geht in den Häfen. Dann kann ich wieder zu dir.“
Das hat einmal funktioniert, dachte ich. Aber bei deinen Schulleistungen stehen die Chancen auf eine Wiederholung schlecht. Ich wechselte das Thema.
„Hast du etwas von deiner Mutter gehört?“
„Vorgestern ist eine Karte gekommen“, sagte Juri und wedelte mit der Hand, als hätte er sich verbrannt. „Aus Australien. Der Vater hat sie gleich zerrissen. Ich hab sie zusammengesetzt und gelesen. Willst sehen?“
Da bekommt der Bub von seiner geflüchteten Mutter endlich die lang ersehnte Nachricht, und der Vater zerreißt die Karte. Worauf der Bub sie wie ein Puzzle zusammensetzt. Heimlich. Ich weiß schon, warum ich alleine lebe.
„Ihr Gschamsterer is in Australien Tauchlehrer“, fuhr Juri fort. „Am großen Batterie-Riff. Kennst du das?“
„Das Große Barriere Riff ist eine riesige Schotterbank. Bissl größer als unsere da.“
„Deswegen ist die Mutter nach Australien? Das hätt sie bei uns auch gehabt.“
„Wird schon der Herr Tauchlehrer auch ein Grund gewesen sein.“
Juri trat von einem Fuß auf den anderen, dann sprudelte es aus ihm heraus: „Der Gschamsterer trinkt nix. Ich hab ihn voriges Jahr ein paar Mal mit der Mutter gesehen. Der Surm trinkt nur Saft. Literweis Saft. Und Bauch hat er auch keinen. Aber stinken tut er wie ein Iltis, nach teurem Rasierwasser! Das Arschloch.“
„Schön sprechen!“ sagte ich.
„Der Hurenbeidl“, sagte Juri. Ich holte den Buben mit einer Handbewegung ans Fenster. „Juri, es gibt nur eine Lösung: Wir machen mit deinem Vater einen Entzug. Und du gehst regelmäßig in die Schul und schreibst nicht nur Fünfer.“
Juris Miene drückte Ratlosigkeit aus.
„Ich weiß nicht einmal mehr, wie der Herr Oberlehrer heißt.“
„Dann erkundige dich“, sagte ich scharf. „Was deinen Vater betrifft, so gilt ab jetzt: einen Doppler pro Tag und kein Viertel mehr. Und jeden zweiten Tag eine scharfe Fischsuppe von dir. Da hat der Herzpatschen keine Chance. Du mußt nur genau aufschreiben, wieviel der Horst trinkt.“
Juri griff in seine Tasche, glättete einen Zettel am Dachholm des Renaults und reichte mir das karierte Blatt. Es zeigte eine ansteigende Fieberkurve. Plötzlich entriß Juri mir den Zettel und steckte ihn rasch ein.
Horst war aus der Designerhütte getreten und führte einen scharfen Wortwechsel mit dem Nachbarn. Er stieg die Stufen herunter, der Nachbar rannte zu seinem Benz, startete und fuhr mit durchdrehenden Rädern davon.
„Ich hab geglaubt, dein Vater und der Göttlicher sind gut miteinander?“
Juri zuckte die Achseln.
Horst war nähergekommen. Er war mittelgroß, hatte athletische Schultern, einen ansehnlichen Bauch und graues, stumpfes Haar. Müde und verlebt schaut er aus, dachte ich. Aber dann fiel mir ein, daß man genauso über mich urteilen konnte, und es wäre nicht einmal gelogen.
„Servus, Horst.“
„Warum steigst du nicht aus?“ Horsts Stimme war rauh und dunkel wie die eines Kettenrauchers. Aber Horst hatte sein ganzes Leben lang einen großen Bogen um Zigaretten gemacht. Jetzt erst fielen mir zwei Kratzspuren in Horsts Gesicht auf.
„Er muß in die Arbeit“, sagte Juri.
„Was ist denn in den Nachbarn gefahren, daß er den schönen Rasen ruiniert?“
„Laß mich in Ruh mit dem“, erwiderte Horst. „Dauert nicht lang, und ich werd die Mißgeburt ersäufen.“ Er sagte das in einem Ton, der eine Nachfrage ausschloß.
„Hast du die Medikamente mitgebracht?“
„Alles schon in der Hütte!“ sagte Juri.
Horst runzelte die Stirn, worauf die Schürfwunden in seinem Gesicht aufleuchteten. „Warum wartest nicht auf mich?“ schrie er. Juris Gesicht lief rot an. „Weil du nix tragen darfst!“ Horst zuckte zusammen und schlurfte zu mir zurück.
„Weit ist es gekommen mit mir. Jetzt schafft mir der Bub an, was ich machen darf.“ Er nestelte in seiner Hosentasche, zog zwei Hunderter hervor und reichte sie durchs Fenster.
„Da. Nimm nur. Und Dankeschön fürs Bringen.“ Ich verstaute die Scheine im Rollstuhlnetz. „Hast im Lotto gewonnen?“ Daß Horst seine Schulden beglich, war neu.
„So ähnlich“, sagte Horst und verzog das Gesicht zu einem schiefen Lächeln.
Das Polizeiboot von vorhin fuhr in hohem Tempo stromabwärts. Wieder winkten die Beamten, Juri und ich winkten zurück. Horst schaute dem Boot lange nach.
„Heute spinnen die“, sagte Juri. „Mittags waren auch welche da. Mit dem Polizeiboot! Aus Wien! Nicht einmal eine Uniform haben s’ angehabt.“
„Und?“
„Was und? Den Vater wollten s’ sprechen.“
„Aber der hat geschlafen“, sagte Horst.
„Und weiter? So red doch“, platzte es aus mir heraus. Der Bub geriet ganz seinem Vater nach. Maulfaul, wenn er reden soll, und geschwätzig, wenn es um nichts geht.
„Ich soll ihn aufwecken, haben s’ gesagt. Sie wollen mit ihm reschieren.“
„Recherchieren. Weiter!“
„Wenn ich ihn aufweck, erschlagt er zuerst mich und dann Sie, hab ich gesagt.“
Horst war sichtlich stolz auf seinen Buben.
„Weiter!“
„Den Kopf haben s’ geschüttelt, und dann sind s’ weitergefahren. Beim Abstoßen mit dem Boot is einer fast ins Wasser gefallen.“ Juri machte mit der flachen Hand eine Wellenbewegung vor der Stirn.
„Arschlöcher“, sagte Horst. „Nicht einmal schlafen kann man in Ruh. Friedlich wie man is die meiste Zeit.“
„Auf der Schotterbank in der Biegung liegen Polizei und Feuerwehr“, sagte ich. Horsts Augen weiteten sich für einen Moment. Juri schnappte sich das Damenfahrrad und strampelte los.
„Ich muß mit dir reden“, sagte ich zu Horst und setzte meine Lesebrille auf. Das erhöht die Autorität. „Das Jugendamt war bei mir. Die Beamtin hat mich nach dir ausgefragt. Man ist in Sorge wegen dem Juri. Ein Bub ohne Mutter. Kommt in der Schul nicht mit. Der Vater mehrfach vorbestraft. Zwei Herzinfarkte knapp überlebt. Trinkt den lieben langen Tag. Beide allein an der Donau. Das Jugendamt glaubt, daß der Bub verwildert.“
Horst wandte sich um, ich hielt ihn an der Jacke zurück.
„Ich weiß, daß Juri es gut bei dir hat“, sagte ich. „Aber es geht nicht an, daß der Bub in der Schule nur Gastspiele gibt. Von den Noten nicht zu reden.“
„Der Juri fahrt jeden Tag in der Früh weg“, sagte Horst trotzig.
„Und kommt selten in der Schul an. Wann warst du das letzte Mal beim Elternsprechtag?“
„Was ist das?“
„So geht’s nicht, Horst. Auf die Tour bist du deinen Juri bald los.“
Horst hockte sich auf die Fersen und sah mich aus nächster Nähe an. „Schau dir meine Visage an!“ sagte er. „Mir kennt man den Trankler aus einem Kilometer Entfernung an. Ich hab doch auch einen Spiegel.Glaubst, ich will dem Buben schaden?“
Ich nahm die Brille ab. Das Argument war nicht zu widerlegen. „Trotzdem, du mußt was tun, Freund. Sonst kommt dein Juri in ein Heim.“
Horst seufzte und faßte sich ans Herz.
„Schmerzen?“
„Paßt schon.“
Juri kam zurück, er legte eine Vollbremsung hin und ließ das alte Rad auf den Boden fallen.
„Eine junge Frau als Wasserleich!“ rief er.
„Wie schaut s’ denn aus, die Wasserleich?“ fragte ich.
„Tot. Mit einem roten Stöckelschuh.“
Horst wandte sich abrupt zur Seite.
„Geht’s auch wirklich gut?“ fragte ich.
Horst nickte.
„Ich muß los. Gruß an die Schiffe!“ Ich startete, wendete den Wagen und fuhr auf dem Treppelweg nauwärts. Im Rückspiegel sah ich, daß Juri mir mit dem Rad folgte. Ich hielt an.
„Is noch was?“ fragte ich ungeduldig. Das war ein Fehler, denn der Bub, der den Mund schon geöffnet hatte, machte ihn sofort wieder zu.
„Juri, meine Kanzlei öffnet in einer halben Stunde. Ich bin in Eile.“
„Eh“, sagte der Junge hilflos.
„Paß auf deinen Vater auf. Schreib auf, wieviel er trinkt. Koch ihm eine Fischsuppe“, wiederholte ich und erkannte zu spät, daß Juri gern etwas anderes gehört hätte. „Ich komm morgen abend bei euch vorbei. Versprochen!“
„Eh“, sagte Juri. Und dann, wie zur Bestätigung und lauter als zuvor: „Eh!“
Ich tippte den Zeigefinger an die Schläfe, Juri salutierte und grinste. Ich fuhr los. Ein großer Redner wird aus dem Buben nicht werden, dachte ich, aber er kann fischen, er kennt sich am Strom aus, und er kann teuflisch gut Fischsuppe kochen. In halb Europa muß das für ein erfülltes Leben reichen, und jener Teil, in dem es nicht reicht, kann uns sowieso gestohlen bleiben.
Liebe Mutti,
soweit ich Dir berichte, ist bei uns alles in der Ordnung. Ich kann schon gut Zillenstaken und der Vater haltet sich beim Trinken zurück. Er kriegt auch wieder mehr Luft. Heute war in der Donau eine Wasserleiche, aber wir wissen nicht, wer das ist. Der Herr Groll kümmert sich recht um uns, so daß wir nicht verhungern brauchen. In der Bezirkszeitung hab ich gelesen, daß die Flugpreise wegen des billigen Korosions stark gefallen sind. Wenn Du also kommen könntest, wär es nicht so teuer.
Es grüßt Dich sehrDein Juri
Noch was: Nimm auf alle Fälle Gummistiefel mit, wenn du kommst. Bei uns regnet es wie blöd und die Donau wird bald übergehen. Mit Gummistiefeln ist das aber harmlos.
Und noch was: Schick mir eine Antwort bitte nicht in die Hütte, sondern zum Heurigen von Herrn Grolls Anita. Die Adresse hast Du ja. Außerdem kennt den eh ein jeder, sogar der Briefträger.
2. Kapitel
Erinnerung an eine folgenschwere Kollision.Ein Dozent beforscht die Ränder der sozialen Welt.Seine Mutter besitzt eine Fabrikund ist Weltmarktführerin
Während mein Wagen auf dem holprigen Weg dahinschlich, beobachtete ich die Schotterbank in der Biegung des Flusses. Trotz des steigenden Wassers waren jetzt noch mehr Feuerwehrboote und Zillen angelandet, am Ufer leuchteten zwei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr rot aus den grünen Büschen. Von der Leiche war nichts mehr zu sehen. Auf dem Strom lieferten sich zwei bergwärts fahrende Selbstfahrer ein Duell. Zur selben Zeit näherte sich auf dem Treppelweg eine Gruppe von Radfahrern. Ich bremste spät. So spät, daß die Biker derbe Flüche ausstießen, und das noch dazu in einem norddeutschen Idiom. Ich entschuldigte mich und ließ die Gruppe passieren. Momente später wurde ich aber von einer heftigen Hassattacke heimgesucht. Wenn Deutsche laut werden, stellen sich einem Österreicher die Nackenhaare auf. Seit Königgrätz ist das eine anthropologische Konstante. Gleichzeitig verspürte ich Scham darüber, daß ich beinahe in einen Unfall verwickelt worden wäre. Und das an einer Stelle, an der mir vor Jahren schon einmal ähnliches widerfahren war.
Es war zur selben Jahreszeit gewesen, es war heiß damals und schwül, und die Donau glänzte wie geschmolzenes Blei. Sie führte so wenig Wasser, daß die Schiffe nur mit halber Ladung fuhren. Kilometerlange Schotterbänke säumten den Strom, und auf den Buhnen und Leitwerken konnte man trockenen Fußes die Strommitte erreichen. Ich kam gerade von einem Besuch in der Fischerhütte und war auf dem Weg in meine Kanzlei. Horst arbeitete damals noch als Kesselwärter, seine Frau war als Friseurin am Wiener Flughafen beschäftigt und kümmerte sich um Juri. Obwohl Horst schon zu viel trank und oft in Schlägereien verwickelt war, führten die drei eine gute Ehe, und die Donau gab ihren Segen dazu.
Ich hatte nur Augen für den Fluß gehabt, den entgegenkommenden Radfahrer bemerkte ich daher viel zu spät. Ich ging aber davon aus, daß der Mann schon ausweichen würde. Unglücklicherweise galt auch der Blick des Radfahrers nicht dem Treppelweg. Der Mann schaute indes nicht auf die Donau, sondern in die entgegengesetzte Richtung, in die Au, und er schaute auch nicht auf den Boden, sondern in die Luft. Seine Aufmerksamkeit galt einer Gruppe Kormorane, die sich zu einem Pfeil formiert hatte und in südlicher Richtung verschwand. Als ich gewahr wurde, daß der Radfahrer seinen Blick nicht vom Himmel abwandte, war es schon zu spät. Ich versuchte zu hupen, aber die Hupe war kaputt. Ich ließ den Motor aufheulen, doch die Kollision schien unausweichlich. Im letzten Moment bog der Radfahrer abrupt zur Seite, während ich den Bremshebel nach unten riß. Mit einem störrischen Sprung kam der Wagen zum Stillstand. Die Kollision wurde vermieden, aber um einen hohen Preis. Der Radfahrer bog nicht etwa in Richtung Au, sondern in Richtung Donau ab und stürzte über die steile Uferböschung in den Fluß. Ich konnte den Mann nicht mehr sehen. Aber hören konnte ich ihn umso besser. Lautes Wehklagen mischte sich in das Rauschen der an dieser Stelle recht ungestümen Donau. Ich fluchte und stieß die Fahrertür auf. Der Mann klagte jetzt nicht mehr, er schrie in Todesangst. Ich ließ mich aus dem Wagen fallen, kroch auf allen vieren zur Böschung und rutschte dann über Stock und Stein auf dem Hintern zum Fluß hinunter. Der Radfahrer war so unglücklich gestürzt, daß er mit dem Kopf halb unter Wasser lag, sich aber nicht befreien konnte, weil das Rad über ihm zu liegen gekommen war und die Strömung ihn immer wieder unter Wasser zog. Ich streifte Hose und Hemd ab, ließ mich ins Wasser gleiten und versuchte, das Rad zur Seite zu schieben. Der Mann hätte nur die Hand nach mir auszustrecken brauchen, aber er war so sehr in Todesangst, daß er bei jedem Auftauchen hysterisch brüllte und gurgelte. Da vernahm ich ein lautes Motorgeräusch und wandte den Kopf. Ein altes Tragflügelboot, ich glaube, es war die Mijava, rauschte in hohem Tempo vorüber, einen dunklen Schweif von Abgasen hinter sich herziehend. Ich wußte, daß ich den Radfahrer bergen mußte, bevor die Wellen ans Ufer schlugen und versetzte dem Mann beim nächsten Auftauchen eine kräftige Ohrfeige. Dann herrschte ich ihn an, er solle mir seine Hand geben und gefälligst mithelfen.
Wenig später saßen wir auf der Wiese neben dem Treppelweg. Der Radfahrer ließ seine Kleider in der Sonne trocknen und war nackt. Ich trug nur eine Unterhose. Zu meinem Ärger rieselten aus ihr Erdklumpen und Blätter, und zu meiner nicht geringen Beunruhigung war sie blutverschmiert. Ich mußte mir auf dem Weg in die Donau den Hintern verletzt haben. Hoffentlich nur eine kleine Schürfwunde, dachte ich, sonst liege ich vier Wochen auf dem Bauch, und das Duschen und das Klogehen werden zur Tortur. Wenn dem wirklich so sein sollte, würde ich den Schnösel um Schadenersatz und Verdienstausfall angehen. Seine italienische Rennmaschine war um ein Vielfaches wertvoller als mein altes Auto. Da wäre sicher allerhand zu holen. Ich versuchte, die Schürfwunde genauer zu orten, scheiterte aber. Sofort bot der Radfahrer seine Hilfe an. Meine Bordapotheke umfaßte zwar nur eine Flasche Ouzo und einige Stofftücher, aber für die Behandlung der paar Kratzer reichte die Ausstattung. Dann betrachtete der Radfahrer das grotesk verbogene Rad seiner Rennmaschine.
„Sie haben mich geschlagen!“ sagte er. Als ich darauf nicht einging, setzte er hinzu. „Sie haben einem Schiff nachgeschaut!“
Ich sah mir den Mann genauer an. Er war mittelgroß und schien regelmäßig zu trainieren. Seine Gesichtszüge ließen auf ein offenes Wesen schließen.
„Ich habe keinem Schiff nachgeschaut, sondern einem Tragflügelboot. Die sind heutzutage selten.“
„Während Sie den Schiffsverkehr bewunderten, wäre ich um ein Haar ertrunken!“
„Niemand ertrinkt in meiner Nähe“, sagte ich ruhig und setzte meine Beobachtungen fort. Der Mann trug das dunkle und volle Haar kurz, was gut mit der hellen Gesichtsfarbe kontrastierte.
„Es sei denn, ein Schaufelraddampfer kommt vorbei. Die sind an der Donau auch schon rar.“ Zornig trat der Mann mit einem Fuß auf einen dürren Ast. Der Ast zerbrach aber nicht. Ich hatte mir ein Bild von dem Radfahrer gemacht; jetzt konnte er sich eines von mir machen.
„Hören Sie! Ich habe mir Ihretwegen den Arsch aufgerissen“, sagte ich, jedes Wort betonend. „Ich habe Sie vor dem Ertrinken bewahrt und aus dem Wasser gezogen. Tut mir leid, wenn Ihnen das nicht recht ist.“ Schließlich setzte ich höflich hinzu. „Soll ich Sie wieder in die Donau werfen?“
Der Radfahrer erschrak. Dann schaute er an sich hinunter und schien sich seiner Nacktheit bewußt zu werden. Seine Brust sank ein, und als er mir wieder sein Gesicht zuwandte, spielte ein verlegenes Lächeln um seinen Mund.
„Pardon, so habe ich das nicht gemeint“, sagte er. „Ich habe mich vergessen. Sie haben mir das Leben gerettet. Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet.“
Währenddessen hatte ich Joseph aus dem Wagen geholt und war mühsam in den Rollstuhl hinaufgeturnt. „Sprechen Sie weiter“, sagte ich und setzte mich zurecht.
Der Radfahrer deutete eine Verbeugung an. „Gestatten, Nostitz. Ich bin Dozent der Soziologe. Freischaffend. Einundvierzig Jahre, ledig.“
„Ich bin auch freischaffend“, erwiderte ich. „Achtundvierzig Jahre, ab und zu ledig. Herr Dozent, Sie können Groll zu mir sagen.“
Der Radfahrer verneigte sich nochmals. „Es ist mir eine Ehre.“
„Das freut mich für Sie. Und jetzt steigen S’ ein, Euer Gnaden. Ich muß zur Arbeit.“
Längst schon sollte ich mit meiner Beratungstätigkeit begonnen haben, aber ich konnte den Mann mit seiner verbeulten Psyche und seiner ramponierten Rennmaschine nicht an der Donau und schon gar nicht auf der Ostautobahn stehen lassen. Ein nackter Dozent auf der Autobahn, da drohte nicht nur in Wien die Einweisung in die Psychiatrie. Mir blieb nur, mich ins Unvermeidliche zu fügen und den Mann nach Hause zu bringen. Anita mußte die wartenden Klienten im Heurigengarten eben vertrösten.
„Verfügen Sie über einen Lärmdepp?“ fragte ich den Dozenten.
„Pardon?“
„Ein Mobiltelefon!“
Der Dozent nestelte in seiner Radtasche und zog ein Handy hervor. „Es ist naß geworden“, sagte er bedauernd.
Auf der Autobahn fuhr ich konsequent auf der linken Spur. Das verbogene Rad ragte aus dem geöffneten Stoffdach. Ich fuhr so langsam, daß ich immer wieder rechts überholt wurde. Der Dozent bemerkte das, schluckte einen Kommentar aber tapfer hinunter. Schließlich ertrug er es doch nicht länger. Höflich fragte er an, ob es nicht klüger wäre, auf die rechte, langsamere Spur zu wechseln. Ebenso höflich antwortete ich, daß es nicht klüger wäre. So seien wir aber ein Verkehrshindernis, merkte der Dozent, immer noch höflich, an. Ich wolle nicht ständig den Fuß vom Gaspedal nehmen, erwiderte ich darauf schon etwas weniger höflich. Dazu brauche ich nämlich die Hände. Und als der Dozent eine ungläubige Miene aufsetzte, wechselte ich auf die rechte Spur und zog mit der Hand das rechte Bein vom Gaspedal. Der Wagen verlor rasch an Leistung, ein hinter uns fahrender Truck mußte abrupt bremsen. Mehrmals betätigte der Fahrer des Trucks die Hupe. Ich stellte das Bein wieder aufs Gaspedal, worauf der Renault wieder Abstand gewann.
Der Dozent klammerte sich an Türgriff und Handbremse. Wieso ich nicht mit den Händen Gas gebe? Der Wagen verfüge doch über einen Gasring! Der sei nicht mehr funktionsfähig, antwortete ich. Wie die Handbremse und die Hupe.