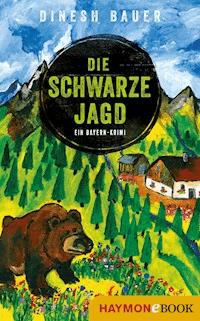Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Wunderwasser sprudelt aus den Quellen von Sankt Leonhard. Ein bayerisches Loden-Lourdes, so die Legende. Mörtel-Magnat Stocker will das Wallfahrtskirchlein in eine Wellness-Oase verwandeln. Dafür ist ihm jedes Mittel recht. Chefreporter Lorenz Seidel und Provinz-Profiler Quirin Berger haben ihre Müh und Not die perfiden Pläne zu durchkreuzen - zumal im Zeichen des Profits nicht nur mysteriöse Verbrechen, sondern auch wundersame Dinge geschehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dinesh Bauer
Herrgottswasser
Ein Alpen-Krimi
Zum Buch
Scheinheilig Ewig leben oder selig sterben? Dem Leonhardswasser wird eine heilkräftige Wirkung nachgesagt – seit Jahrhunderten. Bau-Bonze Stocker glaubt zwar nicht an Wunder, hat dafür aber einen wunderbaren Plan. Mithilfe eines geldgierigen Bischofs und eines korrupten Lokalpolitikers will er aus der Wallfahrtsstätte einen Wellnesstempel für Scheichs und Oligarchen machen. Der hinterhältige Geschäftemacher hat die Rechnung allerdings ohne Pater Cölestin gemacht. Zumal der Einsiedler nicht der Einzige ist, der gegen die »Macht des Bösen« kämpft. Nach einem Anschlag auf Sankt Leonhard droht ein »heiliger Krieg« im Land vor den Bergen.
TV-Reporter Lorenz Seidel und sein Spezl, Kriminalkommissar Berger, werden in einen schwer durchschaubaren Fall verwickelt – in dem nicht nur grausame Verbrechen, sondern auch wahre Wunder geschehen.
Servus beinand! Das Bayerische liegt mir im Blut – meine Vorfahren stammen samt und sonders aus dem weißblauen Land zwischen Inn, Isar und Loisach. Warum ich Krimis schreibe? Weil ich die bayerische Sprache, die alten Erzählungen und die echte, authentische Volksmusik mit der Muttermilch aufgesogen habe. Ein ganz spezielles, kulturelles Substrat. Meine ebenso spannenden wie spaßigen „Fallstudien“ verstehe ich als eine Art Hommage an Land und Leute. Ich liebe die lieblichen Hügel, die rauen Berge und den ebenso eigenbrötlerischen wie liebenswerten Menschenschlag, der hier lebt. Wer seine Wurzeln und seine Geschichte kennt, erkennt sich selbst. Oiso: Gnothi seauton – Dahoam is Dahoam!
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
Lektorat: Teresa Storkenmaier
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © owik2 / photocase.de
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6270-2
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Vorbemerkung
Aus Witterungsgründen fand die bayerische Revolution im Wirtshaus statt!
»Für die, welche an keine Unsterblichkeit glauben, gibt es auch keine.« (Ludwig Börne)
Handelnde Personen
LORENZ SEIDEL, TV-Reporter, riecht den Braten
QUIRIN BERGER, Kriminalkommissar, macht mächtig Dampf
ANTON GRÜNAUER, IT-Crack, glaubt an das Böse
EMERAM HOLZINGER, Banker, denkt pragmatisch
*
CÖLESTIN FROMBERGER, Pater von Sankt Leonhard
INNOZENZ BÖCK, Bischof von Chiemsee
DONATO PASQUANO, bayerischer Dorfpfarrer aus Sizilien
SOPHIE GRABMAIER, kennt Cölestins wahres Ich
KRESZENZ PENZKOFER, hält der Jungfrau die Treue
FRATER ZENO, ein Ketzer, der um ein Geheimnis weiß
*
SEVERIN STOCKER, Bau-Magnat, weiß, wie man Geschäfte macht
KAJETAN FERSTL, Landrat, hält gern die Hand auf
FRANZ SALVATOR FILZMOOSER, sein Stellvertreter, wär gern selbst Chef
RENATE ECKMAIER-FILZMOOSER, seine Gattin
ÄGIDIUS SONNÖDER, Ministerpräsident, macht Wahlkampf
*
JOE GREINER, bayerischer Guerillaführer, träumt von der Revolution
NEPOMUK »SPITZ« SCHWARZ, sein Mann fürs Grobe
BELLE, kümmert sich um PR
WOIFE, kümmert sich um Waffen und Sprengstoff
*
BORIS, wird angeheuert, wenn es Probleme gibt
ANATOL und KOLJA, seine Handlanger
Koloman
Man hatte es nicht leicht, aber leicht hatte es einen. Pater Cölestin Fromberger saß etwas scheps auf seinem Veloziped Marke »Vaterland«. Eigentlich war er zu alt für solch halsbrecherische Berg- und Talfahrten. Das »Vaterland« war nur unwesentlich jünger als er selbst und verfügte weder über eine Gangschaltung noch über Scheibenbremsen oder gar eine Federgabel. Der an den Werkbänken des Deutschen Reichs gefertigte Drahtesel geriet in den steilen Haarnadelkurven heftig ins Schlingern – und bei den Abfahrten ging es in einem solchen Höllentempo bergab, dass die Trommelbremsen nur so qualmten. Doch Pater Cölestin vertraute auf Gott und die legendäre deutsche Wertarbeit. Sein Radl war mit ihm durch Sturzregen und Graupelschauer, durch Staub und Schlamm gegangen oder besser gesagt gefahren. Es würde ihn auch hier und jetzt nicht im Stich lassen. An der Lenkstange baumelte ein Fresskörbchen. In diesem befanden sich ausgesuchte Präsente, die er der betagten Jubilarin zu ihrem Ehrentag überreichen durfte: eine ungarische Salami mit Prädikatsetikett, ein fettes Stück Südtiroler Speck, ein Viertellaib Pustertaler Almkäse, eine prall gefüllte Bonbonniere, ein irdenes Töpfchen mit Zimt verfeinerter Brombeermarmelade sowie ein Rieslingsekt extra brut aus dem Hause Dr. Deinhard zu 7,90 € die Flasche. Vor allem das »Sprudelwasser« würde die Jubilarin überaus zu schätzen wissen. Zu einem edlen Tröpfchen sagte die Sophie nie Nein. Das »Vaterland« rüttelte über die Holzplanken einer Pontonbrücke, die einen gurgelnden Bergbach überspannte. Nun ging es auch noch bergauf – und Cölestin musste kräftig in die Pedale treten, um den Anstieg im Stil eines Eddy Merckx zu bewältigen. Schweißperlen netzten seine Stirn, kleine Diamanten, die im Sonnenlicht glänzten. Gleich wäre er oben an den »Mahdwiesen« samt dem Kolomanskapellchen. Die bayerische Version des Don Camillo war zwar nicht mehr der Jüngste, ließ es sich aber nicht nehmen, jedem seiner ergrauten Schäfchen persönlich zum Festtag zu gratulieren. Und jedes »Geburtstagskind« bekam sein spezielles Geschenk. Der Pfarrer von Flintsbach, Don Pasquano, würde derweil für ihn die Messe lesen. Auf seinen »sizilianischen Spezi« war diesbezüglich Verlass. Der Almweg schlängelte sich durch bucklige Bergwiesen. Der Frühling hatte sein Füllhorn ausgeschüttet, überall grünte und blühte es in kunterbunter Pracht. Solche Tage waren rar gesät. Cölestin spürte die Urkraft der Schöpfung, fühlte sich 30 Jahre jünger, voller Energie und Tatendrang. In weiten, sanften Kehren führte der Weg nun hinab in ein dunkles Tal. Unter ihm schäumte ein Gebirgsbach durch das eng geschnürte Korsett einer wilden Felskluft. Er genoss das Gefühl von Freiheit und Abenteuer und trat in die Pedale. Wie eine gesengte Sau sauste er talwärts. Der Fahrtwind zauste seine weiße Mähne und ließ die Rockschöße flattern. Sein klappriges Gefährt schlingerte und schleuderte hin und her, doch Cölestin war felsenfest überzeugt, dass der Herrgott mit ihm im Sattel saß.
Cölestin schwang sich lässig vom Rad und lehnte es mit der gebotenen Vorsicht an das morsche Gestänge des Staketenzauns. Auf dem blauen Emailschildchen stand zu lesen: Arnried 7. Das Haus der Alten war eher eine Hütte, ein Hexenhäuschen, das sich unter die knorrigen Äste einer dickbäuchigen Linde duckte. Die Bretter und Bohlen waren über die Jahre kräftig nachgedunkelt, sodass das Holz einen dunkelbraunen Farbton angenommen hatte. Da es weder Glocke noch Klingelknopf gab, pochte Cölestin an die Tür. Eine harsche, keineswegs brüchig klingende Stimme hieß ihn eintreten: »Was pumperst denn wie Knecht Ruprecht an die Tür. Es ist offen, komm herein!« Zwei kleine Sprossenfenster ließen etwas Licht in die dunkle, spärlich möblierte Stube. Die Lichtstrahlen fielen in einem schrägen Winkel auf den Dielenboden, Staubkörnchen tanzten darin. Auf der Eckbank saß die Hausherrin – ein handgeschnitztes Kruzifix über, ein Sitzkissen unter ihr. »Hock dich her, kostet auch nicht mehr!«, befahl Sophie Grabmaier. Die Grande Dame, die ihre langen grauen Haare zu einem Dutt hochgesteckt hatte, schien es für eine Selbstverständlichkeit zu halten, dass ihr Pater Cölestin anlässlich ihres Geburtstags einen Besuch abstattete. »Da, nimm dir eines von den Kissen, hält die vier Buchstaben warm. Es ist noch früh im Jahr, nicht dass du mir noch krank wirst! Ihr Mannerleut meint ja allerweil, dass ihr das ewige Leben gepachtet habt’s, so wie mein Josef! Und was ist passiert? Der alte Lapp hat sich eine Frühjahrsgrippe geholt, daraus ist eine Lungenentzündung geworden. Aber er hat ja unbedingt ins Holz hinaus müssen, der sture Hammel. Zwei Wochen später hast du ihn beerdigt.«
»So schnell kann’s gehen. Unser Leben liegt in Gottes Hand!« Cölestin räusperte sich und platzierte den Präsentkorb in der Mitte des Tisches. Wie ihn die Grabmaierin geheißen hatte, schob er ein zerschlissenes Wollkissen unter seinen Allerwertesten und schlug in einer Geste der Verlegenheit die Zipfel der Soutane über die Knie: »Schön, dass es dir so weit gut geht, Sophie. Wie du siehst, hab ich im Dorfladen unten ein paar Kleinigkeiten für dich besorgt. Schließlich hast heut’ ja Geburtstag!«
Sophie prüfte den Inhalt des Korbs mit Kennerblick: »Da hast du dich ja nicht sonderlich überanstrengt. Salami, Schinken, Käse und ein Glas Marmelade, aber nicht einmal einen Kanten Brot. Ihr Männer – habt’s einfach keinen Sinn fürs Praktische! Gut, dass ich noch einen halben Wecken hab!« Die Grabmaierin erhob sich ächzend und schlurfte in einem Tempo, als ob sie gerade mit Ach und Krach eine Hüft-OP überstanden hätte, in die Küche hinüber.
»Kann ich dir helfen?«, erkundigte sich Pater Cölestin besorgt.
Einem unwilligen Grunzen folgte eine unmissverständliche Anweisung: »Bleib bloß sitzen. Du bringst mir höchstens alles durcheinander. Ein Mannsbild in der Küche – mir gangst!« Sophie humpelte – mit Brotkorb, Brotzeitbrettl und einem scharf geschliffenen Metzgermesser bewaffnet – zum Tisch. Mit geübten Handbewegungen säbelte sie Käse und Speck auf das Brettl und schob es zusammen mit drei Scheiben Brot zu ihm hinüber. »Das muss langen, sonst wirst um die Mitte herum noch zeckerlfett!«
»Zu gütig!« In den graugrünen Augen des Paters funkelte es belustigt. Sophie Grabmaier besaß, wie er wusste, durchaus einige gute Charaktereigenschaften – Herzenswärme und Gastfreundschaft gehörten nicht dazu. Zwischen zwei Bissen Speck erkundigte er sich: »Wie wär’s mit einem Schlückerl Sekt? Ich mein, wir müssen doch noch auf dich anstoßen.«
Ein schelmisches Lächeln grub sich in die tiefen Falten um ihre Mundwinkel. »Bei Schaumwein sag ich nicht Nein. Da, nimm den Korkenzieher, damit du auch was tust.« Der Korken knallte und die goldgelbe, perlende Flüssigkeit schäumte in die Gläser.
»Auf dich, Sophie! So jung kommen wir nicht mehr zusammen.«
»Runter mit dem Zaubertrankerl!« Ohne sich mit einem weiteren Toast aufzuhalten, stürzte Sophie den Inhalt auf ex hinunter.
Pater Cölestin nippte nur am Glas: »Schmeckt er dir? Ist er nicht etwas zu trocken?«
Sophie schnalzte mit der Zunge: »Ah geh, an die Sprudelbrause könnte man sich glatt gewöhnen!«
Cölestin mimte den Sekt-Sommelier: »Goldene Farbe, feine Würze, leichte Aromen von weißem Pfirsich und Zitrone, prickelnd im Abgang.«
Sophies klare, weder vom grauen Star noch vom Alter getrübte Augen blickten ihn herausfordernd an. In ihrer Stimme lag leiser Spott: »Was du nicht sagst, Bruder Bacchus. An dir ist ein echter Gourmet verloren gegangen. Wie wär’s mit einem Schluck Wasser? Der Mensch lebt nicht vom Alkohol allein.«
Cölestin nickte bedächtig – auch ohne große Worte bestand ein stilles Einverständnis zwischen ihnen. »Meine Kehle ist staubig wie die Wüste Juda. Und Wasser wirkt wahre Wunder.«
Sophie holte eine Plastikflasche mit dem Aufdruck »Basinus Brunnen« aus dem Kühlschrank und füllte die Krügerl. »Frisch gezapft.«
Der Pater hielt das Wasserglas so andächtig in die Höhe, als ob es sich um einen Hostienkelch handelte: »Auf ein langes Leben und auf dich, Sophie!« Wenn nichts Unvorhergesehenes geschah, würde es noch ein Weilchen dauern, ehe ihre Zeit gekommen war. Und so lange konnte der Himmel allemal warten.
Hubertus
Wasser ist zum Waschen da, tralali und tralala – doch auch zum Zähneputzen durfte man es benutzen. Man konnte damit die Geranien am Balkon gießen, den fein vertikutierten Rasen sprengen oder den gekachelten Fußboden schrubben. Wasser war vielfältig verwendbar. Zur Not konnte man es sogar trinken – auch wenn Lorenz Seidel in aller Regel andere Getränke bevorzugte. Einen im Eichenfass gereiften Kentucky Bourbon zum Beispiel. Seidel spritzte sich etwas Wasser ins Gesicht, kühlte mit der feuchten Handinnenfläche den Nacken und massierte mit kreisenden Bewegungen die schmerzenden Schläfen. Endlich wagte er einen Blick in den Spiegel. Der Kerl, der ihn aus glasigen, rot umrandeten Augen anstarrte, kam ihm irgendwie bekannt vor. Sein spiegelverkehrter Doppelgänger ähnelte zwar nur auf rudimentäre Weise dem Bildnis des Dorian Gray, doch Lorenz hatte zweifelsohne schon bessere Tage gesehen. Er sah müde, zerfurcht und reichlich abgekämpft aus. Sein Teint hatte die blässliche Farbe von Kartoffelbrei aus Wintererdäpfeln – und hätte dringend eines zweiwöchigen Solariumbesuchs oder besser noch einer Kreuzfahrt durch die Karibik bedurft. Dabei sollte er heute Abend noch ein Interview führen. An einem abgeschiedenen Ort, mitten im Wald, beim Hubertus-Bründl. »Ohne Zeugen«, hatte ihn der Mann am Telefon mit seltsam blechern klingender, wie mit einer technischen Apparatur verfremdeter Stimme ermahnt. »Entweder Sie kommen allein – oder das Date findet nicht statt und Sie können die Nummer vergessen.« Das Treffen versprach wenn schon nicht sonderlich spaßig, so doch zumindest spannend zu werden.
Lorenz Seidel wandte seinen Blick von dem Wandspiegel über dem Waschbecken ab und starrte zu dem Schreibtisch hinüber, auf dem sein Laptop summte wie ein Schwarm Honigbienen, deren Königin sich anschickte, auf Wanderschaft zu gehen. Er fühlte sich leer und ausgelaugt – unfähig, auch nur ein einziges weiteres Wort aus seinen Gehirnwindungen zu wringen. Seidel schob die Gardinen zurück und blickte auf die Dächer Rosenheims hinab. In den meisten Fenstern der umliegenden Häuser brannte bereits Licht. Unten auf dem breiten Boulevard staute sich der Feierabendverkehr. Eine lange Lichterkette schlängelte sich wie eine Riesenpython durch die Straßenschluchten. Tief in ihrem Herzen waren die Menschen Nomaden geblieben. Eine ewige Unrast zog sie unaufhörlich weiter – von einem Ort zum andern. Nichts erschreckte sie mehr, als wenn ihr Leben zum Stillstand kam und sich nichts mehr vom Fleck bewegte. So wie jetzt – zwischen Stoßstange und Stoßstange eingekeilt in ihren Blechsärgen. Die Berge, jene Fluchtpunkte am südlichen Horizont, waren hingegen, aus der Entfernung betrachtet, nicht mehr als eine diffus schimmernde, unregelmäßig gezackte Linie, eine von Schwärze umrandete Staffage.
Er war ein Meister darin, sich in Tagträumereien und abstrusen Gangliengespinsten zu verirren. Lorenz fand auch diesmal nur schwer in die Realität zurück. In seinem Büro war alles wie immer, inmitten des Chaos herrschte eine feste, klar umrissene Ordnung. Trotz des scheinbaren Durcheinanders, trotz der von ihm fein säuberlich gerahmten Fotografien, trotz der aus den Wandregalen lugenden Plüschtiere und Filzfigürchen empfand er das Zimmer als steril und nüchtern. Dem Raum fehlte die persönliche Atmosphäre, die individuelle Duftmarke. Es war ein nach Schema F eingerichtetes Bürozimmer, hell und funktionell. Lorenz hob den Blick und blinzelte ins Licht der in die geriffelte Rigips-Decke eingelassenen Halogenstrahler. Geblendet schloss er die Augen. Als er die Lider einen Spaltbreit öffnete, zogen sich für einen Sekundenbruchteil geisterhafte Leuchtspuren über seine Netzhaut.
»Los jetzt, an die Arbeit! Träumen kannst du später in der Koje.« Lorenz gab sich einen Ruck und nahm Kurs auf seinen Schreibtisch. »Hock dich auf den Hosenboden und geh das Mail noch einmal genau durch! Zeile für Zeile!« Seufzend plumpste er in den mit einem Karomuster gesprenkelten Drehstuhl. Zweimal klicken und das Fenster des Mailprogramms poppte auf. »Ha, da haben wir ja unseren Geisterseher. Wie kommt jemand nur auf solch absurde Ideen? Da ist die Glühbirne doch komplett durchgebrannt!«
Absender der Mail waren ein gewisser »Dan Brown« und ein »Guevara 67«. Immerhin bewies der große Unbekannte einen Sinn für schwarzen Humor. Lorenz nahm an, dass die Mails von einem gekaperten Krypto-Server verschickt und von Chiffrier-Programmen verschlüsselt worden waren. Er hatte allerdings keinen blassen Schimmer, wie sich das in der Praxis bewerkstelligen ließ. Seine Computerkenntnisse dümpelten an der Benutzeroberfläche, von Programmieren hatte er keine Ahnung. Fakt war, dass sich der Absender für eine Art Visionär hielt, einen »Propheten der Armut«. Nun, das schien noch nicht weiter außergewöhnlich. Heutzutage war es schließlich en vogue, sich als Minimalist und Anti-Materialist zu gerieren – und zumindest nach außen hin in Bescheidenheit und Bedürfnislosigkeit zu üben. Dass »Dan Brown« sich für die Wiedergeburt Che Guevaras hielt, legte allerdings die Vermutung nahe, dass der Bursche an Größenwahnsinn litt oder schlicht und einfach nicht ganz auf der Höhe seiner geistigen Schaffenskraft war. Zumal der Typ – nach Form und Inhalt seines Elaborats zu urteilen – an die Reinkarnationsnummer zu glauben schien. Er sprach von sich in der dritten Person oder verwendete den Plural Majestatis, um seiner Revoluzzer-Rolle Nachdruck und Gewicht zu verleihen.
»Ein Psycho, eindeutig«, schüttelte Seidel mitleidig den Kopf. »Aber diese irrwitzige Story darf ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen.« Zumal der Verfasser des Sendschreibens steif und fest behauptete, dass er ein Prophet des Herrn sei und zwei Seelen in seiner Brust wohnten: die des chiliastischen Endzeit-Predigers Müntzer sowie die des smarten Latino-Lenins Guevara – ein schillerndes, wenn auch sonderbares Pärchen. Und Gott selbst – kleiner wär keiner – habe ihm den Auftrag erteilt, die verderbte Welt aus den Fängen Satans zu erretten und die Menschen auf den Pfad der proletarischen Tugend, der Demut und der Armut zu führen: mitten hinein in den Garten Eden der Arbeiter und Bauern. Um das Paradies der Gleichheit und Brüderlichkeit zu erschaffen, sei jedes Mittel erlaubt – denn der Zweck heilige bekanntlich die Mittel. So weit »Dan Brown« alias Che alias Thomas Müntzer.
»Der Kerl ist ein Vollhorst, aber die Geschichte hat Potenzial!« Seidel war Profi und wusste, wie die Medienwelt tickte – so sah er die Studio-Deko einer großen Sondersendung zum Thema »Glaube, Verblendung, Wahn« schon vor sich: mannshohe Pappmachéfiguren von Jesus, Mohammed, Buddha auf der einen, von Marx, Lenin und Che auf der anderen Seite. Dazu vielleicht noch Luther und Papst Benedikt als Assistenzfiguren. Inmitten großer religiös-revolutionärer Kulisse würde er mit »Dan Brown« angeregt über Gott und den Teufel, über Mystik und Dialektik philosophieren. Er würde den Kerl reden, von der mystischen Erkenntnis faseln, von revolutionären Umwälzungen schwärmen und den Geist der Gemeinschaft beschwören lassen, um ihn dann mit dem Instrumentarium seines messerscharfen Intellekts als das zu entlarven, was er war: ein eitler Schwätzer, ein heuchlerischer Scharlatan. Ein solches Thema brachte Quote – und ein souveräner Auftritt des Moderators Pluspunkte beim Publikum. Vielleicht würde er als angesagte »TV Personality« sogar einen gut dotierten Werbevertrag einheimsen. Im Geiste sah sich Seidel bereits einen XXL-Schokoriegel ins Objektiv halten, um im Brustton der Überzeugung zu verkünden: »Marx macht mobil!« Oder vielleicht noch besser: »Der Riegel mit dem Che, der schmeckt voll o. k.!«
Doch noch war es nicht so weit. Erst kam die Arbeit, dann der Schokoriegel. Seidel musste zugeben, dass der Wahnsinn dieses durchgeknallten Spinners einer gewissen Methodik nicht entbehrte. Der Absender des Mails beschränkte sich nicht darauf, prophetische Phrasen zu dreschen oder sich in Hetztiraden auf die Reichen und Mächtigen zu ergehen. Der wiedergeborene Che kündigte konkrete revolutionäre Schritte an und plante – zumindest behauptete er dies – am Tag X zuzuschlagen. Er habe Seidel dazu auserkoren, seiner »heiligen Mission« in den Medien Gehör zu verschaffen. Deswegen bot er ihm eine exklusive Story an. Er würde ihn im Rahmen einer »Guided Tour« zu ihren geheimen Waffen- und Munitionsdepots führen, um ihn von der Ernsthaftigkeit ihrer Absichten zu überzeugen. Natürlich nur unter den Bedingungen eines Paranoikers, der unter chronischem Verfolgungswahn litt: Seidel sollte allein und per Fuß zu dem Treffpunkt kommen – mit einer professionellen, hochauflösenden Videokamera, aber ohne Handy, Smartphone & Co.
Sollte er sich zur Beruhigung seiner überreizten Nerven einen Obstler aus der »Bordbar« genehmigen? Die »Recherche« schien ihm nicht ganz ungefährlich. Was erwartete ihn dort draußen im Wald? Er wäre allein auf weiter Flur – und auf Gedeih und Verderb einem, um es euphemistisch auszudrücken, geistig labilen Neurotiker ausgeliefert. Was, wenn ihn dieser in seinem Wahn für einen Spitzel oder Spion hielt – und ihn umgehend exekutierte? Seidel stützte sich mit beiden Ellenbogen auf die Tischplatte und scrollte gedankenverloren durch das Mail. »Zwölf Seiten, in 10 Punkt Calibri. Der Typ hat sie wirklich nicht alle. Wo ist die verflixte Passage?«, nuschelte er in seinen frisch gestutzten Seeräuberbart: »Ja, da ist es!« Lorenz las halblaut mit: »Seine Mitstreiter hielten Jesus für den Messias. Das bezeugt die Bibel. Wer aber ist dieser Messias? Dem jüdischen Verständnis nach ist der ›Maschiach‹ ein von Gott erwählter Herrscher, König und Hohepriester in einer Person. Ein Herrscher, der die Juden aus Knechtschaft und Fremdherrschaft erlösen würde. Einer, der das Schwert erhob, um mit aller Macht für das Reich Gottes zu streiten. Niemand, der die linke Wange hinhielt und vor den Mächtigen, vor Herodes, Kaiphas & Co., zu Kreuze kroch. Beim Evangelisten Matthäus steht es klar und unmissverständlich: Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert.«
Dieser »Dan Brown« war offensichtlich nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Er kannte die Bibel besser als Seidel selbst und hatte sich mit den grundlegenden theologischen und exegetischen Fragen des Messiasbegriffs im Judentum und Christentum beschäftigt. War er ein Profi, ein abtrünniger Priester gar, der sich vom Paulus zum Saulus gewandelt hatte? Ein Umstürzler, der in seinem Mail christliche Würdenträger wie Bischof Innozenz Böck als »Meister der List und Tücke«, als »Lügenpriester« und »gottlose Mammonsjünger« diffamierte. Solch wütende Anschuldigungen gegen einen hochrangigen VIP der katholischen Kirche bargen Zündstoff in sich – was ihm als »Skandal-Journalist« nur recht sein konnte.
Seidel strich sich unschlüssig durch den Bart. Sollte er seinen Skalp riskieren? Er spürte ein Kribbeln in den Fingern, spürte, wie die innere Anspannung wuchs. Es gelang ihm nur mit Mühe, sich noch einmal in den Text zu vertiefen: »Che und Christus waren Brüder im Geiste. Beide überzeugt von ihrer Mission, bereit, ans Limit zu gehen und in letzter Konsequenz ihr Leben zu geben. Zwei, die aus dem Halbdunkel der Geschichte kamen, aus der Wüste Judäas, aus dem Dschungel Kubas. Zwei Rebellen, die ein großes Ziel vor Augen hatten: die Menschen zu verändern – und eine neue Welt zu erschaffen. Zwei Göttersöhne, die gegen die Allmacht der Väter aufbegehrten – Heiland und Held zugleich.«
»Brown« war anscheinend darum bemüht, sich selbst zu inszenieren und mit pathetisch-prophetischen Phrasen zu punkten. Bei Licht betrachtet erschienen ihm die Kernaussagen allerdings reichlich abstrus. Christ und Marxist – zwei Ikonen, zwei Idole vom selben Schlag. Nun ja! Lorenz hatte die schlechte Angewohnheit, seine Beine unter dem Tisch zu verknoten und sich wie ein blinder Maulwurf so weit vorzubeugen, dass er mit der Nase fast gegen die Mattscheibe stieß: »… das politische Establishment, die Kaste der ›Väter‹ kann keine Rebellion wider die herrschende Ordnung dulden. Und mit den ungeratenen ›Söhnen‹ macht man kurzen Prozess. Ihr halb entblößter Leichnam wird öffentlich zur Schau gestellt. In einer demütigenden Pose der Ohnmacht. Die Botschaft ist klar: Schaut her – so endet euer Messias, euer junger Gott!« Nach solch hochgeistigen Ergüssen griff Seidel nun doch zum selbstgebrannten Obstler aus dem »Giftschränkchen«. Das aus diversen Fallobstresterln, aus Äpfeln, Birnen, Zwetschgen und weiß der Teufel noch was zusammengebraute Gesöff stammte aus der hauseigenen Destillerie seines alten Kumpels Anton Grünauer. Er schraubte den Drehverschluss auf und schnüffelte mit skeptischer Miene an den herben »Düften«, die dem Gebräu entströmten. »Runter damit, bis jetzt ist noch niemand daran gestorben.« Der Schnaps brannte wie Feuer in seiner Kehle. Trotz des »Feuerwassers« wurde er das mulmige Gefühl nicht los, dass er sich auf einen schmalen Grat begab, ja, schlimmer noch, einen schweren Fehler beging. Lorenz schaltete den Computer aus, ließ das Schnapsfläschchen in seine Manteltasche gleiten, dann löschte er das Licht.
Es roch modrig, nach verrottendem Laub, nach Vergänglichkeit und muffigen Socken. Auf dem Waldboden breiteten sich schwammig grüne Moospolster. Flechten-Flecken glänzten feucht auf den Felsblöcken. Ein Bergsturz hatte vor Hunderten von Jahren eine gewaltige Gerölllawine ausgelöst und tonnenschwere Felsbrocken zu Tal gewälzt. Unter einem unscheinbaren, aus Lehm und Felsbrocken geformten Erdhügel trat frisches Quellwasser zutage und gurgelte in einen hölzernen Trog: das Hubertus-Bründl. Aus dem Bründl und einigen kleineren, unter dem grünen Teppich hervorsprudelnden Quellen speiste sich ein munteres Bächlein. Sein Name passte perfekt: Kaltenbach. Die Gegend hier war ein echtes Feuchtgebiet, dachte Lorenz. Und es war arschkalt. Frierend und fröstelnd trat er von einem Bein auf das andere. Am Himmel hing ein zu einer schmalen Sichel zerschmolzener Mond, dessen fahles Licht in den dunstigen, über dem Boden aufsteigenden Nebelschwaden versickerte. Die Wegkreuzung bei der Kindswieskapelle, die der Unbekannte als Treffpunkt gewählt hatte, lag in gespenstischem Zwielicht. Seidel schielte auf das beleuchtete Zifferblatt seiner Armbanduhr. Wo bleibt der Kerl bloß? Schon eine Viertelstunde über der Zeit. Seine Nervosität wuchs von Minute zu Minute. Wieso meldet sich dieser Wirrschädel nicht oder schickt wenigstens eine SMS? Da fiel ihm siedend heiß ein, dass ihm »Brown« alias »Guevara« ein striktes Handyverbot erteilt hatte. Und das Klingelgerät friedlich in der Mittelkonsole seines Bauern-Jaguars schlummerte. »Hockst du hinterm Busch und lachst dir einen Ast ab, ha?« Seidels innere Anspannung wandelte sich in Gereiztheit und Zorn. »Jetzt langt’s mir aber langsam. Was soll das blöde Theater, fix!« Lorenz tastete nach der bauchigen Schnapspulle in seiner Manteltasche, notfalls würde sich diese als Waffe verwenden lassen. Schließlich besaß er nicht die geringste Garantie, dass ihm dieser Spinner keine Falle gestellt hatte, um ihn zu kidnappen. Vom Standpunkt des Reporters aus betrachtet, war ein »Geisel-Drama« an sich eine feine Sache – aber nicht, wenn er selbst die Geisel war!
Die nächtlichen Geräusche des Waldes waren nicht dazu angetan, seine überreizten Nerven zu beruhigen. Seidel hörte Zweige im Gehölz knacken – und zuckte zusammen. Was war das? Schlich dort irgendein mordlüsternes Raubtier, ein Marder, ein Fuchs, ein ausgebüxter Wolf gar herum? Oder versteckte sich seine Kontaktperson im Unterholz? Seidel erhob seine Stimme und rief in die Nacht hinein: »Hallo, sind Sie das? Che, Mister Brown? Ich bin allein – wie vereinbart. Ich hab alles dabei, um unser Gespräch aufzuzeichnen!« Doch er bekam keine Antwort. Im dunklen Tann wurde es so still wie am Tag nach dem Jüngsten Gericht. Verdammt, irgendetwas war da schiefgelaufen. Lorenz wartete weitere zehn Minuten. Doch niemand ließ sich am Bründl blicken. Kein Fuchs, kein Wolf und erst recht keine dunkle Gestalt mit rußgeschwärztem Gesicht. Er stand da wie der Depp von der Au, die Schnapsbuddel in der rechten, die Kamera in der linken Hand. Er nahm einen tiefen Schluck und entledigte sich eines Schleimbatzens, der in hohem Bogen gegen den Stamm einer verkrüppelten Bonsai-Birke klatschte. »So ein Sauhund, lässt mich eiskalt auflaufen!« Wieso war dieser Schweinepriester überhaupt auf ihn gekommen? Seidel wusste es nicht. Er wusste jedoch, wen er auf »Brown« ansetzen musste. Anton Grünauer war nicht nur Schwarzbrenner und Schwarzseher, er fischte auch in den trüben Kanälen des Darknets und war in den Untiefen des World Wide Web zu Hause. Wenn jemand die digitale Fährte von »Dan Brown« alias »Guevara 67« aufspüren konnte, dann er – Grünauer! »Finito, geh ma!« Seidel hatte endgültig genug für heute – just in diesem Moment verschwand die Mondsichel hinter einer von Westen heranziehenden Wolkenwand. Zwei Minuten später schüttete es wie aus Gießkannen. Seidel fluchte – und wurde nass bis auf die Knochen.
Sebastian
In der Sakristei roch es nach altem Holz, Staub und Mottenkugeln. In den Gewändern und Talaren hing der Mief von tausend Jahren. Die Einrichtung des kahlen, weiß gekalkten Raums beschränkte sich auf einen riesigen Wäscheschrank, einen Garderobenspiegel sowie ein von einer Schicht Firnis versiegeltes Ölbild, auf dem sich der heilige Sebastian, von Pfeilen durchsiebt, um ein hölzernes Kreuz in der Form eines T wand. In den Ecken der niedrigen, von einer Stuckleiste umkränzten Decke hingen dicke Spinnweben. Naserümpfend stieß Donato Pasquano das Fenster auf und sog die angenehm kühle Luft des Abends ein. Es wurde gerade dunkel und die Schwärze kroch aus den Schatten der Bäume hervor. Nebel stieg aus dem feuchten, von einer Schicht Laub bedeckten Boden auf und hing wie Lametta von den Ästen herab. Die Kirche Sankt Leonhard lag auf einem schmalen Absatz am Abhang des Heubergs. Auf einer kleinen Lichtung inmitten dichter Bergwälder. Wenn unten im Tal schon die Knospen sprangen, lag hier oben oft noch Schnee. Ein stiller, verwunschener Ort, dem Gewese und Gewirbel der Welt entrückt. Pasquano hätte stundenlang so dastehen können, den starren Blick auf die sich in farbloser Finsternis auflösenden Konturen von Bäumen und Büschen gerichtet. Er hatte die Dunkelheit immer gemocht, die die Dinge des Diesseits unsichtbar werden ließ, die die klaren Linien verwischte, die Gewissheiten der Ratio ins Wanken brachte. Und dem Ungreifbaren, Unergründlichen und Rätselhaften Raum bot.
Pasquano riss sich von seinen abgründigen Betrachtungen los und schloss rasch das Fenster. Es war das erste Mal, dass er hier – in Vertretung Pater Cölestins – die Messfeier hielt. Was an sich reine Zeitverschwendung war. Doch er hatte ihm die Bitte nicht abschlagen wollen. Cölestin war so etwas wie sein Mentor – und ein elendiger Sturschädel. Er hielt eisern daran fest, einmal im Monat eine Messe samt Seelenamt zu lesen. Der Hintergrund war, dass vor etlichen Hundert Jahren ein ebenso frommer wie vermögender Blaublütler eine ewige Messe zum Heil der armen Seelen gestiftet hatte. Wohl um irgendwelche Sünden abzubüßen. Solange diese Messe gelesen wurde, bestand das Benefizium fort. Das Benefizium warf wiederum genug ab, dass Pater Cölestin sein Auskommen fand und die Kirche vor dem vollkommenen Verfall bewahren konnte. Zum Unwillen der bischöflichen Administration, die längst ein Auge auf die Grundstücke geworfen hatte, die Teil des Benefiziums der Messstiftung zu Sankt Leonhard waren. Leonhard war einer der vierzehn Nothelfer und der Schutzpatron aller Gefangenen, egal, in welchem Gefängnis sie zu Recht oder Unrecht schmorten. Der »Kettenheilige« wachte aber auch über das Wohlergehen des lieben Viehs, insbesondere über das von Rössern und Rindern. Unter den bayerischen Bauern war »Lehardi« zum Heiligen schlechthin avanciert – und der »Lehards-Tag« am 6. November wurde mit Umzügen und Prozessionen zu Pferd gefeiert. In der guten alten Zeit waren jedes Jahr Tausende von Menschen mit ihren Ochsen und Kaltblütern hierher gepilgert, um Vergebung ihrer Sünden zu erlangen und sich mit »Weihwasser« aus der Lehardi-Quelle einzudecken. Das aus den Felsen unterhalb der Kirche sprudelnde Wasser galt als wundertätig, sollte das Vieh vor Seuchen und Pestilenz schützen. Es war aber angeblich auch imstande, die Leiden der Gemütskranken zu lindern, Schwermut und Trübsinn zu verjagen. Die Quelle sprudelte noch, der Pilgerstrom aber war jäh versiegt. Die Wallfahrer waren nur mehr eine Schimäre, heutzutage verirrte sich kein Mensch mehr hierher. Pasquano runzelte die Stirn. Wenn er nun vor leeren Bänken allein in der Kirche stand? Egal, er würde Pater Cölestin den Gefallen tun – basta.
Die Schranktür knarrte in den Angeln. Von der langen Stange hingen unförmige Gewänder herab wie ein Fledermausrudel im Winterschlaf: Albe, Kasel, Stola, Velum, Zingulum, Pluviale, Soutane, Chorhemd. Die ganze Palette liturgischer Kleidungsstücke – darunter auch solche wie Schultertuch oder Scheitelkäppchen, die nicht mehr sonderlich up to date waren und mit den Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils in die Klamotten- respektive Mottenkiste verbannt worden waren. Diese altmodischen Teile trugen höchstens einige Hardcore-Hardliner wie die Piusbruderschaft. Sollte Pater Cölestin insgeheim mit diesen Brüdern, die ihre Messe auf Latein lasen und sich an anachronistische Riten klammerten, sympathisieren? Ein mildes Lächeln kräuselte Pasquanos Lippen. Cölestin mochte ein Querkopf und Eigenbrötler sein, ein verknöcherter Reaktionär war er nicht.
Pasquano trat seinem Spiegelbild gegenüber. Vor ihm stand ein hochgewachsener, athletisch gebauter Mann in den besten Jahren, der ihn aus erdbraunen, von kleinen Fältchen umzingelten Augen ansah. Er konnte seinem Doppelgänger den Missmut von den mürrisch zusammengepressten Lippen ablesen. An Tagen wie diesen war er der Priesterrolle überdrüssig. Steckte er etwa in der Midlife-Crisis? Woran lag es, dass er seinen Elan verloren hatte? Dass er in der priesterlichen »Paradeuniform« nur das Requisit in einem Theaterstück erblickte? Alles hier war vergilbt, verblichen und verstaubt. Und es hatte schon bessere Zeiten gesehen. Pasquano brummte unwillig: »Alles geht vorüber, Freund – auch dieser Tag.« Er schlang das Zingulum, einen dünnen Strick, um seine etwas füllig gewordene Leibesmitte und knüpfte ihn mit geübten Handgriffen zusammen. Mit Knoten kannte er sich aus: Pal- oder Stopperstek, Achter- oder Kreuzknoten – er verlor sich in Gedanken an die bunt gestrichenen Fischerboote, das Azurblau des Meeres, an die glitzernde Gischt des Kielwassers, an die alte Heimat. Das war alles lange her. »Was vorbei ist, ist vorbei, verdammt!« Pasquano warf sich das mantelartige Messgewand, die Kasel, über. Auf dem scharlachroten Seidenstoff prangte das mit Goldfaden eingestickte Anagramm Jesu – IHS. Iota, Eta, Sigma. Griechische Buchstaben – ähnlich anachronistisch wie eine Bibellesung auf Latein. »Gloria in excelsis Deo!« Er musste unwillkürlich grinsen und linste aufs Zifferblatt seiner billigen Armbanduhr: halb sieben – Showtime! Zeit für die Messe.
Pasquano betrat den Chorraum durch den Hintereingang. Hastig beugte er sein Knie vor dem Tabernakel, der das Allerheiligste, den Kelch mit den konsekrierten Hostien, enthielt. Schwungvoll wandte er sich zum Publikum um. Wie erwartet war die Kirche so gut wie leer: drei ältere Damen, eine knochiger und spindeldürrer als die andere. Dazu der Bichler-Bauer, der seit Jahrzehnten getreulich den Mesnerdienst versah. Seine altersfleckigen, von der Gicht verkrüppelten Hände krallten sich ums Gebetbuch. Pasquano war in Gedanken noch immer am Meer, im Land seiner Vorväter. Er zählte bis drei, dann begann er mit der lateinischen Litanei: »In nomine Patris et Filii … Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio …« Vor leerem Haus trat keiner gerne auf – kein Operntenor, keine Primaballerina, kein Prediger des Wortes Gottes. Pasquano ließ sich nicht von den Papamobil-Shows und Messias-Meetings blenden. Jesus Christus war nicht mehr Teil des Mainstreams, er führte ein Nischendasein. Eine logische Konsequenz dieser Entwicklung war die Tendenz zur Sektiererei, zur Abgrenzung von der gottlosen, heidnischen und hedonistischen Welt. Die Kirche war tief gespalten, zwischen den Traditionalisten einerseits und den Erneuerern und Reformern andererseits. Es erschien ihm schon fast symptomatisch, dass tiefe Risse das Mauerwerk der alten Wallfahrtskirche durchzogen.
Die Zuhörerschaft schien nicht recht bei der Sache zu sein. Die grauhaarigen Betschwestern tuschelten und tratschten, der Bichler-Bauer schnäuzte geräuschvoll in sein Stofftaschentuch. Pasquano schlug die durch einen roten Bindfaden markierte Stelle in der Heiligen Schrift auf. Mit monotoner Stimme deklamierte er: »Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher.« Der Paulusbrief war das erste »Schriftstück« überhaupt, das Jesus beim Namen nannte. Der Apostel aus Tarsus propagierte darin die bevorstehende Wiederkunft Christi, die Parusie, um die versprengte Schar der Messiasgläubigen bei der Stange zu halten und den Nobody aus Nazareth in den Himmel zu loben: »Gott, unser Vater, und Jesus, unser Herr, mögen unsere Schritte zu euch lenken. Euch aber lasse der Herr wachsen und reich werden in der Liebe zueinander, damit euer Herz gefestigt wird und ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen kommt.« Pasquano war ein eloquenter Redner, der wie ein Flößer den Strom der Worte zu bändigen wusste: »Ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben müsst, um Gott zu gefallen, und ihr lebt auch so; werdet darin noch vollkommener! Das ist es, was Gott will: eure Heiligung.« Seine getragene Stimme hallte von den barocken Bögen und Gewölben wider: »Wenn Jesus – und das ist unser Glaube – gestorben und auferstanden ist, wird Gott auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen.«
Ein paar rhetorische Kniffe gehörten dazu, damit wenigstens der Rest der Belegschaft wach blieb. War doch der Bichler-Bauer inzwischen eingedöst – und schnarchte selig vor sich hin. Die Wirkung einer Predigt beruhte auf Modulationen und Kontrasten: hell und dunkel, Himmel und Hölle. Pasquano verstand es, auf der Klaviatur der Gefühle zu spielen, die Tonlage zu wechseln und über ein Thema mit Variationen zu improvisieren. Seine Stimme raspelte Süßholz: »Wir, die Lebenden, die noch übrig sind, wenn der Herr kommt, werden den Verstorbenen nichts voraushaben. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt.«
Die Vorstellung von einem Leben nach dem Tod hatte Donato schon als halbwüchsiger Bursche fasziniert. Das Meer in seiner scheinbaren Unendlichkeit war ihm wie ein Spiegel der unstillbaren Sehnsucht des Menschen nach Unsterblichkeit, nach dem ewigen Leben erschienen. Pasquano war in Gedanken weit, weit weg. Er hockte am Steuer seines Fischerboots und eine innere Kompassnadel wies ihm zielgenau den Weg zur Küste. Der Mensch musste seiner inneren Stimme folgen, nur so erreichte er den schützenden Hafen. In diesem Moment verstand er, weshalb Pater Cölestin hier oben ausharrte. Wie David kämpfte er gegen die Verlorenheit und Verlogenheit der Welt. Dies war sein Hafen, obwohl es hier nur wenig mehr gab als feuchte, von Rissen durchzogene Wände.
Jetzt noch die Kommunion – dann konnte er seine Klamotten an den Haken hängen und von hier verschwinden. Pasquano pressierte es. Um halb neun hatte er einen Tisch in der »Osteria Siciliana« bestellt. Eine Platte voll Antipasti, ein Teller Pasta con le sarde, eine gedünstete Seezunge und ein Töpfchen Tiramisu warteten auf ihn. Um die Gedanken an die lukullischen Genüsse zu vertreiben, richtete er den Blick nach oben. Die Baumeister des Barocks hatten die Gewölbe mit Stuck überzogen. Die weiß glänzenden Gips-Gebilde erinnerten ihn an die Gischt der Brandungswellen, die sich an den hochaufragenden Felsklippen brachen und gegen den azurblauen Himmel spritzten. Pasquano fühlte sich in seinem Element, die Worte strömten nur so aus ihm heraus: »Die Auferstehung des Herrn ist keine Rückkehr ins physische, rein menschliche Leben. Sondern zu einem neuen, übernatürlichen und …« In diesem Moment sprangen die Flügel der Eingangstür mit lautem Knall auf. Donato brach mitten im Satz ab. Seine Zuhörer schreckten aus ihrem Dämmerschlaf hoch.
Drei maskierte Männer stürmten in die Kirche und bellten ihre Befehle: »Niemand rührt sich!« – »Schluss mit dem Mummenschanz.« Pasquano hatte das Gefühl, in den falschen Film, in eine Kommandoaktion der Carabinieri geraten zu sein. Die Männer steckten in kaffeebraunen Mönchskutten und hatten schwarze Sturmhauben über ihre Köpfe gezogen. Zwei von ihnen trugen große Jutesäcke über der Schulter, der Anführer hielt ein Sturmgewehr in Händen. Das Trio erinnerte ihn entfernt an das Dreigestirn, das am Nikolaustag um die Häuser zog: der Nikolo mit Krampus und Knecht Ruprecht. Die Metallkappen der wuchtigen Springerstiefel schabten über die Marmorplatten. So als ob es sich um einen von langer Hand vorbereiteten Banküberfall handelte, postierten sich die Männer an strategischen Punkten. Ungläubig rieb sich Pasquano die Augen. Doch er litt nicht unter Halluzinationen, was er sah, war leider wahr. Der Anführer der Bande, dem er den Spitznamen »Don Nicolo« verpasste, fuchtelte mit seiner Knarre herum: »Wenn ihr Weihrauchschnüffler euch ruhig verhaltet und brav unsere Anordnungen befolgt, dann passiert keinem etwas!« Pasquano war ein Mann Gottes, dennoch kannte er sich mit den Dingern bestens aus. Sein Onkel Salvo war über Jahrzehnte hinweg der Waffenspezialist des örtlichen Mafia-Clans gewesen. Der Onkel hatte alles auf Lager gehabt: von der kleinen handlichen Pistole bis zum Präzisionsgewehr mit überlangem Lauf. Er war kein Fachmann wie Salvo, aber er vermutete, dass es sich um einen M4-Karabiner handelte. Eine automatische Waffe, mit der man einen Feuerstoß abgeben oder wie mit einer Maschinenpistole Dauerfeuer schießen konnte. Eine Waffe, die in den falschen Händen absolut tödlich war. Eine der alten Frauen stammelte furchtsam: »Jesus Maria, steh uns bei! Hilf uns in unserer Not.«
»Maul halten, deine Maria ist gerade anderweitig beschäftigt.« Der Mann mit dem Gewehr rief in barschem Befehlston: »Anatol, du durchsuchst diese Jammergestalten, nimm ihnen ihre Handys und Wertsachen ab – dann machst du draußen alle Fahrzeuge und Fahrräder platt. Und vergiss nicht, die Telefonleitung zu kappen, verstanden?« Der Kuttenträger nickte stumm. Er packte eine der vor Angst schlotternden Alten rabiat am Arm, zerrte sie auf den Gang und versetzte ihr unvermittelt einen Schlag in die Magengegend. Die Greisin klappte zusammen und wimmerte vor Schmerzen: »Heilige Jungfrau … bist voll der Gnaden … rein und schön …« Ungerührt machte sich der Rohling an die »Leibesvisitation«. Donato Pasquano schluckte; das war kein böser Traum, das war blutige Realität.
In selbstgefälliger Pose verschränkte der Bandenchef die Hände vor der Brust: »Na, wie wär’s mit einem Hosanna in der Höhe? Hat es euch die Sprache verschlagen?« Kein Ton, nur das leise Wimmern der sich am Boden krümmenden Alten war zu hören. In Feldherrenpose stolzierte der Boss des Räuber-Trios breitbeinig in der Kirche herum und begutachtete mit abschätzigem Blick eine der geschnitzten Holzfiguren: »Kolja, schau dir das an, das alte Zeug setzt hier nur Staub an. Pack alles ein, was sich am Antiquitätenmarkt versilbern lässt. Die Kelche, Kerzenleuchter, Kruzifixe und Monstranzen. Der da …«, dabei deutete der Mann mit ausgestrecktem Zeigefinger auf Pasquano, »… wird uns zeigen, wo er seine Schätze hortet.« Sein Spießgeselle krächzte mit fremdländischem Akzent: »Ich polier dem Fettsack die Fresse, dann rückt er den Schlüssel zur Schatztruhe schon raus, Bruder Boris.«
Der »Bruder« brach in ein rohes, meckerndes Gelächter aus. »Aber Kolja, wir sind doch keine gemeinen Strauchdiebe! Wir halten es wie Robin Hood! Wir nehmen den Reichen und geben den Armen. Unser Bruder Tuck hier wird uns bei der Umverteilung behilflich sein.« In seiner Stimme schwang ein drohender Unterton mit. »Diese selbstgerechten Schweinesäcke helfen ja sonst nur diesen verlausten Schmarotzern, holen diese Drecksflüchtlinge in unser Land und gewähren der Bimbo-Brut auch noch Asyl! Und was tut dieser Scheißstaat? Er zahlt auch noch für diese verkommenen Römlinge. Das muss aufhören.« Wie ein Agitator, der seinen Auftritt mit seinem Rhetoriktrainer einstudiert hat, erhob er seine Stimme: »Bald ist Schluss mit lustig. Das Jüngste Gericht wird kommen – aber nicht euer Jesus, sondern wir werden den Vorsitz führen.« Kolja näherte sich ihm mit einem grimmigen Grinsen und ließ ein Klappmesser aufspringen – doch sein Chef gebot ihm Einhalt: »Lass gut sein, Kolja, du räumst die Kirche aus und ich schnapp mir die Kanaille!« Der Mann verzog seinen Mund zu einer boshaften Grimasse, sodass er aussah wie ein greinendes Kind, dem der Papa untersagt hatte, das Fell seines Angorakaninchens abzuziehen.
Pasquano stand hinter dem Ambo, einer steinernen Stele rechts vorm Hochaltar. Er war wie gelähmt, war unfähig zu sprechen, sich zu bewegen oder sich gar zur Wehr zu setzen. Er erwachte erst aus seiner Starre, als der Anführer der Räuberbande das Gewehr hob und einen Feuerstoß auf einen der Seitenaltäre abgab, sodass der gläserne Sarkophag, der die schwarz verfärbten Gebeine eines unbekannten Märtyrers in sich barg, zersplitterte. Seine Brust füllte sich mit dem Mut und der Wut eines Mannes, der zu allem entschlossen war. Diese Kirche war ihm anvertraut worden und er musste dem Wüten dieser Vandalen Einhalt gebieten. Aus den Augenwinkeln sah er, wie einer dieser Unholde den Reliquienschrein plünderte, Edelsteine und silberne Schmuckstücke in dem mitgebrachten Sack verschwinden ließ. Er musste diesem Teufelsspuk ein Ende setzen: »Raus hier, ihr Gottlosen! Verdammt sollt ihr sein, die ihr das Haus Gottes besudelt und entweiht.« Er trat hinter dem Ambo hervor und ging auf den Anführer zu. Boris richtete die Mündung seines Gewehrs auf ihn: »Halt, keinen Schritt weiter! Oder du hörst die Engel rückwärts singen!« Pasquano blickte in zwei schiefergraue Augen, die ihn lauernd anstarrten: »Soll ich dich zum Märtyrer befördern? Nein, keine Angst, Priesterlein, den Gefallen tun wir dir feigen Sau nicht.« Mit einem höhnischen Gelächter ließ er die Waffe sinken.
Pasquano schoss die Zornesröte ins Gesicht. »Du verkommene Missgeburt Satans. Der Teufel soll dich holen …« Mit angriffslustig gesenktem Kopf stürmte er auf den Eindringling zu. Wie er es von Onkel Salvo gelernt hatte, vollführte er eine pirouettenartige Drehung, um seinen Gegner zu täuschen und mit einem gezielten Handkantenschlag gegen den Hals außer Gefecht zu setzen. Doch Gott war nicht mit seinem Diener. Boris schien sein Manöver vorausgeahnt zu haben. Ein gezacktes Kampfmesser glitt in seine Hand und er stieß, ohne zu zögern, zu. Die Klinge durchdrang das schwere Brokatgewebe und bohrte sich tief ins Fleisch des Priesters. Pasquano meinte zu hören, wie der Stahl an einer Rippe entlangschrammte und sein Rippenfell in Fetzen riss. Dann taumelte er rückwärts, seine Augen seltsam verdreht. Wie eine vom Blitz getroffene Korkeiche kippte Pasquano langsam zur Seite und fiel der Länge nach hin. Ehe ihn eine gnädige Schwärze umfing, hörte er die seltsam entstellt klingende Stimme des Mannes zetern: »Hat dein Jesus nicht die andere Wange hingehalten, hm? Und du elender Schweinehund willst mir ans Leder, was?« Da verwandelte sich die Schwärze um ihn in ein sattes, purpurnes Blau, blauer noch als der Himmel im sizilianischen Herbst.