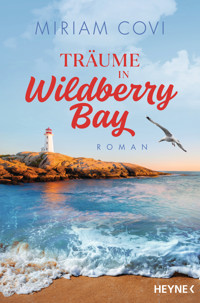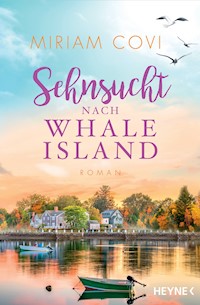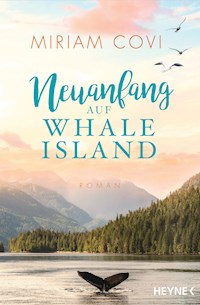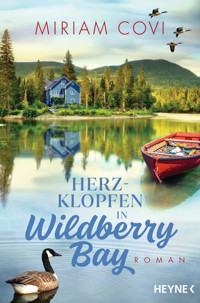
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wildberry-Bay-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Wo die Wildgänse fliegen, wartet dein Glück
Zwanzig Jahre nach dem traumatischen Verlust ihrer Mutter bei einem Flugzeugunglück an der kanadischen Ostküste kehrt Helena Stern zum ersten Mal an die Absturzstelle zurück. Ausgerechnet in der Nähe eines Gedenksteins am Rande des malerischen Fischerdorfs Wildberry Bay stürzt sie bei einem Unwetter in die stürmische See und wird von einem Fremden gerettet. Zwischen Helena und Luke prickelt es sofort. Doch dann finden sie heraus, dass sie sich schon viel länger kennen, als ihnen klar war. Trotzdem begreift Helena nicht, warum Luke sich ihr gegenüber plötzlich so merkwürdig verhält. Sie ahnt nicht, dass er ein Geheimnis hütet, das ihre Gefühle für ihn schon bald zunichtemachen könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 661
Ähnliche
Das Buch
»›Ich liebe das Lied‹, sagt Luke, und ich greife einfach nach seiner Hand und ziehe ihn mit mir, ohne ihn groß protestieren zu lassen. Mit geschlossenen Augen beginne ich, mich im Takt der Musik zu bewegen. Luke fühlt sich nach Zuhause an, nach Geborgenheit, nach einem sicheren Hafen. Er riecht so gut, und seine Hände liegen warm und beruhigend auf meinem Rücken, geben mir den Halt, den ich so sehr brauche.
Ich hebe den Kopf und sehe zu ihm hoch. Luke erwidert meinen Blick, lässt ihn flüchtig zu meinem Mund wandern, sieht mir dann wieder in die Augen.
Ich habe mich noch nie so spontan so wohl mit einem Mann gefühlt wie mit Luke. Außer damals, vor zwanzig Jahren, mit dem Jungen mit den kurz geschorenen Haaren und den traurigen Augen. Am Pebble Beach in Wildberry Bay.
Und ehe ich begreife, was ich da tue, recke ich meinen Kopf ein wenig höher, während ich Lukes Blick entschlossen festhalte – und küsse ihn.«
Die Autorin
Miriam Covi wurde 1979 in Gütersloh geboren und entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für zwei Dinge: Schreiben und Reisen. Ihre Tätigkeit als Fremdsprachenassistentin führte sie 2005 nach New York. Von den USA aus ging es für die Autorin und ihren Mann zunächst nach Berlin und Rom, wo ihre beiden Töchter geboren wurden. Nach vier Jahren in Bangkok lebt die Familie nun in Brandenburg. Zur zweiten Heimat wurde für Miriam Covi allerdings die kanadische Ostküstenprovinz Nova Scotia, in der sie viele Sommer ihrer Kindheit und Jugend verbringen durfte und wo sie heute auch immer wieder Inspiration für neue Romane findet.
Lieferbare Titel
978-3-453-42213-1 – Sommer in Atlantikblau
978-3-453-42271-1 – Sommer unter Sternen
978-3-453-42375-6 – Träume in Meeresgrün
978-3-453-42374-9 – Sehnsucht in Aquamarin
978-3-453-42569-9 – Heimkehr nach Whale Island
978-3-453-42570-5 – Neuanfang auf Whale Island
978-3-453-42571-2 – Sehnsucht nach Whale Island
978-3-453-42825-6 – Träume in Wildberry Bay
Miriam Covi
HERZKLOPFEN IN
Roman
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe 06/2024
© 2024 by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Diana Mantel
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München,unter Verwendung von © Huber Images (Pietro Canali),FinePic®, München
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-30640-3V001
www.heyne.de
Wir können nicht entscheiden,wie und wann wir sterben,aber wir können entscheiden,wie wir gelebt haben.
Joan Baez
In Gedenken an Swissair-Flug 111
Wer ist wer in Wildberry Bay
Helena Stern
Lukas »Luke« Cabot
& sein Bruder Blake Cabot
Florentine Schiller
Eltern Regina & Bernd Schiller
Brüder Raven & Jay Leblanc
Eltern Fern & Steve Leblanc
Neil McIntosh
Schwester Zoe McIntosh & ihr Sohn Elliott
Vater Jimm McIntosh, Pfarrer & Betreiber
des Blue Gables Bed & Breakfast
Eliza Baker, Besitzerin des Bayview Diners
& ihr Bruder Carl Baker
Gwendolyn Hobbs, geb. Walker
Eltern Debbie & Bob Walker
Noah Miller, Yogalehrer & Ferns Freund
Wildberry Bay WhatsApp-Gruppe
Samstag, 14. Juli 2018
Leanne Smith:Okay, ich hatte mich beschwert, dass es in letzter Zeit zu heiß und trocken war, aber so viel Regen muss jetzt auch nicht auf einmal runterkommen!
Rachel Sullivan:Du sagst es. Passt bloß in der Kurve hinter dem Bayview Diner auf – ich sage nur: Aquaplaning!
Thomas Hugh:Macht es wie ich: Fahrt nicht am Bayview Diner vorbei, sondern kommt rein und leistet mir Gesellschaft. Bei diesem Wetter schmeckt Elizas Fish Chowder besonders gut
Rachel Sullivan:Du hast recht, @ThomasHugh. Ich verstaue nur kurz meine Tiefkühlsachen, dann bin ich gleich da. Bitte hebt eine große Portion Suppe für mich auf, @ZoeMcIntosh!
Zoe McIntosh:Wird gemacht
1
Helena
Regen trommelt gleichmäßig gegen die Bullaugen meiner Schiffskabine und hüllt mich ein wie ein Schlaflied. An dieses Geräusch und an das sanfte Schaukeln der Queen Mary 2 könnte ich mich wirklich gewöhnen, denke ich im Halbschlaf und räkele mich unter der Bettdecke. Zum Glück habe ich keine Probleme mit Seekrankheit, und so wirkt das leichte Heben und Senken der Wellen beruhigend auf mich und nicht unangenehm.
Wobei ich dieses Schaukeln in den letzten Tagen, an Bord des majestätischen Ozeanriesen, bei der Atlantiküberquerung vom britischen Southampton nach New York und dann bei der Weiterfahrt an die kanadische Ostküste gar nicht so deutlich wahrgenommen habe. Merkwürdig. Schläfrig blinzele ich, doch anstatt auf die mir inzwischen vertraut gewordene cremefarbene Sitzgruppe meiner Kabine starre ich auf einen hölzernen Einbauschrank, der mir überhaupt nicht vertraut ist. Ratlos bewege ich mich unter der Bettdecke – kein fluffiges Federbett wie in den letzten Tagen, sondern dem Gewicht nach zu urteilen eine schwere Steppdecke – und stoße dabei meinen Knöchel an einer Wand an. Wo zum Teufel kommt diese Wand denn her, so dicht neben meinem Bett?
Ein unangenehmer Schmerz durchzuckt meinen Fuß. Und eben dieser Schmerz bringt die Erinnerung schlagartig zurück. Die Bilder stürzen regelrecht auf mich ein – dunkles Wasser will mich verschlingen, die starke Strömung zerrt erbarmungslos an mir, ich komme nicht gegen sie an … Erschrocken reiße ich meine Augen auf, bin mit einem Mal hellwach.
Oh, verdammt. Jetzt fühlt sich das Schaukeln nicht mehr beruhigend an – denn es gehört überhaupt nicht zur Queen Mary 2! Nein, ich bin leider ziemlich weit entfernt von meiner Kabine auf dem Ozeanriesen im Hafen von Halifax.
Suchend sehe ich mich weiter um und entdecke über meinem Kopf ein Regal, auf dem mehrere Bücher stehen und aufeinandergestapelt liegen und … aha, ein Wecker! Rasch greife ich danach und starre auf die Digitalanzeige.
Das kann nicht sein. Das darf einfach nicht sein. Ungläubig reiße ich meine Augen auf. 19:50 Uhr.
Um 20 Uhr legt die Queen Mary ab.
Panik beginnt, durch meinen Körper zu pulsieren.
Vielleicht geht dieser Wecker falsch? Ja, das wird es sein. Das MUSS es sein! Ich werfe ihn auf die Matratze und springe aus dem Bett, wobei ich meinen schmerzenden Knöchel ignoriere und auch nicht weiter darüber nachdenke, warum ich fremde Klamotten trage – schwarze Jogginghosen und einen kratzigen Wollpullover über einem schlabberigen T-Shirt. Durch das leichte Schaukeln des Bootes gerate ich flüchtig ins Straucheln, fange mich jedoch rasch und eile auf die Kajütentür zu. Ich stoße sie auf und stolpere aus dem Bug des Bootes, wo sich das Schlafzimmer befindet, in den kleinen Durchgangsraum dahinter. Vor mir führt eine steile Treppe nach oben, und ich haste die wenigen Stufen hinauf, in den Wohnbereich des Boots. Hektisch lasse ich meinen Blick über eine Sitzecke mit hölzerner Eckbank und einem am Boden festgeschraubten Tisch fliegen, über eine winzige Küchenzeile, ein paar Einbauregale … bis er an einem Mann hängen bleibt.
Luke Cabot. Die Bilder vom Strand rasen augenblicklich durch meinen Kopf – wie er sich über mich beugt, mich besorgt ansieht, als ich keuchend im kalten Sand liege, erschöpft von meinem Kampf gegen die Strömung.
Der Mann, der mich gerettet hat, sitzt in einem faltbaren Regiestuhl vor einem schwarzen Ofen, durch dessen Scheibe ich ein Feuer erkennen kann, und hat seine Füße auf einer alten Holzkiste neben einem Gegenstand abgelegt, der sehr nach einem zerkauten Hundespielzeug aussieht. Von einem Hund ist allerdings nichts zu sehen.
Ganz flüchtig überkommt mich ein wehmütiges Gefühl – diese Szene, wie Luke da vor dem Ofen sitzt, erweckt eine nagende Sehnsucht in mir. Eine Sehnsucht nach Geborgenheit und Zuhause.
Luke hat das Buch, in dem er offenbar gelesen hat, sinken gelassen und sieht mich alarmiert an.
»Helena«, sagt er, und ich versuche, nicht näher darüber nachzudenken, wie er meinen Namen ausspricht. Vergeblich. Er spricht ihn aus, als würde er die erste Zeile eines Gedichts wiedergeben. Die Silben rollen weich und melodisch und dunkel über seine Lippen, und ich muss mich räuspern, um bei der Sache zu bleiben. Luke hat sich aus seinem Stuhl erhoben und mustert mich besorgt. »Geht es dir gut? Was …?«
»Nein, mir geht es nicht gut«, unterbreche ich ihn hektisch, bevor ich noch mehr darüber nachdenken kann, wie sehr mir seine dunkle Stimme gefällt. Genau wie das Kapuzensweatshirt, an das ich mich von vorhin erinnern kann, und die verwaschenen Jeans, die auf Kniehöhe abgeschnitten sind und daher einen ausgefransten Saum haben. Seine Beine sind braun gebrannt, und er ist barfuß, mit einem schmalen gewebten Bändchen um ein Fußgelenk. Seine Locken, die nicht mehr nass sind, glänzen im Schein der altmodischen Schiffsleuchte aus Chrom nussbraun.
»Was ist los?«, fragt er jetzt und macht ein paar Schritte auf mich zu, als ich schon schnell hervorstoße: »Wie spät ist es?«
Bevor er langsam sein Handgelenk mit der Armbanduhr hebt, sieht er mich noch zwei Herzschläge lang ernst aus diesen schokoladenbraunen Augen an, an die ich mich so gut erinnern kann.
Vorhin, am Strand, als ich im nassen Sand lag und versucht habe, zu verarbeiten, dass ich fast gestorben wäre, haben eben diese Augen so voller Sorge auf mich herabgestarrt.
»Es ist … kurz vor 20 Uhr«, sagt Luke jetzt und bringt meine Welt damit zum Einsturz.
2
Ungefähr drei Stunden vorher
Ich hätte nicht gedacht, dass es nach all dieser Zeit so schwer sein würde, an der Gedenkstätte zu stehen. Dass meine Emotionen so heftig ausfallen würden. Zwanzig Jahre ist es nun her, seit das Flugzeug ins Meer gestürzt ist, und seitdem ist so viel passiert. Ich war vierzehn, als es geschehen ist, nun bin ich vierunddreißig – aber als ich jetzt, im Regen, auf die Gedenktafeln aus grauem Stein starre, fühle ich mich wieder wie der Teenager von damals: verzweifelt und unfassbar traurig.
Der kühle Wind zerrt heftig an meinem Haar, lässt die offenen Strähnen durcheinanderwirbeln – nichts erinnert heute daran, dass wir eigentlich Hochsommerwetter haben müssten. Die dramatischen Wolkenberge am Himmel passen zu meiner Stimmung. Ich blinzele ein paar Tränen fort, während ich auf die eingravierten Worte starre:
In memory of the 229 men, women and children
Aboard Swissair Flight 111
Who perished off these shores
September 2, 1998
They have been joined to the Sea and the Sky
May they rest in peace
Dann gleitet mein Blick über die Reihen aus eingravierten Namen. Meine Finger krampfen sich um das helle Leder meiner Handtasche, während ich atemlos nach ihrem Namen suche.
Als ich ihn finde, beiße ich mir so heftig auf meine Unterlippe, dass ich Blut schmecke.
Lydia Stern.
Das war sie. Meine Mama. Sie war einer der 229 Menschen an Bord von Swissair-Flug 111. Ein heiseres Schluchzen ringt sich aus meiner Kehle, und ich wische mir mit dem Handrücken unter meinen Augen entlang. Rasch sehe ich mich um, weil mir plötzlich die Frau einfällt, die mich vorhin, in Peggy’s Cove, beobachtet hat. Dort, an der zweiten Gedenkstätte für den Flugzeugabsturz, war ich heute zuerst. Und ich war nicht ganz allein dort, denn plötzlich ist diese andere Deutsche neben mir aufgetaucht. Ich kann gar nicht sagen, woher ich gewusst habe, dass sie aus Deutschland kam – es war wohl ein Bauchgefühl.
Und ich hatte recht, denn sie sprach auf Deutsch mit mir. Ich dachte erst, sie hätte ebenfalls jemanden beim Flugzeugabsturz verloren, hoffte schon auf jemanden, der verstand, was ich fühlte, auf eine Art Verbündete.
Nein, wie sich herausstellte, hatte die Fremde keine Angehörigen an Bord gehabt, und trotzdem war sie in gewisser Weise mit dem Unglück verbunden: Sie war damals hier gewesen, vor Ort, als die Swissair-Maschine in jener Septembernacht vor zwanzig Jahren zwischen den Orten Peggy’s Cove und Wildberry Bay ins Meer gestürzt war, und diese Tatsache hat mich regelrecht überwältigt. Sie war hier gewesen, als meine Mutter, gemeinsam mit den anderen Menschen an Bord, über Wildberry Bay hinweggeflogen war und ihre letzte Ruhestätte im dunklen Atlantik gefunden hatte.
Ich war nicht hier gewesen. Ich hatte in meinem gemütlichen Bett zu Hause in Zürich so tief und fest geschlafen, wie ich in den kommenden Wochen nicht mehr schlafen würde. In jener Nacht konnte ich noch nicht ahnen, dass an der Ostküste Kanadas meine Mutter ums Leben gekommen war.
Aber diese fremde Deutsche, die sich als Florentine vorgestellt hat, sie war hier gewesen. Sie hatte den Absturz mitbekommen.
Diese Vorstellung beschäftigt mich noch immer, als ich meine Fingerkuppen sacht über den eingravierten Namen meiner Mutter gleiten lasse, an dieser menschenleeren und recht abgelegenen Gedenkstätte, wo ich nur das Wispern des Windes in den Baumwipfeln über mir und das entfernte Rauschen der Brandung höre. Diese Gedenkstätte ist mir so viel lieber als die andere, in der Nähe des berühmten Leuchtturms von Peggy’s Cove, denn dort waren heute für meinen Geschmack viel zu viele Touristen unterwegs. Die Begegnung mit dieser Florentine fand ich zwar sehr nett, weil sie mir auf Anhieb sympathisch war, aber all die anderen neugierigen Blicke der Urlauber, die Fotos des Denkmals machten, als wäre es nur eine weitere Touristenattraktion, haben mich gestört. Hier ist alles intimer und ruhiger, und ich wünsche mir, das Wetter ließe es zu, mich auf den Rasen, an den Rand des durch Pfosten und Ketten rund abgegrenzten Areals zu setzen, wo unter den sattgrünen Grashalmen sterbliche Überreste der Flugzeuginsassen beerdigt sind. Vielleicht auch Mamas.
Ich habe das als Teenager nicht wirklich verstanden – nicht verstehen wollen. Warum dieses Massengrab? Warum konnten wir meine Mutter nicht in Zürich beerdigen?
Heute weiß ich, wie es ist, wenn ein Passagierflugzeug ungebremst auf einer Wasseroberfläche aufschlägt. Ich habe inzwischen begriffen, was das mit den Körpern der Menschen an Bord gemacht hat. Und dass es nicht immer möglich war, die aus dem Salzwasser geborgenen Überreste einem Fluggast von der Passagierliste zuzuordnen. Doch obwohl ich heute zum ersten Mal an dieser Gedenkstätte bin, zum ersten Mal den Ort sehe, wo meine Mutter möglicherweise beerdigt wurde, kann ich nicht länger bleiben. Das Wetter wird immer schlimmer statt besser, und ich muss zurück zu meinem Schiff. Schweren Herzens lege ich den Strauß leuchtend gelber Sonnenblumen – Mamas Lieblingsblumen – an den Rand der Rasenfläche und wende mich schließlich ab, um über den Fußweg zu meinem Mietwagen zurückzukehren. Als ich immer wieder über Wurzeln und glitschige Steine stolpere, verfluche ich mein heutiges Outfit, das überhaupt nicht an die raue kanadische Atlantikküste passt. Was habe ich mir bloß dabei gedacht, diese Pumps anzuziehen? Und meine teure Designerhandtasche mitzunehmen, obwohl Regen angekündigt war? Außerdem wäre der Anorak mit Kapuze, den ich mir extra für meine Reise gekauft habe, sehr viel praktischer gewesen als dieser knallrote Trenchcoat von Burberry. Wen interessieren hier schon irgendwelche Marken?
Das Donnern der Brandung wird über den Wind zu mir getragen, während ich auf dem kleinen Parkplatz der Gedenkstätte in meinen Mietwagen steige und durch die Regenschlieren auf der Windschutzscheibe in die Richtung starre, wo sich der Atlantik schemenhaft zwischen den Bäumen abzeichnet. Dann fasse ich einen Entschluss.
Ich lenke den Wagen nicht sofort zurück Richtung Highway, der mich nach Halifax und auf mein Schiff bringen würde, sondern mache noch einen Abstecher zu dem Strand, der sich ganz in der Nähe der Gedenkstätte erstreckt. Selbst an einem grauen Tag wie diesem hat der Pine Tree Beach seinen Reiz, denke ich, als ich auf dem Seitenstreifen der Küstenstraße halte und über das wogende Dünengras hinweg auf den Sand und das tosende Meer dahinter starre. Wie schön es hier wohl an einem sonnigen Tag ist? Ganz kurz erlaube ich mir die Vorstellung, wie es wäre, in so einem kleinen Ort am Meer zu leben. Womöglich sogar fußläufig zum Strand, sodass man morgens vor der Arbeit dort joggen gehen könnte. Mit einem Hund. Ja, ein Hund würde gut zu so einem Leben passen.
Doch ich lebe nicht am Meer. Nein, mein Leben spielt sich völlig ohne Hund und Strand in Frankfurt am Main ab und ganz sicher nicht in diesem Ort am Atlantik, wo meine Mutter ihre letzte Ruhestätte gefunden hat. Am Main kann man auch gut joggen gehen.
Und dennoch zieht mich dieser Strand fast magisch an. Der Regen peitscht mir ins Gesicht, während ich aus dem Auto steige und die wütenden Wellen beobachte, die gischtgekrönt an die Küste rollen. Ich will nur kurz hinaus zu den Felsen gehen, die sich rechts von mir, wo der Sandstreifen immer schmaler wird, wie ein Gürtel weiter an der Küste entlangziehen. Ja, ich werde auf diese Felsen steigen und dem Atlantik ein paar kostbare Minuten lang ganz nah sein.
Mama ganz nah sein.
Aus purer Gewohnheit schließe ich den Wagen mit der Fernbedienung am Schlüsselbund ab – wer sollte hier, an diesem menschenleeren Strand, mein Auto stehlen? –, während ich schon den Trampelpfad einschlage, der mich am Rande des Strandes entlangführt. Mit den Absätzen meiner Pumps bleibe ich immer wieder im nassen Dünengras hängen, bis es mir reicht und ich die Schuhe einfach ausziehe. Nass sind meine dünnen Seidenstrümpfe sowieso schon, also kann ich auch so weiterlaufen, über den matschigen Untergrund, bis ich die Felsen erreiche. Ich lasse die Schuhe zu Boden fallen und steige auf den ersten Stein. Er ist glitschig vom Regen, und ich rudere leicht mit den Armen, um bloß nicht den Halt zu verlieren.
Plötzlich muss ich an die Bitte dieser Florentine denken, vorhin, in Peggy’s Cove: Dass ich keinen Blödsinn machen soll. Sie hat erwähnt, dass die Angehörigen der Opfer direkt nach dem Absturz ihren Liebsten ganz nah sein wollten.
Ich habe sofort verstanden, was sie gemeint hat. Natürlich habe auch ich in den letzten zwei Jahrzehnten viel über die Tage und Wochen nach diesem Unglück gelesen, als Polizisten in Peggy’s Cove aufpassen mussten, dass sich niemand von den berühmten Felsen ins Meer stürzte.
Nein, so etwas werde ich nicht tun. Immerhin sind zwanzig Jahre vergangen, seit meine Mutter hier ums Leben gekommen ist. Und selbst wenn ich mich in den letzten Monaten, seit Papas Tod, so einsam gefühlt habe wie noch nie zuvor, bin ich doch … zufrieden mit meinem Leben. Ich habe meine Karriere als Juristin, die mich voll und ganz ausfüllt. Diese Arbeit passt so gut zu mir, denn ich bin seit meiner Kindheit mit ihr vertraut. Mein Vater war Jurist, ein besonders guter. Es war ein Selbstläufer, dass ich in seine Fußstapfen getreten bin.
Wie immer verbiete ich mir den Gedanken, dass ich mich beruflich sehr wahrscheinlich in eine andere Richtung entwickelt hätte, wenn meine Mutter noch bei uns gewesen wäre, als ich mein Abitur gemacht habe. Es bringt nichts, darüber nachzudenken, was hätte sein können. Ich bin eine hervorragende Juristin geworden, und meine Karriere macht mich glücklich.
Ehe ich begreife, was passiert, schlägt plötzlich eine Welle an den Felsen hoch, die viel höher ist als die zuvor. Erschrocken versuche ich noch, einen Schritt rückwärts zu machen, doch auf dem glitschigen Felsen verliere ich den Halt – und das Wasser tut sein Übriges. Mit einer Wucht, die mich entsetzt aufschreien lässt, werde ich von der Welle getroffen, spüre, wie sie meine Füße vom Felsen fortreißt, mich taumeln und wanken lässt, bis ich falle … hinab, in den kalten Ozean.
3
Ich kann gerade noch einen Schrei ausstoßen, einen Schrei, den niemand an dieser menschenleeren Küste hören wird, dann tauche ich auch schon in eiskaltes dunkles Wasser ein, stoße mit meinem Fußknöchel an einen der scharfkantigen Felsen, werde von der wütenden Brandung umhergewirbelt und weiter nach unten gedrückt wie ein Spielzeug. Panisch kämpfe ich mich gegen die Kraft der Wellen wieder nach oben, gelange an die Oberfläche, ringe nach Luft und versuche, mich zu orientieren – doch die nächste Welle schlägt bereits unbarmherzig über mir zusammen und drückt mich erneut unter Wasser. Wieder schaffe ich es aufzutauchen, und diesmal erkenne ich durch den peitschenden Regen und das schäumende Salzwasser zu meinem Entsetzen, dass ich immer weiter von der Küste abgetrieben werde. Gerade eben waren die Felsen noch zum Greifen nah – zum Fußanschlagen nah –, und plötzlich finde ich mich außerhalb ihrer Reichweite, im offenen Wasser wieder. So sehr ich auch versuche, auf das rettende Ufer zuzuschwimmen, so spüre ich doch, dass mich der Sog der Brandung mit beängstigender Kraft immer weiter auf den Atlantik hinauszieht, bevor die nächste Welle mich erneut unbarmherzig unter Wasser drückt. Hektisch kämpfe ich mich zurück an die Oberfläche, sehe mich verzweifelt nach dem rettenden Ufer um, doch wegen des hohen Wellengangs kann ich nichts erkennen. Angst packt mein Herz und schnürt es zusammen, während die eisige Kälte des Wassers meine Gliedmaßen zu lähmen beginnt, meinen Kampf gegen die Brandung immer brutaler werden lässt.
Immer aussichtsloser.
Und dann dringt ein Gedanke mit erschreckender Klarheit in mein Bewusstsein: Das ist es. Mein Ende.
Wer hätte gedacht, dass ich ausgerechnet hier, im stürmischen Atlantik, nahe der Stelle, wo Mama ums Leben gekommen ist, sterben werde? Was wird man auf der Queen Mary 2 tun, wenn ich nicht vor Auslaufen heute Abend in meine Kabine zurückkehren werde? Was wird man in Frankfurt sagen, wenn ich in einer Woche nicht wieder ins Büro komme?
Wird man mich vermissen? Mich, als Menschen? Oder nur die brillante Juristin?
Noch während diese Gedanken wirr durch mein Gehirn wabern, höre ich erschöpft auf zu kämpfen. Ich kann nicht mehr weitermachen. Es macht keinen Sinn, wie eine Irre zu versuchen, gegen die Strömung anzuschwimmen, denn sie ist zu stark. Das Wasser ist zu kalt, der Sturm zu heftig, der Regen zu dicht. Das Meer nimmt mir jede Entscheidungsfreiheit, und irgendwann kann ich mich nicht länger wehren. Keuchend lasse ich mich auf den Rücken gleiten, werde von den Wellen auf und ab gehoben, spüre den Regen auf mein Gesicht prasseln, schließe meine Augen.
Hoffentlich geht es schnell.
Im nächsten Moment packt mich jemand von hinten. Erschrocken reiße ich meine Augen wieder auf und stoße einen Schrei aus.
»Ganz ruhig«, höre ich eine dunkle Männerstimme hinter mir keuchen und versuche zu erkennen, wer das ist, doch da legt sich schon eine kräftige Hand unter mein Kinn, sodass ich mich nicht mehr umschauen kann. Und schon werde ich rücklings durch das tobende Wasser gezogen. Ich will fragen, wie der Fremde mich gesehen hat, will sagen, dass es keinen Sinn macht, weil die Strömung zu stark ist. Doch als ich den Mund öffne, schwappt Salzwasser hinein, und so spucke und huste ich nur und merke, wie mein fremder Retter den Griff seiner Hand verstärkt, während er unbeirrt weiterschwimmt. Ich spüre die gleichmäßigen, kräftigen Schwimmstöße seiner Beine unter meinem Körper, als er mich entschlossen mit sich zieht. Ungläubig schnappe ich nach Luft und starre in den bleigrauen Himmel hinauf, während neue Hoffnung beginnt, wild durch meinen Körper zu pulsieren. Nein, heute werde ich noch nicht sterben! Plötzlich werde ich von neuer Kraft gepackt, und ich versuche, mit meinen Beinen mitzuhelfen, selbst Schwimmbewegungen zu machen, damit wir schneller das rettende Ufer erreichen.
»Ganz ruhig«, höre ich die Männerstimme erneut atemlos hervorstoßen, und dann erkenne ich aus den Augenwinkeln, dass wir uns dem Strand nähern. Der Fremde schwimmt mit mir fast parallel zur Küste, wird mir klar, und dennoch halten wir auf das rettende Land zu. Und dann steht er mit einem Mal auf und watet weiter – er hat tatsächlich Boden unter den Füßen! Ehe ich mich selbst aufrappeln kann, spüre ich seine Hände unter meinen Achseln, und ich werde rückwärts auf den Strand geschleift und schließlich vorsichtig auf dem nassen Sand abgelegt.
Ein Gesicht schiebt sich in mein Blickfeld. Ein Mann schaut besorgt auf mich herab – dunkelbraune Augen, dunkle Locken, die ihm nass am Kopf kleben, ein kurzer Bart. Seine Brauen ziehen sich zusammen, als er mich eingehend mustert.
»Geht es dir gut? Bist du verletzt?«
Mein Brustkorb hebt und senkt sich heftig. Erst nicke ich, dann schüttele ich den Kopf und stoße schließlich atemlos hervor: »Nicht … verletzt. Mir … geht es gut.«
»Wie heißt du?«, fragt der Fremde, und ich starre ein paar Sekunden lang in seine dunklen Augen, bevor ich die Kraft finde, leise zu wispern: »Helena. Helena Stern.«
»Hi, Helena Stern. Ich bin Luke Cabot. Sag mir bitte, was passiert ist. Hast du viel Wasser geschluckt? Warst du unter Wasser? Ich überlege, ob ich den Rettungswagen rufen soll, oder …«
»Nein!«, sage ich schwach und hebe meinen Kopf ein wenig, um diesen Luke Cabot anzusehen. »Bitte, keinen Rettungswagen. Mir geht es … gut. Ich bin ins Wasser gefallen, und … die Strömung war zu stark. Ich hab es nicht geschafft, dagegen anzuschwimmen.«
»Man kann nicht dagegen an schwimmen, man muss … Ach, ist jetzt egal«, murmelt Luke Cabot und mustert mich immer noch so intensiv, dass ich verlegen seinem Blick ausweiche. Mit einem Seufzer fährt er sich durch sein nasses Haar und holt tief Luft. Ich will ihm danken, weil er mich gerettet hat, aber als ich ihn wieder ansehe, fällt sein Blick auf meinen Fuß, und seine Brauen ziehen sich zusammen. Erst jetzt merke auch ich, dass ich dort blute.
Der Fremde wendet sich meinem Fuß zu, und ich presse meine Lippen zusammen, um nicht aufzustöhnen, als er den Knöchel abtastet. Auf keinen Fall will ich in irgendeine Notaufnahme mit endlosen Wartezeiten gebracht werden – ich muss doch zurück zum Hafen!
Mit einem Mal bin ich wieder mitten in meinem durchgeplanten Leben. Unfassbar, dass ich im Wasser eben tatsächlich bereit gewesen bin, einfach aufzuhören zu kämpfen … was um alles in der Welt ist da draußen im Meer in mich gefahren? Natürlich wird niemand an Bord der Queen Mary 2 vergeblich auf mich warten, denn ich werde pünktlich vor Auslaufen zurück an Bord sein, werde frisch geduscht zum Abendessen erscheinen, und nichts wird mehr an diesen peinlichen Zwischenfall in Nova Scotia erinnern. Und im Büro wird man auch nicht umsonst auf mich warten – nicht auszudenken, wenn ich, Helena Stern, eine der besten Juristinnen in Frankfurt am Main, nicht in meinen Alltag zurückkehren würde!
»Tut das weh?«, reißt mich diese dunkle Stimme aus meinem Gedankenkarussell und beruhigt mich auf eigenartige Weise, obwohl der Mann doch eigentlich ein Fremder für mich ist.
Vehement schüttele ich den Kopf und hoffe, dass er mir glaubt. Als ich vorsichtig aufschaue, merke ich, dass er von meinem Fuß abgelassen hat, mich aber immer noch ernst betrachtet. Er trägt normale Klamotten, keine Schwimmsachen – eine durchnässte Jeans, ein T-Shirt, das ihm eng am Körper klebt, und eine offene Jeansjacke. Natürlich war er bei diesem Wetter nicht schwimmen und hat mich dabei zufällig gesehen, nein – er muss von Land aus beobachtet haben, wie ich in die Brandung gestürzt bin, und hinterhergesprungen sein.
Dieser Mann hat mein Leben gerettet.
Als könnte er meine Gedanken lesen, fragt der Fremde mich in ruhigem Tonfall: »Was ist da eben passiert, Helena?«
Ich starre ihn an, mustere sein ernstes Gesicht mit den dunklen Augen, die mich seltsam faszinieren. Mit kratziger Stimme stoße ich hervor: »Ich bin ausgerutscht und ins Meer gefallen.«
Luke nickt langsam, ohne seinen intensiven Blick von mir abzuwenden.
»Ich habe dich von der Straße aus beobachtet«, sagt er. »Ich bin zufällig mit meinem Wagen vorbeigekommen, als du auf den Felsen gestiegen bist. Ohne Schuhe.«
»Ja, die haben nur gestört«, wispere ich und schaue flüchtig meine Füße in den zerrissenen, teilweise blutverschmierten Seidenstrümpfen an.
»Schuhe zieht man eher aus, wenn man ins Wasser will, oder?«
Lukes Frage lässt mich ihn überrascht ansehen. »Glaubst du wirklich, dass ich bei diesem Wetter schwimmen gehen wollte?«, frage ich und hätte fast lachen können, wenn mir nicht mit einem Schlag so kalt werden würde. Meine Zähne beginnen aufeinanderzuschlagen, während ich mich langsam aufsetze. Luke starrt mich immer noch unverwandt an.
»Ich habe nicht gemeint, dass du schwimmen wolltest«, sagt er langsam.
Ganz toll. Erst diese andere Deutsche – Florentine –, die mich gebeten hat, keinen Blödsinn zu machen –, und jetzt dieser Mann auch.
»Nein, Luke Cabot, ich wollte mich nicht ins Meer stürzen, um … mir das Leben zu nehmen«, stoße ich aufgebracht hervor, und es regt mich zusätzlich auf, dass sich meine Augen schon wieder mit Tränen füllen. Meine Zähne schlagen jetzt immer heftiger aufeinander.
Lukes Augenbrauen ziehen sich weiter zusammen, während er mich ernst mustert. Dann nickt er langsam.
»Okay, Helena Stern, dann warst du einfach nur ziemlich leichtsinnig. Weißt du, wie viele Unfälle dieser Art es entlang unserer Küste gibt – vor allem drüben, in Peggy’s Cove? Man steigt bei so einem Wetter, bei dieser Brandung, nicht einfach auf die Felsen am Ufer! Und das nicht nur wegen der Strömung, gegen die du umsonst angekämpft hast! Du hättest dir den Kopf einschlagen können, oder ich hätte dich querschnittsgelähmt aus dem Wasser ziehen müssen! Dass du dir nur deinen Knöchel verletzt hast, grenzt an ein Wunder, weißt du das? Andere haben hier schon ihr Leben verloren!«
Seine aufgebrachten Worte treffen mich mit voller Wucht.
Andere haben hier schon ihr Leben verloren.
Schockstarr sehe ich ihn an, während ich wieder glaube, das kalte Wasser über mir zusammenschlagen zu spüren, erneut hinabgesogen und umhergewirbelt zu werden.
Andere haben hier schon ihr Leben verloren.
Ja, aber daran war nicht der tosende Atlantik schuld. Daran war die Technik schuld. Ein dummes Kabel in der ersten Klasse der Swissair-Maschine. Ein Schwelbrand, der zu Rauchentwicklung im Cockpit geführt und das Flugzeug schließlich hat abstürzen lassen. Hinein in den Atlantik, der das Grab meiner Mutter geworden ist. Der auch fast meines geworden wäre.
Andere haben hier schon ihr Leben verloren.
Ich sehe wieder die Geburtstagskarte vor mir.
Als ich ein merkwürdiges Geräusch höre, weiß ich im ersten Moment nicht, was das ist. Dann wird mir klar, dass das Geräusch tief aus meinem Inneren kommt. Wilde Schluchzer ringen sich aus meiner Brust, während ich so heftig zu zittern beginne, dass meine Zähne immer schmerzhafter aufeinanderschlagen. Ich höre mich an wie ein Tier, ich mache mir selbst Angst, und ich schäme mich für meine wegbröckelnde Selbstbeherrschung, aber ich kann nichts dagegen tun. Was an den beiden Gedenkstätten heute mit Tränen in den Augen und einem Knoten im Hals begonnen hat, kämpft sich nun mit aller Macht an die Oberfläche. Ich habe das Gefühl, dass all die Trauer der letzten zwanzig Jahre mit einem Schlag aus mir herauswill. Gehört werden will. Gefühlt werden will – hier, jetzt, an diesem Ort, wo meine Mutter aus dem Leben gerissen worden ist.
Wo ich gerade beinahe meinen eigenen Kampf ums Überleben aufgegeben hätte. Was war bloß los mit mir? Meine Mutter, sie hatte keine Chance. Aber ich, ich habe einfach aufgehört zu schwimmen, war bereit, mich dem Meer zu überlassen! Wenn Luke nicht gekommen wäre …
Heftig schluchzend und zitternd schlage ich mir die Hände vor die Augen, beuge mich vor und krümme mich zusammen, schreiend und wimmernd und außer mir vor Schmerz und Kummer.
Erst als ich eine Hand auf meinem Arm spüre, wird mir klar, dass er immer noch da ist. Luke Cabot, der für mich ins Wasser gesprungen ist und mir das Leben gerettet hat.
»Hey, Helena«, höre ich seine dunkle Stimme, und er klingt ziemlich erschüttert. Ich würde ihm gern erklären, warum ich gerade so sehr die Fassung verliere, aber ich kann nicht sprechen, kann nur weinen, weinen, weinen.
Da nimmt mich dieser Fremde in die Arme. Er zieht mich eng an sich, ich höre seine Stimme dicht an meinem Ohr, als er leise sagt: »Hey, ist ja gut, alles wird gut.«
Ich möchte ihm erklären, dass nicht alles gut werden kann, weil ja alles, weshalb ich weine, schon vor zwanzig Jahren passiert ist, aber ich kann nicht sprechen. Stattdessen lasse ich mich halten und leicht hin und her wiegen, und durch den Nebel meiner Trauer dringt vage der Gedanke, dass sich das hier, mit diesem fremden Mann, an diesem fremden Strand, so merkwürdig vertraut anfühlt.
Wie vor zwanzig Jahren, an einem Strand hier in der Nähe.
»Du zitterst so sehr«, höre ich Luke murmeln. »Du musst sofort aus den nassen Sachen raus. Wohnst du hier in der Nähe?«
Schlotternd schüttele ich den Kopf und will sagen, dass ich zurück auf mein Schiff im Hafen von Halifax muss, aber ich komme über ein bibberndes »Ha-Ha-Halifax …« nicht hinweg.
»Du musst nach Halifax? Okay, vergiss es, mit diesen nassen Sachen lasse ich dich nicht eine Stunde Auto fahren«, erklärt Luke entschieden. »Außerdem muss dein Knöchel versorgt werden – und du stehst ganz offensichtlich unter Schock. In diesem Zustand kannst du erst recht nicht selbst fahren.«
Fast bin ich enttäuscht, als sich Luke von mir löst und aufsteht. Augenblicklich fehlt mir sein Körper, obwohl er selbst nass und kalt ist. Trotzdem fühlt er sich so unfassbar gut an.
»Komm«, höre ich Luke mit rauer Stimme sagen, und dann spüre ich seine Hände an meinen Oberarmen und merke, dass er mich in die Höhe zieht. Überrascht blicke ich auf und bleibe auf wackeligen Beinen stehen, als Luke mich bereits ohne Umschweife hochhebt und über den Strand trägt. Erneut will ich versuchen, zu erklären, dass ich nicht ewig Zeit habe, kann jedoch nur erschöpft meinen Kopf gegen seine Brust sinken lassen.
Verdammt, ich wäre gerade um ein Haar ertrunken!
Ich schluchze heiser, als wir einen Pick-up erreichen, der in der Nähe meines Autos am Straßenrand geparkt steht, und ich schluchze immer noch, als Luke mich wie ein Kind auf dem Beifahrersitz anschnallt und dann eine Wolldecke, die leicht nach Hund riecht, über mir ausbreitet und um mich herum feststopft. Auch als er einsteigt, den Motor anlässt und mit mir die gewundene Küstenstraße entlangfährt, weine ich noch immer. So viele Tränen habe ich seit jenem Septembertag vor zwanzig Jahren nicht mehr vergossen, als ich mit meinem Vater am Flughafen von Zürich gestanden und vergeblich auf meine Mutter gewartet habe.
Irgendwo in meinem Hinterkopf hämmert die Stimme der Vernunft, die versucht, mir mitzuteilen, dass es nicht wirklich clever ist, bei einem völlig fremden Mann im Auto mitzufahren. Aber ich kann mich gerade nicht auf diese Stimme konzentrieren – und außerdem hält mein Bauchgefühl dagegen, dass ich diesem Mann vertrauen kann. Warum ich davon so überzeugt bin, weiß ich wirklich nicht – aber ich habe das merkwürdige Gefühl, Luke Cabot zu kennen.
Und so lasse ich mich weinend die Küstenstraße entlangfahren, wie bereits vor so vielen Jahren, als ich mit meinem Vater hier war.
4
Bis wir endlich von der Straße abbiegen und anhalten, glaube ich, vor Kälte einzugehen. Ich zittere und schlottere am ganzen Körper, als Luke den Motor abstellt, aus dem Wagen springt und die Beifahrertür aufreißt. Er hebt mich mitsamt der Hundedecke heraus und trägt mich mit langen Schritten über etwas Knarzendes – ist das ein Bootssteg? Erschöpft hebe ich meinen Kopf ein wenig und sehe mich ratlos um. Ja, wir sind auf einem Pier, doch noch ehe ich mich weiter orientieren kann, geht Luke schon mit mir über eine schmale Gangway und betritt das Deck eines Boots.
»Wo bringst du mich hin?«, stoße ich mühsam hervor und frage mich, ob er mich überhaupt versteht, weil meine Zähne so sehr aufeinanderschlagen, dass ich mich kaum artikulieren kann, doch da kommt schon seine knappe Antwort: »Ich wohne hier.«
Eilig reißt er eine Tür auf und verschwindet mit mir unter Deck dieses fremden Boots. Vermutlich sollte ich jetzt wirklich endlich Angst bekommen, doch mir ist einfach nur kalt, und ich kann immer noch nicht aufhören zu weinen.
Luke setzt mich auf einem Bett ab und sagt mit rauer Stimme: »Du musst schnell aus deinen nassen Sachen raus. Warte, ich gebe dir etwas Trockenes von mir.«
Schlotternd bleibe ich auf dem Bett sitzen und starre auf einen Einbauschrank, den Luke jetzt öffnet. Rasch zieht er ein paar Anziehsachen hervor und reicht sie mir.
»Ich gehe raus, und du ziehst dich bitte schnell um, ja? Hier ist auch ein Handtuch. Beeil dich, sonst holst du dir den Tod. Ich mache dir einen heißen Tee.«
Mit diesen Worten verschwindet er und lässt mich zurück mit einer schwarzen Jogginghose, einem verwaschenen T-Shirt mit Metallica-Aufdruck und einem dicken Wollpullover mit Schneeflockenmuster.
Irgendwie schaffe ich es, mich mit steifen kalten Fingern aus meinen nassen Klamotten zu schälen und die trockenen überzustreifen. Dass ich nun keine Unterwäsche trage, würde mich unter anderen Umständen sehr irritieren, aber jetzt gerade ist mir das völlig egal. Obwohl es nicht mein Bett ist, krieche ich einfach unter die Decke, denn die sieht so verlockend warm aus, und ich schlottere noch immer wie Espenlaub.
Erst als ich an meinem Knöchel einen flammenden Schmerz spüre, reiße ich meine Augen erschrocken auf und merke, dass ich tatsächlich kurz weggedämmert war. Verwirrt sehe ich Luke an, der entschuldigend einen Wattebausch in die Höhe hält.
»Die Wunde musste desinfiziert werden«, erklärt er ruhig und klebt schon ein großes Pflaster über die Stelle. Ich kann nur erschöpft nicken. Als er mir eine Tasse mit dampfendem Tee reicht, setze ich mich auf und trinke gehorsam. Die Flüssigkeit rinnt wohltuend warm meine Speiseröhre hinab. Als die Tasse leer ist, lasse ich mich kraftlos zur Seite sinken, gegen Lukes Oberkörper. Ich merke, dass er sich ebenfalls umgezogen hat. Nichts an ihm fühlt sich mehr nass und kalt an, und er trägt einen dicken Kapuzenpullover, der merkwürdig tröstlich nach Waschpulver duftet. Ich höre, dass er die Tasse auf den Nachttisch zurückstellt, dann zieht er mich einmal mehr fest in seine Arme.
»Helena. Ich würde dir so gerne helfen. Willst du mir erzählen, was los ist? Woher du kommst? Was du hier machst?«, wispert er in mein feuchtes Haar, und sein Atem liebkost warm und wohltuend meine Kopfhaut.
Ich murmele etwas Unverständliches und kann nicht einmal selbst sagen, was ich eigentlich ausdrücken will. Meine Augenlider werden mit einem Mal schwer, so unglaublich schwer. Gerade fühle ich mich unfassbar erschöpft und kann nicht mehr reden, nicht mehr denken, nichts mehr tun. Ich bin sogar zu müde zum Weinen. Das sanfte Schaukeln des Boots macht mich immer schläfriger, und Luke riecht so gut, so merkwürdig vertraut, so nach Zuhause. Langsam, ganz langsam fallen mir die Augen zu, und ich versuche vergeblich, den Gedanken festzuhalten, dass ich zurück zum Hafen muss. Auf mein Schiff.
5
Luke
»Was ist denn los?«, frage ich Helena, die plötzlich in meinem Wohnbereich aufgetaucht ist und sich aufgewühlt ihr langes schwarzes Haar rauft, das von Salzwasser und Schlaf ohnehin schon sehr zerwühlt aussieht.
Was mir gefährlich gut gefällt, wie überhaupt die ganze Frau. Aber das ist jetzt wirklich nicht von Bedeutung!
»Helena?« Ich kann irgendwie nicht aufhören, ihren Namen zu sagen. Helena, das klingt wie der Teil eines Refrains. Unsere Band sollte dringend ein Lied über eine Helena schreiben.
»Was los ist?« Sie lacht auf und klingt jetzt fast hysterisch, was mich sofort aus meinen Fantasien rund um Songtexte und schöne Frauennamen und ihre Besitzerinnen reißt. »Ich müsste jetzt an Bord der Queen Mary 2 sein!«
Ach du Schande.
»Du musst … auf die Queen Mary 2? Auf das Passagierschiff der Cunard-Linie?«, hake ich langsam nach und mustere Helena ratlos.
»Ja.« Verzweifelt starrt sie mich an. In ihren hellgrauen Augen flammt so viel gleichzeitig auf – Panik, Verlorenheit, Angst. Bei der Erinnerung daran, wie aufgelöst und verletzlich Helena vorhin am Strand war, muss ich schwer schlucken. Trotz der vielen Tränen war … ist … sie so bildschön, dass ich mich heute schon mehrfach bei der Überlegung ertappt habe, ob ich eine Meerjungfrau aus dem Atlantik gefischt haben könnte.
Als ob eine Meerjungfrau vor dem Ertrinken hätte gerettet werden müssen!
Zum wohl tausendsten Mal frage ich mich, was wohl geschehen wäre, wenn ich nicht zufällig mit meinem Pick-up die gewundene Küstenstraße am Pine Tree Beach entlanggefahren wäre und sie nicht auf diesem Felsen hätte stehen sehen, mit ihrem langen schwarzen Haar, das im Sturm wild hin und her gepeitscht wurde, und mit ihrem flammenroten Trenchcoat.
In dem Moment wirkte sie noch nicht wie eine Meerjungfrau, sondern eher wie der Geist einer verwegenen Piratin. So unwirklich auf ihrem Felsen, dass ich auf dem Seitenstreifen angehalten habe und ausgestiegen bin, um zu sehen, was für eine leichtsinnige Person das war – und auf einmal fiel sie von diesem Felsen.
Ich habe noch ihren Schrei gehört, und ehe ich wusste, was wirklich geschehen war, bin ich wie ein Irrer den Trampelpfad entlanggerannt, wie schon unzählige Male in meinem Leben – aber diesmal nicht mit der Aussicht auf einen entspannten Strandtag, einen Surfausflug oder sogar einen Tauchgang, sondern von der Angst getrieben, dass sich diese dunkelhaarige Fremde beim Sturz ins Wasser verletzt haben könnte.
Ihren roten Mantel konnte ich im schwarzen, aufgewühlten Wasser zum Glück schnell erkennen, und ohne nachzudenken bin ich hinterhergesprungen.
Kaum zu glauben, dass sie sich nur den Knöchel verletzt hat!
Den Blick aus ihren hellgrauen Augen, als sie bibbernd und keuchend am Strand lag, werde ich niemals vergessen. In diesem Moment hat sie wie ein verletztes Tier gewirkt, und mein Beschützerinstinkt ließ mich alles um mich herum vergessen – vor allem, als sie anfing, so furchtbar zu weinen. Sie hatte ganz eindeutig einen Nervenzusammenbruch – vermutlich wegen des Schocks, beinahe ertrunken zu sein, wobei ich vermute, dass noch mehr dahintersteckt.
Etwas, das sie überhaupt erst auf den Felsen hatte steigen lassen. Etwas, das sie quälte und nicht losließ.
Mit so etwas kenne ich mich leider aus, und ich bin mir fast sicher, etwas in ihrem Blick gesehen zu haben, das mir schmerzhaft vertraut ist. Allerdings habe ich ihr trotzdem geglaubt, dass sie sich nicht absichtlich ins Meer stürzen wollte – sonst hätte sie wohl nicht geschrien, als sie fiel.
Nein, Helena Stern wollte sich bestimmt nicht das Leben nehmen, als sie vorhin am sturmumtosten Strand war – aber dass ihr das Leben schwer auf den schmalen Schultern lastet, das war ganz klar zu erkennen. Ich muss an ihr Schluchzen und ihr Zittern denken, auch dann noch, als sie mit trockenen Anziehsachen in meinem Bett lag. Dass ich sie einfach so umarmt und gehalten habe, war ganz schön dreist – aber sie hat mich nicht weggeschoben. Und es hat geholfen, denn bald hat sie nicht mehr gezittert – und war eingeschlafen.
Helena holt tief Luft und stößt hektisch hervor: »Die Queen Mary 2 hat nur einen Tag lang in Halifax angelegt – ein letzter Stopp in Nordamerika, bevor sie den Atlantik nach Southampton überquert. Ich habe mich gegen einen der organisierten Tagesausflüge entschieden und selbst einen Mietwagen genommen, um … mir die Küste anzusehen.« Sie holt noch einmal tief Luft. »Und nun bin ich hier. Und die Queen Mary 2 müsste jetzt gerade auslaufen. Mit meinem Gepäck – und meinem Reisepass.«
»Fuck.« Seufzend reibe ich mir mit einer Hand über das Gesicht. Jetzt verstehe ich, warum sie vorhin immer wieder etwas von Halifax gemurmelt hat – sie musste zurück zum Hafen!
»Du sagst es«, erwidert Helena und verschränkt ihre Arme vor der Brust. »Ich hätte niemals hier einschlafen dürfen!«
»Hey, tut mir leid«, sage ich und fühle mich tatsächlich, als müsste ich mich rechtfertigen. Dabei habe ich ihr doch nur helfen wollen!
Sie atmet tief durch und sagt: »Schon gut. War ja nicht deine Schuld, sondern meine. Erst falle ich ins Wasser, dann schlafe ich einfach so in deinem Bett ein … und jetzt ist das Schiff weg, mit all meinen Sachen!« Plötzlich straffen sich ihre Schultern ein wenig, und sie reckt das Kinn, als sie mit fester Stimme hinterherschiebt: »Wobei es nicht gesagt ist, dass das Schiff wirklich weg ist. Vielleicht warten sie auf mich.«
Niemals, denke ich, aber ich halte meine Klappe. Ein riesiger Dampfer wie die QM2? Der wird nicht auf eine einzelne Passagierin warten.
»Ich muss es versuchen«, sagt Helena, und nun funkeln in ihren Augen Entschlossenheit und Tatkraft auf, wo eben noch die Verlorenheit schimmerte. »Hier rumsitzen und Trübsal blasen ist keine Option. Wo sind meine Klamotten?«
Überrascht deute ich auf mein winziges Badezimmer, wo ich ihre nassen Sachen notdürftig in meiner Duschkabine aufgehängt habe. Normalerweise nutze ich dafür eine Wäscheleine an Deck, aber die fällt bei diesem Wetter wortwörtlich ins Wasser.
»O Mann, die sind ja noch klitschnass«, höre ich Helena murmeln, als sie mit ihren Anziehsachen über dem Arm aus dem Bad tritt. Trotz der angespannten Situation muss ich mir ein Lachen verkneifen. Ernsthaft? Was hat sie erwartet – dass ihre Anziehsachen bei der momentanen Luftfeuchtigkeit in so kurzer Zeit trocknen?
Ich will zu meiner Verteidigung bemerken, dass ich keinen Trockner besitze, immerhin lebe ich hier auf einem umgebauten Fischkutter und nicht auf einem Ozeandampfer, der die Bevölkerung einer Kleinstadt unterbringen könnte – doch ich sage nichts, denn in diesem Moment erstarren ihre Gesichtszüge. Ihre Hand ist in ihre Manteltasche geglitten und kommt leer wieder heraus. Helenas graue Augen weiten sich leicht, dann sagt sie entgeistert: »Mein Autoschlüssel. Er ist weg.«
6
Ich weiß, dass es keinen Sinn macht, bei diesem Regen wie ein Irrer Richtung Hafen zu fahren und dabei die Geschwindigkeitsbeschränkungen erschreckend oft außer Acht zu lassen – mein Kumpel Neil, der Polizist, würde mir die Hölle heiß machen, wenn er mich so erleben müsste. Man braucht eine gute Stunde von meinem Heimatort Wildberry Bay, dem ruhigen Fischerort an der Südküste von Nova Scotia, bis zum Hafen der Provinzhauptstadt Halifax, und selbst mit unserem Tempo werden wir ganz sicher nicht mehr rechtzeitig vor dem Auslaufen der Queen Mary 2 dort sein. Aber ich will nicht, dass Helena das Gefühl hat, ich würde hier nicht alles geben, um sie noch auf dieses Schiff zu bekommen.
Dabei flüstert mir eine ziemlich nervige Stimme in meinem Kopf immer wieder zu, dass ich im Grunde genommen gar nicht will, dass sie ihr Schiff erwischt. Dann wäre sie nämlich so schnell wieder weg, wie sie in mein Leben gekommen ist – und der Gedanke gefällt mir nicht. Warum, darüber will ich nicht näher nachdenken. Deshalb konzentriere ich mich erst einmal aufs Fahren, während sich Helena auf dem Beifahrersitz über mein Telefon beugt und versucht herauszufinden, wen man am Hafen von Halifax erreichen könnte, damit die Queen Mary 2 aufgehalten wird. Da ich weiß, dass so ein Schiff nicht ewig auf einzelne Passagiere wartet, gebe ich ihr nach einer Weile den Rat, lieber die Mietwagenfirma anzurufen, damit sie dort einen Ersatzschlüssel für ihr Auto abholen kann. Leider stellt sich heraus, dass die Filiale am Hafen, wo Helena den Wagen heute Vormittag ausgeliehen hat, schon um 20 Uhr geschlossen hat. Resigniert lässt sie schließlich mein Telefon sinken und starrt aus dem Beifahrerfenster, wo die Wälder vorbeifliegen. Mir ist klar, wie sie sich fühlen muss – sie trägt meine Klamotten, hat ihren Wagen in Wildberry Bay zurücklassen müssen und konnte zu allem Überfluss ihre Handtasche mit ihrem Telefon und Portemonnaie nicht aus dem verriegelten Auto holen.
Immer wieder werfe ich ihr verstohlene Seitenblicke zu, weil ich mich nicht an diesen Anblick von ihr in meinem T-Shirt gewöhnen kann, seit sie den Wollpullover mit Schneeflockenmuster ausgezogen hat. Ich schäme mich fast dafür, dass mein Blick wieder und wieder wie von selbst zu dem verblassten Metallica-Aufdruck wandert, den ich in- und auswendig kenne. Was ich nicht kenne, ist ihre Brust unterhalb dieses Aufdrucks. Und die Tatsache, dass sie keinen BH trägt – natürlich nicht, der liegt nass in einer Tüte im Fußraum meines Pick-ups, zusammen mit ihren restlichen Anziehsachen – lenkt meine Konzentration immer wieder von der Straße ab, was in Verbindung mit meiner Geschwindigkeitsüberschreitung und dem Regen wirklich nicht ratsam ist.
Reiß dich zusammen, Luke!
So schnell habe ich den Hafen von Halifax tatsächlich noch nie erreicht. Ich halte am Straßenrand, ganz in der Nähe des Piers, wo die Kreuzfahrtschiffe anlegen. Helena reißt schon die Beifahrertür auf und springt mit ihrer Plastiktüte hinaus, bevor ich überhaupt in »Parken« geschaltet habe und der Motor verstummt ist. Eilig folge ich ihr, mit einem Schirm für sie, den sie jedoch ungerührt ignoriert. Ihr Anblick, wie sie im strömenden Regen vor mir her den Bürgersteig entlanghastet, nimmt mir den Atem. Sie wirkt so wild und ungestüm, mit ihrem nach wie vor zerzausten schwarzen Haar und ihren bloßen Füßen – sie wollte partout nicht noch mehr Zeit verschwenden, um ihre Schuhe am Strand suchen zu gehen, obwohl ich sie besorgt auf die vielen Pfützen hingewiesen habe. Jetzt gerade rennt sie wieder barfuß durch eine, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich hätte ihr gern noch Schuhe gegeben, aber meine Größe 45 wäre an ihren Füßen, die höchstens eine 39 sind, wohl wenig hilfreich. Auch meine schwarze Jogginghose ist eigentlich zu lang und weit für sie – und trotzdem schafft es das Kleidungsstück nicht, die Rundung ihres Hinterns zu kaschieren, was nicht wirklich zu meinem Seelenfrieden beiträgt.
Ich war so sehr auf Helena konzentriert, dass ich sie nicht warne. Dabei hätte ein Blick auf das Gebäude am Kreuzfahrtterminal gereicht, um klarzumachen, dass die Queen Mary 2 dort nicht mehr liegt. Ihre Aufbauten hätten das Dach des Terminals überragt. So aber, vertieft in Helena, wie ich bin, folge ich ihr, blind für alles andere, bis um das Gebäude herum, bis zum Pier, wo einige Schaulustige mit Regenschirmen stehen und der Queen Mary 2 hinterherschauen.
Das majestätische Schiff hat bereits McNabs Island am Eingang zum Hafen von Halifax passiert und wird am Horizont kleiner und kleiner. Helena bleibt wie angewurzelt stehen und holt zitternd Luft.
»Verdammt«, flüstert sie und rauft sich mit beiden Händen die Haare. »Verdammt, verdammt, verdammt!«
Ich würde sie gern wieder in den Arm nehmen, aber jetzt, da sie nicht weinend in meinem Bett liegt, traue ich mich nicht. Stattdessen spanne ich endlich den Schirm auf und halte ihn schützend über sie. »Es tut mir leid«, sage ich leise. »So eine Schiffsreise macht man ja echt nicht alle Tage.«
Helena schnaubt auf und schüttelt mit einem heiseren Lachen den Kopf. »Nein, das stimmt. Und vor allem sind meine ganzen Sachen auf dem Schiff! Ich meine, alles, was ich außer dem Inhalt dieser Plastiktüte auf dieser Seite des Atlantiks hatte!« Sie hält kurz die Tüte hoch, dann lässt sie ihren Arm mit einem tiefen Seufzer wieder sinken. »Okay, plus meine Handtasche in meinem verriegelten Mietwagen. Und meine Pumps, am Strand. Wenn sie noch da sind. Aber meine restlichen Klamotten, mein Laptop und vor allem mein verdammter Reisepass sind auf diesem Schiff!«
Mir wird bewusst, was ich alles nicht über sie weiß. Aus welchem Land sie kommt, zum Beispiel. Sie hat einen leichten Akzent, wenn sie Englisch spricht, der mich vermuten lässt, dass sie aus Deutschland stammt (sie klingt wie meine deutsche Kindheitsfreundin Florentine Schiller und ihre Eltern). Außerdem habe ich keine Ahnung, warum sie überhaupt mit ihrem Mietwagen in Wildberry Bay war. Oder warum sie im strömenden Regen auf diesen Felsen am Pine Tree Beach gestiegen ist. Aber jetzt ist nicht die Zeit, um Antworten zu bekommen. Stattdessen sage ich mit fester Stimme: »Nein, ich glaube nicht, dass all deine Sachen weg sind.«
Die Hoffnung, die flüchtig in ihren hellgrauen Augen aufglimmt, lässt mich trocken schlucken. Himmel, was ist eigentlich los mit mir? Was hat diese fremde Meerjungfrau, die heute in mein Leben gewirbelt wurde, in so kurzer Zeit mit mir gemacht?
Um nicht weiter über mein eigenes bescheuertes Verhalten nachzudenken, erkläre ich rasch: »Wenn ein Schiff ohne einen Passagier auslaufen muss, dann sollte zumindest der Reisepass beim Hafenagenten abgegeben werden. Ich versuche, jemanden zu erreichen.«
Und diesmal haben wir Erfolg. Der Agent trifft uns nur zehn Minuten später am Rande des Kreuzfahrtterminals unter einem schützenden Vordach und reicht Helena mit einem mitleidigen Gesichtsausdruck ihren Reisepass und eine schwarze Tasche, bei deren Anblick ihre Augen aufglimmen.
»Mein Pass – und mein Laptop!«, sagt sie erleichtert. »Gott sei Dank!« Dann stockt sie und hakt langsam nach: »Okay, die Pässe der Passagiere waren ja seit Reisebeginn bei der Crew, wegen der Einreiseformalitäten in den USA und Kanada. Aber … meinen Laptop hatte ich in meinen Kabinensafe eingeschlossen. Hat man den Safe geöffnet?«
Sie hebt den Blick und sieht den Mann ratlos an. Der Agent nickt und zuckt beinahe entschuldigend mit den Schultern, dabei hilft er Helena gerade – und er war es nicht, der ihre Sachen auf dem Schiff zusammengesucht hat, das hat sicher jemand von der Mannschaft machen müssen.
»In solchen Fällen, wenn einzelne Passagiere nicht vom Landgang zurückkommen, können Kapitäne in der Regel nicht länger als eine halbe Stunde auf sie warten, das wirft sonst den gesamten Fahrplan durcheinander – und die Wetterlage hat die Queen Mary eh schon in Bedrängnis gebracht, der Kapitän musste sich beeilen, um es gut an Neufundland vorbei zu schaffen«, erklärt der untersetzte Mann und wischt sich mit einem Taschentuch Schweiß von der Stirn. »Man hat wohl versucht, Sie telefonisch zu erreichen, leider umsonst.«
»Ja, mein Telefon ist in meinem Mietwagen«, murmelt Helena und fährt sich mit beiden Händen über das Gesicht. »Und den kann ich momentan nicht öffnen, weil ich den Schlüssel verloren habe.«
»Mhhm«, macht der Agent mitleidig und kratzt sich im Nacken. »Tja, und wenn der Passagier nicht auftaucht und nicht erreichbar ist, wird der Kabinensafe geöffnet, falls sich Wertsachen darin befinden, die der Passagier womöglich dringend braucht. Und Ihren Pass haben Sie jetzt auch, also können Sie immerhin ins nächste Flugzeug nach Europa steigen.«
Als mein Blick auf Helena fällt, merke ich, dass sie ganz blass geworden ist. Spontan will ich einen Arm um ihre Schultern legen und ihr sagen, dass alles gut wird. Aber ich verkneife mir jegliche Annäherung, weil ich nicht will, dass sie mich für aufdringlich hält.
»Aber … meine Anziehsachen und Kosmetika wurden nicht bei Ihnen abgegeben?«, hakt Helena mit belegter Stimme nach.
Der Mann schüttelt bekümmert den Kopf und murmelt etwas von »Das hätte zu lange gedauert«, während er ein Formular aus einer Folie zieht und es Helena mit einem Kugelschreiber reicht, weil sie den Erhalt ihrer Wertsachen bestätigen soll. Schließlich gibt er ihr noch einen Zettel mit den Kontaktdaten der Cunard-Reederei, damit Helena sich darüber informieren kann, wie sie ihre restlichen Sachen zurückbekommen kann. Zögernd sieht er schließlich von ihr zu mir und wieder zu Helena, bevor er fragt: »Ich gehe davon aus, dass Sie fürs Erste mit allem Nötigen versorgt sind, Ma’am? Oder kann ich noch etwas für Sie tun?«
Helena mustert mich ernst und scheint nicht so recht zu wissen, wie sie reagieren soll, also versichere ich rasch: »Ich bin für Miss Stern da, Sir. Vielen Dank für Ihre Hilfe.«
Der Mann versucht, seine offensichtliche Erleichterung, weil er sich nicht weiter um Helena kümmern muss, hinter einem herzlichen Lächeln zu verbergen, und verabschiedet sich von uns.
»Alles Gute und trotzdem noch einen schönen Abend«, sagt er, bevor er sich abwendet und davoneilt. Helena schnaubt leise und lacht dann voller Selbstironie auf, als sie an sich hinabsieht.
»Oh, einen schönen Abend werde ich ganz bestimmt haben – immerhin habe ich jetzt Laptop und Reisepass. Allerdings nach wie vor nur Klamotten, in denen ich versinke, und keinen Cent Geld. Am besten übernachte ich wohl unter einer Brücke. Kannst du mir zufällig eine hier in der Nähe empfehlen?«
Ich sehe sie zwei Sekunden lang stumm an, bevor ich mit Nachdruck sage: »Ich kann dir ein Boot in Wildberry Bay empfehlen.«
Sie hebt den Blick und sieht mich mit schief gelegtem Kopf kritisch an. Da erst wird mir klar, was sie denken muss.
»Du bekommst mein Bett, ich schlafe auf einer Matte in der Küche«, beeile ich mich hinterherzuschieben.
»Warum tust du das für mich?«, fragt sie jetzt und klingt ehrlich erstaunt. »Du warst einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort, als du am Pine Tree Beach vorbeigefahren bist, und jetzt hast du mich an der Backe. Du könntest mir an dieser Stelle viel Glück wünschen und nach Hause fahren, dir ein wohlverdientes Bier aufmachen und dich dafür beglückwünschen, dass du dein Leben im Griff hast. Im Gegensatz zu anderen Leuten wie mir zum Beispiel.«
Schweigend starre ich sie an, bevor ich langsam und mit Nachdruck sage: »Erstens war ich genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Zweitens würde ich dich niemals einfach so dir selbst überlassen – ohne Auto, Telefon und Portemonnaie.« Und ohne BH, füge ich im Stillen hinzu. »Und drittens trinke ich gar kein Bier.«
Einen Moment lang sieht sie mich ehrlich erstaunt an. Dann jedoch verzieht sich ihr Mund, den ich heute schon viel zu oft verstohlen angestarrt habe, zu einem langsamen Lächeln, und sie sagt: »Okay, Luke Cabot, aber ICH brauche jetzt unbedingt eins. Oder, noch besser: einen Whiskey Sour. Den habe ich mir nach diesem beschissenen Tag wirklich verdient.«
Ich bin noch mit ihrem Lächeln beschäftigt, als sie plötzlich wieder ernst wird und nachdenklich hinzufügt: »Ups, allerdings habe ich zwei Probleme. Erstens: Ich sehe aus wie eine Obdachlose. Und zweitens: Ich habe ja kein Geld dabei.«
Nun lache ich leise auf und schüttele meinen Kopf. »Erstens: Du bist wunderschön, Helena Stern, selbst wenn du meine alte Jogginghose und das olle T-Shirt trägst. Und zweitens: Ich lade dich natürlich ein.«
7
Helena
Er hat gesagt, dass er mich wunderschön findet – und das, obwohl mein Aussehen ziemlich genau meinen Tag widerspiegelt: fast ertrunken, verschlafen, im strömenden Regen einem Schiff nachgerannt. Yep, genauso sehe ich aus. Irritiert betrachte ich mich im Spiegel hinter der Theke und wünsche mir sehnlichst meinen roten Lippenstift herbei, den ich sonst immer trage. Aber der Lippenstift liegt leider momentan unerreichbar in meiner Handtasche in meinem Mietwagen in Wildberry Bay.
Egal. Kein BH, keine Schuhe, kein Lippenstift. Immerhin passt das alles optisch zusammen, und nur meine roten Fingernägel erinnern daran, dass ich mal ziemlich gepflegt herumgelaufen bin. Gefühlt war das in einem anderen Leben.
Dankbar greife ich jetzt nach dem Whiskey Sour, den mir Luke reicht. Er selbst hat sich tatsächlich nur eine Coke auf Eis bestellt. Ob er nie trinkt – oder nur, wenn er fahren muss?
»Cheers«, sagt er nun und stößt lächelnd mit meinem Drink an. »Auf … das Leben.«
Ich schlucke und starre ein paar Herzschläge lang in Lukes dunkelbraune Augen, in denen ich immer noch die Geborgenheit erkenne, die ich vorhin, auf seinem Boot, gespürt habe. Er scheint sie mit jeder Faser seines Körpers auszustrahlen, und das irritiert mich mindestens so sehr wie die Tatsache, dass meine Knie weich werden, wenn er so süß lächelt wie gerade jetzt.
»Auf das Leben«, wiederhole ich matt und zwinge mich selbst zu einem Lächeln, bevor ich einen großen, wohltuenden, hart verdienten Schluck von meinem Whiskey Sour nehme. Ich schließe die Augen und atme tief durch. Okay, keine Panik, versuche ich mich im Stillen zu beruhigen. Mein Schiff ist weg, und ich habe keine Ahnung, wie ich zurück nach Deutschland kommen soll, denn einfach in das nächste Flugzeug zu steigen, wie der Agent eben gemeint hat, ist ja leider keine Option. Aber ich werde eine Lösung finden. Immerhin habe ich meinen Pass und sogar meinen Laptop – ich könnte also von hier aus übergangsweise arbeiten. Homeoffice in Kanada, sozusagen. Und sobald ich morgen einen Ersatzschlüssel für meinen Mietwagen und somit in Wildberry Bay Zugang zu meiner Handtasche mit den Kreditkarten bekomme, werde ich auf Shoppingtour gehen und mich neu einkleiden.
Und dann kann ich Luke auch das Geld für meinen Drink und für die köstlich duftenden Hamburger mit Pommes frites wiedergeben, die ein Kellner gerade zwischen uns auf dem kleinen Ecktisch in der vollen Hafenbar abstellt.
»Vielen Dank«, sage ich und greife erleichtert nach einer Pommes. Erst in diesem Moment wird mir klar, wie ausgehungert ich bin, und ich bin sehr froh, dass Luke darauf bestanden hat, uns etwas zu essen zu bestellen, nicht nur einen Drink.
»Guten Appetit«, sagt er jetzt und sieht mich immer noch mit diesem Lächeln an, das mich wahnsinnig macht. Ich kann nichts erwidern, weil ich gerade einen großen Bissen von meinem Burger genommen habe und begeistert kaue, darum grunze ich etwas Unverständliches. Luke lacht auf und greift jetzt ebenfalls nach seinem Burger.
Eine Weile essen wir schweigend, und mit jedem Bissen (und mit jedem Schluck meines Drinks) geht es mir ein wenig besser. Während er mit seinen letzten Pommes die Reste der Burgersoße von seinem Teller wischt, sagt Luke schließlich: »So, Helena Stern – ich weiß eigentlich nichts über dich, obwohl du schon in meinem Bett geschlafen hast.« Er grinst kurz, und ich lache ebenfalls auf, weil uns beiden klar ist, wie das klingt. Dann jedoch werde ich wieder sehr ernst, als er nachhakt: »Woher kommst du eigentlich? Und … warum unternimmst du eine Reise mit der Queen Mary 2 – offenbar allein? Zumindest vermute ich das, sonst hättest du wohl erwähnt, dass an Bord jemand auf dich wartet oder so.«