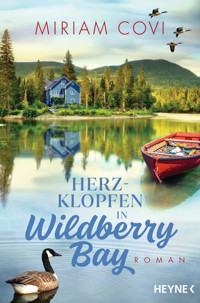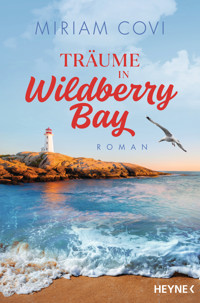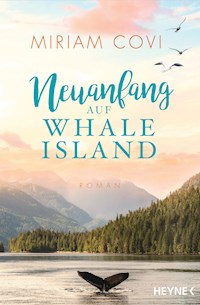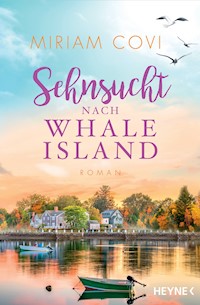
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Whale-Island-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Wenn das Schicksal andere Pläne für dich hat
Bloggerin Viola lebt jeden Tag als könnte es ihr letzter sein – schließlich hat in ihrer Familie noch keine Frau ihren 35. Geburtstag gefeiert. Während einer Rucksacktour durch Kanada hat sie einen Unfall. Doch als sie im Krankenhaus erwacht, ist sie 35 und die Zukunft liegt plötzlich vor ihr. Krankenschwester Skye Cameron lädt sie ein, sich bei ihr auf Whale Island zu erholen. In Skyes Haus lebt seit Kurzem auch ihr jüngster Bruder, der Schriftsteller Glenn. Noch nie hat sich Viola bei jemandem so wohl gefühlt wie bei dem schüchternen aber attraktiven Glenn. Sie kann sich bald gar nicht mehr vorstellen, die Insel zu verlassen. Doch ist der Familienfluch wirklich gebrochen? Viola ahnt nicht, dass die Lösung auf der Insel selbst zu finden ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 667
Ähnliche
ZUMBUCH
Bloggerin Viola Willmers genießt jeden Tag, als könnte es ihr letzter sein – schließlich hat in ihrer Familie noch keine Frau ihren fünfunddreißigsten Geburtstag erlebt. Während einer Rucksacktour durch Kanada hat sie einen Unfall. Doch als sie im Krankenhaus erwacht, ist sie fünfunddreißig, und die Zukunft liegt plötzlich vor ihr. Krankenschwester Skye Cameron lädt sie ein, sich bei ihr auf Whale Island zu erholen. Auf der kleinen Insel inmitten des tosenden Atlantiks fühlt sich Viola so wohl wie noch nie zuvor. Liegt es an der faszinierenden Natur? Oder auch an Skyes jüngstem Brüder, dem schüchternen, aber attraktiven Schriftsteller? Viola ahnt nicht, dass sie mehr mit Whale Island verbindet, als sie sich je hätte vorstellen können.
ZURAUTORIN
Miriam Covi wurde 1979 in Gütersloh geboren und entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für zwei Dinge: Schreiben und Reisen. Ihre Tätigkeit als Fremdsprachenassistentin führte sie 2005 nach New York. Von den USA aus ging es für die Autorin und ihren Mann zunächst nach Berlin und Rom, wo ihre beiden Töchter geboren wurden. Nach vier Jahren in Bangkok lebt die Familie nun in Brandenburg. Zur zweiten Heimat wurde für Miriam Covi allerdings die kanadische Ostküstenprovinz Nova Scotia, in der sie viele Sommer ihrer Kindheit und Jugend verbringen durfte und wo sie heute auch immer wieder Inspiration für neue Romane findet.
MIRIAMCOVI
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 10/2022
Copyright © 2022 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Diana Mantel
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
unter Verwendung von FinePic®, München
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-27609-6V001
www.heyne.de
Die Zukunft gehört denen,
die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben.
Eleanor Roosevelt
Für meine Großeltern:
Gerda, Hubert und Gottfried,
die ich nie kennenlernen durfte.
Und für meine Oma Charlotte,
die zu früh von uns gegangen ist.
1
Viola
Mein erster Gedanke, als ich die Augen aufschlage, ist: So sehen Engel also aus. Sie müssen gar keine langen blonden Locken haben wie auf kitschigen Bildern. Nein, dieser Engel hat kurzes, recht verstrubbeltes rotes Haar und bernsteinfarbene Augen.
»Hallo, Viola«, sagt der Engel und lächelt mich freundlich an.
Der Engel kennt meinen Namen. Klar, das ist wohl nicht verwunderlich. Engel müssen sicherlich von Berufs wegen alles über uns wissen.
»Hallo«, krächze ich mühsam, weil sich mein Mund staubtrocken anfühlt.
»Wie geht es dir?« Der Engel mustert mich eingehend, und ich überlege, wie es mir geht. Mein Kopf tut weh, mein Oberkörper auch, und mir ist schwindelig. Irgendwie … fühlt sich das hier gar nicht himmlisch an. Der Sicherheitsgurt ist zu straff, er lässt mich kaum atmen. Mühsam ringe ich nach Luft.
Stopp. Sicherheitsgurt? Irritiert will ich nach unten sehen, aber mein Kopf protestiert mit pulsierenden Schmerzen. Gequält stöhne ich auf.
»Bitte nicht bewegen«, sagt der Engel rasch, in hörbar besorgtem Tonfall. »Hilfe ist unterwegs. Du solltest im Auto sitzen bleiben, bis die Sanitäter dich durchchecken können.«
»Sanitäter?«, stammele ich mühsam und sehe den Engel entgeistert an. Was denn für Sanitäter? Die haben doch nun wirklich nichts im Jenseits verloren!
Während der Engel nur nickt und mich beruhigend anlächelt, dämmert mir ganz langsam eine unglaubliche Tatsache: Ich bin nicht tot. Oder? Zögernd bewege ich meine Finger. Dann einen Fuß. Den anderen. Alles da. Alles funktioniert. Außerdem – wenn ich tot wäre, hätte ich ganz sicher keine Schmerzen.
»Sie sind kein Engel«, stelle ich mit belegter Stimme fest und mustere das Gesicht der Rothaarigen fassungslos. Ihre Augen werden von vielen Fältchen umrahmt und wirken irgendwie … weise. Jetzt erkenne ich das Silbergrau an ihren Schläfen und zwischen den leuchtend roten Strähnen. Spontan frage ich mich, ob ich in einigen Jahren auch so aussehen werde, mit Silber in meinem roten Haar, das nicht ganz so leuchtend ist wie das dieser Frau.
Moment mal – habe ich gerade wirklich gedacht‚ in einigen Jahren? Nein … bloß nichts überstürzen, Viola! Nur, weil du nicht tot in diesem Wrack klemmst, heißt das noch lange nicht, dass du die Chance haben wirst, graue Haare zu bekommen!
Die Fremde lacht amüsiert auf. »Ich soll kein Engel sein? Oh, das ist wohl Ansichtssache, meine Liebe. Manche sagen ja, mache sind anderer Meinung. Aber für alle bin ich Rae MacLaughlin, die fahrende Bibliothekarin.«
Ein paar Herzschläge lang mustere ich die Rothaarige sprachlos, und da wird auch sie wieder ernst und hakt sanft nach: »Du dachtest wirklich, du seist tot, hm?«
Ich muss schlucken, bevor ich leise wispere: »Ja.«
»Nun, ich kann dir versichern, meine Liebe, dass du noch einen Puls hast. Das habe ich eben selbst kontrolliert, als ich dich hier aufgefunden habe. Und du warst auch nicht lange ohne Bewusstsein, höchstens fünf Minuten. Ich habe nämlich aus der Ferne gesehen, wie die Lichter deines Wagens von der Straße abgekommen sind. Als ich hier eingetroffen bin, hat dein Auto mitten im Unterholz gesteckt. Nur gut, dass ich die Fahrertür aufbekommen habe, zwischen all diesen Ästen.«
Erneut versuche ich, meinen Kopf zu bewegen, um mich umzusehen, doch wieder protestiert mein Schädel mit Schmerzen, und so bleibe ich ergeben sitzen. Draußen ist es ohnehin zu dunkel, um etwas zu erkennen, nur die Scheinwerfer meines Mietwagens leuchten in das schwarze Unterholz, als wäre nichts geschehen.
Da kommt mit einem Schlag die Erinnerung zurück.
Der Elch.
Ich bin einer gewundenen Straße durch dichten Wald gefolgt, und hinter einer Biegung stand mit einem Mal dieser ausgewachsene Elchbulle mit eindrucksvollem Geweih vor mir. Ich weiß noch, dass ich gedacht habe: So geht es also zu Ende. Eine Kollision mit einem Elch. Wie passend, mitten in der kanadischen Wildnis. Ich bin auf die Bremse gestiegen wie noch nie in meinem Leben. Der Wagen schlingerte, ich riss das Lenkrad herum … das Unterholz kam auf meine Windschutzscheibe zugerast. Lautes Knirschen und Knacken und dann … Stille. Dunkelheit.
»Wo ist der Elch?«, frage ich heiser und sehe die Frau aus den Augenwinkeln an, ohne den Kopf zu drehen. Ein Lächeln flackert über ihr Gesicht.
»Es war also ein Elch, ja? Dachte ich es mir doch. Elche sind oft schuld an Unfällen in dieser Gegend. Keine Sorge, Kindchen, der Bursche ist längst über alle Berge. Du hast ihn schließlich nicht erwischt. Glaub mir, dein Auto sähe anders aus, wenn du mit ihm kollidiert wärst. Oder mit dem Baum dort.« Die Frau zeigt auf einen dunklen Schatten, der nur wenige Schritte von meiner Motorhaube entfernt aus dem Unterholz in die Höhe ragt. »Das dichte Gestrüpp hat dich zum Glück abgebremst, sonst wärst du gegen die Kiefer gerauscht.«
Erschüttert schließe ich kurz die Augen und atme tief durch, während ich an einen anderen Unfall denken muss. An ein anderes Auto, das nicht vom Unterholz abgebremst wurde. Das gegen einen Baum geprallt ist. An meine Mutter, die nicht das Glück hatte, fünfunddreißig werden zu dürfen.
Aber … noch bin ich auch nicht fünfunddreißig. Noch kann so viel passieren.
»Wie spät ist es?«, frage ich die Rothaarige. Wie hieß sie noch? Rae.
»Kurz nach einundzwanzig Uhr«, erwidert sie nach einem Blick auf ihre Armbanduhr. »Keine Sorge, die Ambulanz vom Seaside Hospital in Scott’s Harbour müsste bald hier sein, und die Feuerwehr und der Sheriff auch.«
»Hm«, murmele ich gedankenverloren. Dabei wollte ich gar nicht deshalb hören, wie spät es ist. Vielmehr wollte ich wissen, wie lange ich womöglich noch auf dieser Erde habe.
Drei Stunden bis Mitternacht.
Hat sich Esmeralda damals womöglich vertan? Dachte sie … ich würde dem Elch nicht ausweichen? Würde hier sterben, mitten im dichten Wald an der Ostküste Kanadas, in der Atlantikprovinz Nova Scotia? Oder … wird noch etwas geschehen, bis Mitternacht ist? Bis ich die Chance bekomme, tatsächlich fünfunddreißig zu werden?
Eine entfernte Sirene reißt mich aus meinen durcheinandergaloppierenden Gedanken. Und dann noch eine. Und noch eine. Himmel, ich habe wirklich einen ganz schönen Aufruhr in diesem stillen nächtlichen Wald verursacht! Was der Elch jetzt wohl macht?
»Ah, da sind sie ja«, sagt Rae mit einem zufriedenen Lächeln und nickt mir aufmunternd zu, bevor sie sich von mir abwendet und den rot und blau aufleuchtenden Lichtern entgegengeht, die nun den schwarzen Wald um uns herum erhellen.
Während sie sich von meinem Mietwagen entfernt und mich zurücklässt, den Blick auf den aufgeblasenen Airbag und die Windschutzscheibe mit dem Spinnennetz aus Rissen dahinter gerichtet, flackert plötzlich eine Frage durch meinen schmerzenden Kopf: Hat diese Rae mich eben bei meinem Namen genannt? Hat sie wirklich Viola zu mir gesagt? Woher … wie konnte sie wissen, dass ich so heiße? Liegt mein Pass hier herum? Aber nein, der steckt in den Tiefen meines Rucksacks, und der ist im Kofferraum. Und mein Führerschein ist in meinem Portemonnaie. Hat sie womöglich meine Handtasche geöffnet, um herauszufinden, wie ich heiße? Ganz vorsichtig und langsam drehe ich meinen Kopf ein wenig und spähe angestrengt zum Beifahrersitz. Meine Handtasche liegt im Fußraum, sie ist verschlossen. Es ist unmöglich, dass diese Rae von meiner geöffneten Fahrertür aus an mir vorbei bis in den Fußraum des Beifahrersitzes reichen konnte.
Aber … woher …? Oder … habe ich mir das nur eingebildet?
Ja, das wird es sein. So muss es sein. Um Himmels willen, ich habe doch hoffentlich kein schwerwiegendes Schädel-Hirn-Trauma?
Vielleicht sterbe ich doch noch, bevor ich fünfunddreißig bin, wispert die Stimme der Angst in meinem Kopf, die mich seit so vielen Jahren begleitet. Drei Stunden. Drei Stunden, in denen so viel passieren kann. Nur weil ich noch lebe, heißt das doch nicht, dass ich überlebe! Eine Hirnblutung vielleicht. Oder eine andere innere Verletzung, von der ich noch gar nichts ahne. Oder …
Schritte nähern sich, schwerere diesmal, das ist nicht Rae. Der Lichtkegel einer Taschenlampe scheint in meinen Mietwagen, und eine männliche Stimme fragt in ruhigem Tonfall: »Guten Abend, Ma’am, wie geht es Ihnen?«
»Ähm … ganz gut«, ächze ich leise. Soll ich sagen, dass ich Halluzinationen hatte? Noch ehe ich mich dazu durchringen kann, beugt sich der Sanitäter zu mir herein und sieht mich freundlich an.
»Das hören wir gern. Mal wieder ein Elch, hm? Cape Breton ist voller Risiken. Jetzt wollen wir mal sehen, wie es Ihrem Kopf geht, und dann holen wir Sie hier heraus. Können Sie sich denn an den genauen Ablauf des Unfalls erinnern?«
Ich beantworte die Fragen des Mannes und lasse mir in die Augen leuchten. Nach einer Weile redet er mit seinen Kollegen und den Feuerwehrleuten, die ich draußen um das Auto herumlaufen höre, und dann nickt er mir zu und sagt: »Also, dann wollen wir Sie mal aus dem Wagen holen, Viola.«
»Woher … kennen Sie meinen Namen?«
Das hatte ich ihm doch nicht gesagt! Ich habe ihm nur erzählt, dass ich aus Deutschland komme, dass ich vierunddreißig bin (noch!) und auf einer Rundreise durch Kanada war, von der Westküste bis zur Ostküste. Ehrlich gesagt hatte ich mich schon gewundert, dass er mich nicht nach meinem Namen gefragt hat.
»Den haben wir von Rae«, sagt er.
Leider komme ich nicht mehr dazu, Rae zu fragen, woher zum Teufel sie meinen Namen kennt, denn während ich aus dem Wrack geborgen und mit der Liege zum wartenden Krankenwagen geschoben werde, muss Rae ihr eigenes Auto aus dem Weg fahren, damit die Ambulanz besser wenden kann. Allerdings handelt es sich gar nicht um ein normales Auto, merke ich mit einem Mal, nein: Aus den Augenwinkeln erkenne ich einen richtigen Bus – offenbar einer dieser typischen nordamerikanischen Schulbusse in leuchtendem Gelb. Aber … sie hat sich als fahrende Bibliothekarin bezeichnet, also befindet sich in dem Bus womöglich eine mobile Bücherei? Mir liegen so viele Fragen auf der Zunge, doch da werde ich auf der Liege bereits in den Krankenwagen geschoben, und mir fällt siedend heiß mein Gepäck ein. Das darf nicht einfach hier, in meinem Autowrack mitten im Wald, zurückbleiben! Schon gar nicht meine geliebte Fotokamera, mein Ein und Alles! Die brauche ich, unter anderem für meinen Blog!
»Was ist mit meinem Gepäck?!«, frage ich panisch und will mich ein wenig aufrichten, doch einer der Sanitäter hindert mich sanft, aber dennoch mit Nachdruck, daran.
»Schön liegen bleiben«, sagt er. »Der Sheriff kümmert sich um Ihre Sachen, keine Sorge. Sie werden alles im Krankenhaus wiederbekommen. Da nimmt man dann auch in Ruhe Ihre Personalien auf. Also, dann wollen wir mal. Auf nach Scott’s Harbour.«
Die Türen werden geschlossen, und das Letzte, das ich von der Unfallstelle sehe, ist Rae MacLaughlin, die im Scheinwerferlicht vor ihrem Bus steht, ihr Haar rot leuchtend, den Blick auf mich gerichtet. Um ihre Lippen spielt ein leichtes Lächeln, das merkwürdig zufrieden wirkt.
2
Oh, ich muss eingenickt sein. Als ich die Augen öffne, weiß ich einen Moment lang nicht, wo ich bin. Dann jedoch drehe ich den Kopf, und der pulsierende Schmerz ruft es mir in Erinnerung: richtig. Ich bin in der Notaufnahme des Seaside Hospitals in Scott’s Harbour.
Eine Bewegung lässt mich den Blick heben, und ich erkenne eine Krankenschwester, die durch den Vorhang, der mein Bett vom Nachbarbett abschirmt, hindurchsieht.
»Happy Birthday, Viola.«
Geradezu erschrocken starre ich die Frau mit dem schwarzen Pferdeschwanz und den himmelblauen Augen an, die vorhin, als ich eingeliefert wurde, nicht hier war. Woher weiß denn diese Fremde, wie ich heiße – und dass ich Geburtstag habe?
Moment mal. Wie bitte? Nein! Das kann nicht sein!
»Ähm – was?«, stammele ich und versuche, mich zu räuspern, weil sich meine Stimme so schrecklich nach Reibeisen anhört. »Ist etwa schon Mitternacht?«
»Ja. Es ist viertel nach zwölf.« Die Krankenschwester tritt lächelnd an mein Bett und hält mir zum Beweis eine pinkfarbene Smartwatch vor das Gesicht. Auf dem Display steht es ganz eindeutig, in blauen Leuchtziffern: 9. September.
Ich bin fünfunddreißig Jahre alt geworden.
»Oh. Das … das ist ja … der Wahnsinn«, murmele ich überwältigt und muss kurz meine Augen schließen, weil mir ein wenig schwindelig wird. Als ich sie wieder öffne, sagt die Krankenschwester in verständnisvollem Tonfall: »Ich weiß, es gibt schönere Orte als die Notaufnahme, um Geburtstag zu feiern, aber, hey, immerhin kannst du Geburtstag feiern. Dafür sollte man ja immer dankbar sein, aber erst recht nach einem Beinahezusammenstoß mit einem Elch, hm?«
Sie betrachtet mich freundlich, und ich stelle zu meiner Verwunderung fest, dass die Leute hier, im Norden der Insel Cape Breton in Nova Scotia, wirklich sehr herzlich sind. Und das, obwohl ich nur eine dumme Touristin aus Deutschland bin, die fast in einen Elch gerast wäre.
»Ja, das stimmt«, wispere ich.
Ich kann es nicht fassen, dass ich fünfunddreißig bin! Als ich merke, dass die Krankenschwester nach einem Clipboard greift, das am Fußende meines Bettes hängt, wird mir klar, warum sie meinen Namen und mein Geburtsdatum kennt. Natürlich, meine persönlichen Angaben wurden doch vorhin aufgenommen.
Aber Rae – die konnte wirklich nicht wissen, wie ich heiße. Oder erinnere ich mich einfach nicht an alles, was sich an der Unfallstelle abgespielt hat?
Als habe die Fremde meine Gedanken lesen können – die Leute hier werden mir langsam unheimlich, so nett sie auch sind! –, fragt die Schwester jetzt: »Mir wurde erzählt, dass Rae MacLaughlin dich gefunden hat, stimmt das?«
»Ja«, erwidere ich und muss wieder an die mysteriöse Rothaarige denken.
»Mensch, da hast du großes Glück gehabt, dass Rae mit ihrem Bücherbus vorbeigekommen ist, Viola. Die Straße, wo du den Unfall hattest, ist ziemlich einsam, vor allem nachts.«
»Ja, das war … ein glücklicher Zufall«, sage ich leise.
»Nein, das war bestimmt kein Zufall«, höre ich die Dunkelhaarige da murmeln und sehe sie überrascht an.
»Wie bitte?«, hake ich ratlos nach.
»Ach, schon gut«, winkt sie lächelnd ab. »Auf jeden Fall wollte ich dir sagen, dass du dich nur noch ein paar Minuten gedulden musst, dann wirst du endlich hoch in die Radiologie gebracht. Ich bin übrigens Skye Cameron.«
»Freut mich, Skye«, erwidere ich, und zum ersten Mal, seit der Elch hinter der Biegung auf der Straße stand, bekomme ich ein echtes Lächeln zustande. Im nächsten Moment jedoch merke ich, wie die Emotionen über mich hereinbrechen, und zu meinem Entsetzen schluchze ich heiser auf, bevor ich es verhindern kann. Peinlich berührt presse ich meine Lippen fest aufeinander.
»Hey«, sagt Skye sanft und greift nach meiner Hand. »Das war ein ganz schöner Schreck, hm?«
»Ja«, flüstere ich. »Ich … ich war mir sicher, dass ich sterben würde.«
»Das hast du gedacht, als du im Wrack auf Hilfe gewartet hast?«, hakt Skye nach und drückt mitfühlend meine Hand.
Ich schüttele den Kopf, was dieser mit einem heftigen Stechen kommentiert. Aua. Lieber ruhig liegen bleiben.
»Ich … ich habe immer gedacht, ich würde nie fünfunddreißig werden«, sage ich heiser.
Warum um alles in der Welt erzähle ich dieser Fremden das? Skyes Augen weiten sich vor Überraschung.
»Warum das denn?«
»So, jetzt zu unserer deutschen Patientin«, reißt uns eine Stimme aus unserer Unterhaltung. Ich weiß nicht so recht, ob ich enttäuscht oder erleichtert sein soll. Einerseits strahlt diese Skye eine so warme Freundlichkeit aus, dass ich mich gern länger mit ihr unterhalten würde. Andererseits möchte ich jetzt nicht erklären, warum ich nicht nur im Wrack meines Mietwagens überzeugt davon war zu sterben, bevor ich fünfunddreißig werden konnte.
Aber jetzt bin ich es. Fünfunddreißig. Unfassbar. Oder … Moment mal. Vielleicht bin ich in Deutschland noch gar nicht fünfunddreißig? Vielleicht … schwebt das Damoklesschwert doch noch über mir? Angestrengt versuche ich, in meinem Gehirn, das sich merkwürdig benebelt anfühlt, die Antwort auf die Frage zu finden, wie spät es in meiner Heimat jetzt ist. Als sich ein grauhaariger Mann in weißem Kittel über mich beugt und mich aufmerksam betrachtet, frage ich heiser: »Wissen Sie zufällig, wie spät es in Deutschland ist?«
Er zieht überrascht seine Augenbrauen in die Höhe, dann fragt er über seine Schulter: »Skye, googelst du das bitte mal?«
Ich merke, wie Skye ein Telefon aus einer Tasche ihres Kittels zieht – dann sehe ich erst einmal nichts, weil mir der Arzt mit einer kleinen Taschenlampe abwechselnd in die Augen leuchtet.
»Mhm«, murmelt er und zeigt mir eine Anzahl von Fingern. »Wie viele Finger sind das?«
»Drei«, murmele ich und fühle mich mit einem Mal sehr müde. Der Arzt nickt mit einem Lächeln.
»In Deutschland ist es zwanzig nach fünf am Morgen«, erklärt Skye in diesem Moment.
Richtig, denke ich. Das wusste ich doch. Hier, in Nova Scotia, an Kanadas wildromantischer Atlantikküste, ist es fünf Stunden früher als in Europa.
Das heißt … dass ich in meiner Heimat auch fünfunddreißig bin. Sogar schon seit etwas mehr als fünf Stunden. Ich war dort schon fünfunddreißig, als ich dem Elch begegnet bin.
»Möchtest du mit jemandem zu Hause sprechen?«
Ich verstehe Skyes Frage im ersten Moment nicht. Erst als sie mir ihr Telefon hinhält, während der Arzt etwas auf seinem Clipboard notiert, ahne ich, was sie meint.
»Deine Eltern?«
Ich schüttele schon wieder unüberlegt den Kopf und werde erneut von einem stechenden Schmerz durchzuckt.
»Bitte ruhig liegen bleiben«, schaltet sich der Arzt mahnend ein. »Ihr Kopf muss die wilde Fahrt ins Unterholz erst einmal verkraften, liebe Viola.«
»Ich habe keine Eltern mehr«, wispere ich, weil mir Skyes Frage wieder einfällt. Ihr mitleidiger Blick entgeht mir nicht. An solche Blicke bin ich gewöhnt.
»Sonst jemanden?«, hakt sie sanft nach.
Erneut will ich meinen Kopf schütteln, besinne mich aber rechtzeitig eines Besseren und flüstere stattdessen: »Nein. Da gibt es niemanden.«
Doch, es gibt Luigi und Tim, wabert der vage Gedanke an meine zwei besten Freunde durch mein vernebeltes Hirn. Aber … das hat Zeit. Ich werde die zwei später anrufen. Jetzt möchte ich eigentlich nur noch schlafen, meine Lider fühlen sich plötzlich sehr schwer an. Ich spüre, wie Skye erneut nach meiner Hand greift und sie leicht drückt.
»Okay, wir können Miss Willmers nach oben bringen«, höre ich da eine weitere männliche Stimme, und ein Pfleger taucht neben meinem Bett auf. »Hey, Skye, hast du nicht Feierabend?«, fragt der junge Mann, während der Arzt noch ein paar weitere Notizen auf dem Clipboard macht.
»Ja, ich müsste längst weg sein, vor allem, weil ich in ein paar Stunden schon wieder hier bin – Betty ist ausgefallen. Darum gab es heute einfach so viel zu tun«, seufzt Skye. Als ich sie ansehe, merke ich, wie sie mich nachdenklich mustert. Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht, als sie hinzufügt: »Aber ich wollte unbedingt unserer deutschen Patientin alles Gute zum Geburtstag wünschen, bevor ich verschwinde. Ich war mir fast sicher, dass ihr Kerle das vergessen würdet.«
»Geburtstag?«, fragt der Arzt prompt ein wenig erstaunt, wirft einen Blick auf sein Clipboard, sieht mich dann wieder an und sagt mit einem Kopfschütteln: »Na, dann, Happy Birthday! Also, da gibt es ja wirklich schönere Arten, in seinen fünfunddreißigsten Geburtstag zu starten.«
Na ja, denke ich. Wenn man bisher überzeugt davon war, tot in seinen fünfunddreißigsten Geburtstag zu starten, ist die Notaufnahme eine gar nicht so schlechte Alternative. Es ist, wie immer im Leben, eine Frage der Perspektive.
»Alles Gute«, sagt auch der jüngere Mann mit dem blauen Kittel, und dann hantiert er an meinem Bettende herum, und mir wird klar, dass er die Feststellbremse gelöst hat. »So, Ihr Geschenk ist jetzt, dass Sie auf schnellstem Wege in die Radiologie gebracht werden, wo man Sie röntgen wird. Dann können wir sehen, ob in Ihnen alles so ist, wie es sein sollte, Geburtstagskind.«
»Danke«, murmele ich, wobei ich jedoch nicht den jungen Mann ansehe, sondern Skye. Dass sie mir noch gratulieren wollte, bevor sie in ihren sicher wohlverdienten Feierabend startet, rührt mich sehr.
»Gern geschehen.« Sie zwinkert mir zu und sagt, während sie meine Hand loslässt: »Ich werde später wieder nach dir sehen, okay? Bis dann, Viola.«
3
Fast bin ich enttäuscht, als Skye später an diesem Tag nicht auftaucht. Zumindest glaube ich, dass sie nicht aufgetaucht ist – immerhin habe ich mehrere Stunden geschlafen, nach der größtenteils schlaflosen vergangenen Nacht. Allerdings habe ich die Krankenschwester, die eben mein viel zu frühes Abendessen gebracht hat, gefragt, ob jemand für mich hier war. Sie hat bedauernd erwidert, dass sie niemanden gesehen habe, und mich mitleidig angelächelt – schließlich habe ich Geburtstag. Ich habe tapfer zurückgelächelt und mir eingeredet, dass das nicht schlimm ist. Denn, ganz ehrlich … hatte ich wirklich erwartet, dass Skye mich besuchen würde? Hatte ich etwa gehofft, einfach so eine neue Freundin zu finden? Hier, mitten in der Einsamkeit der Insel Cape Breton? Das ist doch lächerlich. Skye ist eine Krankenschwester, und sie hat heute Nacht nur ihren Job gemacht. Selbst wenn sie länger geblieben ist als nötig, um mir noch zum Geburtstag gratulieren zu können.
Außerdem bin ich in den letzten Wochen auch sehr gut allein zurechtgekommen.
Doch, natürlich habe ich Freunde. Und meine zwei allerbesten Freunde warten in Hamburg sicherlich auf Neuigkeiten von mir: Tim und sein Mann Luigi, die mir in den letzten Wochen ständig Nachrichten geschickt und sich Sorgen gemacht haben. Sorgen, weil auch sie sich vermutlich nicht sicher waren, ob man der Wahrsagerin von damals glauben sollte oder nicht.
»Du schickst einmal am Tag ein Lebenszeichen per WhatsApp!«, hat Tim mir eindringlich mit auf den Weg gegeben, als er mich zum Abschied am Hamburger Flughafen so fest an sich gedrückt hat, dass ich Angst hatte, er würde mir ein paar Rippen brechen. Das allerdings hat im Endeffekt nicht mein fast zwei Meter großer blonder Hüne von einem Freund geschafft, sondern ein kanadischer Elch – zumindest indirekt. Eine Rippe ist gebrochen, ich habe eine Prellung an der Schulter und eine leichte Gehirnerschütterung. Alles nicht dramatisch, wie der Arzt mir versichert hat.
»Ja, ich verspreche es«, habe ich Tim vor fast drei Monaten, Mitte Juni, am Hamburger Flughafen feierlich versichert und mich sehr darum bemüht, nicht in Tränen auszubrechen, als ich in sein besorgtes Gesicht gesehen habe. Luigi hatte diesen Kampf längst aufgegeben und schluchzte hemmungslos, als auch er mich zum wiederholten Mal fest an sich gedrückt und mir noch den Wunsch mit auf den Weg gegeben hat, in Kanada den Mann meiner Träume zu finden.
»Wieso denn das?«, habe ich ungläubig gefragt, während sich Luigi die Tränen von den Wangen tupfte. Ich wollte hinzufügen, dass es doch Schwachsinn ist, sich zu verlieben, wenn man eh bald stirbt. Darum habe ich mich ja auch in den letzten Jahren nicht verliebt. Habe es nicht zugelassen, dass sich jemand in mich verliebt, denn wie hätte ich das geschehen lassen können, wenn ich doch wusste, dass ich dem Mann unweigerlich das Herz brechen würde? So wie mir das Herz schon gebrochen wurde, durch den Tod eines geliebten Menschen?
Nein, das wollte ich niemandem antun, und so hatte ich die letzten Jahre konsequent ohne Liebe verbracht. Und ich würde auch meine letzten Wochen auf dieser Erde nicht mehr damit anfangen, mich plötzlich, sozusagen auf den letzten Metern, zu verlieben.
Aber Luigi hat mich am Hamburger Flughafen eindringlich aus seinen großen braunen Augen mit dem sehr dezent aufgetragenen schwarzen Lidstrich angesehen und beharrlich wiederholt: »Weil die Liebe alles verändert, Violetta.«
Nicht den Tod, wollte ich erwidern, habe jedoch tapfer die Lippen zusammengebissen, weil ich Luigi, dem unheilbaren Romantiker, nicht seine Hoffnung rauben wollte.
»Mal schauen«, habe ich daher nur ausweichend erwidert und ihn schief angelächelt.
Und jetzt liege ich an diesem 9. September am frühen Abend im Bett des Seaside Hospitals und habe den größten Teil meines Geburtstags verschlafen, nachdem ich in der letzten Nacht kaum ein Auge zugemacht hatte. Zu aufgewühlt und durcheinander war ich, als ich nach dem Röntgen gegen vier Uhr morgens endlich in dieses Zimmer gebracht worden war. Trotz der bleiernen Müdigkeit habe ich noch eine ganze Weile über die unfassbare Tatsache nachgedacht, dass ich lebte. Atmete. Dass mein Herz noch schlug. Und wie es das tat, es hämmerte vor lauter Aufregung wie verrückt gegen meinen Brustkorb! Ich traute mich nicht, die Augen zu schließen. Was, wenn ich dann doch nicht mehr aufwachen würde?
Schließlich war die Müdigkeit jedoch größer als meine Angst. Zwar hat mich, kurz nachdem ich erschöpft eingenickt war, eine Krankenschwester wieder geweckt, um meine Temperatur zu messen, aber das Frühstück habe ich verpennt und auch das Mittagessen. Jetzt, da sich der ungewöhnlichste Geburtstag meines Lebens tatsächlich bereits seinem Ende entgegenneigt, bin ich endlich ausgeruht genug, um mir auf meinem Telefon meine Geburtstagsnachrichten durchzulesen und abzuhören. Der Sheriff hat mein Gepäck letzte Nacht tatsächlich in mein Zimmer gebracht, während ich bei den diversen Untersuchungen war. Hoffentlich hat meine heißgeliebte und wirklich nicht billige Fotokamera den Unfall überlebt! Bisher habe ich mich nicht getraut, die Tasche zu öffnen, um mir den Zustand der Linse und der Objektive anzusehen.
Ungläubig lese ich die Glückwünsche von Bekannten aus aller Welt, die mich erreicht haben, während ich immer noch versuche zu begreifen, dass ich lebe. Dass ich fünfunddreißig bin.
Mit einem gerührten Lächeln nehme ich die vielen ungelesenen Nachrichten in der WhatsApp-Gruppe La Famiglia wahr, deren Mitglieder Tim, Luigi und ich sind. Gegründet hat diese Gruppe Tim, aber den Namen vergeben hat Luigi, der zur Hälfte Italiener und ganz und gar südländisch temperamentvoll und leidenschaftlich ist. Und der Name passt so gut, denn er und sein Göttergatte Tim sind in der Tat das, was ich als meine Familie bezeichnen würde. Eine tatsächliche Familie im Sinne von Blutsverwandtschaft habe ich nämlich nicht mehr.
Meine Familie war schon immer sehr klein, was daran liegt, dass ich meinen Vater und auch dessen Verwandtschaft nie kennengelernt habe. Ich bin das Ergebnis einer einzigen leidenschaftlichen Nacht, hat meine Mutter, die mindestens so romantisch veranlagt war wie Luigi, immer gesagt. Leider blieb es jedoch bei dieser einen Nacht, denn mein Vater war Seemann und musste am folgenden Morgen fort, auf sein nächstes Schiff, das im Hamburger Hafen auf ihn wartete. Nach einem langen Abschiedskuss hat Mama nie wieder von ihm gehört, obwohl er versprochen hatte, sich zu melden. Ich glaube, meine Mutter hat das nie verkraftet. Sie war ein Mensch, der verzweifelt an die große Liebe im Leben geglaubt hat, und obwohl sie später hin und wieder einen Freund hatte, bin ich fest davon überzeugt, dass für sie mein Vater diese große Liebe war, auch wenn sie nur eine Nacht zusammen hatten. Oft hat sie mich angesehen und nachdenklich gemeint: »Du hast seine wunderschönen braunen Augen, Herzenskind.«
Meine Augen werden ein wenig feucht, als ich an Mamas Kosenamen für mich denke: Herzenskind. Es ist jetzt zwanzig Jahre her, seit sie gestorben ist. Ich war damals fünfzehn. Meine Mutter war vierunddreißig – nur wenige Tage von ihrem fünfunddreißigsten Geburtstag entfernt.
Ich bin fünfunddreißig, denke ich erneut fassungslos, während ich die älteste ungelesene Nachricht in der Gruppe La Famiglia öffne. Sie ist von Luigi und er hat sie gestern Abend geschrieben, als es in Deutschland schon nach Mitternacht war. Das war noch vor meinem Unfall, überlege ich erstaunt, aber dann wird mir bewusst, dass ich auf der einsamen Strecke durch den dichten Wald von Cape Breton gestern Abend größtenteils keinen Handyempfang hatte.
Was für ein Glück, dass Rae anscheinend mit ihrem Telefon den Notruf absetzen konnte, fährt es mir durch den Kopf. Und überhaupt, was für ein Glück, dass diese merkwürdige Frau mich gefunden hat – wer weiß, wann das nächste Fahrzeug vorbeigekommen wäre? Mir sind nicht viele Autos begegnet, als ich auf der Strecke unterwegs war. Mit einem Schaudern versuche ich, die Erinnerung an meinen Unfall und die Überlegung, wie viel schlimmer es hätte werden können, zur Seite zu schieben, und lese stattdessen Luigis Nachricht:
Bella, hier in Deutschland bist du schon fünfunddreißig! Auguri! Buon compleanno! Melde dich bitte, wir denken an dich!
Nur wenige Minuten später eine Nachricht von Tim:
Auch von mir die herzlichsten Glückwünsche, Süße! Wo bist du? Melde dich doch mal, wir würden gern singen!
Zehn Minuten später haben die beiden ein Video geschickt, auf dem sie zu sehen sind: Luigi hält eine Kerze, Tim seine Gitarre. Sie tragen blau-weiß gestreifte Schlafanzüge im Partnerlook, was mich grinsen lässt.
»Bella, es ist hier halb eins, und wir müssen wirklich ins Bett, du weißt ja, dass ich kein Nachtmensch bin«, sagt Luigi. »Bei weniger als sieben Stunden Schlaf bekomme ich Migräne.«
»Was Luigi sagen will …«, schaltet sich Tim ein und spielt einen Akkord auf seiner Gitarre, »wir singen jetzt per Video für dich und gehen dann ins Bett. Morgen telefonieren wir dann richtig, ja? Wenn du auch in Kanada fünfunddreißig geworden bist.«
Er zählt leise bis drei, und trotzdem fängt Luigi bereits bei »zwei« an, Happy Birthday loszuschmettern, als würde er eine italienische Operette singen. Tim wirft seinem Mann einen Blick zu, der zu gleichen Teilen verzweifelt und amüsiert ist, bevor er sich beeilt, in das Ständchen einzusteigen.
»O wie schön, Glückwünsche aus der Heimat?«, unterbricht mich eine Stimme, und ich lasse mein Telefon sinken. Mein Herz macht einen kleinen Freudensprung, als ich Skye in der Tür stehen sehe. Sie hat mich doch nicht vergessen!
»Ja, von meinen besten Freunden«, antworte ich und lege das Telefon zur Seite, während Skye mein Zimmer betritt. In diesem Zimmer stehen zwei Krankenbetten, aber das zweite ist momentan nicht belegt, weshalb ich in den Luxus eines Einzelzimmers komme.
»Du hast also doch jemanden in Deutschland«, bemerkt sie und klingt regelrecht erleichtert, als sie das sagt.
»Ja, Freunde schon.« Ich atme tief durch. »Nur keine Familie. Aber Tim und Luigi, die fühlen sich fast an wie Familie.«
Skye zieht sich den Besucherstuhl neben mein Bett und mustert mich interessiert. »Zwei Männer?«, hakt sie nach, und ich nicke.
»Ja. Zwei wunderbare, sehr attraktive, kluge, manchmal urkomische und immer extrem liebenswerte Männer, die miteinander seit vielen Jahren glücklich und seit Kurzem auch verheiratet sind.«
Skye lacht auf, als ich sie breit angrinse.
»Hach, die besonders netten und attraktiven Exemplare der männlichen Spezies sind oft schwul, oder?«, bemerkt sie, bevor sie innehält und nachdenklich hinzufügt: »Und genau da liegt vermutlich das Problem. Die wirklich Netten sind für uns unerreichbar. Und die, mit denen wir uns fortpflanzen könnten, sind leider nicht selten Arschlöcher.«
»Wow«, mache ich überrascht und starre Skye aus weit aufgerissenen Augen an. »Du scheinst aber keine positiven Erfahrungen mit Männern gemacht zu haben!«
Skye seufzt leise und zuckt mit den Schultern. »Geht so«, gibt sie dann zögernd zu und sieht sich rasch in meinem Krankenzimmer um, als wolle sie sich vergewissern, dass sich in dem zweiten Bett nicht doch noch ein Patient versteckt hat. »Ein Grund, warum ich jetzt erst zu dir komme, ist der Chefarzt der Inneren«, sagt sie schließlich leise. »Ich bemühe mich darum, Dr. Jeff Montgomery aus dem Weg zu gehen.«
Ich merke, dass sie mit einem Zwinkern versucht, ihren Worten die Schwere zu nehmen, doch in ihren Augen erkenne ich genau, dass es ihr sehr wohl ernst damit ist.
»Warum?«, flüstere ich und werde ein wenig nervös. Zwar bin ich nicht vom Chefarzt untersucht worden, aber, wer weiß, vielleicht kommt er noch? »Gehört er etwa zur Arschloch-Kategorie?«
»Und ob«, lacht Skye bitter auf. »Er ist mein Ex-Freund. Und wir sind nicht im Guten auseinandergegangen.« Sie seufzt bei ihren Worten tief auf.
»Er hat dir aber nicht wehgetan, oder?« Besorgt mustere ich die lebensfrohe Frau vor mir, die gerade so bekümmert wirkt.
»Nein, das nicht. Also … nicht physisch zumindest.« Skye lacht erneut heiser auf. »Aber egal – das mit Jeff und mir ist vorbei, und er hat heute auch keinen Dienst mehr, darum muss ich keine peinlichen Begegnungen auf dem Flur befürchten.« Sie grinst mich schief an.
»Hm«, mache ich und betrachte sie nachdenklich.
»Himmel, wir kennen uns kaum, und ich erzähle dir schon von meinem Ex«, sagt Skye mit einem Augenrollen. »Dabei waren wir gerade bei deinen besten Freunden. Die klingen toll, wirklich. Mein jüngster Bruder ist auch schwul. Also … zumindest sagt mir das mein Gaydar.«
»Dein … was?«, hake ich amüsiert nach und lege mein Telefon zur Seite. Tim und Luigi müssen warten – Skye zieht mich ganz und gar in ihren Bann. Sie schafft es wirklich, einen abzulenken. Vielleicht gehört das in Kanada zum Training der Krankenschwestern in der Notaufnahme dazu? Wenn Skye mit allen Patienten, die eingeliefert werden, so umgeht wie mit mir, kann ich mir gut vorstellen, dass die meisten ihre Ängste und sogar Schmerzen schnell vergessen. Skye wirkt wie eine wandelnde Feel-Good-Pille, selbst wenn sie von ihrem Ex mit Arschloch-Tendenzen erzählt. Ich habe den Eindruck, mich mit jemandem zu unterhalten, den ich schon ewig kenne. Es fühlt sich völlig normal an, hier mit Skye zu sitzen und zu plaudern.
Jetzt sieht sie mich an und lacht auf. »Mein Gaydar! Von ›Radar‹, verstehst du?«
»Ach so«, grinse ich. Stimmt, jetzt erinnere ich mich – den Begriff hat Tim mal erwähnt. Sein Gaydar täuscht ihn angeblich auch nie – ganz im Gegensatz zu meinem, denn ich war in der Schule ein ganzes Jahr lang heimlich und unglücklich in ihn verliebt. Als mich Tim in der elften Klasse dann tatsächlich endlich gefragt hat, ob wir uns bei ihm zu Hause einen Film anschauen wollten, war ich im siebten Himmel. Doch während wir uns in seinem Zimmer bei Kartoffelchips und Gummibärchen Shakespeare in Love angesehen haben, hat sich Tim ein Herz gefasst und mir nicht etwa seine Gefühle für mich gestanden, sondern mir klargemacht, dass er Joseph Fiennes sehr viel anziehender fand als Gwyneth Paltrow. Von dem Abend an war unsere platonische Freundschaft besiegelt, und ich stand Tim wenig später seelisch zur Seite, als er sich geoutet hat.
»Mein Gaydar hat mich bisher nie getäuscht«, fährt Skye jetzt mit Nachdruck fort. »Zum Glück, darum habe ich mir bei den besonders gut aussehenden Patienten in der Notaufnahme nie umsonst Hoffnung gemacht! Und bei Glenn schlägt mein Gaydar eindeutig an, auch wenn er sich nie richtig geoutet hat. Aber mein Bruder ist ganz eindeutig zu nett, um hetero zu sein.« Sie grinst breit. »Und viel zu attraktiv! Glenn war schon immer sehr … diskret, wenn es um sein Liebesleben ging. Viel diskreter als meine Brüder – ich habe insgesamt drei, weißt du?«
»Oh, wow«, mache ich überrascht. Ich bin Einzelkind. Drei Brüder sind für mich nur schwer vorstellbar. Kein Wunder, dass Skye so voll sprudelnder Energie ist – ich kann mir lebhaft ausmalen, wie sie sich zu Hause als einzige Schwester durchsetzen musste.
»Bei Duncan und Aidan, meinen beiden älteren Brüdern, da habe ich immer gleich mitbekommen, was los war. Für welches Mädchen sie gerade schwärmten, wann sie Liebeskummer hatten, und natürlich habe ich all ihre Freundinnen kennengelernt. Aber Glenn, unser Nesthäkchen, hat nie eine Freundin mit nach Hause gebracht. Hat auch nie darüber gesprochen, für wen er sich interessiert hat. Okay, auf dem College, da hatte er kurz eine Freundin, die ich auch kennengelernt habe. Aber … ich bin davon überzeugt, dass er diese Diana nur als Alibi vorgeschoben hat, weil meine Mom und ich ihn ständig gefragt haben, ob er endlich jemand Nettes kennengelernt hätte. Dabei war Diana ganz und gar nicht nett! Sie war furchtbar, mit so einer schrecklichen Pferdelache!«
Skye fängt an, wiehernd zu lachen, und ich pruste los. »Genau.« Sie sieht mich bedeutungsschwer an. »Glenn hat wirklich jemand Besseres verdient. Irgendeinen netten, gut aussehenden schwulen Kerl!« Sie grinst breit.
»Aber … er hat dir bis heute keinen Freund vorgestellt?«, frage ich, fasziniert von diesem Glenn, den ich überhaupt nicht kenne.
»Nicht direkt.« Skye zuckt mit den Schultern. »Aber Glenn wohnt seit Jahren mit einem guten ›Freund‹ zusammen.« Sie malt mit ihren Fingern Anführungszeichen in die Luft. »Andy und er teilen sich in Halifax, der Hauptstadt unserer Provinz, eine Wohnung. Die beiden sind garantiert nicht nur platonisch befreundet. Zum einen sieht Andy auch zu gut aus, um hetero zu sein. Und als ich die zwei vor ein paar Jahren mal besucht habe, da wirkten sie wie ein altes Ehepaar. Haben gegenseitig ihre Sätze beendet, ständig über Insider-Witze gelacht, die ich nicht verstanden habe, und einmal hat Andy meinem Bruder den Rücken mit Voltaren eingecremt, weil er sich angeblich etwas gezerrt hatte. Für mich war danach klar, dass da was zwischen ihnen läuft, aber ich wollte nicht so direkt nachfragen, sondern Glenn die Chance geben, das von sich aus anzusprechen. Ich hatte immer die Hoffnung, dass er sich überwindet und Andy mit nach Whale Island bringt. Ihn uns als seinen Partner vorstellt. Aber ich fürchte, dass er sich aus irgendeinem bescheuerten Grund nicht traut, uns zu sagen, dass er schwul ist. Als ob auch nur einer in unserer Familie Glenn dafür verurteilen würde, wen er liebt!« Skye rollt mit den Augen. »Wirklich. Okay, mein Dad ist ziemlich konservativ, aber selbst er würde darüber hinwegkommen, wenn Glenn einen Mann nach Hause brächte. Und … Mom würde sich einfach nur für ihn freuen. Sie … sie ist einer der herzlichsten, liebevollsten Menschen, die ich kenne.«
Ich will etwas sagen, doch da merke ich, dass sich Skyes himmelblaue Augen plötzlich mit Tränen gefüllt haben und sie diskret nach unten sieht und dabei mehrmals blinzelt. Überrascht setze ich mich ein wenig aufrechter hin. »Hey, was ist los?«, frage ich besorgt.
»Ach, meine Mom … Sie ist heute Morgen mit einem Herzinfarkt in diese Klinik gebracht worden«, sagt sie heiser und wischt sich mit dem Ärmel ihrer Schwesternuniform über die Augen.
»Wie bitte? Und das erzählst du erst jetzt?« Erschüttert starre ich sie an. Da habe ich mich gefragt, warum Skye den ganzen Tag nicht bei mir vorbeigeschaut hat … und dabei musste sie nicht nur ihrem Ex aus dem Weg gehen, sondern hatte noch dazu ihr ganz eigenes familiäres Drama in diesem Krankenhaus!
»Ja, ich … ich wollte selbst gern ein bisschen an etwas anderes denken«, erwidert Skye mit einem schiefen Lächeln.
»Geht es ihr gut?«, frage ich tonlos, weil ich mich noch so gut daran erinnern kann, wie es ist, in einem Krankenhaus um das Leben seiner Mutter zu bangen. Auch nach zwanzig Jahren weiß ich das noch.
»Ja, zum Glück«, schnieft Skye, und ich atme erleichtert auf. »Ihr wurde vor ein paar Stunden ein Stent gesetzt und der Eingriff ist gut verlaufen. Sie wird es schaffen, meinten die Ärzte. Es war trotz allem ein riesiger Schock, heute Vormittag die eigene Mutter als Patientin in der Notaufnahme zu haben.«
»Du Arme«, sage ich leise. »Ich kann das sehr gut nachvollziehen.«
Skye tupft sich einmal mehr unter den Augen entlang und strafft entschlossen die Schultern.
»So, genug geweint«, sagt sie dann energisch und zieht eine Packung aus ihrer Handtasche. Es sind Pralinen, stelle ich gerührt fest. Und jetzt zaubert sie noch eine Frauenzeitschrift hervor und legt mir beides auf die Bettdecke.
»Noch einmal alles Gute zum Geburtstag, Viola«, sagt sie feierlich und lächelt mich warm an.
»Danke«, stammele ich verblüfft. »Das war doch nicht nötig. Wir … wir kennen uns doch eigentlich kaum.«
»Da hast du recht, und das mache ich sicher nicht bei allen Patienten«, lacht Skye unbekümmert auf. »Allerdings haben auch nicht so viele Patienten, die ich in der Notaufnahme behandele, Geburtstag. Okay, letzten Monat war einer da, der sich beim Anschneiden seiner Geburtstagstorte so blöd in die Hand geschnitten hat, dass er ziemlich viel Blut verloren hat. Aber … das war zum Glück eine Ausnahme!« Sie lacht erneut, und auch ich muss kichern.
Da wird Skye allerdings wieder ernst und fügt nachdenklich hinzu: »Aber … bei dir hatte ich vom ersten Moment an das Gefühl, dass du anders bist. Besonders irgendwie. Frag mich nicht, warum. Vielleicht liegt es daran, dass Rae dich gefunden hat – sie ist immerhin auch besonders.«
Skye grinst mich schief an, und ich grinse zurück, während meine Gedanken wieder zu der rätselhaften Rothaarigen wandern. Da fällt mir Skyes Bemerkung von heute Nacht ein – »Bestimmt kein Zufall!« –, und ich will sie fragen, was es eigentlich mit dieser fahrenden Bibliothekarin auf sich hat, als sie mir mit ihrer nächsten Frage zuvorkommt:
»Wohin warst du eigentlich unterwegs, als du fast mit dem Elch zusammengestoßen wärst?«
Ich greife nach der Packung Pralinen und beginne, die Folie abzuknibbeln, während ich antworte: »Ich war seit Mitte Juni auf einer ›Coast-to-coast‹-Reise durch Kanada, von der Westküste bis zur Ostküste, und Nova Scotia ist meine letzte Station.«
»Du bist ganz allein unterwegs?«, unterbricht mich Skye überrascht, und ich nicke, während ich den Deckel der Packung öffne.
»Ganz allein, ja. Praline?« Ich halte ihr die Auswahl an Pralinen unter die Nase, und Skye seufzt leise auf.
»Eigentlich habe ich mir vorgenommen, nicht mehr so viel Süßes zu essen, aber … was soll es. Auf dich, Viola.« Sie hält die Praline in die Höhe, als würde sie mir zuprosten, und ich greife ebenfalls nach einer, halte sie auch kurz hoch und stecke sie mir dann genüsslich in den Mund.
»Das Leben ist viel zu kurz, um auf so etwas zu verzichten«, bemerke ich mit vollem Mund, und einmal mehr schießt mir der Gedanke durch den Kopf: Ich bin nicht gestorben. Ich bin fünfunddreißig, und ich lebe noch!
»Apropos«, sagt Skye und leckt sich ein wenig Schokolade vom Zeigefinger. »Gestern Nacht in der Notaufnahme, da … also, da hast du so Bemerkungen gemacht, als wenn du davon überzeugt gewesen wärst, dass …«
»… dass ich den Unfall eigentlich nicht hätte überleben können?«, vollende ich vorsichtig ihren Satz, und Skye nickt.
»Ja. Ganz genau.«
»Das ist eine lange Geschichte«, murmele ich und greife nach einer weiteren Praline. »Dafür brauche ich Stärkung. Musst du gar nicht zurück zur Arbeit?«
»Nein, ich habe den restlichen Tag frei, wegen meiner Mom«, sagt Skye und sieht auf ihre Armbanduhr. »Ich gehe gleich zurück zu ihr … sie liegt auf der Kardiologie, eine Etage über uns.« Sie deutet an die Decke und greift dann ebenfalls nach einer weiteren Praline. »Aber du wolltest von dir erzählen. Warum um alles in der Welt dachtest du, du würdest sterben?«
»Also«, beginne ich langsam und frage mich, wie weit ich mit meiner Geschichte ausholen soll, als es plötzlich an der Tür klopft. »Ja?«, rufe ich, und die Tür geht einen Spalt weit auf. Ein Mann lugt vorsichtig herein.
4
Stumm starre ich den Fremden an und fürchte im ersten Moment, dass dieser Chefarzt mit Arschloch-Tendenzen doch noch im Dienst ist und mich nun untersuchen wird. O mein Gott, wenn das Dr. Jeff Montgomery ist, den Skye eben erwähnt hat, dann verstehe ich, dass sie ihm nach wie vor hinterherzutrauern scheint – das zumindest glaube ich vorhin an ihrem Gesichtsausdruck abgelesen zu haben. Denn, Halleluja, im Türrahmen meines Krankenzimmers steht der absolut attraktivste Mann, den ich je gesehen habe. Oder liegt es vielleicht an meiner Gehirnerschütterung, dass mich dieser Fremde so umhaut? Sein dunkelbraunes Haar ist nicht zu kurz und nicht zu lang, und ein paar unbändige Strähnen fallen ihm leicht zerzaust in die Stirn. Er hat markante Gesichtszüge, ein Grübchen im Kinn, und seine Augen sehen aus dieser Entfernung grünlich aus. Kann er bitte ein anderer Arzt sein? Bitte NICHT Dr. Jeff Montgomery? Bitte, jeder, nur nicht der blöde Ex von Skye!
»O! MEIN! GOTT!«, kreischt Skye in diesem Moment und springt so abrupt von meinem Besucherstuhl auf, dass dessen Lehne nach hinten, gegen die Wand, kippt.
Ist das etwa doch Dr. Montgomery? Aber … Skye klingt eher begeistert als entsetzt. Und, ganz ehrlich, so eine heftige Reaktion wäre bei ihrem Ex, der noch dazu Chefarzt dieser Abteilung ist, wohl ein wenig übertrieben, oder?
»Glenny!«, juchzt Skye nun, bevor sie auf den Mann zustürmt.
Glenny?
Oh. Glenn. Ihr jüngster Bruder. Der schwul ist. Natürlich. Ich versuche, meine Enttäuschung mit dem Rest Praline in meinem Mund hinunterzuschlucken.
Aber, hey – immerhin will ich mich sowieso nicht verlieben. Also kann es mir egal sein, wie attraktiv ich Skyes Bruder auf Anhieb finde. Mal ganz abgesehen davon, dass ich ohnehin nicht mehr lange hier in Kanada sein werde, schließlich bin ich schon am Ende meiner Rundreise angekommen. Mein Flug soll in vier Tagen von Halifax nach Frankfurt gehen.
Es ist das erste Mal, dass ich an meinen Flug nach Deutschland denke, denn bisher war ich mir ziemlich sicher, das Rückflugdatum nicht mehr zu erleben. Ich hatte das Flugticket ohnehin nur gebucht, weil ich sonst bei der Einreise nach Kanada Probleme bekommen hätte. Die Beamten von der Grenzkontrolle hätten sicherlich geglaubt, dass ich vorhätte, illegal in Kanada zu bleiben. Dass ich fest damit rechnete zu sterben, bevor ich länger als die erlaubten sechs Monate ohne Visum in Kanada hätte bleiben können, das hätte mir ja niemand abgenommen. Oder man hätte mich sofort zurück nach Deutschland geschickt, weil man an meiner mentalen Gesundheit gezweifelt hätte.
Ganz ehrlich: Jetzt, da ich fünfunddreißig bin und immer noch atme, frage ich mich mit einem Mal auch, warum ich die ganzen letzten Jahre so fest daran geglaubt habe, dass ich mit vierunddreißig sterben würde. Warum ich …
Nein. Nicht jetzt. Wenn ich jetzt näher darüber nachdenke, dass ich womöglich Jahre meines Lebens vergeudet habe, dann werde ich hier und jetzt wahnsinnig.
Stumm beobachte ich, wie Skye auf ihren Bruder zustürmt und sich mit einem Geräusch, das halb nach Lachen, halb nach Schluchzen klingt, in seine Arme schmeißt. Wie er sie mit beiden Armen umschlingt und sein Gesicht in ihr schwarzes Haar presst, wie er sie hochhebt und sich einmal mit ihr um die eigene Achse dreht, während Skye lachend ihre Hände in seiner dunkelbraunen Lederjacke vergräbt.
Meine Augen werden ohne Vorwarnung feucht. Die beiden scheinen sich eine Weile nicht gesehen zu haben, so wie Skye sich freut. Und Glenn auch.
»Wie konntest du so schnell hier sein?«, fragt Skye jetzt atemlos und löst sich aus der Umarmung ihres Bruders. »Bist du etwa geflogen?«
»Fast«, grinst Glenn, der seine Schwester um einen guten Kopf überragt.
»Jetzt sag bitte nicht, dass du die ganze Strecke auf dem Motorrad gekommen bist!« Skye sieht ihren jüngeren Bruder so streng an, dass mir klar wird, dass sie mit Sicherheit immer schon die Beschützerrolle gespielt hat.
»Doch, Ma’am. Und ich habe mich hin und wieder auch an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten.«
»Hin und wieder! Glenn!« Als Skye empört schnauft, lächelt ihr Bruder amüsiert. Dann aber wird er ernst und sagt mit rauer Stimme: »Ich … wollte mich beeilen. Die ganze Fahrt über dachte ich … was, wenn ich zu spät komme?«
Skye starrt ihren Bruder stumm an, bevor sie erneut die Arme um ihn schlingt und ihn fest an sich zieht. Während sie ihren Kopf gegen seinen Oberkörper presst, sieht Glenn mich über ihren schwarzen Haarschopf hinweg fast verlegen an. Schließlich löst er sich sanft von Skye und räuspert sich, ohne seinen Blick von mir abzuwenden. Himmel, diese Augen. Muss er so faszinierende Augen haben? Ich kann aus dieser Entfernung immer noch nicht genau ihre Farbe erkennen, aber … sie lassen mich nicht mehr los, diese Augen. Der Mann zieht mich in seinen Bann, ohne dass ich auch nur ein Wort mit ihm gewechselt hätte. Jetzt sieht er wieder seine Schwester an, die sich eine Träne von der Wange wischt, und sagt: »Ich wollte euch nicht stören. Mom hat erwähnt, dass du hier unten bei einer Patientin bist. Allerdings eher privat, weil du nicht mehr im Dienst bist?«
»Genau«, erwidert Skye und wirft mir einen flüchtigen Blick zu, bevor sie aufgeregt nachhakt: »Du warst also schon bei Mom? Ach so, klar, sonst hättest du mich wohl nicht hier aufgestöbert.«
Glenn nickt mit einem schiefen Lächeln. »Ich bin so froh, dass es ihr gut zu gehen scheint. Also … den Umständen entsprechend zumindest.«
»Ja«, haucht Skye. »Du kannst dir nicht vorstellen, was Mom uns heute Morgen für einen Schrecken eingejagt hat.«
»Doch, das kann ich«, erwidert Glenn leise. Einen Moment lang sehen die Geschwister sich ernst an. Dann nimmt Glenn das Gesicht seiner Schwester in beide Hände und sagt mit einem jungenhaften Lächeln, das mir gefährlich gut gefällt: »Du bist keinen Tag älter geworden, seit ich dich zum letzten Mal gesehen habe, Scarlett.«
»Scarlett?«, kann ich mir nicht verkneifen, verdutzt zu fragen. Hatte ich ihren Namen – Skye? – etwa falsch verstanden? Meine Gehirnerschütterung lässt mich immer mehr an mir und meinem gesunden Menschenverstand zweifeln.
Da sehen mich beide an, und mit einem Lachen stellt die sympathische Krankenschwester, die ich kaum kenne und die mir in der letzten halben Stunde dennoch so merkwürdig vertraut geworden ist, klar: »Ach, so nennt mich dieser Kerl gern. Weil ich angeblich so anstrengend sein kann wie Scarlett O’Hara.«
»Starrköpfig, nicht anstrengend«, bemerkt Glenn mit einem gutmütigen Schmunzeln.
»Wie auch immer«, entgegnet Skye. »Er nennt mich so, seit ich elf war und er zehn, weil wir da zum ersten Mal Vom Winde verweht geschaut haben.«
»Und du verkündet hast, Rhett Butler heiraten zu wollen«, ergänzt Glenn, woraufhin Skye mit einem Augenrollen sagt: »Mein Gott, ja, jeder hat mal Phasen mit merkwürdigem Geschmack in seinem Leben, oder? Ich fand auch mal Leo DiCaprio heiß. So viel dazu. Nur du …« Sie sieht ihren Bruder nachdenklich an und meint dann: »Du hast immer nur für Bücher geschwärmt. Nachdem wir Vom Winde verweht geguckt hatten, hast du den Roman gelesen. Mit zehn. Und zwar gleich zweimal nacheinander. Bücher waren immer schon deine große Liebe, oder, Glenny?«
»Absolut. Irgendwann werde ich die gesammelten Werke von Shakespeare heiraten«, bemerkt Glenn trocken, was mich leise auflachen lässt. Glenn sieht mich an und grinst flüchtig.
»Himmel, ich habe euch ja noch gar nicht vorgestellt!«, fällt es Skye jetzt ein, und sie schlägt sich gegen die Stirn. »Dass du so plötzlich hier aufgetaucht bist, hat mich echt umgehauen, Glenny!« Entschlossen greift sie nach seiner Hand und zieht ihn weiter ins Zimmer, auf mein Bett zu. Befangen zupfe ich meine Haare zurecht, die sich ziemlich zerzaust anfühlen.
»Viola, darf ich vorstellen, das hier ist mein jüngerer Bruder Glenn, unser Schriftsteller aus Halifax.«
»Wow, du bist Schriftsteller?«, frage ich angetan, während mich Glenn mit einem zurückhaltenden Lächeln fast schüchtern betrachtet. Ich merke, dass er sich nicht sicher ist, ob er hier sein sollte, in diesem Krankenzimmer einer ihm völlig fremden Patientin. Dabei habe ich das skurrile Gefühl, Glenn schon gut zu kennen, nachdem Skye mir eben so viel über ihn, seine Pseudo-Ex mit dem wiehernden Lachen und seinen ›Mitbewohner‹ Andy erzählt hat.
»Ähm, ja, ich schreibe«, erwidert er und kratzt sich verlegen am Kopf, was sein dunkles Haar noch mehr durcheinanderbringt, als es ohnehin der Fall ist. »Allerdings habe ich bisher nichts veröffentlicht.«
»Noch nicht«, wirft Skye betont fröhlich ein. »Glenn wollte immer schon Bücher schreiben, und er hat diesen Traum stur verfolgt. Du wirst sehen, Glenny, irgendwann schaffst du es!«
»Mhm«, macht Glenn ausweichend und lächelt mich erneut flüchtig an. »Viola, ja? Wie aus Was ihr wollt.«
Ich nicke. »Genau. Das mit den gesammelten Werken von Shakespeare und dir scheint also wirklich etwas Ernstes zu sein.«
Glenn lacht leise. »O ja, definitiv.« Er zögert, sieht seine Schwester an und hakt nach: »Und … woher kennt ihr zwei euch?«
»Viola ist gestern Nacht in die Notaufnahme eingeliefert worden, als ich Dienst hatte. Sie hat heute Geburtstag, darum wollte ich sie noch einmal besuchen und ihr gratulieren.«
»Oh, alles Gute zum Geburtstag«, sagt Glenn in einer ruhigen, freundlichen Art, die mir sehr gut gefällt. Leider.
»Danke«, erwidere ich und fühle mich plötzlich eigenartig befangen.
»Ich hoffe, es geht dir gut? Ich meine … den Umständen entsprechend?«, fragt Glenn zögernd, und ich merke, wie sein Blick flüchtig über meinen Körper unter der Bettdecke huscht, als versuche er zu verstehen, was mich hierhergebracht haben könnte.
»Gehirnerschütterung, eine gebrochene Rippe und eine Prellung an der Schulter«, zähle ich nüchtern auf. »Dafür, dass ich fast mit einem Elch kollidiert wäre, geht es mir ziemlich gut.«
»Wow. Ein Elch, ja?« Glenn pfeift leise auf.
»Ja. Stand hinter einer Kurve plötzlich vor meinem Auto.« Bei der Erinnerung wird mir ein wenig schummerig.
»War vielleicht ein missglückter Versuch, dir zum Geburtstag zu gratulieren«, bemerkt Glenn todernst, und ich muss loslachen.
»Ja, das könnte natürlich sein. Wobei er dafür ein paar Stunden zu früh dran war.«
»Ah, Elche und Uhren, das ist so eine Sache«, murmelt Glenn, und um seine Mundwinkel zuckt ein Schmunzeln. »Die Kerle bekommen das einfach nicht hin.«
Die Art, wie er das sagt, bringt mich so sehr zum Lachen, dass mich meine gebrochene Rippe vor Schmerz zusammenzucken lässt. »Autsch«, murmele ich, und Glenn wird schlagartig ernst und mustert mich betroffen.
»Sorry, ich wollte nicht … Okay, keine Witze mehr.«
»Aber echt, Glenn, du bist unmöglich. Einfach so diese Patientin zum Lachen zu bringen«, grinst Skye und knufft ihn in die Seite. »Apropos – wir sollten dringend nach Mom sehen. Sie könnte ebenfalls ein paar deiner blöden Witze vertragen. Und sehen will sie dich bestimmt auch ausgiebig, nachdem sie dich so lange nicht zu Gesicht bekommen hat.«
»Danke, dass du mein schlechtes Gewissen noch schlimmer machst, Scarlett. Das kann keine so wie du«, knurrt Glenn und rollt mit den Augen, doch das Lächeln spielt nach wie vor um seine Mundwinkel und nimmt seinen Worten die Schärfe.
»Weiß ich doch. Dafür sind ältere Schwestern da«, kontert Skye ungerührt. Dann sieht sie mich an und fragt: »Viola, können wir dich allein lassen? Ich komme nachher noch einmal vorbei, bevor wir nach Hause fahren.«
»Schon okay«, beeile ich, mich zu sagen. »Geht zu eurer Mom, sie braucht euch jetzt.«
»Ja«, murmelt Skye und mustert mich nachdenklich. »Aber du solltest auch nicht ganz allein sein.«
»Ach, ich habe noch einige Geburtstagsnachrichten, die ich bisher nicht gelesen habe«, werfe ich betont locker ein und deute auf mein Handy. Dabei möchte ich nicht, dass Skye und Glenn gehen. Ich fühle mich in ihrer Gesellschaft so wohl, wie es mir sonst nur bei Tim und Luigi geht. Dabei kenne ich Glenn noch weniger als seine Schwester. Was ist das bloß mit diesen Camerons, das mich geradezu magisch anzieht?
»Bist du etwa ganz allein hier in Nova Scotia unterwegs?«, hakt jetzt Glenn ernst nach. »Ich meine … du bist doch … Also, du wohnst nicht hier, oder?«
Ich merke, dass er ein wenig rot wird. Das finde ich so entzückend, dass ich ihn ein paar Sekunden lang stumm anstarre, sodass Skye für mich antwortet: »Viola kommt aus Deutschland. Sie hat allein eine Reise von der Westküste bis hierher gemacht. Kannst du dir das vorstellen?«
Glenn mustert mich stumm und lächelt dann leicht. »Und auf die letzten Kilometer unseres großartigen Landes ist dir ein Elch in die Quere gekommen, ja?«
»Genau.« Ich grinse ihn breit an, und er grinst mit einem Mal ebenso breit zurück. Mein Gott, wenn er so lächelt, sieht er noch viel besser aus. Das ist nicht fair!
»Wohin wolltest du gestern Nacht noch gleich, bevor dich der Elch aus der Bahn geworfen hat?«, hakt jetzt Skye nach und mustert mich nachdenklich. »Du bist eben nicht mehr dazu gekommen, das zu erzählen, weil ein gewisser Glenn Cameron reingeplatzt kam.« Sie zwinkert ihrem Bruder liebevoll zu.
»Ich wollte eigentlich auf eine Insel hier in der Nähe – nach Whale Island. Kennt ihr die?«
5
Skye starrt mich groß an, und Glenn gibt ein leises Prusten von sich.
»Ähm, ja«, bemerkt er trocken. »Schon mal davon gehört.«
Skye rollt die Augen zur Decke und wirft ihrem Bruder einen strengen Blick zu, bevor sie an mich gewandt erklärt: »Herzchen, wir beide, wir sind auf Whale Island geboren worden, sind dort aufgewachsen, und ich für meinen Teil wohne dort noch immer, und zwar sehr, sehr gern. Ich könnte mir nicht vorstellen, jemals woanders zu leben. Ganz im Gegensatz zu gewissen Leuten, die lieber in einer stinkenden Großstadt leben.«
»Halifax stinkt nicht«, brummt Glenn.
»Ihr kommt von Whale Island?«, hake ich ungläubig nach. »Was für ein Zufall!«
»Und warum wolltest du ausgerechnet dorthin?«, fragt Glenn mich ehrlich ratlos, so als könne er sich kaum vorstellen, was eine Touristin auf seine Heimatinsel führen könnte.
»Ich habe von dem neu eröffneten Whale Sanctuary gehört – das wollte ich mir gern ansehen.«
»Ah, ja«, sagt Skye und nickt. »Die zwei Beluga-Damen Alba und Luna locken momentan ziemlich viele Besucher an.«
»Ach, richtig«, murmelt Glenn nachdenklich. »Das Whale Sanctuary habe ich auch noch nicht gesehen.«
»Wie auch?«, fragt Skye spöttisch. »Wenn du fast nie nach Hause kommst?«
Glenn hebt ergeben die Hände, als wolle er kapitulieren, und Skye sieht wieder mich an. »Also … möchtest du dir das Whale Sanctuary und den Rest von Whale Island nach wie vor anschauen, Viola?«
Ich überlege einen Moment. Möchte ich? Ja, natürlich! Immerhin hatte ich ursprünglich geplant, am Tag vor meinem Geburtstag auf Whale Island anzukommen und die Belugawale zu besuchen. Sozusagen als letzte Station meines Lebensweges. Doch ich hatte für die Strecke bis in den Norden der Insel Cape Breton länger gebraucht, als gedacht – umso mehr erstaunt es mich, wie schnell Glenn anscheinend auf seinem Motorrad von Halifax heraufgekommen ist. Ich hatte spätestens gestern Nachmittag die Fähre nach Whale Island nehmen wollen, doch als ich auf dem Weg durch den immer schwärzer werdenden Wald Richtung Scott’s Harbour und Fähranleger unterwegs war, hatte ich meinen Plan, die Insel noch lebend zu erreichen, bereits aufgegeben.
Aber jetzt, mit fünfunddreißig, habe ich wohl tatsächlich doch noch die Chance, die Belugawale und die ganze Insel zu sehen, die im Reiseführer als »charmantes Eiland im wilden Atlantik« beschrieben wurde. Diese Möglichkeit macht mich mit einem Schlag unfassbar glücklich. Ich lebe noch!
»Und ob ich das möchte«, sage ich inbrünstig, während sich ein warmes Glücksgefühl in meinem Bauch ausbreitet. »Allerdings weiß ich noch nicht, wann ich entlassen werde. Und … ich habe keinen Mietwagen mehr.«
Das Glücksgefühl lässt eine winzige Spur nach, als ich an mein Autowrack und den Papierkram mit meiner Versicherung, der mir noch bevorsteht, denken muss. Jetzt, da ich lebe, muss ich mich wohl oder übel damit auseinandersetzen.
»Also, ich habe noch einen Platz auf meinem Motorrad frei«, wirft Glenn freundlich ein, was ihm einen strengen Blick von Skye einbringt.
»Viola hat eine gebrochene Rippe und eine Gehirnerschütterung«, erinnert sie ihn. »Und Gepäck. Hast du eigentlich keinen Koffer dabei?«
»Einen Rucksack«, bemerkt Glenn schlicht. »Steht bei Mom im Zimmer.«
»Also«, sagt Skye und sieht mich entschlossenen an. »Ich rede mit dem Arzt und bekomme heraus, wann du entlassen wirst. Die werden dich bestimmt nur noch eine Nacht hier behalten – dann könnten wir dich morgen mit auf die Insel nehmen. In meinem Auto, Glenn.«
»Okay«, grinst Glenn, und ich kann mir den Gedanken nicht verkneifen, dass ich sehr gern auf seinem Motorrad mitgefahren wäre.