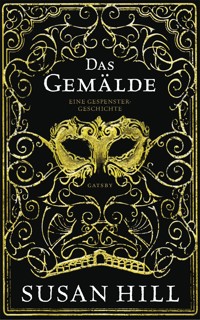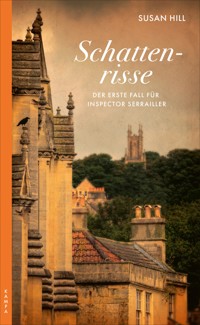Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: EIn Fall für Inspector Serrailler
- Sprache: Deutsch
Der neunjährige David wartet vor dem Haus seiner Eltern im englischen Städtchen Lafferton darauf, zur Schule abgeholt zu werden, doch dort kommt er nie an. Für Detective Chief Inspector Simon Serrailler entwickelt sich der Fall zum Albtraum: Die Ermittlungen scheinen im Sande zu verlaufen. Ist der Junge entführt worden? Ist er tot? Serrailler muss hilflos mit ansehen, wie Davids Familie an der Katastrophe zu zerbrechen droht. Dann verschwindet im Nachbarort ein weiteres Kind. Und auch privat kommt Serrailler nicht zur Ruhe: Der Tod seiner Kollegin Freya Graffham ist ihm nähergegangen als erwartet. Serrailler fährt nach Venedig, um auf andere Gedanken kommen, aber er muss die Reise abbrechen: Seine schwerbehinderte Schwester Martha liegt auf der Intensivstation und ringt mit dem Tod. Zu allem überfluss taucht dann auch noch eine Frau aus Serraillers Vergangenheit auf ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susan Hill
Herzstiche
Der zweite Fall für Inspector Serrailler
Aus dem Englischen von Susanne Aeckerle
Kampa
Für meine überall verstreuten Maulwürfe
Selig sind, die reinen Herzens sind,
denn sie werden Gott schauen.
Matthäusevangelium
1
Im Frühlicht lag der Nebel weich und rauchig über der Lagune, und es war noch so kühl, dass Simon Serrailler froh um seine gefütterte, wasserabweisende Jacke war. Wartend stand er auf der leeren Fondamenta, den Kragen hochgeschlagen, eingehüllt in die gedämpfte Stille. Bei Tagesanbruch an einem Sonntagmorgen im März tat sich kaum etwas in diesem Teil Venedigs, in den nur wenige Touristen kamen; Sonntag war Ruhetag, und sogar die frühen Kirchgänger waren noch nicht auf den Beinen.
Er mietete hier stets dieselben zwei Zimmer über dem leeren Lagerhaus seines Freundes Ernesto, der jeden Moment anlegen würde, um Simon auf die andere Seite der Lagune zu bringen. Die Zimmer waren gemütlich und schlicht, erfüllt vom wunderbaren Licht des Wassers und des Himmels. Nachts war es ruhig, und von der Fondamenta aus konnte Simon an den abgelegenen Kanälen entlangwandern und nach Motiven für seine Zeichnungen Ausschau halten. In den vergangenen zehn Jahren war er mindestens einmal, wenn nicht zweimal pro Jahr hier gewesen. Es war sowohl Arbeitsplatz wie auch Schlupfloch aus seinem Leben als Detective Chief Inspector, genauso wie es ähnliche Zufluchtsorte in Florenz und Rom gab. In Venedig fühlte er sich am meisten zu Hause, deshalb kehrte er immer wieder hierher zurück.
Das Tuckern eines Motors kündigte das Boot an, das gleich darauf neben ihm aus dem silbrigen Nebel auftauchte.
»Ciao.«
»Ciao, Ernesto.«
Das Boot war klein und zweckmäßig, ohne die romantischen Verzierungen traditioneller venezianischer Gondeln. Simon verstaute seine Segeltuchtasche unter dem Sitz und stellte sich neben den Bootsführer, der wendete und über das offene Wasser preschte. Der Nebel legte sich wie Spinnweben auf ihre Gesichter und Hände, und Ernesto verlangsamte für eine Weile die Fahrt, bis sie plötzlich eine Schneise durch den Dunstschleier zu schlagen schienen und in ein diesiges, gelbliches Licht gelangten, in dem Simon die vor ihnen liegende Insel erkennen konnte.
Er war schon mehrmals auf San Michele gewesen, war herumgewandert, hatte Eindrücke in sich aufgenommen – eine Kamera benutzte er nie –, und er wusste, dass er die Insel mit etwas Glück um diese Uhrzeit für sich allein haben würde, selbst ohne die schwarz gekleideten, arthritischen Witwen, die hier ihre Familiengräber in Ordnung hielten.
Ernesto sagte nicht viel. Er war kein redseliger Italiener. Er war Bäcker, arbeitete nach wie vor in der höhlenartigen Backstube, wie Generationen seiner Familie zuvor, und lieferte immer noch selbst das frische, warme Brot an den Kanälen aus. Aber er würde der Letzte seiner Familie sein, sagte er jedes Mal, wenn Simon kam; seine Söhne hatten kein Interesse, studierten in Padua und Genua, und seine Tochter war mit dem Geschäftsführer eines Hotels in der Nähe von San Marco verheiratet. Wenn Ernesto mit dem Backen aufhörte, würden die Öfen erkalten.
Die Lagunenstadt veränderte sich, venezianische Traditionen verschwanden, die Jugend blieb nicht, machte sich nichts aus dem harten Alltagsleben auf den Booten. Venedig würde bald sterben. Simon fand das schwer zu glauben, konnte die Prophezeiungen des nahenden Untergangs nicht recht ernst nehmen, wo doch die alte, magische Stadt immer noch da war, nach Tausenden von Jahren und trotz aller düsteren Vorhersagen, die über der Lagune schwebten.
Irgendwie, in irgendeiner Form würde die Stadt überleben, auch das echte Venedig, nicht nur die überfüllten und teuren Touristenviertel. Die Menschen, die an den abgelegeneren Wasserarmen jenseits der Zattere und der Fondamenta und an den Kanälen hinter dem Bahnhof lebten und arbeiteten, würden das auch noch in hundert Jahren tun, einander stützen und ihre Dienste in den Hotels und Touristenvierteln anbieten.
»Venedig stirbt«, wiederholte Ernesto jedoch, deutete auf San Michele, die Insel der Toten, bald würde das alles so sein, ein einziger großer Friedhof.
Sie legten am Landungssteg an, und Simon stieg mit seiner Tasche aus.
»Mittags«, sagte Ernesto. »Gegen zwölf.«
Simon winkte und ging zum Friedhof mit den gepflegten Wegen und den reich verzierten Marmorgrabmälern.
Das Motorengeräusch verklang fast sofort, worauf Simon nur noch seine eigenen Schritte, ein wenig Vogelgezwitscher und sonst nichts als die außerordentliche Stille vernahm.
Er hatte recht behalten. Niemand war hier – keine gebückten alten Frauen mit schwarzen Kopftüchern, keine Familien mit kleinen Jungs in langen Hosen und mit bunten Blumensträußen in der Hand, keine Gärtner, die Unkraut aus dem Kies zupften.
Es war immer noch kühl, aber der Nebel hatte sich gehoben, und die Sonne ging auf.
Vor zwei Jahren war ihm das Grabmal zum ersten Mal aufgefallen, und er hatte es im Hinterkopf behalten, doch in diesem Jahr war er hauptsächlich an den Marktständen gewesen, hatte die Berge von Obst, Fisch und Gemüse gezeichnet, die Menschen beim Einkaufen, die Standbesitzer, und er hatte weder Zeit noch Energie gehabt, sich auf die Friedhofsinsel einzulassen.
Er erreichte das Grabmal und blieb stehen. Es war von einem Engel mit gefalteten Schwingen gekrönt, an die drei Meter hoch, umgeben von drei Kerubim, alle mit gebeugten Köpfen und trauerndem Ausdruck, alle ernst, unbewegt schön. Obwohl in der Darstellung idealisiert, war sich Simon sicher, dass die Figuren nach lebenden Vorbildern gestaltet worden waren. Auf dem Grabstein stand die Jahreszahl 1822, die Gesichter der Engel waren typisch venezianisch, Gesichter, wie man sie noch heute sah, bei älteren Männern auf dem Vaporetto ebenso wie bei den jungen Männern und Frauen, die in ihrer Designerkleidung am Wochenende abends auf der Riva degli Schiavoni promenierten. Man sah solche Gesichter auf den großartigen Gemälden in den Kirchen, als Kerubim und Heilige und Jungfrauen und Prälaten und bei den einfachen Bürgern, die zu ihnen hinaufblickten. Simon war davon fasziniert.
Er fand einen Sitzplatz auf dem Rand eines benachbarten Grabmals und holte Zeichenblock und Bleistifte heraus. Er hatte auch eine Thermoskanne mit Kaffee und etwas Obst dabei. Es war immer noch diesig und nicht warm. Aber in den nächsten drei Stunden würde er ganz von seiner Arbeit in Anspruch genommen sein, sie nur gelegentlich unterbrechen, um sich auf den Friedhofswegen die Beine zu vertreten. Um zwölf würde Ernesto ihn wieder abholen. Simon würde seine Sachen in die Wohnung bringen, dann auf einen Campari und etwas zu essen in seine Stammtrattoria gehen. Später würde er ein wenig schlafen, bevor er einen Spaziergang in den geschäftigeren Teilen der Stadt machte, vielleicht mit dem Vaporetto den Canal Grande hinauf- und hinunterfahren, nur um es zu genießen, zwischen den alten, zerfallenden, vergoldeten Häusern auf dem Wasser zu sein und zu sehen, wie die Lichter angingen.
Seine Tage waren fast unterschiedslos. Er zeichnete, ging spazieren, aß und trank, schlief, schaute. Er dachte nicht viel an zu Hause und sein anderes Arbeitsleben.
Doch diesmal …
Er wusste, warum es ihn nach San Michele und zu den Statuen der trauernden Engel zog, aus demselben Grund, aus dem er die dunklen, weihrauchgeschwängerten kleinen Kirchen in abgelegenen Ecken der Stadt aufgesucht hatte, herumgegangen war und dieselben alten Witwen in Schwarz mit ihren Rosenkränzen hatte knien oder Kerzen anzünden sehen.
Der Tod von Freya Graffham, die unter seiner Leitung als Detective Sergeant nur so kurze Zeit im Polizeirevier von Lafferton gearbeitet hatte, war ihm viel nähergegangen, als er erwartet hatte. Seit ihrer Ermordung war ein Jahr vergangen, und die entsetzliche Tat verfolgte ihn immer noch ebenso wie die Tatsache, dass sie seine Gefühle auf eine Art angesprochen hatte, die er sich vor ihrem Tod nicht hatte eingestehen wollen.
Simons Schwester Cat Deerborn hatte gesagt, er erlaube sich nur, tiefer für Freya zu empfinden, weil sie tot sei und deshalb unfähig zu reagieren und daher keine Bedrohung mehr darstellte.
Hatte er sich bedroht gefühlt? Er wusste, was seine Schwester meinte, aber vielleicht war das bei Freya anders gewesen.
Simon verlagerte das Gewicht und verschob den Skizzenblock auf den Knien. Er zeichnete nicht die ganze Statue, sondern einzeln die Gesichter des Engels und der Kerubim; er wollte noch einmal wiederkommen, um das Grabmal als Ganzes zu zeichnen und dann an jeder Zeichnung zu arbeiten, bis er zufrieden war. Seine nächste Ausstellung würde die erste in London sein. Alles musste stimmen.
Eine halbe Stunde später stand er auf, um sich die Beine zu vertreten. Der Friedhof lag immer noch verlassen, und die Sonne stand jetzt höher am Himmel, wärmte sein Gesicht, als er den Pfad zwischen den schwarzen, weißen und grauen Grabsteinen entlangging. Während dieses besonderen Venedigaufenthalts hatte Simon sogar mehrfach überlegt, ob er nicht ganz hierherziehen sollte. Er hatte seinen Beruf immer mit Leidenschaft ausgeübt – als Einziger seiner Familie, die seit drei Generationen Ärzte waren, hatte er einen abweichenden Weg eingeschlagen –, aber die Anziehungskraft eines anderen Lebens, das Zeichnen und vielleicht ein Leben im Ausland, um sich dem ganz zu widmen, war seit Freyas Tod zunehmend stärker geworden.
Er war fünfunddreißig. Nicht mehr lange, und er würde zum Superintendent befördert werden. Was er auch wollte. Was er nicht wollte.
Er kehrte zu den trauernden Engeln zurück. Doch der Pfad war nicht mehr leer. Ernesto kam auf ihn zu und hob den Arm, als er Simon sah.
»Ciao – ist was passiert?«
»Ich komme dich abholen. Da war ein Anruf.«
»Aus dem Revier?«
»Nein, von der Familie. Dein Vater. Er will, dass du ihn sofort zurückrufst.«
Simon verstaute Block und Bleistifte wieder in der Segeltuchtasche und folgte Ernesto rasch zum Landungssteg.
Ma, dachte er, ihr ist etwas passiert. Seine Mutter hatte vor zwei Monaten einen leichten Schlaganfall gehabt, die Folge von zu hohem Blutdruck und zu viel Stress, aber sie hatte sich gut erholt, und es waren anscheinend keine Nachwirkungen zurückgeblieben. Cat hatte ihm gesagt, es gebe keinen Grund, seine Reise abzublasen. »Ihr geht’s gut, es war kein schwerer Anfall, Si. Es gibt keinen Grund, warum sie noch einen haben sollte. Außerdem, wenn was wäre, könntest du schnell genug zurück sein.« Und genau das musste er tun, dachte er, als er neben Ernesto über das inzwischen sonnengesprenkelte Wasser zurückfuhr.
Überraschend war nur, dass nicht Cat, sondern sein Vater angerufen hatte. Richard Serrailler missbilligte Simons Berufsentscheidung, sein künstlerisches Schaffen, sein Junggesellenleben – kurz, alles an ihm.
»Klang er besorgt?«
Ernesto zuckte die Schultern.
»Hat er meine Mutter erwähnt?«
»Nein. Nur, dass du anrufen sollst.«
Das Motorboot schoss auf die Fondamenta zu, wendete geschickt und hielt an.
Simon legte Ernesto die Hand auf den Arm. »Du bist ein guter Freund. Danke, dass du mich abgeholt hast.«
Ernesto nickte nur.
Simon rannte die Treppe vom leeren Lagerhaus in seine Räume hinauf und warf Tasche und Jacke auf den Boden. Die Telefonverbindung hatte sich seit Einführung des digitalen Telefonnetzes verbessert, und er hörte das Tuten in Hallam House.
»Serrailler.«
»Ich bin’s, Simon.«
»Ja.«
»Geht es Mutter gut?«
»Ja. Ich habe wegen deiner Schwester angerufen.«
»Cat? Was ist passiert?«
»Martha. Sie hat eine Lungenentzündung. Man hat sie ins Kreiskrankenhaus von Bevham gebracht. Wenn du sie noch lebend sehen möchtest, solltest du nach Hause kommen.«
»Selbstverständlich, ich …«
Aber das Telefon war tot. Richard Serrailler verschwendete keine Worte, schon gar nicht an seinen Polizistensohn.
Es gab einen Abendflug nach London, aber Simon musste erst eine halbe Stunde telefonieren und dann noch einen Bekannten bei der italienischen Polizei um Hilfe bitten, damit er einen Platz bekam. Der Rest des Tages verging mit Packen und dem Aufräumen der Wohnung. Ernesto brachte ihn zum Flughafen, daher kam Simon erst in dem voll besetzten Flugzeug zum Nachdenken. Und er hatte vorher tatsächlich nicht nachgedacht. Der Anruf seines Vaters war ein Befehl gewesen, und Simon hatte ohne Fragen gehorcht. Sein Verhältnis zu Richard Serrailler war so schlecht, dass Simons Verhalten vergleichbar war mit dem gegenüber seinen Vorgesetzten bei der Polizei und genauso emotionslos.
Er saß über der Tragfläche, hatte daher wenig Möglichkeit, beim Start auf die Lagune hinunterzuschauen, was ihm ganz recht war, da er Venedig, seinen Zufluchtsort, seine Arbeit und seine ruhigen, abgeschiedenen Räume diesmal noch weniger gern als sonst verlassen hatte. Durch die Stadt zu gehen, über die Brücken und die Plätze, unter den schmalen kleinen Durchgängen zwischen den hohen alten Häusern zu sitzen, zu schauen und zu zeichnen, sich mit Ernesto und seinen Freunden abends bei einem Glas Wein zu unterhalten – das war ein ganz anderer Simon Serrailler als der DCI in Lafferton, mit einem anderen Lebensstil, anderen Interessen und vollkommen veränderten Prioritäten. Während der Reise bewegte er sich von dem einen zum anderen, aber heute wurde er ohne den üblichen entspannten Übergang in sein Alltagsleben zurückgeschleudert.
Die Anschnallzeichen waren erloschen, und der Getränkewagen wurde durch den Gang geschoben. Simon bat um einen Gin Tonic und eine Flasche Mineralwasser.
Simon Serrailler war ein Drilling. Seine Schwester Cat, eine praktische Ärztin, war die Zweite, ihr Bruder Ivo, Arzt in Australien, der Dritte. Martha war zehn Jahre später zur Welt gekommen, als Richard und Meriel Serrailler Mitte vierzig waren; sie war geistig und körperlich schwerstbehindert und hatte den größten Teil ihres Lebens in einem Pflegeheim verbracht. Martha würde Simon erkennen oder auch nicht. Das wusste keiner.
Der Anblick seiner Schwester bewegte ihn immer zutiefst. Mal lag sie im Bett, mal saß sie im Rollstuhl, ihr Körper aufgerichtet und angeschnallt, ihr Kopf abgestützt. Bei gutem Wetter schob er sie in den Garten und auf den Wegen zwischen den Büschen und Blumenbeeten hindurch. Sonst saßen sie in ihrem Zimmer oder in einem der Aufenthaltsräume. Es gab nichts, was er ihr mitbringen konnte. Er redete mit ihr, hielt ihre Hand und küsste sie, wenn er kam und wieder ging.
Über die Jahre hatte er sich weniger Gedanken darüber gemacht, ob sie ihn erkannte oder etwas von seiner Gesellschaft hatte, und auch falls seine Besuche für sie keine Bedeutung hatten, wurden sie für ihn wichtig, in ähnlicher Weise wie seine Besuche in Italien. Bei Martha war er jemand anderer. Die Zeit, die er neben ihr verbrachte, ihre Hand hielt, nachdachte, leise redete, ihr half, durch den Strohhalm zu trinken oder vom Löffel zu essen, erfüllte und beruhigte ihn und führte ihn von allem anderen in seinem Leben fort.
Sie war mitleiderregend, hässlich, sabbernd, kommunikationsunfähig, kaum ansprechbar, und als Junge hatte er sie peinlich gefunden und sich unbehaglich gefühlt. Martha hatte sich nicht verändert. Er hatte sich verändert.
Seine Eltern erwähnten sie gelegentlich, aber über ihre Situation wurde weder ausführlich noch im Detail gesprochen, und die Gespräche blieben stets gefühllos. Was empfand seine Mutter für sie, und wie dachte sie über Martha? Sein Vater besuchte Martha regelmäßig, sprach jedoch nie darüber.
Wenn es ihr schlecht ging, wurde ihr Zustand immer sehr rasch akut, und doch hatte sie fünfundzwanzig Jahre lang überlebt. Erkältungen führten zu Bronchitis und dann zu Lungenentzündung. »Wenn du deine Schwester noch lebend sehen willst …« Aber all das war schon öfter passiert. Würde sie diesmal sterben? War er deswegen traurig? Wie konnte er? Wie konnte das überhaupt jemand? Wünschte er sich ihren Tod? Simon war verwirrt. Aber er musste darüber reden. Sobald er in Heathrow gelandet war, würde er Cat anrufen.
Er trank noch einen Schluck Gin. Im Gepäckfach über seinem Kopf lagen zwei Skizzenblöcke voll neuer Zeichnungen, aus denen er die besten aussuchen würde, um sie für die Ausstellung fertigzustellen. Vielleicht hatte er doch genug zusammen und hätte in den zusätzlichen fünf Tagen in Venedig nur noch herumgelungert.
Als sein Drink leer war, zog er einen kleinen Skizzenblock heraus, den er immer bei sich trug, und zeichnete die kunstvoll geflochtenen, mit Perlen verzierten Zöpfe der jungen Afrikanerin im Sitz vor ihm.
Das Flugzeug flog dröhnend über die Alpen.
2
»Ich bin’s.«
»Hallo!« Erfreut wie immer, die Stimme ihres Bruders zu hören, machte sich Cat Deerborn für einen gemütlichen Plausch bereit. »Warte mal, Si, ich muss mich bloß noch richtig hinsetzen.«
»Geht’s dir gut?«
»Alles prima, ich weiß nur nicht mehr, wie ich es mir bequem machen soll.«
Cats Baby, ihr drittes Kind, sollte in wenigen Wochen zur Welt kommen.
»Okay, besser krieg ich es nicht mehr hin … Aber hör zu, es kostet doch ein Vermögen, per Handy aus Italien anzurufen, soll ich dich zurückrufen?«
»Ich bin in Heathrow.«
»Was …?«
»Dad hat angerufen. Er hat gesagt, ich solle lieber nach Hause kommen, wenn ich meine Schwester noch lebend sehen will.«
»Oh, sehr taktvoll ausgedrückt.«
»Wie immer.«
»Ma und ich hatten beschlossen, es dir nicht zu sagen.«
»Warum?«
»Weil du den Urlaub dringend nötig hattest und es nichts gibt, was du tun kannst. Martha erkennt dich sowieso nicht …«
»Aber ich sie.«
Cat verstummte.
Dann sagte sie: »Natürlich. Entschuldige.«
»Lass nur. Hör zu, ich werde erst spät ankommen und fahre dann direkt ins Krankenhaus.«
»Gut. Chris ist bei einem Hausbesuch, aber es kann gut sein, dass er auch noch vorbeischaut, wenn er in der Gegend ist. Kommst du morgen zu uns raus? Ich kriege meinen dicken Bauch nicht mehr hinters Steuer.«
»Was ist mit Ma?«
»Ich weiß einfach nicht, was sie empfindet, Si, du kennst das ja. Sie geht ins Krankenhaus. Sie geht nach Hause. Manchmal kommt sie zu uns, aber sie spricht nicht darüber.«
»Was ist denn genau passiert?«
»Das Übliche – Erkältung, dann Bronchitis, dann Lungenentzündung … Wie oft haben wir das jetzt schon durchgemacht? Ich glaube allerdings nicht, dass ihr Körper noch dagegen ankämpfen kann. Sie hat kaum auf die Behandlung reagiert, und Chris sagt, sie überlegen jetzt, wie aggressiv sie vorgehen sollen.«
»Arme kleine Martha.«
Die Stimme ihres Bruders, besorgt und zärtlich, hallte in Cats Ohr wider, als sie auflegte. Tränen traten ihr in die Augen, wie so häufig während der Schwangerschaft … Selbst der Anblick eines der Plüschtiere ihrer Tochter, das aufgeweicht im regennassen Gras lag, hatte Cat an diesem Nachmittag zum Weinen gebracht. Unbeholfen stemmte sie sich vom Sofa hoch. Sie hatte es vergessen. Hatte fast alles darüber vergessen, wie es einem in der Schwangerschaft ging. Sam war jetzt achteinhalb und Hannah sieben. Das dritte Kind war nicht geplant gewesen. Chris und sie führten zu zweit eine Hausarztpraxis und waren bis an die Grenzen ihrer Zeit und Energie ausgelastet. Aber obwohl sie so rasch wie möglich wieder Sprechstunden abhalten wollte, wusste Cat, dass sie, realistisch betrachtet, für die nächsten sechs Monate größtenteils ausfallen und das Jahr danach nur halbtags würde arbeiten können. Außerdem gewann sie, je näher die Entbindung rückte, zunehmend Gefallen an der Vorstellung, Zeit mit dem Baby zu Hause verbringen, den anderen beiden mehr Zeit widmen zu können und nicht schon so schnell zu der anstrengenden Schinderei in einer Arztpraxis zurückkehren zu müssen. Ein viertes Kind würde es nicht geben. Dieses hier war kostbar. Sie würde die Zeit genießen.
Sie lag auf dem Sofa und versuchte zu schlafen, konnte aber ihre Gedanken nicht abstellen. Wie seltsam und doch typisch von ihrem Vater, in Venedig anzurufen, mit solchen Worten. »Wenn du deine Schwester noch lebend sehen willst, solltest du besser nach Hause kommen.«
Und wie oft besuchte er Martha? Cat hatte ihn nur selten den Namen ihrer Schwester aussprechen hören, und er hatte sie einst wütend gemacht, als er Martha in Gegenwart von Sam und Hannah »den Krüppel« genannt hatte. Schämte er sich dafür, ein gehirngeschädigtes Kind zu haben? Oder war er wütend? Warf er es sich selbst oder Meriel vor?
Und aus welchem Grund hatte er Simon angerufen, das andere Kind, für das er nichts übrighatte?
Simon, Cats Drillingsbruder, der Mensch, den sie, neben ihrem Mann und ihren Kindern, am meisten liebte.
Der Kater Mephisto tauchte aus dem Nichts auf, sprang auf das Sofa neben sie und rollte sich zusammen.
Und dann schliefen sie alle drei ein.
3
Die Straßen waren dunkel und fast leer, obwohl es noch vor zehn war. Nur das Kreiskrankenhaus Bevham war hell erleuchtet, und als Simon Serrailler in die Einfahrt bog, wurde er von einem Krankenwagen mit heulenden Sirenen überholt, der auf die Notaufnahme zuraste.
Simon hatte immer gerne nachts gearbeitet, schon vom ersten Tag als uniformierter Constable an, und er mochte es auch jetzt noch, wenn er gelegentlich nächtliche Einsätze leitete. Ihn befeuerte das Gefühl der Dringlichkeit, die Art, wie sich alles verschärfte, jede Bewegung und jedes Wort bedeutsam zu sein schienen, aber auch die merkwürdige Nähe, erzeugt durch das Wissen, dass sie eine wichtige und manchmal gefährliche Arbeit leisteten, während der Rest der Welt schlief.
Auf dem halb leeren Parkplatz stieg er aus und schaute zu dem großen Klotz des Krankenhauses, neun Stockwerke hoch und mit mehreren niedrigeren Gebäuden im rechten Winkel dazu. Venedig war Lichtjahre entfernt, doch für einen kurzen Augenblick schoss ihm ein Bild des Friedhofs auf San Michele im kühlen Licht des Sonntagmorgens durch den Kopf, die Bänder der Kieswege und die bleichen, stillen, trauernden Statuen. Wie hier im Krankenhaus hatten sich so viele Gefühle angestaut, steckten in jeder Ritze, dass man sie einatmete und spürte und roch.
Er ging durch die Glastüren. Tagsüber glich die Eingangshalle des Krankenhauses der eines Flugplatzes, mit all den kleinen Läden und dem ständigen Menschengewimmel. Das Kreiskrankenhaus Bevham war ein Lehrkrankenhaus für mehrere Fachrichtungen mit einer riesigen Belegschaft und vielen Patienten. Jetzt, da die Ambulanzräume und Büros im Dunkeln lagen, machte sich wieder die echte Krankenhausatmosphäre auf den ruhigen Fluren breit. Lichter hinter Stationstüren, das Quietschen eines Medikamentenwagens, eine leise Stimme, klirrende Ringe auf einer Vorhangstange … Simon ging langsam Richtung Intensivstation, und die Atmosphäre, das Gefühl von Leben und Tod so eng beieinander, legte sich auf ihn, erhöhte seinen Pulsschlag.
»Chief Inspector?«
Er lächelte. Einer der wenigen Menschen, die ihn hier beruflich kannten, war zufällig die diensthabende Schwester.
Die Station machte sich für die Nacht bereit. Vorhänge wurden um ein oder um zwei Betten gezogen, in einer Seitenstation ging Licht an. Im Hintergrund das schwache Piepsen und Summen der Monitore. Der Tod schien nahe zu sein, als lauerte er im Schatten oder hinter einem Vorhang, die Hand an der Tür.
»Sie liegt in einem Nebenzimmer.« Schwester Blake führte ihn durch die Station.
Ein Arzt mit aufgekrempelten Ärmeln, das Stethoskop um den Hals, kam aus einem der Zimmer und ging, nach einem Blick auf seinen Piepser, eilends davon.
»Die werden auch immer jünger.«
Schwester Blake sah über ihre Schulter. »Bald haben wir Sechzehnjährige.« Sie blieb stehen. »Ihre Schwester ist hier drin … Alles ist ruhig. Dr. Serrailler war fast den ganzen Tag bei ihr.«
»Wie sind die Aussichten?«
»Menschen in der Verfassung Ihrer Schwester sind anfällig für Thoraxinfektionen … Na ja, das wissen Sie bereits, sie hatte sie oft genug. Die gesamte Physiotherapie der Welt kann lebenswichtige Bewegung nicht ersetzen.«
Martha hatte nie laufen gelernt. Sie hatte das Gehirn eines Babys und verfügte über so gut wie keine motorischen Funktionen. Sie hatte nie gesprochen, nur stammelnde und gurrende Laute von sich gegeben, hatte nie Kontrolle über ihren Körper erlangt. Sie hatte im Bett gelegen, auf Stühlen und Rollstühlen gesessen, der Kopf ihr Leben lang von einem Gestell gehalten. Als sie noch klein war, hatte die Familie sie abwechselnd herumgetragen, aber sie war immer bleischwer gewesen, und keiner hatte sie mehr hochheben können, nachdem sie drei Jahre alt war.
»Hier ist das Stationstelefon, leider nicht besetzt … zu wenig Personal, wie gewöhnlich. Ich komme, wenn Sie mich brauchen.«
»Danke, Schwester.«
Simon öffnete die Tür von Zimmer C.
Als Erstes traf ihn der Geruch – der Geruch von Krankheit, den er immer verabscheut hatte; doch der Anblick seiner Schwester in dem hohen, schmalen und unbequem wirkenden Bett schnitt ihm ins Herz. Die Monitore, an die sie mit verschiedenen Kabeln angeschlossen war, blinkten, im durchsichtigen Infusionsbeutel am Ständer stiegen hin und wieder Blasen auf, während der Inhalt Tropfen für Tropfen in ihre Armvene lief. Aber als er näher ans Bett trat und auf Martha hinunterblickte, wurden die Apparate unsichtbar, bedeutungslos. Simon sah die Schwester, die er immer gesehen hatte. Martha. Hirngeschädigt, reglos, bleich, schwer, ein wenig Speichel im leicht geöffneten Mundwinkel. Martha. Wer wusste, was sie je von ihrem Leben, der Welt, ihrer Umgebung, den Menschen, die sie pflegten, der Familie, die sie liebte, wahrgenommen hatte? Niemand hatte je richtig mit ihr kommunizieren können. Ihr Bewusstsein und Verständnis waren geringer als das eines Haustiers.
Und doch … war da ein Lebensfunke in ihr gewesen, auf den Simon von Anfang an reagiert hatte und der ihn tiefer und stärker berührte als Mitgefühl oder auch nur ein Gefühl einfacher Verwandtschaft mit jemandem von seinem eigenen Fleisch und Blut. Bevor sie nach Ivy Lodge gekommen war, hatte er sie oft in den Garten getragen oder sie im Auto festgeschnallt und sie meilenweit herumgefahren, in der Gewissheit, dass sie es genoss, aus dem Fenster zu schauen, hatte sie im Rollstuhl durch die Straßen geschoben, um ihr Abwechslung zu bieten. Und er hatte immer mit ihr gesprochen. Sicherlich hatte sie seine Stimme gekannt, wenn sie auch nicht ahnen konnte, was die Laute bedeuteten, die diese Stimme hervorbrachte. Später, wenn er sie im Pflegeheim besuchte, war ihm die gespannte Stille aufgefallen, die über sie kam, sobald sie ihn sprechen hörte. Er liebte sie, mit einer seltsamen reinen Liebe, die keine Anerkennung oder Reaktion erhalten kann und sie auch nicht fordert.
Ihr Haar war gebürstet worden und lag auf dem hohen Kissen locker um ihren Kopf. Ihr Gesicht zeigte weder Charakter noch Ausprägung; die Zeit schien ohne Auswirkung darüber hinweggeglitten zu sein. Aber Marthas Haar, das man aus Rücksicht auf das Pflegepersonal immer kurz geschnitten hatte, war in letzter Zeit länger geworden und schimmerte im Licht der Deckenlampe, dasselbe Weißblond wie sein eigenes. Simon zog sich einen Stuhl heran, setzte sich und griff nach ihrer Hand.
»Hallo, Liebling, hier bin ich.«
Er sah in ihr Gesicht, wartete auf diese leichte Veränderung ihres Atems, das Zittern ihrer Lider, was darauf hindeutete, dass sie Bescheid wusste, ihn hörte, ihn spürte, und er sich getröstet, beruhigt fühlen konnte.
Die grünen und weißen fluoreszierenden Linien auf dem Monitor liefen in kleinen, regelmäßigen Wellen weiter über den Bildschirm.
Ihr Atem war flach, strömte rasselnd in ihre Lunge und wieder hinaus.
»Ich war in Italien, habe gezeichnet … viele Gesichter. Menschen in Cafés, Menschen auf dem Vaporetto. Venezianische Gesichter. Dieselben Gesichter, wie man sie auf den berühmten Gemälden von vor fünfhundert Jahren sehen kann, ein Gesicht, das sich nicht verändert, nur die Kleidung ist modern. Ich sitze in den Cafés, trinke Kaffee oder Campari und schaue mir einfach die Gesichter an. Niemand stört sich daran.«
Er sprach weiter, aber ihr Gesichtsausdruck blieb unverändert, ihre Augen öffneten sich nicht. Sie war weiter weg, tiefer unten und unerreichbarer denn je.
Er blieb eine Stunde lang, seine Hände über ihren, redete leise mit ihr, als besänftige er ein verängstigtes Kind.
Draußen wurde ein Medikamentenwagen durch den Flur geschoben. Jemand rief etwas. Simon überkam eine gewaltige Müdigkeit, und für einen Moment hätte er am liebsten seinen Kopf neben Martha auf das Bett gelegt, um zu schlafen.
Das Zuschwingen der Tür ließ ihn hochschrecken.
»Si.«
Sein Schwager, Cats Ehemann Chris Deerborn, kam ins Zimmer. »Ich dachte mir, du könntest das brauchen.« Er hielt ihm einen Styroporbecher mit Tee hin. »Cat hat mir erzählt, dass du hergekommen bist.«
»Martha sieht nicht gut aus.«
»Nein.«
Simon stand auf und streckte seinen Rücken, der immer schmerzte, wenn er zu lange saß. Er war einen Meter zweiundneunzig groß.
Chris legte die Hand auf Marthas Stirn und sah auf die Monitore.
»Was meinst du?«
Chris zuckte die Schultern. »Schwer zu sagen. Sie hat all das schon früher gehabt, aber jetzt spricht eine Menge gegen sie.«
»Alles.«
»Viel hat sie sowieso nicht vom Leben.«
»Können wir uns da sicher sein?«
»Ich glaube schon«, erwiderte Chris sanft.
Sie blickten auf Martha hinunter, bis Simon seinen Tee ausgetrunken hatte und den Becher in den Abfalleimer warf.
»Jetzt schaffe ich es nach Hause. Danke, Chris. Ich bin fix und fertig.«
Sie gingen zusammen. An der Tür blickte Simon sich um. Seit seiner Ankunft hatte sich nichts geändert, kein Zucken, kein Anzeichen dafür – abgesehen vom rasselnden Atmen und dem stetigen Klicken des Monitors –, dass der Körper im Bett einer lebendigen jungen Frau gehörte. Er ging zurück, beugte sich über Martha und küsste ihr Gesicht. Die Haut war feucht und leicht flaumig, wie die Haut eines neugeborenen Babys. Simon glaubte, sie nicht lebend wiederzusehen.
4
»Gunton?«
Natürlich musste es was zu meckern geben, sogar heute, bloß um ihn wissen zu lassen, dass sich nichts geändert hatte, nicht bis um acht am nächsten Morgen.
Er drehte sich um.
Hickley hielt eine Harke hoch. »Nennst du das sauber?«
Andy Gunton ging zurück in den langen Schuppen, wo alle Gartengeräte untergebracht waren. Er hatte den Schlamm so sorgfältig wie immer von der Harke gekratzt. Falls Hickley, der einzige Schließer, mit dem er nie zurechtgekommen war, einen Dreckfleck zwischen den Zinken gefunden hatte, dann hatte er den selbst dahin gemacht.
»Keine dreckigen Geräte, du weißt, wie das läuft.« Hickley schob Andy die Harke vors Gesicht.
Nur zu, bedeutete die Geste, mach nur, wehr dich, werd frech, geh mit der Harke auf mich los … Tu es, und ich lass dich für einen weiteren Monat einbuchten, worauf du dich verlassen kannst.
Andy nahm die Harke und trug sie zu der Werkbank unter dem Fenster. Sorgfältig wischte er jede Zinke ab, fuhr mit dem Tuch durch die Zwischenräume und rieb dann immer wieder über den Stiel. Hickley beobachtete ihn mit verschränkten Armen.
Hinter dem Fenster lag der verlassene Gemüsegarten, die Arbeit für diesen Tag war beendet. Einen einzigen, seltsamen Moment lang dachte Andy Gunton, ich werde ihn vermissen.
Ich habe Samen ausgesät, deren Früchte ich nicht ernten werde, ich habe Pflanzen eingesetzt, um deren Wachstum ich mich nicht mehr kümmern kann.
Er erwischte sich bei diesen Gedanken und hätte beinahe gelacht.
Andy drehte sich um und reichte dem Wärter die erneut gesäuberte Harke zur Prüfung. Er nahm es Hickley nicht übel. Es gab immer so einen. Hickley war nicht wie die anderen Schließer, die sie mehr wie Lehrer ihre Schüler behandelten und damit das Beste aus ihnen herausholten. Für Hickley waren sie nach wie vor Knastbrüder, der Feind. Abschaum. War Andy Abschaum? In den ersten paar Wochen hinter Gittern hatte er sich so gefühlt. Er war von dem Ganzen völlig niedergeschmettert, vor allem aber von der Realität, die er nicht in seinen Kopf bekam, nämlich dass er hier saß, weil er während eines verpfuschten Raubüberfalls aus Panik einen unschuldigen Mann geschubst hatte und der Mann auf dem Beton aufgeschlagen war, sich den Schädel gebrochen hatte und gestorben war. Das Wort Mörder war in seinem Kopf herumgerollt wie eine Murmel in einer Schüssel, Mörder, Mörder, Mörder. Was war ein Mörder anderes als Abschaum?
Er wartete, während der Wärter die Harke überprüfte. Mach schon, leg sie unters Mikroskop, na los, du wirst nicht den kleinsten Fleck finden.
Aber Hickley würde ihm nicht alles Gute wünschen, würde eher ersticken, als ihm zu seiner endgültigen Entlassung zu gratulieren. »Lass dich von dem Drecksack nicht fertigmachen«, hatte ihm jemand vor achtzehn Monaten, an seinem ersten Tag hier draußen, geraten. Daran dachte Andy wieder, als er ohne ein Wort oder einen Blick zurück auf Hickley aus dem Schuppen trat und durch den Gemüsegarten zum Ostflügel der offenen Strafvollzugsanstalt Birley ging.
Durch einen Ventilator im Küchentrakt wurde der Geruch nach gekochten Eiern zu ihnen geblasen; aus einem offenen Fenster war das Geräusch eines Pingpongballs auf der Tischtennisplatte zu hören, pock-pock, pock-pock.
Einmal, während seiner ersten Woche im Stackton-Gefängnis, hatte ein Schließer ihn sagen hören: »Es gibt immer ein erstes Mal«, und hatte zurückgefaucht: »Nein, Gunton, es gibt nicht immer ein erstes Mal, aber so sicher wie das Höllenfeuer immer ein letztes.«
In seinem damaligen verstörten und niedergeschlagenen Zustand, vor über vier Jahren, hatten sich die Worte in sein Gedächtnis gebohrt wie ein Pfeil in die Zielscheibe und waren dort hängen geblieben.
Es gibt immer ein letztes Mal. Er blieb an der Tür zu seinem Wohntrakt stehen und schaute sich um. Der letzte Arbeitstag. Zum letzten Mal eine Harke gereinigt. Die letzte Konfrontation mit Hickley. Die letzten gekochten Eier mit Rote-Bete-Salat und Kartoffeln. Das letzte Billardspiel. Die letzte Nacht in dem Bett. Letzte. Letzte. Letzte.
Sein Magen rumpelte kurz, als die schwindelerregenden Gedanken an die Außenwelt wieder einsetzten. Er war schon draußen gewesen, zuerst bei Einkäufen mit einem Schließer, dann beim Ausliefern des Gemüses, aber es war nicht dasselbe, das wusste er. Der offene Strafvollzug lockerte die Fesseln Stück für Stück, aber man trug sie nach wie vor, man gehörte immer noch nach drinnen und nicht nach draußen, war immer noch dadurch bestimmt, wo man aß und schlief, welche Gesellschaft man hatte, welche Vergangenheit, warum man hier war.
Dem Körper wurde erlaubt, nach draußen zu gehen, aber der Geist blieb hinter Gittern, konnte nicht, wagte nicht, das in sich aufzunehmen.
Er schloss die Tür auf. Die Spätnachmittagssonne berührte die pilzfarbene Wand und ließ sie noch schmuddeliger aussehen. Hier musste dringend gestrichen werden. Am Anfang hatten sie sich wohl sehr angestrengt, waren sicherlich stolz darauf gewesen, dass es möglichst wenig nach Gefängniszelle aussah und die Gemeinschaftsräume mehr wie ein Jugendklub und die Anstalt wie ein Bürogebäude. Doch jetzt musste alles erneuert, frisch gestrichen, möbliert, ersetzt werden, wozu sie nie zu kommen schienen.
Das letzte Mal, das letzte Mal, das letzte Mal. Raus hier. Raus …
Andy öffnete das Fenster. Ihm fielen die ersten Tage ein, als er sich nicht an diese kleinen Dinge hatte gewöhnen können, wie das Fenster öffnen zu dürfen, wenn er es wollte. Er hatte es immer wieder gemacht, das Fenster geöffnet und geschlossen, geöffnet und geschlossen.
Er lehnte sich hinaus. Morgen würde dieser Raum jemand anderem gehören. Ein anderer Mann würde vom geschlossenen in den offenen Strafvollzug kommen und alles erneut machen. Das Fenster öffnen. Es schließen. Öffnen. Schließen, immer wieder. Morgen.
Es klopfte an der Tür, und Spike Jones trat ein, bevor Andy »Herein« sagen konnte. Spike war in Ordnung.
»Die Jungs wollen Fußball spielen.«
»Nee.«
»Warum nicht?«
»Hab meine Stollenschuhe schon abgegeben.«
»Ach so. Nimmst du Kylie Minogue mit?«
»Kannst du haben.«
Spike lachte, nahm das aufgerollte Poster, das am Schrank lehnte. Er hatte noch zehn Monate in Birley abzusitzen und schon seit Langem ein Auge auf das Poster geworfen.
»Du hängst doch hier nicht rum und grübelst, oder?«
»Verpiss dich.«
Grübeln. Andy drehte sich wieder zum offenen Fenster um. Grübeln. Nein. Das war am Anfang gewesen, in den ersten Tagen und Wochen in Stackton, wo er Tag und Nacht nicht hatte unterscheiden können und gedacht hatte, er würde verrückt. Grübeln. Das hatte er nicht mehr getan, seit er hierhergekommen war und im Gemüsegarten zu arbeiten begonnen hatte. Und er dachte nicht dran, es wieder aufzunehmen.
Der Abend verging, wie alle zuvor, und darüber war er froh. Er hätte es nicht anders gewollt. Er aß in der Kantine, stand mit ein paar anderen draußen und sah beim von Flutlicht erleuchteten Fußballspiel zu, rauchte eine Selbstgedrehte, ging wieder hinein und spielte eine Stunde Billard. Um zehn war er in seinem Zimmer, schaute sich im Fernsehen The West Wing an.
Verwirrt und schwitzend wachte er aus einem Albtraum auf. Scheinwerfer entlang der äußeren Umzäunung sorgten dafür, dass es nie ganz dunkel wurde. Es war kurz nach drei.
Der Schock dessen, was passieren würde, traf ihn erneut und jagte ihm solche Angst ein, dass sich sein Magen verkrampfte und seine Kehle eng wurde. Viereinhalb Jahre Gefängnisleben: sich anpassen lernen, eine Fassade errichten, sein eigenes Selbst so weit verbergen, dass er kaum mehr wusste, was dieses Selbst war, Routine, Regeln, Lernen und jedes nur mögliche Gefühl empfinden, viereinhalb Jahre Schwanken zwischen Wut und Verzweiflung, Akzeptanz und Hoffnung und wieder zurück. In fünf Stunden würden die viereinhalb Jahre zu Ende sein. In fünf Stunden würde er draußen sein. In fünf Stunden würde ihm dieses Zimmer, dieser Ort nichts mehr bedeuten und, mehr noch, er würde denen hier nichts mehr bedeuten. Geschichte. Sein Name aus dem Register gestrichen, sein Gesicht vergessen.
Fünf Stunden.
Andy Gunton legte sich auf den Rücken. Wenn es schon nach einer viereinhalbjährigen Strafe so war, wie musste es für diejenigen sein, die nach fünfzehn Jahren und mehr rauskamen? Empfanden sie auch diese plötzliche Panik bei dem Gedanken, ohne Wände zu sein, ohne Stützen, ohne die abstumpfende Routine, die nach kurzer Zeit das Einzige war, an das man sich zur Sicherheit klammerte?
Er dachte an die erste Woche in Stackton. Da war er zwanzig gewesen. Und hatte keine Ahnung gehabt. Der Gestank und der Krach, die toten Gesichter und misstrauischen Augen, das Bedürfnis, nicht unbedingt auszubrechen oder wegzulaufen, sondern einfach zu verschwinden, sich aufzulösen, das dröhnende Schnarchen von Joey Butler, seinem ersten Zellengenossen, an das er sich nie gewöhnt hatte, nie tief genug schlafen zu können, die roten, juckenden Stellen auf seiner Haut, die nach zwei Nächten auf der Gefängnismatratze zu Ekzemen geworden und erst hier richtig verheilt waren – all das fiel ihm wieder ein, er erlebte alles erneut, lag wach und schaute auf den trüben Schein der Lampen an der Wand. Sie behaupteten, es würde einem entweder das eine oder das andere antun. Es raubte einem die Seele, sodass man sich nie wieder selbst gehörte, sondern für immer dem Gefängnis und alles tat, um wieder hineinzukommen, oder es jagte einem schreckliche Angst ein, man wurde verändert, durchgekaut und ausgespuckt. Geheilt. Er war in dem Moment geheilt worden, als er seine eigene Kleidung abgab und die Gefängnisuniform anzog. Da hätten sie ihn gehen lassen können. Es hatte funktioniert. Er würde nicht zurückkehren.
Wie hätte er ahnen können, dass er sich so fühlen würde, viereinhalb Jahre später, voller Angst rauszukommen, sich an das Vertraute klammerte, sich halbwegs danach sehnte, einen Fehler begangen zu haben, eine weitere Strafe absitzen zu müssen, damit dieser Raum in der kommenden Nacht noch seiner war?
Er starrte weiter auf das Licht an der Wand, bis es sich zu verändern begann und in der Morgendämmerung zu einem weichen Grau wurde.
5
Simon Serrailler hatte tief geschlafen und wachte um acht Uhr vom Schlagen der Kathedralenuhr auf.
Die Wohnung, die er mit liebevoller Sorgfalt eingerichtet hatte, war kühl und still, erfüllt von dem milden Licht eines Märzmorgens. Er zog seinen Morgenmantel an und tappte in das lang gestreckte Wohnzimmer, vorhanglos und friedvoll mit den glänzenden Ulmenböden, den Büchern, dem Klavier, den Bildern. Das Licht am Anrufbeantworter blinkte nicht. Niemand hatte ihn angerufen, um ihm mitzuteilen, dass seine Schwester gestorben war.
Er füllte Bohnen in die Kaffeemühle und Wasser in den Filter. In einer halben Stunde würden die ersten Autos auf ihre Parkplätze vor dem Haus biegen, und die Geräusche der früh zur Arbeit Gekommenen würden durch das Treppenhaus hallen. Der Rest des georgianischen Gebäudes war längst in Büros für diverse Diözesanorganisationen und zwei Anwaltskanzleien umgewandelt worden. Simon besaß die einzige Privatwohnung im Haus. Normalerweise war er um acht schon auf dem Revier und kam oft erst nach sieben heim, daher traf er selten jemanden, der hier arbeitete – während des Tages hatte das Gebäude ein eigenes Leben, von dem er wenig wusste. Das passte ihm gut, so zurückhaltend und reserviert, wie er war, zufrieden in seinen stets ordentlichen Räumen. Er übte seinen Beruf mit Begeisterung aus, hatte bislang fast jeden Tag seines Polizeidienstes genossen, aber sein Rückzugsort hier war ihm äußerst wichtig.
Mit dem Kaffeebecher in der Hand trat er zu den drei Zeichnungen, die gerahmt an der Wand neben den hohen Fenstern hingen. Sie stammten von seiner letzten Venedigreise, und er sah sofort, dass sie besser waren als alles, was er in den wenigen Tagen dort zu Papier gebracht hatte. Es klappte schon seit längerer Zeit nicht recht mit dem Zeichnen, so verstört, wie er seit den Ereignissen des vergangenen Jahres war. Der Mord an Freya Graffham hatte ihn schwer getroffen, und nicht nur, weil der Tod eines Polizeikollegen stets ein Schlag war, von dem man sich nur mühsam erholte.
Nein, sagte er, ging mit energischen Schritten zurück in die Küche, um sich mehr Kaffee zu holen. Fang nicht damit an, nicht schon wieder.
Er zog Jeans und ein Sweatshirt an und holte die Segeltuchtasche mit seinen Zeichensachen. In den Büros begann die Arbeit, Stimmen drangen durch halb offene Türen, Wasserkessel pfiffen in Kochnischen. Seltsam, dachte Simon. Das Gebäude wirkte anders, gehörte nicht mehr ihm. Seltsam. Seltsam, an einem Wochentag Jeans zu tragen statt eines Anzugs, seltsam, hier zu sein, statt über einen venezianischen Kanal zu blicken. Seltsam und verwirrend.
In raschem Tempo fuhr er aus Lafferton hinaus.
Auch das Krankenhaus wirkte wie ein anderer Ort. Er hatte Schwierigkeiten, einen Parkplatz zu finden, die Eingangshalle war voller Menschen auf dem Weg zu ihren Ambulanz-Sprechstunden, Pfleger schoben Rollstühle, Gruppen von Studenten standen herum, Blumen wurden geliefert, zwei Frauen bauten einen Wohlfahrtsstand auf. Hier unten war der Geruch nach Antiseptika kaum wahrnehmbar.
Der Aufzug war voll, auf den Stationen war es laut. Irgendwer ließ einen Eimer fallen und fluchte. Aber in Marthas Zimmer hatte sich nichts verändert. Die Monitore piepsten, die fluoreszierenden grünen Wellenlinien schlängelten sich über die Bildschirme, die Flüssigkeit in dem Plastikbeutel über ihrem Kopf tropfte langsam. Zuerst meinte Simon, auch seine Schwester sehe unverändert aus, aber als er näher trat, erschien ihm ihre Haut etwas dunkler. Ihre Haare waren feucht, ihre Augenlider zart, wie die weiche Haut von Pilzen.
Er fragte sich, wie er es bei jedem Wiedersehen tat, wie viel in ihrem Kopf vorging, was sie erkannte und begriff, ob sie denken konnte, und wenn ja, wie tief ihre Gedanken waren. Dass sie etwas fühlte, bezweifelte er nicht. Ihre Gefühle hatten ihn stets bewegt, denn sie äußerte sie wie ein Baby, weinte und lachte oft unvermittelt und aus vollem Herzen, hörte genauso schnell wieder damit auf, wobei es ihm immer schwergefallen war, zu erkennen, was diese Gefühle hervorrief, ob sie damit auf etwas Äußerliches oder Innerliches reagierte.
Ihre Behinderung wirkte sich derart auf ihre Gesichtszüge aus, dass es schwer war, Familienähnlichkeiten zu entdecken, aber für Simon hatte das ihre Einzigartigkeit nur noch verstärkt. Er zog einen Stuhl nahe an ihr Bett.
Er war so ins Zeichnen vertieft, dass er das Öffnen der Tür nicht bemerkte. Er wollte den Geist seiner Schwester einfangen, indem er sie auf Papier von den medizinischen Apparaten befreite, die sie umgaben, und als er ihr Haar betrachtete, die Biegung ihrer Nasenlöcher unter der breiten Nase und die Wimpern, wie feine Pinselstriche auf ihrer Wange, erkannte er, dass sie schön war, so wie ein Kind schön ist, weil weder Zeit noch Erfahrung auf ihrem Gesicht in irgendeiner Weise Spuren hinterlassen hatten. Während er mit den feinsten Bleistiftstrichen ihre Lider zeichnete, hielt er fast den Atem an.
»Oh, Liebling …« Auf ihrem Kopf glitzerten Regentropfen.
»Cat hat mir erzählt, dass du zurück bist.«
Sie betrachteten die stille, eigentümlich flache Gestalt auf dem Bett.
»Es tut mir so leid.«
»Das muss es nicht.«
»Jedes Mal, wenn ich durch diese Tür trete, fühle ich mich zerrissen«, sagte Meriel Serrailler. »Befürchte, dass sie tot ist. Hoffe, dass sie tot ist. Bete, aber ich weiß nicht, zu wem oder für was.« Sie beugte sich vor und hauchte einen Kuss auf Marthas Stirn.
Simon zog den Stuhl für sie zurück.
»Du warst dabei, sie zu zeichnen.«
»Das wollte ich schon lange.«
»Armes kleines Mädchen. War die Visite schon da?«
»Bisher nicht. Ich habe gestern Abend mit Schwester Blake gesprochen. Und Chris ist gekommen.«
»Es ist hoffnungslos, so oder so. Aber niemand will das aussprechen.«
Er legte seiner Mutter die Hand auf den Arm, doch sie wandte sich ihm nicht zu. Sie klang – wie immer, wenn sie über Martha sprach – kühl, distanziert, professionell. Die Wärme in ihrer Stimme, den anderen der Familie so vertraut, schien zu fehlen. Simon ließ sich nicht täuschen. Er wusste, dass sie Martha genauso sehr liebte wie ihre anderen Kinder, allerdings mit einer vollkommen anderen Liebe.
Seine Zeichnung lag auf der Bettdecke. Meriel griff danach.
»Merkwürdig«, sagte sie. »Schönheit, aber kein Charakter.« Dann wandte sie sich ihm zu. »Und du?« Sie sah ihn mit irritierender Direktheit an. Ihre Augen glichen denen von Cat und Ivo, sehr rund, sehr dunkel, nicht wie seine eigenen blauen.
Sie wartete, ruhig und gefasst. Simon nahm ihr die Zeichnung ab und bedeckte sie mit einer Schutzfolie.
»Ich wünschte, dein Vater hätte dich nicht angerufen. Du hast den Urlaub nötig.«
»Urlaub kann ich auch später noch nehmen. Ich wollte eine Tasse Tee trinken gehen. Soll ich dir welchen mitbringen?«
Aber seine Mutter schüttelte den Kopf. Von der Tür schaute Simon zurück und sah, dass sie ihrer Tochter sanft das Haar aus dem Gesicht strich.
6
»Komm zu uns raus … Iss mit mir zu Mittag.«
»Vielleicht morgen.«
»Warum erst dann?«
»Ich fahre zum Hylam Peak … Ist ein guter Tag zum Wandern. Ich besorg mir da was zu essen.«
»Grübelst du?«
»Nicht so richtig.«
»Ich ruf dich später an.«
Simon legte auf. Seine Schwester kannte ihn zu gut. Grübeln? Ja. Wenn er sich so fühlte, war er keine gute Gesellschaft, musste Abstand zwischen sich und zu Hause bringen und, wie Cat es mal ausgedrückt hatte, das Grübeln aus sich herausmarschieren. Es war alles, der abrupte Aufbruch aus Venedig, Martha und immer noch die Nachwirkungen des vergangenen Jahres. Am kommenden Mittwoch musste er wieder arbeiten. Wenn, dann musste er jetzt grübeln.
Hylam Peak lag inmitten einer Hügelkette, die sich westlich von Lafferton über dreißig Meilen erstreckte, zu erreichen über eine gewundene Straße durch offenes Moorland. Ein paar feuchte Dörfer schmiegten sich in den Schatten der tiefen Einschnitte zwischen den Gipfeln. Im Sommer waren die Wege voll langsam vorankommender Wandergruppen, Bergsteiger hingen mit ihren Seilen wie Spinnen an den felsigen Vorsprüngen. Die Berge waren die Spielwiese von Bevham.
Die Leute kamen aus der Stadt, um ihre Drachen und Modellflugzeuge fliegen zu lassen, zum Gleitschirmfliegen und Mountainbikefahren.
Während des restlichen Jahres, besonders bei schlechtem Wetter, kam niemand. An solchen Tagen gefiel es Simon am besten, wenn er oben auf dem Hylam Peak saß, umgeben vom Blöken der Schafe und den Schreien der Bussarde mit Blick über drei Grafschaften, und zeichnen, nachdenken, ja sogar auf den trockenen Grasbüscheln schlafen konnte und mit niemandem sprechen musste.
Er fragte sich, wie Menschen tagein, tagaus in Familien und an überfüllten Arbeitsplätzen, in Bussen, Zügen, geschäftigen Straßen überleben konnten, ohne solche einsamen Rückzugsorte in wildem, leerem Land.
Er war der Einzige auf dem umzäunten Gelände, das als Parkplatz diente. Bevor er nach seiner Segeltuchtasche griff, aktivierte er das Lenkradschloss und verriegelte die Türen. Nur eine alte Decke blieb im Auto, und es waren weder ein Radio noch ein CD-Spieler eingebaut. Der Park mochte jetzt zwar leer sein, aber Orte wie dieser waren zu allen Jahreszeiten leichte Ziele für Diebe.
Anderthalb Stunden später saß er allein auf einem Felsen oben am Gipfel. Die Märzsonne jagte Schatten wie Hasen über die Landschaft unter ihm. Die Luft war klar und mit dem melancholischen Blöken Hunderter einheimischer, langfelliger Schafe erfüllt, die über die Hügel verstreut grasten.
Er fühlte sich träge. Unzählige Male war er hier oben gewesen und hatte die Gipfel und die darüberziehenden Wolken gezeichnet, genauso wie Schafe, zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter, bis es, zumindest im Moment, für ihn keine lohnenden Motive mehr gab.
Grübeln, hatte Cat gesagt. Aber jetzt, wo er hier oben war, fühlte er sich in der kühlen Frühlingsluft leicht benommen und grübelte nicht. Die Sonne schien ihm ins Gesicht. Er legte sich auf den Rücken und verschränkte die Hände unter dem Kopf. Eine einzelne Lerche schraubte sich in den blauen Himmel und höher hinauf in die Helligkeit darüber.
Ihr Gesang wurde abgeschnitten und übertönt vom Rattern eines Hubschraubers, dessen Schatten auf Simons Gesicht fiel und die Sonne auslöschte. Erschrocken setzte er sich auf. Das Ding flog mit wirbelnden Rotorblättern dicht über die Gipfel. Simon meinte, mit ausgestreckter Hand die Kufen berühren zu können, und als der Hubschrauber nach Osten über das Tal flog, waren innen die Umrisse von zwei Personen zu erkennen. Es war weder ein Krankentransporter noch ein Polizeihubschrauber, sondern ein privater, soweit er das beurteilen konnte.
Verschreckte Schafe flohen in ihrer Panik die Hänge nach allen Richtungen hinauf und hinunter, um von dem Krach und dem gleitenden Schatten fortzukommen. Der Hubschrauber selbst war längst außer Sichtweite, bis sich die Stille wieder einstellte.
Die Lerche nahm ihren Gesang nicht wieder auf.
Simon erhob sich und hängte sich die Segeltuchtasche über den Rücken. Der hässliche Lärm und der Anblick des Hubschraubers hatten seinen Frieden und das wohlige Gefühl zerstört, genauso wie es die Schafe aufgeschreckt und den Vogel zum Schweigen gebracht hatte.
Er schlug den Pfad ein, der steil vom Gipfel hinunterführte, und folgte den Wegweisern nach Gardale.
7
Das Bett war abgezogen, die Matratze unbedeckt, Laken und Decken neben der Tür gestapelt. An der Wand waren helle Stellen, wo Andys Poster, der Kalender und die Fotos gehangen hatten. Seine Tasche stand zu seinen Füßen, gepackt, der Reißverschluss zugezogen. Bereit.
Er war bereit.
War schon seit sechs Uhr bereit.
Nur war er nicht bereit, merkte Andy. Er war voller Panik. Sein Magen war ihm schon zweimal in die Hose gerutscht, und er hatte zum Klo rennen müssen.
Er dachte an die Tage und Nächte, die mit der Vorstellung dieses Morgens vergangen waren, der Planung, dem Träumen davon, dem Zählen der Stunden bis dahin. Und jetzt war der Augenblick da, und er schiss sich vor Angst fast in die Hose. Er verstand, warum so viele, kaum dass sie draußen waren, einen dicken Stein durch ein Schaufenster warfen oder einer Frau die Handtasche klauten. Alles nur, um in die Sicherheit zurückzukommen, wie das Rennen zum Abschlagmal auf dem Spielplatz in der Kinderzeit.
Es war anders, wenn jemand auf einen wartete, Kinder auf einen zugerannt kamen, eine Frau sich nach einem verzehrte, dann konnte man dieser Bruchbude hier nicht schnell genug den Rücken kehren.
Er schüttelte sich, stand auf und machte dreißig Liegestützen. Er war fit, dafür hatten die Arbeit im Gemüsegarten, das viele Fußball- und Basketballspielen gesorgt. Schwitzend ließ er sich auf die Matratze zurücksinken. Also gut, sagte er, okay, du bist fit, und du hast da draußen eine Zukunft.
Hoffst du.
Er drehte sich auf die Seite und schlief wieder ein.
Die Straßen waren überflutet, und der Sturm blies so stark, dass sich Andy auf dem Bahnsteig kaum halten konnte. Er ging wieder in die Bahnhofsgaststätte. Der Zug war mit fünfundvierzig Minuten Verspätung angekündigt worden, wegen Unterspülung der Gleise.
Die Leute redeten darüber. Er holte sich noch einen Becher Tee und einen Donut.
Vor einer Stunde war er mit seiner Tasche in der Hand aus dem Gefängnistor gekommen, zusammen mit zwei anderen, von denen er sich jedoch rasch getrennt hatte; außerdem waren diese von Angehörigen abgeholt worden. Familie. Er hatte keine Feierlichkeit erwartet, war aber doch schockiert gewesen, wie schnell alles vorbei war. Die Sachen, die sie für ihn aufbewahrt hatten, waren auf dem Tresen vor ihm ausgebreitet, überprüft und abgezeichnet worden; er hatte sein Geld und seine Zugfahrkarte bekommen, hatte mit den anderen im Durchgang gestanden, dann vor dem Ausgang, und dann waren sie zum Tor hinaus. Das Klirren der Schlüssel, zum letzten Mal.
Regen, der einem ins Gesicht schlug, und ein Sturm, der einen fast umwarf.
»In der Simpson Street hat es ein Auto umgeworfen.«
»Acht Bäume, hat jemand gesagt.«
»Kann nicht sein, in der ganzen Stadt gibt’s keine acht Bäume.«
»Die Kinder waren nicht in der Schule, zu gefährlich.«
»Das halbe Dach von der St.-Nicholas-Kirche ist weggeflogen.«
Andy saß da, den Becher zwischen den Händen. Er kam sich unwirklich vor. Leute redeten, standen auf und setzten sich, kamen in die Gaststätte und gingen hinaus, und keiner beachtete ihn. Keiner wusste, woher er gerade gekommen war.
Was würde passieren, wenn sie es täten?
Es lag nicht daran, dass er allein hier draußen war, sich einen Becher Tee und einen Donut kaufte, auf einen Zug wartete, das machte ihm alles nichts aus. Es lag daran, dass ihn niemand beobachtete, niemand Notiz von ihm nahm. Viereinhalb Jahre lang war er nicht unsichtbar gewesen, doch nun war er es. Der Sturm drückte plötzlich gegen die Türen, schwang sie weit auf, ließ einen leeren Stuhl zu Boden krachen. Ein Kind in einem roten Anorak schrie.
Andy dachte an seine Mutter. Sie hatte ihn nur ein halbes Dutzend Mal besucht, war mit gebeugtem Kopf und vor Scham zu Boden gerichtetem Blick in den Besucherraum geschlurft, danach war sie mehrfach im Krankenhaus gewesen und dann zu krank. Er hatte sie nicht als die verschrumpelt aussehende Person vor Augen, sondern als die Mutter, zu der er gerannt war, als die Freunde von Mo Thompson seine Finger mutwillig in der Tür eingequetscht hatten, die Mutter, die ihn schließlich gefunden hatte, als sie ihn in einen Schuppen gezerrt und im Dunkeln eingesperrt hatten, nachdem sie ihm erzählt hatten, die kratzenden Geräusche auf dem Dach kämen von Ratten. Das damals war seine Mutter gewesen, mit dicken Armen und roten Händen, bereit, seine Peiniger bis aufs Blut zu verprügeln, mit einer Nebelhornstimme, die man noch drei Straßen weiter hören konnte. Sie war geschrumpft. Ihr Mantel hatte graue Flecken gehabt, und in ihren Halsfalten war Dreck gewesen. Wenn sie sich über den Tisch im Besucherraum beugte, hatte sie streng gerochen.
Die Frau hinter der Theke versuchte, eine der Türen mit Zeitungspapier festzuklemmen, aber sie wurde ihr aus der Hand gerissen, und jetzt schwappte das Regenwasser herein und lief über den braunen Linoleumboden.
Drei Männer kamen ihr zu Hilfe. Sie holte einen Mopp und einen Plastikeimer und begann die Flutwelle des Regenwassers zurückzuschieben.
Das Kind aß einen Schokoriegel und brüllte gleichzeitig, während die Fensterscheiben im Sturm ratterten.
Andy wollte wieder zurück. Hier war es nicht sicher, der Boden schien unter seinen Füßen zu schwanken, und die Tatsache, dass niemand seinen Namen kannte, ängstigte ihn. Draußen wurde ein Teil eines Blechdachs abgerissen und krachte auf den Zement.
Mam, murmelte Andy Gunton leise, und es war die Frau mit den dicken Armen und den roten Händen, an die er sich wandte, Mam.
Aus den Lautsprechern kam unverständliches Gekrächze, vielleicht die Ansage für seinen Zug, vielleicht wurde aber auch das Ende der Welt angekündigt.
Das Licht ging aus, und eine Sekunde lang erstarrten alle, schwiegen alle, selbst das Kind.
Das Wetter hatte sie überrascht. Schwerer Regen und starke Winde waren vorhergesagt worden, aber doch kein solcher Hurrikan, der mitten an einem Montagvormittag derartige Schäden und ein solches Chaos anrichten würde. Der Strom in der Bahnhofsgaststätte ging nicht wieder an, und auch die Züge fuhren erst wieder am späteren Nachmittag.
»Wie, zum Teufel, soll ich das denn schaffen?«
Die Mutter des Kindes hatte noch ein Baby in einem Buggy und dazu zwei Koffer. Wegen der Bahnsteigänderung, verursacht durch das Unwetter, musste sie die Eisenbrücke überqueren. Sie war in Tränen aufgelöst, die Kinder waren todmüde, und der Regen prasselte immer noch herab.
»Kommen Sie«, hörte Andy sich sagen. Er nahm die Koffer, trug sie über die Brücke und holte dann noch den Buggy. Der andere Bahnsteig war gefährlich überfüllt. Der Regen floss im breiten Strom in den Rinnen entlang.
»Behalten Sie das kleine Mädchen auf dem Arm, ich mach die Tür auf und besetze einen Sitzplatz, nur keine Bange.«
»Was hätte ich bloß sonst gemacht?«, sagte die Frau immer wieder. »Ich weiß nicht, was ich ohne Sie gemacht hätte.«
»Jemand anders hätte sich um Sie gekümmert.«
»Man kann nicht jedem trauen, wissen Sie, die Menschen sind seltsam. Ihnen kann ich vertrauen.«
Andy sah sie an. Sie meinte es ernst. Später, dachte er, würde er das Komische daran begreifen.
»Wohin fahren Sie denn?«
»Nach Lafferton. In der Nähe von Bevham.«
»Das ist ja ganz auf der anderen Seite des Landes.«
»Ja.«
»Fahren Sie nach Hause?«
Er antwortete nicht. Er wusste es nicht.
»Was machen Sie beruflich?«
Er öffnete den Mund. Der Regen lief ihm am Hals entlang in sein Hemd. »Gemüsegärtnerei.« Aber der Zug fuhr ein. Sie war mit ihren Kindern beschäftigt und hatte ihn nicht gehört. Andy warf sich gegen eine Tür, als sie an ihm vorbeiglitt, und als die Klinken freigegeben wurden, stürzte er in den Zug, drängelte sich zu einem Sitz durch, warf die Koffer der Frau darauf, ging zurück und hob die Kinder herein.
»Sie sind ein Heiliger, wissen Sie das, wie hätte ich es sonst schaffen sollen? Ich hätte es nie geschafft. Sie verdienen einen Orden.«
Sein eigener Zug kam erst eine Stunde später. Inzwischen waren auch die Lichter wieder an, und der Wind hatte sich etwas gelegt, doch es regnete nach wie vor in Strömen.
Es gab keinen Sitzplatz und keinen Speisewagen. Andy setzte sich im Gang auf seine Tasche, eingeklemmt neben einem Jungen mit einem Walkman, aus dem blecherne Geräusche drangen.
Michelle wissen zu lassen, wann er ankam, war unmöglich gewesen, und inzwischen kam es auch kaum mehr darauf an. Der Zug hielt ständig an, für ein paar Minuten oder eine halbe Stunde. Nach einer Weile schlief Andy im Sitzen ein. Als er aufwachte, war es draußen dunkel.
Er überlegte, wo die Frau mit den Kindern wohl war. Der Junge stupste ihn mit dem Ellbogen an und reichte ihm eine Bierdose.
»Prost. Wo kommt das denn her?«
»Hatte welche in meiner Tasche.«
Andy nahm einen großen Schluck von dem lauwarmen, schäumenden Bier.
Vier Stunden später ging er den Zementweg zum Haus seiner Schwester hinauf. Es regnete immer noch. Die ganze Straße war mit Lärm erfüllt, Fernsehlärm, Musiklärm, Lärm von schreienden Kindern und brüllenden Erwachsenen. Die orangefarbenen Straßenlaternen beleuchteten einen Plastiktraktor vor seinen Füßen.
»Verdammt, du hast dir aber Zeit gelassen.« Seine Schwester Michelle sah eher wie vierzig aus als wie dreißig, und im Flur hinter ihr roch es nach Frittieröl. Sie hatte ihn zweimal im Gefängnis besucht, ganz am Anfang, bevor sie nach der Scheidung von dem ersten Nichtsnutz Pete Tait geheiratet und eine neue Kinderproduktion begonnen hatte.
»Wo warst du denn bloß?«
Andy folgte ihr durch das Haus in die hinten gelegene Küche, wo der Frittiergeruch am stärksten war. Fett spritzte aus einer Pfanne mit Pommes frites an die Fliesentapete. Er ließ seine Tasche fallen.
»Es hat gestürmt. Sturmböen und Überflutungen, aber vielleicht hast du ja nicht aus dem Fenster geschaut.«
»Ha, ha, ha, ich musste da verdammt noch mal durchwaten, um die Gören wegzubringen, ja? Sind deswegen keine Züge gefahren?«
»So was in der Art.«
»Hattest du schon deinen Tee?«
»Nein.«
Seine Schwester seufzte und hielt die Kesseltülle unter den Wasserhahn. Aus dem Fernseher im Nebenzimmer drang das ohrenbetäubende Geräusch quietschender Autoreifen.
Andy setzte sich an den Tisch. Sein Kopf schmerzte, er war hungrig und durstig, vollkommen erledigt. Er wollte nicht hier sein. Er wollte zu Hause sein. Wo war zu Hause? Es gab kein Zuhause. Michelle kam dem noch am nächsten.
»Du musst entweder auf der Couch schlafen oder zusammen mit Matt in seinem Zimmer.«
»Mach dir keine Mühe. Ich nehm die Couch.«
»Na ja, Pete will rund um die Uhr fernsehen, wir haben Sky, er schaut Sport.«
»Gut, dann Matts Zimmer. Hab doch gesagt, mach dir keine Mühe.«
Er sah auf. Seine Schwester starrte ihn an, während sie sich eine Zigarette anzündete. Ihm bot sie keine an.
»He, ich bin’s, dein Bruder.«
»Du siehst gar nicht anders aus«, sagte sie schließlich durch eine Rauchwolke. »Älter vielleicht.«
»Ich bin älter. Fast fünfundzwanzig.«
»Du meine Güte.«
Sie stellte ihm einen Becher Tee hin. »Pete sagt, du kannst bleiben, bis du was findest. Werden die von der Bewährungshilfe dir was besorgen?«
»Hör zu, wenn du willst, dass ich austrinke und gehe, dann sag das, Michelle.«
»Ist mir egal. Was wirst du denn den ganzen Tag machen?«
»Arbeiten.«
»Hast du doch noch nie.«
»Werd ich aber.«
»Was denn? Was kannst du denn?«
»Hab eine Ausbildung bekommen.«
Das Pommesfett spritzte gefährlich. Sie zog die Pfanne vom Gas. »Was, im Postsäckenähen?«
»Du hast keine Ahnung. Bist ja nicht gekommen.«
»Ich hab dir geschrieben, oder? Hab dir Zeug geschickt, hab dir Fotos von den Kindern geschickt. Um da hinzukommen, musste man ja quer durchs halbe Land fahren, und Pete war nicht gerade scharf drauf.«
Pete Tait. Soldat, als Michelle ihn geheiratet hatte, war aber entlassen worden, nachdem er beim Geländetraining von einer Mauer gefallen war und sich den Rücken verletzt hatte. Jetzt saß er in einem Kabuff, starrte von zwei Uhr nachmittags bis Mitternacht auf den Überwachungsmonitor eines Einkaufszentrums. Das wusste Andy aus den kurzen, hingekritzelten Briefchen, die Michelle ihm ein halbes Dutzend Mal pro Jahr geschickt hatte.
»Die besorgen mir eine Unterkunft. Wohnung oder so.«
»Willst du Bohnen oder Tomaten?« Michelle öffnete eine Dose Corned Beef.
»Was du hast.«
Gebackene Bohnen. Corned Beef. Pommes frites. Tomaten. Gefängnisfraß. Er stand auf und goss sich noch einen Becher Tee ein. Die Frau mit dem Gepäck und den Kindern fiel ihm ein. Komisch. Man begegnete Menschen. Redete mit ihnen. Sie verschwanden. Man sah sie nie wieder. All diese Männer in all den Gefängnissen. Die sah man nie wieder.
»Schauen die Kinder fern?«
»Die sind im Bett. Es ist halb zehn. Ich gehör nicht zu denen, die sie die ganze Nacht aufbleiben lassen.«
Sie stellte ihm den Teller mit seinem Essen hin. Also rasten die Autos ganz allein im Fernseher herum.