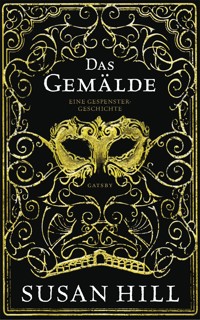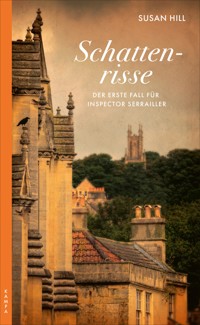Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: EIn Fall für Inspector Serrailler
- Sprache: Deutsch
Acht Monate ist es her, dass der kleine David Angus verschwunden ist, und die Polizei von Lafferton tappt noch immer im Dunkeln. Detective Chief Inspector Simon Serrailler, den der Fall schwer belastet, ist kurz davor, die Hoffnung aufzugeben - dann gibt es endlich einen Hinweis, eine Spur. Serrailler höchstpersönlich nimmt die Verfolgung auf. Und schließlich macht der Täter einen gewaltigen Fehler - und geht der Polizei ins Netz. Zur selben Zeit wird die junge Pastorin Jane von einem verwirrten Witwer als Geisel genommen. Ganz Lafferton ist in Aufruhr, die Nerven liegen blank! Und auch privat liegt bei Simon Serrailler einiges im Argen. Seine Ex-Freundin Diana scheint die Trennung noch nicht überwunden zu haben, Cat, die Zwillingsschwester des Detective Chief Inspector, will mit ihrer Familie nach Australien auswandern - und dann stirbt auch noch Serraillers Mutter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susan Hill
Seelenängste
Der dritte Fall für Inspector Serrailler
Roman
Aus dem Englischen von Susanne Aeckerle
Kampa
Für die niemals Vergessenen
1
Da war keine Fliege, und es hätte eine Fliege da sein sollen. Der Raum sah danach aus. Graues Linoleum. Kittfarbene Wände. Stühle und Tische mit Stahlrohrbeinen. In solchen Räumen gab es auch immer eine Fliege, die langsam an der Fensterscheibe hinauf- und hinuntersurrte. Hinauf und hinunter. Hinauf und hinunter. Hinauf.
Die hintere Wand war mit Magnettafeln und Pinnwänden bedeckt. Namen. Daten. Orte. Dann kam:
Zeugen (Leerstelle)
Verdächtige (leer)
Spuren (leer)
Für jeden Fall.
Im Konferenzraum der Kriminalpolizei von North Riding befanden sich fünf Menschen, die bereits seit über einer Stunde auf die Tafeln starrten. Detective Chief Inspector Simon Serrailler hatte das Gefühl, schon sein halbes Leben lang auf eines der Fotos gestarrt zu haben. Das strahlende junge Gesicht. Die abstehenden Ohren. Die Schulkrawatte. Das frisch geschnittene Haar. Der Ausdruck. Interessiert. Wach.
David Angus. Es war acht Monate her, seit er morgens vor dem Tor seines Elternhauses um zehn Minuten nach acht verschwunden war.
David Angus.
Simon wünschte sich, es gäbe eine Fliege, die ihn hypnotisierte, statt des Gesichts des kleinen Jungen.
Der Anruf von Detective Chief Superintendent Jim Chapman hatte ihn zwei Tage zuvor aus einem herrlichen Sonntagnachmittag herausgerissen.
Simon hatte auf der Bank gesessen, mit Pads und Helm, und darauf gewartet, für die Polizei Lafferton gegen das Kreiskrankenhaus Bevham zu schlagen. Die Scorecard zeigte 228 für 5, die Bowler der Ärzte waren schlaff, und Simon glaubte, sein Team würde das Innings vorzeitig beenden, bevor er an die Reihe käme. Er war sich nicht sicher, ob ihm das etwas ausmachte oder nicht. Er spielte gerne, obwohl er nur ein durchschnittlicher Cricketspieler war. Aber an einem solchen Nachmittag, auf einem so schönen Spielfeld war er zufrieden, ob er nun zum Schlagen kam oder nicht.
Die Mauersegler schossen kreischend hoch über das Klubhaus, und die Schwalben glitten am Spielfeldrand entlang. Während der letzten Monate war Simon niedergeschlagen und ruhelos gewesen, aus keinem besonderen Grund und doch aus einer Unmenge von Gründen, aber die Freude am Spiel und die Aussicht auf eine angenehme Teepause im Klubhaus hatten seine Stimmung gehoben. Später war er zum Essen bei seiner Schwester und deren Familie eingeladen. Ihm fiel ein, was sein Neffe Sam letzte Woche gesagt hatte, als sie zusammen schwimmen waren; Sam hatte mitten in der Bahn angehalten und war mit einem »Heute ist ein guter Tag!« aus dem Wasser gesprungen.
Simon lächelte in sich hinein. Wie Kinder sich doch freuen konnten.
»Naaaaaaa?«
Der Schrei verklang. Der Batsman war in Sicherheit und kurz vor seinen hundert Runs.
»Onkel Simon, hey!«
»Hallo, Sam.«
Sein Neffe kam zur Bank gerannt. Er hielt das Handy in die Höhe, das Simon ihm in Verwahrung gegeben hatte, falls er schlagen musste.
»Anruf für dich. DCS Chapman, Kriminalpolizei North Riding.« Sams Gesicht war von Besorgnis überschattet. »Ich dachte, ich sollte besser fragen, wer dran ist …«
»Das ist vollkommen in Ordnung. Hast du gut gemacht, Sam.«
Simon stand auf und ging um die Ecke des Klubhauses.
»Serrailler.«
»Jim Chapman. Ein neuer Mitarbeiter?«
»Mein Neffe. Ich habe meine Pads an, bin als nächster Batsman dran.«
»Schön für Sie. Es tut mir leid, Sie am Sonntagnachmittag zu stören. Sehen Sie eine Möglichkeit, in den nächsten paar Tagen hier heraufzukommen?«
»Das vermisste Kind?«
»Mittlerweile seit drei Wochen, und wir haben nichts.«
»Ich könnte morgen am frühen Abend da sein und bis Dienstag oder Mittwoch bleiben, falls Sie mich so lange brauchen – sobald ich es hier abgeklärt habe.«
»Das habe ich gerade getan. Ihr Chief hält eine Menge von Ihnen.«
Jubel wurde laut, und Applaus erklang.
»Einer von uns ist ausgeschieden, Jim. Ich muss los.«
Sam wartete, mit Feuereifer, die Hand nach dem Handy ausgestreckt.
»Was soll ich machen, wenn es klingelt, während du schlägst?«
»Lass dir Namen und Nummer geben und sag, ich rufe zurück.«
»Mach ich, Chef.«
Simon beugte sich vor und zog seine Schienbeinschützer fest, um ein Lächeln zu verbergen.
Aber als er aufs Spielfeld ging, wölkte sich ein dünner Nebel der Trübsal um seinen Kopf, schloss die strahlende Helligkeit des Tages aus, verdarb ihm die Freude. Der Fall des entführten Kindes war ihm ständig präsent, ein Makel, der ihn nicht losließ. Was nicht nur an der Tatsache lag, dass es nach wie vor eine Leerstelle war, unausgefüllt und ungeklärt, sondern dass der Entführer des Jungen jederzeit wieder zuschlagen konnte. Niemand mochte einen offenen Fall, ganz zu schweigen von einem so verstörenden. Der Anruf von Jim Chapman hatte Simon zum Angus-Fall zurückgeholt, zur Polizei, zur Arbeit … und dazu, wie er diese Arbeit in den letzten paar Monaten empfunden hatte. Und warum.
Die Konfrontation mit dem trickreichen Spin-Bowling eines Herzspezialisten zwang ihn, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Simon schlug den ersten Ball und rannte los.
Das Wiehern des Ponys auf der Koppel weckte Cat Deerborn aus einem höchstens zweistündigen Schlaf. Verkrampft lag sie da und fragte sich, wo sie war. Sie war zu einem älteren Patienten gerufen worden, der die Treppe hinuntergefallen war und sich den Oberschenkelhals gebrochen hatte, und bei der Heimkehr hatte sie die Tür zufallen lassen und damit ihr jüngstes Kind geweckt. Felix war hungrig, durstig und unleidlich gewesen, und schließlich war Cat neben seinem Kinderbettchen eingeschlafen.
Jetzt richtete sie sich vorsichtig auf, aber Felix’ warmer kleiner Körper regte sich nicht. Die Sonne schien durch einen Spalt in den Vorhängen auf sein Gesicht.
Es war erst zehn nach sechs.
Das graue Pony stand grasend am Zaun und wieherte erneut, als es Cat mit einer Möhre in der Hand auf sich zukommen sah.
Wie könnte ich das alles verlassen?, dachte sie und spürte das weiche Maul. Wie könnten wir es ertragen, dieses Bauernhaus, diese Felder, dieses Dorf zu verlassen?
Die Luft duftete süß, in der Senke lag Nebel. Ein Specht stieß seinen Ruf aus und flog auf die Eiche am anderen Ende des Zauns zu.
Chris, ihr Mann, war wieder ruhelos, unglücklich in der Allgemeinarztpraxis, wütend über die Last der Verwaltungsarbeit, die ihn von seinen Patienten fernhielt, genervt von dem Berg neuer Vorschriften und Kontrollmaßnahmen. In den vergangenen Monaten hatte er mehrfach davon gesprochen, für fünf Jahre nach Australien zu gehen – was genauso gut für immer sein könnte, dachte Cat, da sie wusste, dass diese Befristung nur zu ihrer Beschwichtigung dienen sollte. Sie war einmal dort gewesen, um ihren Drillingsbruder Ivo zu besuchen, und es hatte ihr überhaupt nicht gefallen – der einzige Mensch, dem das je so gegangen war, behauptete Chris.
Sie wischte sich die Hände, schleimig vom Maul des Ponys, an ihrem Morgenmantel ab. Das Tier, momentan befriedigt, trottete ruhig über die Koppel davon.
Sie waren so nah bei der Stadt und der Praxis, nah bei ihren Eltern und Simon, bei der Kathedrale, die ihr so viel bedeutete. Gleichzeitig lebten sie mitten auf dem Land, einem richtigen Bauernhof gegenüber, wo die Kinder Lämmer und Kälber sahen und beim Füttern der Hühner halfen; sie gingen gerne in ihre Schulen, hatten Freunde in der Nachbarschaft.
Nein, dachte sie und spürte die warme Sonne auf ihrem Rücken. Nein.
Aus dem Haus brüllte Felix. Aber Sam würde sich um ihn kümmern, Sam, sein Bruder, der ihn anbetete, im Gegensatz zu Hannah, die ihr Pony vorzog und während Felix’ erstem Lebensjahr eifersüchtig auf das Baby geworden war.
Cat wanderte um die Koppel, wusste, dass sie später am Tag müde sein würde, ärgerte sich aber trotzdem nicht über den unterbrochenen Nachtschlaf – Patienten zu versorgen, wenn sie am schutzlosesten waren, vor allem die älteren und verängstigten, hatte für Cat immer zu den Vorzügen einer Allgemeinpraxis gehört, und sie hatte nicht vor, den nächtlichen Bereitschaftsdienst einer Agentur zu überlassen, wenn der neue Vertrag in Kraft trat. Chris war anderer Meinung. Sie hatten sich zu oft darüber gestritten und vermieden das Thema inzwischen.
Um die knorrigen Äste des alten Apfelbaums hatte sich ein Trieb der weißen Rose gerankt, und der Duft wehte herüber, als Cat vorbeikam.
Nein, dachte sie erneut.
In den letzten zwei Jahren hatte es zu viele schlimme Tage gegeben, zu viel Furcht und Anspannung, doch jetzt, abgesehen von ihrer üblichen Besorgnis um ihren Bruder, war alles in Ordnung – bis auf Chris’ Unzufriedenheit und Gereiztheit, bis auf seinen Wunsch, etwas zu verändern, wegzuziehen, alles zu verderben … Ihre nackten Füße waren nass vom Tau.
»Mammmmiii. Telefooooon …«
Hannah lehnte sich im Obergeschoss viel zu weit aus einem Fenster.
Cat rannte.
Es war ein Morgen, an den die Menschen sich erinnern würden, an den silberblauen, klaren Himmel und den frühmorgendlichen Sonnenschein und die Tatsache, dass alles frisch war. Sie entspannten sich und fühlten sich plötzlich sorglos, Fremde sprachen miteinander, wenn sie sich auf der Straße begegneten.
Natalie Combs würde sich ebenfalls erinnern.
»Ich kann Eds Auto hören.«
»Nein, kannst du nicht, es ist das von Mr Hardesty, und jetzt komm runter, wir sind spät dran.«
»Ich will Ed winken.«
»Du kannst Ed von hier unten winken.«
»Nein, ich …«
»Komm runter!«
Kyras Haar hing ihr ins Gesicht, zerzaust vom Schlaf. Sie war barfuß.
»Verdammt, Kyra, kannst du denn überhaupt nichts alleine machen? Wo ist deine Haarbürste, wo sind deine Schuhe?«
Aber Kyra war ins Vorderzimmer gegangen, um aus dem Fenster zu sehen und zu warten.
Natalie schüttete Schokofrosties in eine blaue Schüssel. Ihr blieben elf Minuten – um Kyra fertigzumachen, ihr eigenes Gesicht zu Ende zu schminken, ihre Sachen zusammenzusuchen, dafür zu sorgen, dass das dämliche Meerschweinchen Futter und Wasser bekam, und loszusausen. Was hatte sie sich bloß dabei gedacht.
Ich will dieses Baby behalten?
»Da ist Ed, da ist Ed …«
Sie hütete sich, Kyra zu unterbrechen. Es war jeden Morgen dasselbe.
»Wiedersehen, Ed … Ed …« Kyra schlug gegen die Scheibe.
Ed hatte sich beim Abschließen der Haustür umgedreht. Kyra winkte. Ed winkte.
»Wiedersehen, Kyra …«
»Kann ich heute Abend zu dir kommen, Ed?«
Doch das Auto war schon angesprungen. Kyra brüllte mit sich selbst.
»Hör auf, so eine Nervensäge zu sein.«
»Ed macht das nichts aus.«
»Du hast mich gehört. Iss deine Cornflakes.«
Aber Kyra winkte immer noch, winkte und winkte, bis Eds Auto um die Ecke bog und außer Sichtweite kam. Was hat Ed bloß an sich, verdammt?, überlegte Natalie. Trotzdem könnte es ihr eine halbe Stunde Zeit verschaffen, wenn sich Kyra nebenan reinmogeln konnte, um beim Blumengießen zu helfen oder einen Marsriegel vor Eds Fernseher zu verputzen.
»Schlabber doch nicht so mit der Milch rum, Kyra, da, siehst du …«
Kyra seufzte.
Für eine Sechsjährige, dachte Natalie, hat sie bereits das Seufzen einer Diva.
Die Sonne schien. Die Leute grüßten einander, stiegen in ihre Autos.
»Sieh mal, sieh mal.« Kyra zerrte an Natalies Arm. »Da, in Eds Fenster, das Regenbogending dreht sich, schau, all die schönen Farben, die sich bewegen.«
Natalie knallte die Autotür zu, öffnete sie, knallte sie noch einmal zu, was sie immer machen musste, sonst blieb sie nicht geschlossen.
»Können wir auch so einen Regenbogenmacher fürs Fenster haben? Die sind wie aus dem Märchenland.«
»Scheiße.« Natalie kam an der Kreuzung quietschend zum Stehen. »Pass doch auf, wo du hinfährst, du Arsch.«
Kyra seufzte und dachte an Ed; kein Brüllen, kein Fluchen, nie. Sie beschloss, heute Abend hinüberzugehen und zu fragen, ob sie Pfannkuchen backen könnten.
Die Sonne, die von der weißen Wand abstrahlte, weckte Max Jameson: helles, strahlendes Licht, das durch die Scheibe fiel. Er hatte das Loft wegen des Lichts gekauft – selbst an einem trüben Tag war der Raum davon erfüllt. Als er zum ersten Mal mit Lizzie hier gewesen war, hatte sie sich voller Entzücken umgeschaut.
»Die alte Bortenfabrik«, hatte sie gesagt. »Warum heißt die so?«
»Weil hier Borten hergestellt wurden. Lafferton-Borten waren berühmt.«
Lizzie hatte ein paar Schritte gemacht und dann mitten im Raum einen kleinen Tanz aufgeführt.
Das war das Loft – ein einziger Raum mit einer offenen Treppe zum Schlafzimmer und Badezimmer. Ein riesiger Raum.
»Wie auf einem Schiff«, hatte sie gesagt.
Max schloss die Augen, sah sie vor sich, den Kopf zurückgeworfen, das dunkle Haar herabhängend.
Es gab eine Wand aus Glas. Keine Jalousie, keine Vorhänge. Nachts brannten Laternen unten in der schmalen Straße. Hinter der alten Bortenfabrik gab es nur noch den Treidelpfad und den Kanal. Beim zweiten Mal hatte er Lizzie abends hierhergebracht. Sie war direkt ans Fenster getreten.
»Das ist das viktorianische England.«
»Ein nachgemachtes.«
»Nein. Nein, es ist echt. Es fühlt sich richtig an.«
An der Wand hinten im Raum hing ihr Bild. Er hatte das Foto von Lizzie gemacht, allein am See in ihrem Hochzeitskleid, den Kopf genauso zurückgeworfen, die Haare herabhängend, aber diesmal mit weißen Blumen durchflochten. Sie blickte auf und lachte. Das Foto war an der weißen Wand auf drei Meter fünfundsechzig mal drei Meter vergrößert worden. Als Lizzie es zum ersten Mal gesehen hatte, war sie weder verblüfft noch verlegen gewesen, nur nachdenklich geworden.
»Das ist die schönste Erinnerung«, hatte sie schließlich gesagt.
Max öffnete erneut die Augen, und das Sonnenlicht blendete ihn. Er hörte sie.
»Lizzie?« Panisch, da sie nicht neben ihm lag, warf er die Decke zurück. »Lizzie …?«
Sie war halb die Treppe hinunter, übergab sich.
Er versuchte ihr zu helfen, sie aus der Gefahrenzone zu bringen, aber ihre Unsicherheit machte es schwierig, und er hatte Angst, sie könnten beide stürzen. Dann starrte sie ihm ins Gesicht, die Augen weit aufgerissen und entsetzt, und schrie ihn an.
»Lizzie, alles in Ordnung, ich bin da, ich bin’s. Ich tu dir nicht weh, ich tu dir nicht weh. Lizzie …«
Irgendwie gelang es ihm, sie wieder zum Bett zu führen und sie zu bewegen, sich hinzulegen. Sie rollte sich zusammen, von ihm abgewandt, und stieß kleine, wütende Kehllaute aus wie eine fauchende Katze. Max lief ins Badezimmer, kippte sich kaltes Wasser über Kopf und Nacken, putzte sich die Zähne und ließ dabei die Tür offen. Er konnte das Bett im Spiegel des Medizinschranks sehen. Sie hatte sich nicht mehr gerührt. Er zog sich Jeans und ein Hemd über, ging hinunter in den strahlenden Raum und stellte den Wasserkessel an. Er atmete schwer, war verspannt durch die Panik, hatte feuchte Hände. Wie ein bitterer Geschmack blieb jetzt die Angst ständig in seinem Mund und seiner Kehle.
Dann kam das Poltern. Er wirbelte herum und sah Lizzie gerade noch in grausiger Zeitlupe die gesamte Treppe hinunterfallen und unten liegen bleiben, das eine Bein unter ihrem Körper abgeknickt, die Arme ausgestreckt, schreiend vor Schmerz und Angst wie ein wütendes Kind.
Der Kessel stieß Dampf aus, und das Sonnenlicht fing sich in der Glastür des Wandschranks wie Feuer.
Max spürte, wie ihm Tränen über das Gesicht liefen. Der Kessel war zu voll, lief beim Ausgießen über und verbrühte ihm die Hand.
Lizzie lag am Fuße der Treppe, und das Geräusch, das sie von sich gab, war das Brüllen eines Tieres, stammte nicht von ihr, nicht von Lizzie, nicht von seiner Frau.
Cat Deerborn hörte es durch das Telefon.
»Max, Sie müssen langsamer sprechen … Was ist passiert?«
Aber sie konnte, abgesehen von dem Krach im Hintergrund, nur ein paar zusammenhanglose, erstickte Worte ausmachen.
»Max, halten Sie durch … Ich komme sofort. Halten Sie durch …«
Felix krabbelte im Flur auf das Treppengitter zu, roch nach schmutziger Windel. Cat hob ihn hoch und trug ihn ins Bad, wo Chris sich rasierte.
»Das war Max Jameson«, sagte sie. »Lizzie … ich muss weg. Lass dir von Hannah helfen.«
Sie rannte, zog im Laufen den Reißverschluss ihres Rocks zu, wich Chris’ Blick aus.
Draußen roch die Luft nach Heu, und das graue Pony trabte über die Koppel, mit vor Vergnügen schlagendem Schweif. Cat war im Nu aus der Einfahrt und beschleunigte auf der Straße, plante, was zu tun sei, wie sie Max Jameson endlich davon überzeugen konnte, dass es für ihn nicht möglich war, Lizzie zum Sterben zu Hause zu behalten.
2
Serrailler war in dem Raum ohne Fliege. Bei ihm waren die höheren Kriminalbeamten des Teams, das den Fall des entführten Kindes bearbeitete.
DCS Jim Chapman war der SIO, der Senior Intelligence Officer, der Leiter des Teams. Er stand kurz vor der Pensionierung, war freundlich, erfahren und scharfsinnig und hatte sein ganzes Berufsleben bei der Polizei von Nordengland verbracht, größtenteils in Yorkshire. Die anderen waren erheblich jünger. Detective Sergeant Sally Nelmes war klein, gepflegt, ernsthaft und galt als Senkrechtstarterin. Detective Constable Marion Coopey, sehr ähnlich in ihrem Wesen, war vor Kurzem aus dem Thames Valley hierher versetzt worden. Während der Besprechung hatte sie sich nur wenig geäußert, aber was sie gesagt hatte, war scharf und pointiert. Der andere Mann aus Yorkshire, Lester Hicks, war seit Langem ein Kollege von Jim Chapman und außerdem sein Schwiegersohn.
Sie hatten das Mitglied einer auswärtigen Polizeieinheit freundlich aufgenommen, genauso gut hätten sie misstrauisch oder ablehnend sein können. Sie waren konzentriert und tatkräftig, und Serrailler war beeindruckt, erkannte jedoch gleichzeitig die aufkeimenden Anzeichen von Frustration und Entmutigung, die er auch bei dem unter ihm an dem David-Angus-Fall arbeitenden Team aus Lafferton erlebt hatte. Er verstand es voll und ganz, durfte aber durch seine Anteilnahme kein Gefühl von Unvermögen, geschweige denn Defätismus aufkommen lassen.
Ein Kind aus dem Ort Herwick wurde vermisst. Der Junge war achteinhalb. Um fünfzehn Uhr am ersten Tag der Sommerferien war Scott Merriman zum Haus seines Cousins Lewis Tyler aufgebrochen, einen knappen Kilometer entfernt. Er hatte einen Sportbeutel mit Badesachen bei sich gehabt – Lewis’ Vater Ian wollte sie ins neue Schwimmbad bringen, eine Fahrt von einer halben Stunde.
Scott war bei den Tylers nie angekommen. Nachdem Ian zwanzig Minuten gewartet hatte, rief er bei den Merrimans und auf Scotts Handy an. Scotts elfjährige Schwester Lauren berichtete Ian, dass Scott »vor Ewigkeiten« losgegangen sei. Sein Handy war abgeschaltet.
An der Straße, die Scott entlanggegangen war, standen hauptsächlich Wohnhäuser, es war eine stark befahrene Ausfallstraße.
Keiner meldete sich, der den Jungen gesehen hatte. Weder eine Leiche noch ein Sportbeutel wurden gefunden.
Ein Schulporträt von Scott Merriman hing an einer der Tafeln im Konferenzraum, ein Stück neben dem von David Angus. Sie glichen sich nicht, hatten aber etwas ähnlich Frisches an sich, einen eifrigen Ausdruck, der Simon Serrailler zu Herzen ging. Scott lächelte auf dem Foto, zeigte eine Lücke zwischen den Zähnen.
Ein Detective Constable kam mit einem Teetablett in den Raum. Serrailler begann auszurechnen, wie viele Plastikbecher Tee er wohl seit seinem Eintritt in die Polizei getrunken hatte. Dann stand Chapman auf. Da war etwas in seinem Ausdruck, etwas Neues. Er war ein maßvoller, ausgeglichener Mann, doch jetzt wirkte er wie angespornt, von frischer Energie erfüllt. Simon richtete sich auf und merkte, dass die anderen dasselbe taten, den Rücken durchdrückten, sich aus ihrer zusammengesackten Haltung aufrafften.
»Eines habe ich in dieser Ermittlung noch nicht getan. Und ich glaube, jetzt wäre es an der Zeit. Simon, hat Lafferton beim David-Angus-Fall Kriminalpsychologen eingesetzt?«
»Als Profiler? Nein. Es wurde darüber diskutiert, aber ich habe es abgelehnt, weil ich der Meinung war, sie hätten einfach nicht genug, wovon sie ausgehen könnten. Sie hätten uns nur ein allgemeines Bild über Kinderentführer geben können – und das kennen wir bereits.«
»Stimmt. Trotzdem glaube ich, dass wir die Sache auch mal aus dieser Perspektive betrachten sollten. Spielen wir Profiler. Überlegen wir, wer eines oder beide dieser Kinder entführt haben könnte – und womöglich auch noch andere. Glauben Sie, das könnte eine nützliche Übung sein?«
Sally Nelmes klopfte mit einem Stift an ihre Schneidezähne.
»Ja?« Chapman entging nichts.
»Wir haben als Ausgangsmaterial nicht mehr, als es ein Profiler hätte, ist meine Ansicht.«
»Nein, haben wir nicht.«
»Ich finde, wir sollten da draußen sein, nicht hier sitzen und uns Geschichten ausdenken.«
»Uniformierte und Kriminalbeamte sind immer noch da draußen. Wir waren alle schon draußen und werden es auch wieder sein. Diese Sitzung, zusammen mit dem Beitrag von DCI Serrailler, dient dazu, dass sich das Kernteam Zeit nimmt, nachzudenken … im Kreis zu denken, durchzudenken, zu denken.« Er hielt inne. »Zu denken«, wiederholte er, diesmal lauter. »Zu bedenken, was passiert ist. Zwei kleine Jungen wurden ihrem Zuhause, ihrer Familie, ihrer vertrauten Umgebung entrissen und sind in furchtbare Angst versetzt, vermutlich missbraucht und fast sicher ermordet worden. Zwei Familien sind zerbrochen, haben gelitten, leiden nach wie vor, sind voller Qual und Schmerz, sie sind verstört, ihre Phantasie läuft Amok, sie schlafen nicht, essen nicht, können nicht normal funktionieren, sich auf nichts und niemanden konzentrieren, und es gibt kein Zurück für sie, nichts wird für sie jemals wieder normal sein. Das alles wissen Sie genauso gut wie ich, aber ich muss Sie daran erinnern. Wenn wir zu keinem Ergebnis kommen und all unser Nachdenken und Reden für unsere Ermittlungen nichts Neues ergeben, bleibt mir nichts anderes übrig, als einen Experten von außen hinzuzuziehen.«
Er setzte sich wieder und drehte seinen Stuhl herum. Sie bildeten eine Art Halbkreis.
»Denkt darüber nach«, sagte er, »welche Art von Mensch diese Dinge getan hat.«
Einen Moment lang herrschte aufgeladenes Schweigen. Serrailler betrachtete Chapman mit großem Respekt. Dann kamen die Worte, die Vorschläge, die Beschreibungen, eins nach dem anderen, klatsch, klatsch, klatsch, aus dem Halbkreis wie Karten, die bei einem schnellen Kartenspiel auf den Tisch geknallt werden.
»Pädophiler.«
»Einzelgänger.«
»Männlich … ein kräftiger Mann.«
»Jung …«
»Kein Teenager.«
»Autofahrer … na ja, offensichtlich.«
»Arbeitet allein.«
»Fernfahrer … Lastwagenfahrer, so was in der Art …«
»Unterdrückt … sexuell unzulänglich …«
»Unverheiratet.«
»Nicht unbedingt … wie kommst du darauf?«
»Kann keine Beziehung eingehen …«
»Als Kind missbraucht …«
»Gedemütigt worden …«
»Ist ’ne Machtsache, oder?«
»Niedrige Intelligenz …«
»Schmutzig … kein Selbstwertgefühl … schmuddelig …«
»Verschlagen.«
»Nein – rücksichtslos.«
»Dreist jedenfalls. Von sich eingenommen.«
»Nein, nein, genau das Gegenteil. Unsicher. Sehr unsicher.«
»Geheimniskrämer. Kann gut lügen. Vertuschen …«
Und so ging es weiter und weiter, die Karten klatschten immer schneller. Chapman schwieg, schaute nur von Gesicht zu Gesicht, folgte dem Muster. Auch Serrailler schwieg, beobachtete sie mit einem zunehmend mulmigen Gefühl. Irgendetwas stimmte nicht, aber er konnte weder das Was noch das Warum festmachen.
Allmählich verebbten die Bemerkungen. Die Karten gingen ihnen aus. Sie sackten wieder auf ihren Stühlen zusammen. DS Sally Nelmes warf Serrailler hin und wieder Blicke zu – keine besonders freundlichen.
»Jetzt wissen wir also genau, wen wir vor uns haben«, sagte sie schließlich.
»Wirklich?« Marion Coopey beugte sich vor, um ein Blatt Papier aufzuheben.
»Na ja, halt einen ziemlich vertrauten Typus …«
Einen kurzen Moment lang sah es so aus, als wollten die Frauen sich streiten. Serrailler zögerte, wartete auf den DCS, aber Jim Chapman schwieg weiter.
»Wenn ich darf …«
»Simon?«
»Ich glaube, ich weiß, was DC Coopey meint. Während alle ihre Ideen in den Ring warfen, wurde mir immer mulmiger … Und das Problem ist … genau dieser ›vertraute Typus‹ … wenn man alles zusammennimmt, zeichnet es das Bild von jemandem, den Sie alle als typischen Kinderentführer betrachten.«
»Und stimmt das nicht?«, forderte Sally Nelmes ihn heraus.
»Vielleicht. Manches davon wird zweifellos zutreffen … Es gibt mir nur zu denken – und das tut es immer beim Profiling, wenn man es als Ganzes schluckt –, dass wir ein Phantombild erstellen und dann nach einer Person suchen, die dazu passt. Funktioniert gut, wenn wir es mit einem Phantombild zu tun haben, das von jemandem stammt, den mehrere Menschen tatsächlich gesehen haben könnten. Aber hier nicht. Ich möchte nicht, dass wir uns auf diesen ›vertrauten Typus‹ fixieren und jeden ausschließen, der nicht dazu passt.«
»In Lafferton haben Sie also mehr, wovon Sie ausgehen können?«
Er fragte sich, ob DS Nelmes einen Komplex hatte oder ihn einfach nur nicht mochte, doch er ging damit um, wie er es immer tat, und womit er fast immer erfolgreich war. Er wandte sich ihr zu und lächelte, ein intimes, freundliches Lächeln mit Blickkontakt, ein Lächeln nur zwischen ihnen beiden.
»Ach, Sally, ich wünschte es …«, sagte er.
Aus dem Augenwinkel sah er, dass Jim Chapman jede Nuance dieses Blickwechsels registriert hatte.
Sally Nelmes bewegte sich ein wenig, und die Andeutung eines Lächelns hob ihre Mundwinkel.
Zum Lunch machten sie eine kurze Pause, und danach gingen Serrailler und Jim Chapman ein wenig spazieren, hinaus aus dem Siebziger-Jahre-Flachbau der Kripo und eine unspektakuläre Straße entlang, die in die Stadt führte. In Yorkshire gab es keine Sonne und anscheinend keinen Sommer. Der Himmel war von einem erstarrten Grau, die Luft seltsam chemisch.
»Ich bin Ihnen keine große Hilfe«, sagte Simon.
»Ich musste sichergehen, dass uns nichts entgangen war.«
»Es ist ein verfluchter Fall. Ihre Leute sind genauso frustriert, wie wir es waren.«
»Nur noch nicht so lange.«
»Das sind die Fälle, die einem unter die Haut gehen.«
Sie erreichten die Kreuzung mit der Durchgangsstraße und machten kehrt.
»Meine Frau erwartet Sie übrigens zum Dinner.«
Simons Laune stieg. Er mochte Chapman, aber es war mehr als das; er kannte hier sonst niemanden, die Stadt und ihre Umgebung waren ihm fremd und nicht besonders anziehend, und das Hotel war in demselben Stil erbaut wie die Polizeidienststelle, mit genauso wenig Seele. Simon hatte schon überlegt, ob er nicht nach beendeter Arbeit heimfahren sollte, statt hierzubleiben und allein eine schlechte Mahlzeit einzunehmen, doch die Einladung von Chapman munterte ihn auf.
»Ich möchte mit Ihnen nach Herwick fahren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bekomme im Allgemeinen ein Gefühl für einen Ort, wenn ich da ein wenig herumlaufe. Wir haben keine Beweise, es gibt dort auch nichts … Doch ich möchte gerne sehen, wie Sie darauf reagieren.«
Serrailler und Chapman fuhren zusammen mit Lester Hicks auf dem Rücksitz nach Herwick. Hicks war ein wortkarger Mann aus Yorkshire, klein und stämmig, mit einem kahl rasierten Kopf und dem chauvinistischen Verhalten, das Simon schon öfter bei Männern aus dem Norden erlebt hatte. Anscheinend mit wenig Vorstellungsvermögen ausgestattet, wirkte er vernünftig und besonnen.
Die Stadt Herwick lag am Rand der Ebene von York und schien sich planlos ausgebreitet zu haben. Die Außenbezirke bestanden aus einem Band von Gewerbegebieten, Baumärkten und Multiplexkinos, und das Stadtzentrum war voller Läden von Wohltätigkeitsorganisationen und billigen Schnellrestaurants.
»Wie sieht es hier mit Arbeitsplätzen aus?«
»Nicht besonders gut … Es gibt einen Verpackungsbetrieb für Hühnerfleisch, mehrere große Callcenter, aber die bauen gerade wieder Stellen ab – das wird alles ins Ausland verlagert, weil es da billiger ist. Große Zementfabriken … ansonsten Arbeitslosigkeit. So, wir sind fast da. Das ist die Painsley Road … hat eine Verbindung zur Schnellstraße drei Kilometer weiter.« Sie fuhren langsam weiter und bogen dann links ab. »Hier ist das Haus der Tylers … Nummer 202 …«
Es war eine gesichtslose Straße. Doppelhäuser und ein paar heruntergekommene Reihenhäuser; zwei Ladenzeilen – Zeitungskiosk, Fish and Chips, Buchmacher, Waschsalon; ein Beerdigungsunternehmen mit Spitzengardinen in den Schaufenstern und einem Flachbau dahinter.
Zwei Häuser daneben lag das Haus der Tylers. Hellrote Ziegel in Fischgrätmuster waren vor Kurzem im ehemaligen Vorgarten verlegt worden. Der Zaun fehlte noch.
Sie bremsten ab.
»Scott hätte sich dem Haus von dort aus nähern müssen … Er wäre von der Kreuzung gekommen.«
Niemand achtete auf das im Schritttempo fahrende Auto. Eine Frau schob einen Kinderwagen, ein alter Mann fuhr in einem Rollstuhl den Bürgersteig entlang. Zwei Hunde kopulierten am Straßenrand.
»Was sind das für Leute?«, fragte Serrailler.
»Die Tylers? Er ist Klempner, seine Frau arbeitet in der Hühnerfabrik. Anständige Leute. Nette Kinder.«
»Wie kommen sie damit zurecht?«
»Der Vater sagt nicht viel, macht sich aber Vorwürfe, dass er den Jungen nicht mit dem Auto abgeholt hat.«
»Scotts Eltern?«
»Kurz davor, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen … Aber ich glaube, das ist nicht neu. Seine Schwester scheint das ganze Gewicht der Familie auf ihren Schultern zu tragen.«
»Und sie ist …«
»Dreizehn, auf dem Weg zu dreißig. Hier hätte Scott um die Ecke biegen müssen … Diese Straße führt zu seinem Haus. Es steht in einer kleinen, etwa zweihundert Meter langen Sackgasse, die von der Hauptstraße abgeht.«
»Niemand hat ihn hier langgehen sehen?«
»Niemand hat irgendwas gesehen, Punkt.«
Eine weitere nichtssagende Straße mit Häusern hinter Gartenzäunen oder verwahrlosten Ligusterhecken. Drei große Wohnblöcke. Eine aufgegebene Baptistenkapelle mit Holzbalken über der Tür und vor den Fenstern. Stetiger, aber kein starker Verkehr auf der Hauptstraße.
»Schwer zu glauben, dass niemand den Jungen gesehen hat.«
»Ach, sie werden ihn schon gesehen haben … nur ohne ihn wahrzunehmen.«
»Demnach muss es ganz normal gewirkt haben, ohne jeden Kampf, genau wie bei David Angus. Niemand übersieht es, wenn ein Kind gewaltsam in ein Auto gezerrt wird.«
»Jemand, den sie beide kannten?«
»Die beiden können nicht dieselbe Person gekannt haben, das ist äußerst unwahrscheinlich. Also müssten wir es dann mit zwei unterschiedlichen Entführern zu tun haben. Beide kannten das jeweilige Kind gut genug, um …« Simons Stimme verklang. Sie wussten alle, dass es sich nicht lohnte, den Satz zu beenden.
»Das hier ist Richmond Grove. Nummer sieben … hinten rechts.«
Die Häuser waren auf winzige Grundstücke gezwängt. Simon konnte sich vorstellen, wie viel Krach durch die dünnen Trennwände drang, wie klein die Gärten dahinter waren.
Chapman schaltete den Motor ab. »Wollen Sie aussteigen?«
Serrailler nickte. »Warten Sie hier?«
Er ging langsam los. Die Vorhänge in Nummer sieben waren zugezogen. Kein Auto stand davor, kein Anzeichen von Leben war zu sehen. Er betrachtete das Haus lange, versuchte sich den Jungen mit der Zahnlücke vorzustellen, wie er aus der Tür kam, den Schwimmbeutel über der Schulter, auf die Querstraße zuging … links abbog … fröhlich marschierte. Serrailler drehte sich um. Ein Bus fuhr auf der Hauptstraße vorbei, aber es schien weit und breit keine Haltestelle zu geben. Simon blickte die graue Straße entlang. Wie weit war Scott gekommen? Wer hatte neben ihm angehalten? Was hatte derjenige gesagt, um den Jungen zum Einsteigen zu überreden?
Er setzte sich wieder ins Auto.
»Erzählen Sie mir, wie der Junge war … Schüchtern? Aufgeweckt? Alt oder jung für sein Alter?«
»Frech. Das haben die Lehrer gesagt. Aber in Ordnung. Sie mochten ihn. Machte keine Probleme. Viele Freunde. War beliebt. Ein Anführertyp. Fußballfan, die örtliche Mannschaft. Werden die Haggies genannt. Hatte ihr Logo auf dem Schwimmbeutel.«
»Die Art von Kind, die mit einem Fremden reden würde, wenn es beispielsweise nach dem Weg gefragt wird?«
»Sehr wahrscheinlich.«
Während David Angus insgesamt etwas zurückhaltender war, allerdings ebenfalls mit so einem Fremden gesprochen hätte, weil es die Höflichkeit gebot.
Hicks’ Handy klingelte. Drei Minuten später rasten sie zurück zur Einsatzzentrale. Bei Hicks’ Frau, Chapmans Tochter, hatten die Wehen vierzehn Tage zu früh eingesetzt; es war ihr erstes Kind.
Serrailler verbrachte den Nachmittag allein und ging die Akten zum Scott-Merriman-Fall durch. Irgendwann trank er einen Tee in der Kantine. Um halb sieben fuhr er zurück ins Hotel.
Sein Zimmer hatte eine beige Tapete mit Goldrändern und roch nach abgestandenem Zigarettenrauch, das Bad schien gerade groß genug für einen Zehnjährigen. Jim Chapman hatte sich mit überstürzten Entschuldigungen verabschiedet und gesagt, er werde sich »später melden«. Serrailler hatte die Wahl … entweder grübelnd in seinem Zimmer auf dem Bett zu liegen, grübelnd allein in der Bar zu sitzen oder die lange Heimfahrt auf verstopften Straßen zurück nach Lafferton in Angriff zu nehmen. Starker Regen hatte eingesetzt. Die Fahrt schien keine angenehme Alternative.
Simon duschte und zog ein sauberes Hemd an.
Die Bar war leer bis auf einen Geschäftsmann, der in einer Ecke an seinem Laptop arbeitete. Die Möbel waren rot lackiert. Auf jedem Tisch lag eine Cocktailkarte. Simon bestellte ein Bier.
Er fühlte sich in seiner eigenen Gesellschaft immer wohl, aber die Hässlichkeit dieser Umgebung und die Abgeschnittenheit von allem, was er kannte und liebte, schienen ihm Leben zu entziehen. In zwei Monaten wurde er siebenunddreißig. Er fühlte sich älter. Er war immer gern Polizist gewesen, doch etwas an diesem Leben begann ihn zu frustrieren. Es gab zu viele Einschränkungen, zu viel an politischer Korrektheit, das erst abgehakt werden musste, bevor man mit der Arbeit vorankam. War es für irgendjemanden von Bedeutung? Hatte sich durch das, was er tat, ein einziges Leben verbessert, wenn auch nur geringfügig? Er dachte daran, welche wichtige Rolle seine Schwester Cat spielte, als gewissenhafte und engagierte Ärztin, was seine Eltern während ihrer aktiven Arztzeit getan hatten, um Leben zu verändern. Vielleicht hatten sie ja recht gehabt, vielleicht hätte er Mediziner werden und seinen Vater glücklich machen sollen.
Er ließ sich gegen die schimmernde rote Rücklehne sinken. Der Barmann hatte die Strahler um die Bar angeschaltet, nur trug auch das nichts zur Hebung der Stimmung bei.
Was ihm fehlte, dachte Simon plötzlich, war Aufregung, der Adrenalinstoß, den er vor zwei Jahren bei der Verfolgung des Serienmörders in seinem Bezirk gespürt hatte und der in den frühen Tagen seiner Polizeilaufbahn fast immer da gewesen war. Die Polizeipräsidentin hatte mehr als einmal angedeutet, dass Simon die nächste Stufe der Karriereleiter erklimmen sollte, aber wenn er sich zum Superintendent und darüber hinaus befördern ließe, würde er noch weniger rauskommen, noch mehr Zeit im Büro verbringen, und das wollte er nicht. Es war die alte Geschichte: Werde kein Schuldirektor, wenn du gern unterrichtest, nimm keinen höheren Posten in der Klinik an, wenn du dich gerne um Patienten kümmerst. Wenn du die Erregung der Jagd willst, bleib in Uniform oder Constable. Aber das hatte er nicht getan, und ein Zurück gab es nicht. Geld war nicht sein Motiv. Allerdings fragte er sich wie üblich, ob ihm Kunst so viel Befriedigung und Vergnügen bereiten würde, wenn er davon leben musste. Vielleicht würde mit der Zeit alles schal.
Vielleicht.
Er stand gerade auf, um sich an der Bar ein weiteres Bier zu bestellen, als er seinen Namen hörte.
DC Coopey sah in einem fließenden schwarzen Kleid, mit hochgestecktem Haar und langen Ohrringen völlig verändert aus. Eine Sekunde lang blickte Simon sie an, ohne sie zu erkennen. Doch sie trat selbstbewusst und lächelnd auf ihn zu.
»Das ist traurig«, sagte sie. »Wirklich … ein einsamer Drink in einem Schuppen wie diesem. Da weiß ich etwas Besseres für Sie.« Sie sah sich um. »Wo sitzen Sie?«
Simon zögerte, deutete dann auf seinen Tisch.
»Gut. Ich hätte gern einen Wodka Tonic, bitte, und dann schlage ich vor, dass ich Sie in ein halbwegs anständiges Lokal mitnehme. Ins Sailmaker.« Sie rauschte durch den Raum und setzte sich.
Er war verärgert, fühlte sich eingeengt und abgeurteilt. Plötzlich enthüllten sich ihm der Charme dieser ruhigen Bar und die Annehmlichkeit seiner eigenen Gesellschaft. Aber seine guten Manieren setzten instinktiv ein, wenn Simon gereizt war; er bestellte ihren Drink und trug ihn zum Tisch.
»Sie trinken nichts mehr?«
»Nein. Ich muss morgen früh raus.«
Marion Coopey trank ihren Wodka und sah ihn über das Glas hinweg an. Sie hat ein recht angenehmes Gesicht, dachte er, weder reizlos noch hübsch, auch wenn sie zu viel Make-up trug. Er brachte diese Person nicht mit der Kriminalbeamtin unter einen Hut, die im Konferenzraum so vernünftig gesprochen hatte. Er hatte sie als sehr karriereorientiert eingeschätzt, auf dem Weg zur nächsten Beförderung.
»Aber Sie werden doch mit mir essen gehen – es ist kein Restaurant, sondern ein Klub, und die Küche ist sehr gut. Es überrascht mich, das Sie noch nie vom Sailmaker gehört haben.«
»Ich bin zum ersten Mal hier.«
»Das weiß ich, aber Homotreffs sprechen sich doch herum.«
Es traf ihn wie ein Schock, ihr selbstsicherer Ton und die Annahme, die dahinterstand. Ihm stieg das Blut ins Gesicht.
Marion Coopey lachte nur. »Ach, kommen Sie schon, Simon, ich bin homosexuell, und Sie sind’s auch. Was soll’s? Deswegen dachte ich, wir könnten einen Abend zusammen genießen. Ist das für Sie ein Problem?«
»Nur, dass Sie absolut und total danebenliegen. Und ich muss ein paar Anrufe machen.« Er stand auf.
»Das glaube ich jetzt nicht … Wie altmodisch kann man denn sein? Heutzutage ist das doch völlig in Ordnung, wissen Sie. Es gibt bei der Polizei sogar eine eigene Organisation für Lesben und Schwule.«
»DC Coopey …«, er sah, wie sie den Mund öffnete, um »Marion« zu sagen, sich aber bei seinem Ton wieder zurücknahm, »… ich gedenke nicht, über mein Privatleben mit Ihnen zu diskutieren, außer zu wiederholen, dass Ihre Annahme falsch ist. Ich …«
In seiner Jackentasche klingelte das Handy. Jim Chapmans Nummer war auf dem Display.
»Jim? Gute Neuigkeiten?«
»Von zu Hause. Stephanie hat um vier Uhr ein Mädchen geboren. Alles bestens.«
»Das ist ja wunderbar. Meine Glück…«
»Der Rest ist nicht so gut.«
»Wie bitte?«
»Wir haben noch eins.«
Simon schloss die Augen. »Sprechen Sie weiter …«
»Heute Nachmittag. Ein sechsjähriges Mädchen. Hat sich ein Eis an einem Eiswagen gekauft … Jemand hat sie gepackt. Nur diesmal gibt es einen Zeugen – Zeitpunkt, Ort, Beschreibung des Autos …«
»Kennzeichen?«
»Teilweise … Das ist mehr, als wir je hatten.«
»Wo ist es passiert?« Er warf Marion Coopey einen Blick zu. Ihr Ausdruck hatte sich verändert.
»In einem Dorf namens Gathering Bridge, oben in den Mooren von North York.«
»Kann ich Ihnen irgendwie von Nutzen sein?«
»Ich würde nicht Nein sagen.«
Simon steckte sein Handy ein. Marion war aufgestanden.
»Ein weiteres Kind. Ich fahre zur Einsatzzentrale.«
Er durchquerte die Bar, und sie folgte ihm rasch. An der Tür hielt sie ihn auf. »Ich sollte mich wohl lieber entschuldigen«, sagte sie.
Er war immer noch wütend, aber jetzt stand die Arbeit wieder im Vordergrund, und er schüttelte nur den Kopf. »Es ist nicht weiter wichtig.« Mit langen Schritten erreichte er sein Auto und ließ sie hinter sich zurück.
Die Kripo brummte. Simon begab sich direkt in die Einsatzzentrale.
»Der DCS ist zum Tatort gefahren, Sir. Er hat mich gebeten, Sie auf den neuesten Stand zu bringen.«
Die Wandtafeln waren mit Informationsmaterial gespickt, und ein halbes Dutzend Kriminalbeamte saßen an Computern.
Serrailler trat zu dem Foto eines silbernen Ford Mondeo.
»XTD oder XTO4 …«, stand daneben.
»Ist die Presse mit im Boot?«
»Der DCS unterrichtet sie am Tatort.«
»Was wissen wir bisher?«
»Gathering Bridge ist ein großes Dorf … altes Zentrum, Neubaugebiete außen herum … ist in den letzten zehn Jahren stetig gewachsen. Hübscher Ort. Das Kind ist gerade sechs geworden … Amy Sudden … Wohnt mit ihren Eltern und einer jüngeren Schwester in einer Sackgasse mit Cottages. Wollte sich ein Eis von einem Eiswagen holen, der an der Ecke zur Hauptstraße geparkt war. Sie war das letzte Kind, das zu dem Wagen kam – der Eisverkäufer wollte gerade Schluss machen, als Amy angelaufen kam. Sie bekam ihr Eis und ging zur Sackgasse zurück, der Eiswagen fuhr los, als ein Auto die Hauptstraße entlangkam und neben dem Mädchen an den Straßenrand fuhr … Der Fahrer beugte sich halb hinaus und zog das Kind rein. Ging alles offensichtlich blitzschnell, der Typ beschleunigte und schloss gleichzeitig die Tür … Der Eiswagenfahrer hielt an und sprang hinaus, aber der Mondeo war weg … Der Eisverkäufer konnte nur noch den Anfang des Autokennzeichens entziffern. Er rannte brüllend die Straße entlang … Jemand kam aus einem Haus … Wir wurden angerufen.«
»Wo ist der Mondeo jetzt?«
»Verschwunden. Wurde seither nicht mehr gesehen.«
»Viel Verkehr?«
»Nicht im Dorf, aber drei Kilometer dahinter kommt man auf eine der Schnellstraßen, die zur Küste führen. Da ist viel los.«
»Und das Kennzeichen?«
»Wird überprüft …«
»Aber es reicht nicht?«
»Nein, die Computer werden ein paar Tausend ausspucken.«
Simon ging hinunter in die Kantine, holte sich Tee und ein getoastetes Sandwich und nahm beides mit an einen Ecktisch. Er wollte nachdenken. Er stellte sich den silbernen Mondeo vor, wie der Fahrer mit dem Kind in Panik auf die Schnellstraße zuraste, das Gebiet unbedingt verlassen wollte, mit wild schlagendem Herzen, ohne klar denken zu können. Diesmal war es schiefgegangen. Die Tat war impulsiv erfolgt, wie die anderen, am helllichten Tag, doch jetzt hatte ihn das Glück verlassen. Er war entdeckt worden. Der Entführer musste davon ausgehen, dass sein Autokennzeichen vollständig notiert und er selbst aus nächster Nähe gesehen worden war. Seine Beschreibung würde an alle Polizeikräfte durchgegeben werden. Sein Instinkt riet ihm, in Bewegung zu bleiben, möglichst schnell und möglichst weit weg.
Am Ende verlässt einen das Glück. Für gewöhnlich. Manchmal.
Trotzdem musste Simon auch andere Möglichkeiten durchdenken – dass es ein anderer Entführer war und sich, falls man ihn fand, herausstellen würde, dass er mit dem Verschwinden der beiden kleinen Jungen im Abstand von fast einem Jahr nichts zu tun hatte. Doch Simon vertraute seinem Instinkt, und sein Bauchgefühl sagte ihm: Das ist derjenige, das ist er.
Aufregung überkam ihn. Wenn sie dem Mondeo auf die Spur kamen, dann hatten sie eine Chance. Hier handelte es sich nicht nur um Jim Chapmans Fall, sondern auch um seinen.
Er ging an die Theke, um sich Tee nachschenken zu lassen, und prallte fast mit Marion Coopey zusammen, in Jeans, Jackett und ohne Ohrringe. Sie warf ihm einen vorsichtigen Blick zu. Er nickte und ging an seinen Platz zurück, wollte nicht mit ihr reden. Ihr abendliches Auftauchen in seinem Hotel hatte ihm an und für sich nichts ausgemacht; es hätte eine freundliche Geste gegenüber einem zu Besuch weilenden Kollegen in einer fremden Stadt sein können. Nur ihre Unterstellung hatte ihn geärgert. Er war schon öfter für schwul gehalten worden, ohne sich groß darum zu scheren. Doch heute hatte es ihn wütend gemacht, und er hatte sich in die Defensive gedrängt gefühlt. Er war ein sehr zurückhaltender Mensch, er wollte die Arbeit von seinem Privatleben getrennt halten.
Was nimmt sie sich heraus, verdammt?, fasste er in etwa seine Gefühle zusammen.
Doch er war gut darin, Dinge beiseitezuschieben, was er auch jetzt tat. Es war trivial. Es war unwichtig. Wichtig war, was vor ein paar Stunden mit einem sechsjährigen Mädchen aus einem Dorf in Yorkshire geschehen war.
Er trank den Tee aus und ging zurück in die Einsatzzentrale, auf der Betontreppe nahm er zwei Stufen auf einmal.
3
Kyra, hör auf, so herumzuhüpfen, hörst du?«
Kyra hüpfte weiter. Wenn sie das lange genug machte, würde ihre Mutter sie rauswerfen, und sie konnte nach nebenan gehen.
»Ich werf dich raus, wenn du so weitermachst. Geh und schau fern. Oder mach ein Puzzle. Oder schmink dich mit meinem Make-up – nein, mach das nicht. Hör jetzt endlich auf zu hüpfen!«
Natalie probierte ein neues Rezept aus. Das tat sie dauernd. Kochen war das Einzige, das ihr genug Spaß machte, um zu vergessen, wo sie war und dass sie mit Kyra allein war, hüpf-hüpf-hüpf, verdammt. In ihren Träumen besaß sie ein eigenes Restaurant oder vielleicht einen Cateringservice für Veranstaltungen und Hochzeiten. Nein, keine Hochzeiten, sie wollte kein Hühnchen à la King für hundert Personen zubereiten, sie wollte diesen gebackenen Barbadosfisch mit gefüllter Paprika für vier Personen kreieren. Oder sechs. Es war knifflig, und der Fisch war nicht die richtige Sorte, sie hatte nur Schellfisch bekommen, doch sie probierte zu gerne Sachen aus, von denen sie noch nie gehört hatte, um zu sehen, was dabei herauskam. Dann würde das Gericht in ihr Buch eingetragen werden, das Buch, das sie benutzen würde, um den Leuten zu zeigen, was sie alles zubereiten konnte. Wenn sie ihr eigenes Geschäft aufmachte. Super Suppers.
Sie begann, die grüne Paprika zu schneiden.
Kyra hüpfte, bis die Eieruhr vom Regal fiel.
»Kyra …«
Kyra ergriff die Gelegenheit und rannte hinaus.
Vor dem Nachbarhaus wusch Bob Mitchell sein Auto. Er sah Kyra und drehte den Schlauch langsam, langsam in ihre Richtung, aber sie wusste, dass er sie nicht nass spritzen würde. Sie steckte ihm die Zunge heraus. Mel schloss das Tor zum Haus gegenüber.
»Hallo, Mel.«
»Hi, Kyra.«
»Du siehst ja toll aus.«
»Danke, Babe.«
»Ich hab ein neues Haargummi, Mel.«
»Cool. Okay, Babe, bis dann.«
»Bis dann, Mel.«
Mel war sechzehn und sah aus wie ein Model. Kyras Mutter hatte gesagt, für Mels Beine könnte sie Morde begehen.
Eds Auto stand nicht in der Einfahrt. Kyra ging den Pfad zur Haustür entlang, zögerte, ging dann hinten herum. Vielleicht …
Aber Ed war nicht da. Das hatte sie bereits gewusst.
Sie klopfte an die Hintertür, nur für alle Fälle, doch es war zwecklos. Langsam schlurfte sie zurück. Bob Mitchell war nach drinnen gegangen. Niemand war da. Nicht einmal eine Katze.
Natalie stellte den in Folie gewickelten Fisch in den Ofen und wusch sich die Hände. Kyra schlüpfte zur Tür herein.
»Hab’s dir ja gesagt«, sagte Natalie. Sie hob die apfelförmige Eieruhr vom Boden auf und stellte sie auf fünfunddreißig Minuten, bevor sie ins Wohnzimmer ging, um sich die Nachrichten anzuschauen.
4
Das müssen Sie verstehen«, sagte Cat Deerborn.
»Lizzie kommt nirgendwohin. Ihr geht’s gut, ich schaffe das.«
»Warum haben Sie mich dann angerufen?«
Max Jameson stand am anderen Ende des langen Raums, blickte auf das wandfüllende Foto seiner Frau. Lizzie selbst lag zusammengerollt auf dem Sofa unter einer Decke und schlief, nachdem Cat ihr ein Beruhigungsmittel gegeben hatte.
»Ich weiß, wie schwer das ist, Max, glauben Sie mir. Sie haben das Gefühl, versagt zu haben.«
»Nein, hab ich nicht. Ich hab nicht versagt.«
»Na gut, Sie haben das Gefühl, versagt zu haben, wenn Sie sie ins Hospiz gehen lassen. Aber es ist sehr schlimm und wird noch schlimmer werden.«
»Das haben Sie mir gesagt.«
»Wenn diese Wohnung etwas geeigneter wäre …«
»Sie liebt die Wohnung. Sie ist glücklich hier, ist nie so glücklich gewesen.«
»Glauben Sie wirklich, dass das immer noch so ist? Sehen Sie denn nicht, wie beängstigend das alles für sie ist? Der riesige Raum, die Treppe, die Höhe, wenn sie vom Schlafzimmer hinunterschaut, die glatten Böden, das schimmernde Chrom in der Küche, im Badezimmer. Helligkeit ist jetzt schmerzhaft für sie, es tut ihr regelrecht weh.«
»Und dort würden sie Lizzie im Dunkeln halten, ja? In diesem Hospiz? Das wäre ja wie im Gefängnis.«
Cat schwieg. Sie war seit vierzig Minuten bei Max Jameson. Nach ihrer Ankunft hatte er an ihrer Schulter geweint. Lizzie hatte sich erneut übergeben und dort auf dem Boden gesessen, wohin sie gestürzt war, das eine Bein unter sich abgeknickt. Erstaunlicherweise stand sie nur unter Schock, hatte sich nicht ernsthaft verletzt.
»Aber wie lange wird es dauern, bis sie mit dem Kopf voran die Treppe hinunterstürzt? Möchten Sie, dass ihr Leben so endet?«
»Wissen Sie …« Max drehte sich zu Cat um und lächelte. Er war ein hochgewachsener Mann und hatte gut ausgesehen, war jetzt allerdings abgehärmt vor Sorgen und Furcht. Sein Gesicht war eingesunken, und sein kahl rasierter Kopf hatte einen bläulichen Schimmer. »… ich will überhaupt nicht, dass ihr Leben endet.«
»Natürlich nicht.«
Er kam langsam auf Cat zu, drehte sich dann um und kehrte zu der Wand mit dem Foto zurück.
»Sie glauben, dass sie gaga ist, nicht wahr?«
»Diesen Ausdruck würde ich niemals benutzen, für niemanden.«
»Okay, und welchen würden Sie dann für sie benutzen?« Er war wütend.
»Die Krankheit hat jetzt ihr Gehirn erreicht, und sie ist sehr verwirrt, obwohl es Augenblicke bewusster Wahrnehmung geben kann. Außerdem ist sie die meiste Zeit sehr verängstigt – Angst ist ein Symptom für die nvCJD in diesem Stadium. Ich möchte Lizzie an einen sicheren Ort bringen, wo sie sich so wenig ängstigt wie möglich. Sie hat ihre Körperfunktionen nicht mehr unter Kontrolle. Die Bewegungsstörungen werden zunehmen, daher wird sie ständig stürzen, sie kann ihre Muskeln …«
Max Jameson schrie, ein entsetzliches Brüllen voll Angst und Wut, die Hände auf die Ohren gepresst.
Lizzie wachte auf und begann zu weinen wie ein Baby, mühte sich ab, sich aufzusetzen. Sein Brüllen hielt an, ein tierischer Laut.
»Max, hören Sie auf«, sagte Cat leise. Sie ging zu Lizzie und nahm ihre Hand, redete ihr gut zu, sich wieder unter die Decke zu legen. Die Augen der jungen Frau waren geweitet vor Furcht und zeigten die Leere von jemandem, der kein Gespür für seine Umgebung, andere Menschen und sogar das eigene Selbst hat. Alles war nur beängstigende Verwirrung.
Es wurde still. Unten auf der Straße ging pfeifend jemand vorbei.
»Lassen Sie mich telefonieren«, sagte Cat.
Nach einer langen Pause nickte Max.
Es war noch keine drei Monate her, seit Lizzie in ihre Praxis gekommen war. Sie hatte sich übervorsichtig bewegt, als hätte sie Angst, das Gleichgewicht zu verlieren, und ihr Sprechen schien verlangsamt. Lizzie war schon einmal bei ihr gewesen – da war es um Verhütung gegangen –, und damals war Cat beeindruckt gewesen von ihrer lebenssprühenden Schönheit und ihrer Fröhlichkeit; die unglückliche junge Frau, die nun in ihr Sprechzimmer kam, erkannte sie kaum wieder.
Eine schwere Depression zu diagnostizieren war nicht schwer, nur konnten weder Cat noch Lizzie eine Ursache dafür finden. Sie sei sehr glücklich, sagte Lizzie, nein, mit ihrer Ehe sei alles in Ordnung und auch mit allem anderen. Ihre Arbeit mache ihr Spaß – sie war Graphikdesignerin –, sie liebe die Wohnung in der alten Bortenfabrik, liebe Lafferton, habe weder psychische Traumata erlitten noch schwere Krankheiten.
»Jeden Tag beim Aufwachen ist es schwärzer. Als würde ich in eine Grube rutschen.« Sie sah Cat hohläugig an, aber es flossen keine Tränen.
Cat verschrieb ihr ein Antidepressivum und bat sie, während der nächsten sechs Wochen einmal wöchentlich in die Praxis zu kommen, um den Fortschritt zu beobachten.
Über einen Monat lang änderte sich nichts. Die Tabletten kratzten kaum die Oberfläche ihrer Trübsal an. Beim vierten Besuch hatte Lizzie einen schweren Bluterguss am Arm und einen ausgerenkten Finger, die sie sich beim Abwenden eines Sturzes zugezogen hatte. Sie habe bloß das Gleichgewicht verloren, sagte sie.
»Ist das früher schon mal passiert?«
»Es passiert immer wieder. Ich nehme an, das liegt an den Tabletten.«
»Hm. Mag sein. Sie können ein leichtes Schwindelgefühl verursachen, gewöhnlich klingt das jedoch nach ein paar Tagen ab.«
Cat vereinbarte für sie einen Termin beim Neurologen im Kreiskrankenhaus Bevham. Am selben Abend sprach sie mit Chris darüber.
»Hirntumor«, sagte er sofort. »Die MRT wird es zeigen.«
»Ja. Könnte sehr tief sitzen.«
»Parkinson?«
»Ist mir auch schon in den Sinn gekommen.«
»Vielleicht hängen die beiden Symptome auch nicht zusammen … Schau sowohl unter Depression als auch unter Gleichgewichtsstörung nach.«
Danach wechselten sie das Thema, doch am folgenden Morgen kam Chris aus seinem Sprechzimmer in Cats.
»Lizzie Jameson …«
»Hast du eine Idee?«
»Wie ist sie gegangen?«
»Unsicher.«
»Ich habe gerade unter ›neue Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit‹, abgekürzt nvCJD, nachgeschaut.«
Cat starrte ihn an. »Die ist sehr selten«, sagte sie schließlich.
»Ja. Ich hab noch nie einen Fall gesehen.«
»Ich auch nicht.«
»Aber es passt alles.«
Nachdem der letzte Patient gegangen war, rief Cat den Neurologen im Bevham an.
Max Jameson war fünf Jahre bevor er Lizzie kennenlernte, Witwer geworden. Seine erste Frau war an Brustkrebs gestorben. Kinder gab es keine.
»Ich war wahnsinnig«, erzählte er Cat. »Ich war verrückt. Ich wollte tot sein. Ich war tot, ich war ein wandelnder Toter. Es ging nur noch darum, über den Tag zu kommen, während ich mich fragte, warum ich mich überhaupt bemühe.«
Freunde hatten ihn zu allem Möglichen eingeladen, doch er tauchte nie auf. »Ich wollte nicht zu dieser Dinnerparty, aber jemand holte mich ab – er musste mich praktisch hinschleppen. Als ich in das Zimmer kam, überlegte ich nur, wie ich sofort wieder hinauskönnte, welche Ausrede mir einfiel, umzudrehen und wegzulaufen. Dann sah ich Lizzie am Kamin stehen … Ich sah sogar zwei Lizzies, weil sie vor einem Spiegel stand.«
»Also haben Sie sich nicht umgedreht und sind weggelaufen?«
Er lächelte sie an, sein Gesicht freudestrahlend bei der Erinnerung. Dann fiel ihm ein, was Cat ihm jetzt beizubringen versuchte. »Lizzie hat Rinderwahn?«
»Das trifft nur auf Tiere zu. Ich benutze den Ausdruck nvCJD, eine neue Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit.«
»Ach, verstecken Sie sich doch nicht hinter Worten. Großer Gott.«
Es gab keine Möglichkeit herauszufinden, wie lange sie die Krankheit schon in sich trug.
»Und sie wird davon ausgelöst, dass man Fleisch isst?«
»Infiziertes Rindfleisch, ja, aber wann genau, lässt sich nicht feststellen. Möglicherweise schon vor Jahren.«
»Was wird passieren?« Max sprang auf und beugte sich über ihren Schreibtisch. »Worte. Was wird passieren? Wie und wann? Ich muss das wissen.«
»Ja«, antwortete Cat, »das müssen Sie.« Und sagte es ihm.
Die Krankheit hatte sehr rasch ihren schrecklichen Verlauf genommen. Von Depression zu Gleichgewichtsstörungen, gepaart mit anderen mentalen Symptomen, die für Max schwerer zu ertragen waren – heftige Stimmungsschwankungen, zunehmende Aggression, Paranoia und Misstrauen, Panikattacken und dann stundenlang anhaltende Angstzustände. Lizzie war mehrfach gestürzt, hatte ihren Geschmacks- und Geruchssinn verloren, war inkontinent geworden und hatte sich immer wieder übergeben müssen. Max war bei ihr geblieben, hatte sie rund um die Uhr versorgt und gepflegt. Ihre Mutter war zweimal aus Sommerset gekommen, konnte aber nicht in der Loftwohnung bleiben, weil sie erst kurz zuvor an der Hüfte operiert worden war. Max’ Mutter war aus Kanada eingeflogen, hatte einen Blick auf die Situation geworfen und war wieder nach Hause geflogen. Er war auf sich allein gestellt. »Das ist schon in Ordnung«, sagte Max. »Ich brauche niemanden. Ich schaff das allein.«
Cat ging durch das seltsame, aus Ziegeln gemauerte Treppenhaus, das immer noch an eine Fabrik erinnerte, hinunter auf die Straße, wo ihr Handy Empfang hatte, und ließ Max bei Lizzie zurück.
Das Hospiz von Lafferton, Imogen House, hatte ein Bett frei, und Cat traf die notwendigen Vorkehrungen. Die Straße war leer. An ihrem Ende war eine merkwürdige Schwärze, die auf das Vorhandensein von Wasser hindeutete, obwohl man von hier aus nichts vom Kanal sehen konnte.
Am Turm der Kathedrale, nicht weit entfernt, schlug die Uhr.
»O Gott, du machst es uns manchmal sehr schwer«, sagte Cat laut. Aber dann fügte sie ein grimmiges Gebet hinzu, für den Mann oben in der Wohnung und die Frau, die zum Sterben von dort weggebracht wurde.
5
Das Klingeln eines Handys unterbrach die geordnete Ruhe der Domkapitelsitzung.
Der Dean hielt inne. »Wenn es wichtig ist, gehen Sie bitte nach draußen und nehmen Sie den Anruf entgegen.«
Reverend Jane Fitzroy errötete. Sie war erst vor einer Woche in Lafferton eingetroffen, und es war ihre erste Domkapitelsitzung.
»Nein, das kann warten. Entschuldigen Sie bitte.«
Sie schaltete das Handy aus, und der Dean fuhr mit der Tagesordnung fort.
Erst eine Stunde später konnte sie auf dem Display nachsehen, wer angerufen hatte. Die letzte Nummer war die ihrer Mutter, aber als sie zurückrief, meldete sich nur der Anrufbeantworter.
»Mum, tut mir leid, ich war in der Domkapitelsitzung. Hoffe, dir geht’s gut. Ruf mich an, wenn du die Nachricht abhörst.«
Die nächsten beiden Stunden verbrachte sie in Imogen House, für das sie jetzt als Seelsorgerin verantwortlich war, außerdem fungierte sie als Verbindungsperson der Kathedrale zum Kreiskrankenhaus Bevham. Die Arbeit würde sie hinaus in die Gemeinde führen, sie aber auch zu ihrer Basis in der Kirche selbst zurückbringen, wo sie ihren Beitrag zu den Gottesdiensten und anderen geistlichen Tätigkeiten zu leisten hatte.
Im Moment bestand der wichtigste Teil ihrer Arbeit darin, Menschen kennenzulernen und sich im Gegenzug von ihnen einschätzen zu lassen, zuzuhören und zu lernen. Es war ein ausgefüllter Nachmittag, an dessen Ende sie bei einem Mann saß, der ein paar Wochen vor seinem hundertsten Geburtstag stand und entschlossen war, wie er sagte, »auf jeden Fall das Telegramm abzuwarten«. Er war wie ein kleines Vögelchen, nur Haut und Knochen, winzig in seinem Bett, seine Haut von der Farbe einer Talgkerze, doch mit leuchtenden Augen.
»Ich schaff das, junger Reverend«, sagte Wilfred Armer und drückte Janes Hand. »Ich blas alle Kerzen aus, Sie werden schon sehen.«
Jane bezweifelte, dass er die nächsten vierundzwanzig Stunden überleben würde. Er wollte, dass sie bei ihm blieb, zuhörte, während er ihr mit pfeifendem Atem Geschichte auf Geschichte aus seiner Kindheit erzählte, vom Fischen im Lafferton-Kanal und vom Schwimmen im Fluss.
Als sie das Gebäude verließ, schaltete sie das Handy wieder an. Die Mailbox hatte eine Nachricht für sie. »Jane?« Magda Fitzroys Stimme klang fern und seltsam. »Bist du da? Jane?«
Sie drückte auf die Ruftaste. Es kam keine Antwort, und diesmal sprang auch der Anrufbeantworter nicht an. Sie setzte sich unter einen Baum und überlegte, was sie tun sollte. Jane hatte noch die Nummer eines Nachbarn ihrer Mutter in Hampstead, aber der war für drei Monate in Amerika. Das Haus auf der anderen Seite gehörte einem ausländischen Geschäftsmann, der nie da zu sein schien. Die Polizei? Die Krankenhäuser? Sie zögerte, weil es ihr zu dramatisch erschien, die Polizei einzuschalten, wenn sie nicht einmal wusste, ob irgendetwas passiert war.
Die Klinik. Deren Nummer hatte sie gespeichert. Weitere Nummern mochten sich bei ihren Sachen befinden, die immer noch in Kisten im Gartenhaus des Kantors standen.
Ein Junge holperte auf seinem Fahrrad über das Kopfsteinpflaster und riss dabei das Vorderrad hoch. Jane lächelte ihm zu. Er reagierte nicht darauf, aber als er an ihr vorbei war, drehte er sich um und starrte sie an. Sie war daran gewöhnt. Hier saß sie, eine junge Frau in Jeans, dazu ein Kollar – der steife weiße Kragen eines Geistlichen. Das überraschte die Menschen immer noch.
»Heathside Klinik.«
»Hier ist Jane Fitzroy. Ist meine Mutter zufällig da?«
Magda Fitzroy behandelte nach wie vor ein paar Patienten an ihrer alten Arbeitsstelle, obwohl sie im Jahr zuvor offiziell in Pension gegangen war und jetzt mit einer befreundeten Kollegin an einem Lehrbuch über Kinderpsychiatrie schrieb. Magda vermisste die Klinik, wie Jane wusste, vermisste die Menschen und ihre eigene Rolle dort.
»Entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten. Niemand hat Dr. Fitzroy heute gesehen, aber sie wurde auch nicht erwartet. Sie hat diese Woche keine Termine hier.«
Während der nächsten Stunde versuchte es Jane mehrfach unter der Nummer ihrer Mutter. Nichts. Immer noch keine Antwort und kein Anrufbeantworter.
Dann ging sie hinüber zum Dekanat. Geoffrey Peach war nicht da, und sie hinterließ eine Nachricht. Als sie Richtung Autobahn fuhr, war es früher Nachmittag.
Je näher sie London kam, desto dichter wurde der Verkehr, und auf dem Haverstock Hill steckte sie zwanzig Minuten lang im Stau. Von Zeit zu Zeit wählte sie die Nummer ihrer Mutter, und beim Abbiegen auf den Heath Place wünschte sie, doch die Polizei angerufen zu haben.
Als sie das georgianische Cottage erreichte, sah sie, dass die Eingangstür nur angelehnt war.
Im Flur meinte Jane zunächst, alles sei wie immer, doch dann bemerkte sie, dass die Lampe, die sonst auf dem Walnusstisch gestanden hatte, zerbrochen am Boden lag. Der Tisch selbst war verschwunden.
»Mutter?«
Magda verbrachte die meiste Zeit in ihrem Arbeitszimmer, das zum Garten hinausging. Jane liebte dieses Zimmer mit den purpurroten Wänden und dem weichen, mit Kissen bedeckten Sofa, den Papieren ihrer Mutter und den Büchern, die jede freie Fläche vom Schreibtisch über die Sessel bis zum Boden bedeckten. Das Zimmer hatte einen besonderen Geruch, teilweise, weil die Fenster fast immer offen standen, selbst im Winter, was die Gartengerüche hereinwehen ließ, und außerdem rauchte ihre Mutter manchmal Zigarillos, deren Rauch sich über die Jahre in den Stoffen festgesetzt hatte.
Der Raum war verwüstet. Die Bilder waren von den Wänden gerissen, jedes Stück altes Porzellan aus den Regalen gefegt, und sowohl aus dem Schreibtisch wie auch aus einem kleinen Tischchen waren die Schubladen herausgezogen und auf den Boden gekippt worden. Über allem hing ein unverkennbarer Uringeruch.
Während Jane noch dastand, sich entsetzt umschaute und alles in sich aufzunehmen versuchte, hörte sie ein schwaches Geräusch aus der Küche.
Magda lag auf dem Boden neben dem Herd. Das eine Bein klemmte verkrümmt unter ihr, und an ihrem Kopf war getrocknetes Blut, verfilzte ihr Haar und hatte seitlich an ihrem Gesicht eine Kruste gebildet. Ihre Haut sah grau aus, ihr Mund war verkniffen.
Jane kniete sich neben sie und griff nach ihrer Hand. Sie war kalt und der Puls schwach, doch ihre Mutter war bei Bewusstsein.
»Jane …?«
»Wie lange liegst du schon hier? Wer hat dir das angetan? O Gott, du hast mich angerufen, und ich hab’s nicht begriffen.«
»Ich, ich glaube … seit heute Morgen? Jemand hat an der Tür geklingelt und … nur … ich konnte nicht wieder hochkommen und ans Telefon gehen … ich … dachte du würdest …«
»Ganz ruhig, ich rufe einen Krankenwagen und die Polizei. Ich hol dir eine Decke, aber beweg dich nicht, überlass das lieber denen … warte kurz.«
Jedes Zimmer, in das sie beim Hinauflaufen blickte, war durchwühlt und verwüstet worden. Ihr wurde übel.
»Das wird dich warm halten. Sie werden gleich da sein.«
»Ich gehe nicht ins Krankenhaus …«
Doch Jane rief bereits den Notarzt an.
»Ich sterbe, wenn ich ins Krankenhaus muss.«
»Du wirst eher sterben, wenn du es nicht tust.«
Jane setzte sich auf den Boden und griff nach der Hand ihrer Mutter. Magda war eine hochgewachsene, kräftige Frau, deren graues Haar für gewöhnlich in einem eigenwilligen Knoten hochgesteckt war. Jetzt war es offen und zerzaust; ihre Gesichtszüge, so charaktervoll, so scharf geschnitten mit der Adlernase und den hohen Wangenknochen und der klaren Stirn, schienen eingesunken zu sein, sodass sie eher wie achtzig aussah statt der achtundsechzig Jahre, die sie alt war. Innerhalb von ein paar Stunden hatten Alter und Verletzlichkeit sie eingeholt und auf erschreckende Weise verändert.
»Hast du Schmerzen?«
»Das ist … schwer zu sagen … Ich fühle mich taub …«
»Was war das für ein Mann? Wie ist das um Gottes willen passiert?«
»Zwei … Jugendliche … Ich hab ein Auto gehört … Kann mich nur schwer erinnern.«
»Mach dir keine Gedanken. Ich bin bloß wütend auf mich, dass ich nicht früher gekommen bin.«
In dem Moment huschte der alte Ausdruck über das Gesicht ihrer Mutter, derjenige, den Jane in den letzten Jahren so oft gesehen hatte. Magdas Blick fiel kurz auf Janes Kragen, und da war er, sogar jetzt, nach allem, was passiert war – der Ausdruck von Verachtung und Ungläubigkeit.