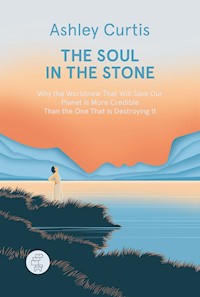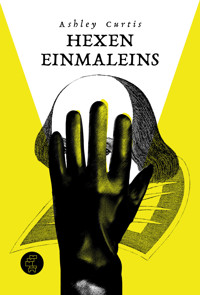
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Kommode
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Stratford-upon-Avon, 2006: Während einer Aufführung von Macbeth im Swan Theater stirbt der prominente Shakespeare-Experte Professor Adrian Thompson. Auf den ersten Blick scheint es sich um einen natürlichen Tod zu handeln – Thompson ist ein alter, nicht sehr gesunder Mann, der bereits einen Schlaganfall erlitten hatte. Doch es gibt Indizien, die auf einen Mord hinweisen: Sein Hotelzimmer wurde am selben Abend durchwühlt und der angekündigte Vortrag, in dem er belegen wollte, dass Shakespeare und nicht de Vere, 17. Earl von Oxford, der wahre Urheber seiner Werke war, macht alle Verfechter der Oxford-Theorie zu Verdächtigen. Kriminalkommissar Ian Stokes wird mit dem Fall betreut, den er nie haben wollte und der ihn exakt in das Umfeld wirft, vor dem er in der Vergangenheit geflohen war. Widerwillig bittet er seine Mutter, Professorin an der Universität Oxford, ihn beim Aufdecken von Thompsons Geheimnis zu unterstützen. Ihre zeitgleich laufenden strafrechtlichen und akademischen Untersuchungen führen unabhängig voneinander zu demselben Täter. Hexeneinmaleins ist ein literarischer Krimi, der die Kontroverse um Shakespeare und de Vere und die historischen Fakten, von welchen der Fall abzuhängen scheint, nachvollziehbar in die Fallermittlung einfliessen lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2019 Kommode Verlag, Zürich
1. Auflage
Alle Rechte vorbehalten.
Text: Ashley Curtis
Übersetzung: Silvia Morawetz
Lektorat: Eva Winiger
Korrektorat: Torat
Cover, Satz und Layout: Anneka Beatty
Fotografie: Thomas Andenmatten
ISBN: 978-3-9524626-5-2eISBN: 978-3-9055740-6-7
Ashley Curtis
Hexeneinmaleins
Deutsch von Silvia Morawetzmit einem Nachwort von Frank Günther
Inhalt
Teil eins
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Teil zwei
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Teil drei
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Epilog
Die Verfasserschaftsfrage oder In der Sache Oxford gegen Shakespeare
Quellennachweise
Über den Autor
Dies ist eine erfundene Geschichte. Namen, Gestalten und Ereignisse des vorliegenden Kriminalromans sind das Produkt der Vorstellungskraft des Verfassers; jede Ähnlichkeit mit realen Personen oder Begebenheiten wäre rein zufällig.
Kein Zweifel besteht jedoch daran, dass beide, Will Shaksper aus Stratford und Edward de Vere, der 17. Earl von Oxford, reale Personen waren. Einer von ihnen schrieb die Dramen. Die von den Oxfordianern in diesem Roman geäußerten Meinungen sind sämtlich publizierten Quellen entnommen, und alle Dokumente, die zur Untermauerung der These von Oxfords Verfasserschaft zitiert werden, sind echt.
Teil eins
Kapitel 1
Zu seinen Lebzeiten rauchte Professor Thompson dicke Zigarren, deren Asche er in schwere Glasaschenbecher abstrich, und zog die ungebärdigen Augenbrauen hoch, die über seine Brillengläser lugten wie fürwitzige Eichhörnchen. Seine Augen waren von den Brillengläsern so verzerrt, dass man nicht genau wusste, ob er einem ins Gesicht blickte oder auf etwas hinter einem an der Wand.
Doch jetzt hatte er die Augen geschlossen. Von den vierhundertsiebenundfünfzig Zuschauern im Swan Theatre der Royal Shakespeare Company lag er als Einziger reglos in seinem Sessel.
Die Beifallsstürme legten sich, und das Licht ging an. Macbeth war tot. Man hatte seinen noch tropfenden malträtierten Kopf auf einen Pfahl gespießt und in wildem Triumph über die Bühne geschwenkt. Die Schlacht, die seiner Enthauptung vorausging, war erbittert gewesen; ein Tumult aus klirrendem Stahl, hämmernden Knüppeln und Schreien der Wut und des Schmerzes. Von allen Seiten waren zuckende Lichter herabgefahren, grellweiße, blendende Lichter, die zornig brüllende Krieger einfroren und in Schattenrisse verwandelten. Schwer vorstellbar, dass jemand, und sei es ein Siebzigjähriger mit Jetlag, so ein Gemetzel verschlief.
Und doch war Thompson in der ersten Reihe zusammengesackt, die Beine von sich gestreckt, der Kopf schief auf die Rückenlehne gesunken.
Georgina Mansard, Thompsons ehemalige Studentin, erhob sich vom Platz neben ihm. Sie sah besorgt auf ihn herab, beugte sich zu ihm.
»Adrian«, sprach sie ihn an. Dann, lauter: »Adrian, alles in Ordnung mit Ihnen?«
Georgina legte die Hand auf seine rechte Schulter und rüttelte sacht daran. Einer seiner Arme war gelähmt, fiel ihr ein, aber nicht welcher, und sie fasste nach der anderen Schulter. Ihre Hand streifte seinen bloßen, kaltfeuchten Hals, und sie zuckte zurück.
»Hilfe!«, stieß sie hervor, nicht eben laut, denn ihr war die Luft weggeblieben. »Hilfe!«
Sie war ein zartes Persönchen, das kurze Haar im forschen Rot eines Orientteppichs gefärbt, eine feine Strähne vor den Ohren herabfallend. Die Brille, die an einer Kette um ihren Hals hing, hatte eine Fassung im gleichen Rot.
Eine ungeduldige Menge drängte von hinten heran, elegant gekleidete Männer und Frauen, verärgert über die Verzögerung, dann beunruhigt über die Aussicht, eine Unregelmäßigkeit könnte ihren freien Abend stören. Georginas Rufe wurden schließlich von zwei jungen Platzanweisern gehört, von denen einer hinaus zur Kasse rannte, während der andere Professor Thompson hilflos und zunehmend bestürzt auf die Wangen patschte und anschließend am versehrten Arm rüttelte. Der kleine Teil des Publikums, der sich noch im Saal befand, zögerte an den Ausgängen, gaffte auf die Aufregung, und als jemand von den Verärgerten hinter Georgina vernehmlich »Ist ein Arzt anwesend?« rief, kam der Exodus zum Erliegen, und einige derer, die bereits an den Türen waren, machten kehrt und wollten wieder in den Saal hinein. Ein junger, athletisch gebauter Mann mit schwarzem Haar und akkurat gestutztem Kinnbart kam nach vorn gestolpert und rief: »Ich bin Arzt, was gibt’s denn?« – aber das war offensichtlich, und niemand antwortete ihm. Der Mann ließ Thompson behutsam auf den Boden herab und wies eine junge Frau an, einen Krankenwagen zu rufen; er bog Thompsons Kopf zurück, legte das Ohr an seinen Mund und, erschrocken, die Finger an den fleischigen Hals, tastete nach dem Puls. Er riss ein transparentes kleines Tuch aus einem Beutel an seiner Schlüsselkette, legte es Thompson über den Mund und atmete zweimal hinein, wechselte dann zum Oberkörper, riss Thompson das Hemd auf und drückte mit aneinandergelegten Ellbogen und verschränkten Händen in so schnellem Rhythmus, dass der schwabbelige, weiß behaarte Brustkorb federte wie ein kaputtes Trampolin unter den Salti eines frenetischen Akrobaten.
Kurz darauf kamen zwei uniformierte Polizisten mit einem Defibrillator angerannt, dessen Pads sie auf Thompsons fleckige Haut klebten. »Weg!«, schrie der eine; der Arzt unterbrach sein Pumpen und beugte sich, noch auf den Knien, zurück.
»Weg, alle weg vom Patienten!«
Der erste Polizist drückte auf einen Knopf, Thompsons Körper wölbte sich in einem peinvollen Bogen nach oben und plumpste bleiern wieder herab. Zwei grauhaarige Rettungssanitäter teilten die Menge und kamen zu ihm geeilt.
Rettungssanitäter Nummer drei, eine stämmige junge Frau, wollte wissen, ob jemand den Mann kenne. Georgina, von der Menge um den Toten abgedrängt, meldete sich zaghaft. Sie wusste zwar nichts über Allergien oder regelmäßig eingenommene Medikamente, konnte aber Details darüber beisteuern, was Thompson zuletzt zu sich genommen hatte, und berichtete, dass er vor einem Jahr einen Schlaganfall gehabt und dadurch den Gebrauch eines Arms eingebüßt habe. Ihr sei heute Abend nichts aufgefallen – das Stück sei so laut gewesen. Die Sanitäterin sah sie befremdet an, aber die anderen waren inzwischen bereit zu gehen. Professor Thompson wurde auf einer Trage die Rampe hinauf und durch den Ausgang aus dem Saal gerollt, von einer Maske auf dem Gesicht mit Sauerstoff versorgt, den er nicht mehr einatmen konnte.
Als Georgina aufblickte, kam ein dünner Mann in dunklem Anzug von der anderen Seite des Theaters auf sie zu. Ein seltsames Gefühl starker Beunruhigung durchzuckte sie, wanderte vom Spann ihrer Füße durch ihre Brust nach oben, und ihr wurde heiß und schwindlig.
»Harry«, sagte sie durch ein Taschentuch und aufkommende Tränen hindurch. »Harry.«
Er legte die Arme um sie, drückte den kleinen Körper fest an sich. Sie erschauerte ob der Wärme, der Verwirrung.
»Was sagen sie?« Harrys Jackett an ihren Ohren, seine warmen Arme, ihre gemeinsame Vergangenheit dämpften seine Worte. Sie gestattete sich, die Umarmung noch einen Moment auszukosten.
»Nichts.« Tränen fielen ihr auf die Wangen.
Harry entließ sie aus seinen Armen. Seine Stirn verzog sich, als er die Augen schloss. »Mein Gott«, sagte er leise. »Adrian.«
Er sprach den Namen, als sei er sich nicht ganz sicher, dass er es war, ihr alter Lehrer und Mentor, als könne es sich durch einen aberwitzigen Zufall um einen anderen würdigen Herrn mit Glatze und dicker Brille handeln, der ihm bloß äußerlich ähnelte. Es war die Feststellung einer Tatsache, die in sich die Hoffnung barg, sie wäre doch fraglich, eine rein hypothetische Hoffnung freilich nur und keiner Antwort wert.
Aufgewühlt und durcheinander, wie sie war, sah Georgina Harry entgeistert an. Jedes Detail seiner Erscheinung kündete von seiner Besonderheit. Nach ihrer gemeinsamen Studienzeit war sie pummelig geworden, er hingegen sah dünner und fahler aus denn je, die lange Nase noch spitzer, die blassblauen Augen, sofern das möglich war, noch entrückter. In Harrys dunklem Haar entdeckte Georgina erste Spuren von Grau, seine Wangen waren seltsam gerötet, und seine schmalen Lippen bebten vor Erregung. Er kam ihr vor wie eine Gestalt der Romantik – Heathcliff oder Wordsworth oder Liszt – beim Durchwandern der Alpen, in langem Wollrock, mit ledernem Ranzen über der Schulter und Wanderstock in der Hand.
Sie sah weg, und das Bild löste sich auf. Ein Polizist und der Arzt traten zu ihnen.
»Waren Sie mit ihm hier?«, fragte der Polizist. Georgina nickte.
»In welcher Beziehung stehen Sie zueinander?«
»Ich bin seine – also, Sie müssen wissen, wir alle hier –, das ist Harry Abrams, er ist auch hier. Wir sind hier auf der Konferenz, der – Konferenz. Heute erst angekommen – über die Urheberschaft der Werke Shakespeares.«
»Wahrscheinlich Shakespeare«, sagte der Arzt gereizt.
»Wie bitte?«, sagte Georgina verwirrt.
»Shakespeare«, wiederholte er. »Ich würde meinen, Shakespeare ist der Urheber seiner Werke.«
»Oh, ja. Ich auch übrigens. Aber einige …«
»Können Sie den Mann identifizieren?«, warf der Polizist ein. Der zweite Beamte stand hinter ihm, einen kleinen Notizblock aufgeschlagen in der Linken, den gezückten Stift in der Rechten.
»Professor Adrian Thompson, ja, aus Yale. Er war unser Lehrer.«
»Und was genau ist passiert?«, fragte der Arzt ungeduldig.
»Ich weiß nicht. Ich dachte nicht, dass etwas passiert sei. Ich meine, die Aufführung war laut und − fesselnd, besonders der Schluss.«
»Das einzig Gute der Tragödie.«
»Was?«
»Der Böse bekommt, was er verdient.«
Es dauerte einen Moment, bis seine Worte zu Georgina durchdrangen. »Ja«, sagte sie schließlich. »So ist es wohl.«
»Ihnen ist also nichts aufgefallen?«
»Nein. Ich dachte am Ende des Stücks, er wäre eingeschlafen. Bis ich ihn berührt habe.«
»Ja«, sagte der Polizist. »Unverwechselbar.«
»Ja. Stimmt. Sie kennen das sicher.«
»Ja.«
Ihr Wortwechsel, fand Georgina, wurde zunehmend surreal.
»Was war es?«, fragte Harry unvermittelt.
»Das Herz. Kammerflimmern – der Herzrhythmus läuft Amok. Sie haben noch einen Puls aus ihm rausgeholt, bevor er starb.« Der Arzt verzog das Gesicht. »Passiert dauernd. Hatte er eine Vorgeschichte?«
Georgina nickte. Der Polizist blickte sie an. »Angehörige?«
»Oh, ja – meine Schwester …«
Er schüttelte den Kopf. »Er, meine ich.«
»Oh. Oh – ich weiß nicht. Er war ledig. Zumindest hat er nie … Weißt du etwas, Harry?«
Harry schüttelte den Kopf. »Rufen Sie im Fachbereich Anglistik an der Yale an. Die können Ihnen weiterhelfen.« Er wandte sich an den ersten Polizisten und sagte nach kurzem Zögern leise: »Eins sollten Sie wissen, finde ich.«
»Ja?«
»Die Konferenz, die wir besuchen – Adrian wollte einen Vortrag halten. Morgen Vormittag. Einen Vortrag, der Schlagzeilen gemacht und eine Menge Leute aufgebracht hätte.«
»Darüber habe ich etwas gelesen«, sagte der Polizist.
»Das ist jetzt wohl nicht wichtig«, sagte Harry. »Es ist bloß – es gibt Leute, die nicht glauben, dass Shakespeare die Stücke geschrieben hat. Sie meinen, es war der Earl von Oxford, ein Mann namens de Vere. Darum ging es bei der Konferenz, ein Riesenthema.« Er hielt inne und atmete aus, so als wolle er mehr nicht sagen. »Adrian wollte de Vere aus dem Rennen nehmen. Er hatte Beweise gefunden. Welche das sind, hatte er bis jetzt noch niemandem gesagt – es sollte seine große Überraschung werden.«
Für einen Moment schwiegen alle. Dann sagte der erste Polizist: »Worauf wollen Sie hinaus?«
Harry zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Es ist nur – jemand könnte sich jetzt seinen Vortrag beschaffen wollen.«
Wieder standen sie da und schwiegen. Der Arzt machte einen ungeduldigen Eindruck. Schließlich zückte der zweite Polizist, der sein Schreiben bei Harrys Worten unterbrochen hatte, wieder Block und Stift. Er lächelte Harry herablassend an. »Alles zu seiner Zeit«, sagte er. »Sobald er für tot erklärt ist, kümmern wir uns schon um seine persönlichen Sachen. Keine Sorge. Fürs Erste würde ich gern Ihre Personalien aufnehmen. Und wenn Sie ins Krankenhaus fahren möchten …«
»Gibt es …« Georgina klang verzweifelt, brachte es aber nicht fertig, den Satz zu beenden. Der Arzt wusste, was sie sagen wollte.
»Ich fürchte, nein. Die werden natürlich tun, was sie können. Aber wenn das Gerät, verstehen Sie, einen Puls findet, und es ist Kammerflimmern, und wenn das Kammerflimmern aufhört – wie hier − und trotzdem kein Puls da ist …« Er runzelte die Stirn, machte eine Geste der Hilflosigkeit. »Dann gehen die Lichter ziemlich sicher aus.«
Sie verharrten für einen Moment in Schweigen, fünf Personen, vom Tod in dem leeren, schmutzigen Zuschauerraum zusammengebracht.
»Soll ich Sie irgendwohin mitnehmen?«, fragte der Polizist.
»Nein«, antwortete Harry für sie beide, sein Ton düster, seine Miene starr. »Wir finden uns schon zurecht, danke.«
»Wie Sie wollen«, sagte der Polizist höflich.
»Wie es Ihnen gefällt«, murmelte der Arzt. Er zog eine Brieftasche aus der Innentasche seines Jacketts, entnahm ihr mit zwei Fingern eine Karte und gab sie dem Beamten. »Falls Sie mich für irgendetwas brauchen.« Er nickte Harry und Georgina zu. »Mein Beileid«, sagte er, sein Ton nun ernst. Er wandte sich fast unwillig ab und zuckte mit den Schultern, als verstehe er noch nicht ganz, was hier gespielt wurde. Dann schritt er – ein Mann, den die Pflicht rief oder der seinen Abend genießen wollte – durch den Zuschauerraum davon.
Die Polizisten verließen Harry und Georgina am Eingang des Swan. Es war eine warme Mainacht, und im Dunst über dem Fluss waren undeutlich Sterne zu erkennen. Scheinwerfer vorüberfahrender Autos leuchteten auf und verschwanden. Vor Jahrzehnten hatten sie schon einmal zusammen an so einem Torbogen gestanden, unter den gleichen Sternen, als Scheinwerfer herumschwenkten und verwirrende Schatten warfen und die gruseligen Wasserspeier von Yale auf sie herabäugten. Für einen kurzen Augenblick war Georgina wieder dort, stand mit ihm am Eingang zum Doktorandengebäude, das Gesicht gehoben, die Lippen schließlich bereit – für nichts.
Die Erinnerung löste sich auf. Georgina betupfte sich die Augen mit einem Taschentuch, das bloß noch ein kleiner nasser Ball war. Harry sah erschöpft aus, so als senke sich erst jetzt das volle Gewicht dessen, was geschehen war, auf ihn herab.
»Gehen wir«, sagte er leise, aber bestimmt.
»Was sollen wir jetzt tun, Harry?«
Er nahm ihren Arm. »Adrians Vortrag«, sagte er eifrig. »Wir müssen das Manuskript holen, bevor die es tun. Los, gehen wir.«
»Was hast du vor?«
Er lotste sie die Straße entlang zu der Wiese vor dem Theaterkomplex. Trotz der hellen Beleuchtung sah das Gras grau aus. Die Schatten unter den belaubten Bäumen waren dunkel und tief.
Georgina spürte, wie das Blut sie durchströmte, passend zu ihrem schnellen Schritt, passend zu der beruhigenden Festigkeit, mit der Harry sie am Arm führte, passend zu einem ganzen Bereich des Lebens, dem sie sich gewöhnlich entzog. Sie traute sich, Harry ins Gesicht zu sehen.
»Begreifst du denn nicht?«, sagte er. »Sobald sie erfahren, dass er gestorben ist, sind sie in seinem Zimmer und wollen sich seinen Vortrag krallen.«
»Das glaubst du nicht wirklich.«
»Ich weiss es nicht. Aber besser, wir vergewissern uns. Was immer er herausgefunden hat, er hätte nicht gewollt, dass es gestohlen und vernichtet wird. Und diese Oxfordianer, das sind Besessene. Es ist nicht undenkbar.« Nach kurzem Stocken sagte er: »Wir sind seine rechtmäßigen Erben. Es ist das Mindeste, was wir für ihn tun können.«
Er nahm wieder ihren Arm, und aller Verwirrung, all ihrem Entsetzen und ihrer Fassungslosigkeit über das gerade Geschehene zum Trotz durchfuhr sie ein lustvoller Schauer. Sie machten sich auf den Weg zum Hotel, kamen auf dem fast leeren Bürgersteig an unbeleuchteten Schaufenstern vorbei, in denen Souvenirs auslagen: kleine Plastikbüsten von Shakespeare, Schürzen und Sweatshirts mit Zeilen aus Hamlet, Was ihr wollt und Romeo und Julia, ein Radiergummi mit dem Aufdruck Fort ist’s. Ein Geschäft für Bühnenausstattung stellte üppige Roben und glänzende Schwerter, Perücken und Bärte, Make-up und Plastikschädel aus. Georgina ging schon einen halben Schritt hinter Harry und geriet zunehmend außer Atem. Während sie körperlich zu kämpfen hatte, um mit ihm Schritt zu halten, dämmerte ihr, dass seine Befürchtungen echt waren, dass es ihm damit wirklich ernst war. Aber es war verrückt – zu sehr wie in einem Film, alles −, und sie sah im Geiste plötzlich Cary Grant vor sich, wie er katzenartig auf Dächern am Mittelmeer herumschlich. Und danach musste sie an Adrian denken, der auf dem Boden lag, an den Arzt, der rhythmisch seine Brust bearbeitete, so physisch und profan. Die beiden Bilder passten nicht zusammen. Da Harry jedoch ernstlich beunruhigt war, fast hektisch, war sie in dem Irrsinn bereit, ihr Urteil aufzuschieben. Vielleicht sah er die Dinge klarer als sie. Und es stimmte ja: Wenn der Vortrag verloren ging, war das Vermächtnis ihres Lehrers zerstört, seine letzte, größte Leistung zunichtegemacht.
»Wir müssen ihn finden«, sagte er. »Wir müssen in sein Zimmer hineinkommen. Adrian ist bestimmt wie wir alle im Stratford Arms.«
»Ja«, sagte sie keuchend. »Ein kleines Stück weiter auf meiner Etage.«
»Gut. Hör zu, wir brauchen den Schlüssel – frag einfach beiläufig danach – weißt du seine Zimmernummer?«
»Ich hab die zweihundertvierunddreißig, er ist, glaub ich, zwei Türen weiter, das müsste die zweihundertachtunddreißig sein – direkt zwischen Wilson und Daley, ist das zu fassen. Man möchte meinen, die haben uns in zwei …« Ihr war der Atem ausgegangen, und sie sprach den Satz nicht zu Ende.
Sie schwiegen bis zur nächsten Kreuzung. Dann fragte Harry, während er nach Autos Ausschau hielt: »Hattest du ihn schon gesehen?«
Georgina sah Adrian vor sich, lebendig und lachend am Tresen, dann sterbend auf dem Boden. »Ja«, sagte sie. »Vor der Vorstellung haben wir zusammen etwas getrunken und dabei festgestellt, dass wir Plätze nebeneinander haben.« In ihrer Kehle wurde es eng. »Kannst du dir das vorstellen?«
Er lachte leise, überrascht, dachte sie, von dem Zufall. Er hielt sie am Arm und lotste sie um die Ecke. Wieder erschauerte sie unwillkürlich bei seiner Berührung.
»Worüber habt ihr gesprochen?«
Sie blieb stehen, um Luft zu holen, schüttelte den Kopf und schluckte. Als ihr Atem sich beruhigt hatte, sagte sie: »Bloß über die alten Zeiten. Was jetzt alle so machen, wer gestorben ist. Die Emeritierung, seine Gesundheit …«
»Über den Vortrag nicht?«
»Nein. Ich hab ihn gefragt, aber er hat bloß gezwinkert, du weißt ja, wie – und gesagt, ich müsse Geduld haben. Ich müsse warten wie alle anderen.«
Harry wirkte für einen Moment verlegen und fragte: »Hat er mich erwähnt?«
»Wir haben von früher gesprochen. Nicht über dich heute. Natürlich freuten wir uns darauf, dich zu sehen, Harry, es ist so lange her.«
»Ich hatte vor, heute Abend zu euch beiden zu stoßen. Hinterher.« Er hielt inne. »Jetzt ist es zu spät.« Er sah über die Straße hinweg zur Drehtür des Hotels – eines unglückseligen Gebäudes, das sich optisch nicht einmal ansatzweise in die Tudorstadt Stratford einfügen wollte.
»Georgina«, sagte er, »könntest du das machen? Den Mann an der Rezeption fragen, nach der zweihundertachtunddreißig? Eine Frau ist unauffälliger. Und wenn er dich darauf anspricht, könntest du so tun, als hättest du die Nummer mit deiner verwechselt – es ist nahe genug.«
Sie sah ihn an. Seine blassblauen Augen sahen direkt in die ihren, brachten sie aus dem Gleichgewicht. Sie spürte, wie der Keim einer vergeblichen Hoffnung Gestalt annahm, der Hoffnung auf einen kaum vorstellbaren Umbruch in ihrem Leben.
Und dann verkrampfte sich ihr Gesicht vor Kummer. Sie dachte an Adrians trockenen Humor, an sein Lachen, seine Freude am Geplänkel mit Studenten, die erlesenen Speisen, mit denen er seine Lieblinge bewirtete. Er war ein glänzender Lehrer gewesen, der von Thema zu Thema schweifte, ganz dem Hin und Her seiner Gedanken folgend, der sich nie auf schriftliche Notizen verließ, sondern nur auf seine Belesenheit und seine Begeisterung. Und doch war er immer einsam gewesen, ohne Familie. Er war einer der drei Gutachter ihrer Dissertation gewesen und hatte auch die von Harry betreut; er hatte Georgina für ihren flüssigen Stil und ihre minutiöse Genauigkeit überschwänglich gelobt und war so stolz gewesen, als Harry mit seiner fertig war – die Doktorarbeit mit den wenigsten Korrekturen, die ich je betreut habe, und die am schnellsten geschriebene, hatte er aufgetrumpft. Wenn alle so wären!
Sie hatte ihn viele Jahre nicht mehr gesehen. Trotz ihrer alten Beziehung, trotz allem, was er für sie getan, trotz des Selbstvertrauens, das sie aus seinem Lob geschöpft hatte. Das war ein Fehler gewesen. Sie hätte sich mehr kümmern sollen, hätte ihn ungeachtet aller Belastung durch die Lehre und das Schreiben besuchen können. Sogar als er den Schlaganfall hatte, hatte sie nur mit ihm telefoniert. Und jetzt war es zu spät; jetzt war er tot.
»Okay«, sagte sie und verzog das zwergenhafte Gesicht. Und marschierte plötzlich, um nicht in Tränen auszubrechen, mit finsterer Entschlossenheit durch die Drehtür, trat mit tapferer Sachlichkeit an die Rezeption – »Zweihundertachtunddreißig, bitte« −, nahm den Schlüssel in Empfang und ging in Richtung Fahrstuhl davon. Harry hatte sich im Hintergrund gehalten, sie aber eingeholt, als die Fahrstuhltür aufglitt. Sie traten hinein und warteten. Es dauerte ewig, bis die Tür zuging, so als wisse der Fahrstuhl, was sie vorhatten, und sträube sich. Nach einem Zischen waren sie, endlich, allein.
Aber nicht für lange. Die Tür glitt fast augenblicklich wieder auf, und sie traten in einen sterilen, leeren Korridor. Wortlos gingen sie auf dem orangefarbenen Läufer bis zur Tür von Zimmer zweihundertachtunddreißig.
Das Blut hämmerte Georgina wieder im Kopf, und doch wagte sie, den Schlüssel ins Schloss zu stecken. Er ging reibungslos hinein. Sie drehte ihn und öffnete. Harry machte die Tür schnell hinter ihnen zu, und sie standen zusammen in der Dunkelheit. Der schmerzlich vertraute Geruch von Adrians Zigarrenrauch, der in der Luft hing, versetzte Georgina schlagartig zurück in seine Wohnung in New Haven – zu den Panoramafenstern, den randvollen Bücherregalen, den Lichtern der Großstadt, dem feinen Essen, den bemerkenswerten, intelligenten jungen Männern −, zu ihrem jüngeren Ich und zu Harry, der jetzt so dicht neben ihr im Dunkeln stand.
Er strich mit der Hand über die glatte Wand, tastete nach dem Lichtschalter und streifte dabei Georgina. Drückte entschieden darauf. Adrian Thompsons Zimmer erwachte zum Leben.
Georgina japste unwillkürlich. Die Schubladen der Kommode und des Schreibtischs waren herausgezogen und aufs Geratewohl auf den Boden geworfen, der ansonsten mit Kleidern und Bettzeug übersät war. Die schimmernde malvenfarbene Tagesdecke lag verknäult in der Ecke, die Doppelbett-Matratze war halb herausgezerrt und lag schräg auf dem Bettgestell, eingedrückt und entwürdigt. Die Schranktüren waren ganz geöffnet, die Kleiderbügel durch den Raum geworfen. Thompsons Jacketts und Hosen lagen zerdrückt auf dem Boden, die Taschenfutter nach außen gedreht; überall in dem Chaos feiner weißer Flaum, der an das Haar von Rotwildschwänzen gemahnte.
»Allmächtiger«, murmelte Harry halblaut.
Georgina stand mit offenem Mund da und fühlte sich elend, wie vor den Kopf geschlagen von der Gewalt, mit der dieses Durcheinander erzeugt worden sein musste, und von der Erkenntnis, dass Harry recht gehabt hatte, dass es jetzt keinen Zweifel mehr gab: Jemand war hinter Adrians Vortrag her, war in sein Zimmer eingebrochen und hatte ihn gestohlen. Sie lehnte sich an die Wand und atmete tief, während Harry durch die Unordnung stakste, hier ein Jackett und da eine Zeitschrift aufhob und schließlich die Finger an die Schläfen presste, als wollten sie ihm zerspringen. Er schüttelte den Kopf, legte die Hände an die Wangen und zog sie langsam herab, zwang sich zur Ruhe.
»Wir rufen wohl lieber die Polizei«, sagte er.
Kapitel 2
Das Handy schrillte zu unchristlicher Stunde, und obwohl Ian rasch danach griff und den Anruf in der Diele annahm, war für Saskia Milner an ein Weiterschlafen nach diesem unsanften Wecken nicht zu denken. So lag sie nun unter der Decke, spielte mit einer Haarsträhne, die ihr über die Brust gefallen war, und lauschte mit schläfrigem Interesse der gedämpften Stimme ihres Mannes. Wirklich verstehen, was gesprochen wurde, konnte sie kaum, hörte jedoch die seltsame Mischung aus Dringlichkeit und Skepsis in seinem Ton. Die Dringlichkeit sagte ihr, dass Detective Superintendent Ian Stokes heute nicht ins Bett zurückkehren würde; die Skepsis machte sie neugierig.
Saskia hörte das leise Klicken, mit dem das Handy zuklappte, und sah, wie die Schlafzimmertür langsam aufging und Ian zu seiner Kommode tapste. Es war schön, seinen schlanken Körper in T-Shirt und Boxershorts anzusehen, während er verstohlen hereinschlich, weil er sie schlafend wähnte. Träge freute sie sich auch mit plötzlich geschärften Sinnen über ihren geschmeidigen Leib.
»Ich bin wach, Ian«, sagte sie schließlich. »Was ist los?«
Er kam ans Bett und setzte sich neben sie, legte behutsam die Hand auf ihren warmen Oberarm. Schwieg noch einen Moment. Saskia nahm den Umriss wahr, mit dem sich sein kurzes dunkles Haar gegen die Decke abzeichnete, vom Schlaf zerdrückt, wild und doch beruhigend.
»Ein Professor hatte einen Herzinfarkt«, sagte er.
»Wie bitte?«
»Du hast mich schon verstanden.«
»Tatsächlich? Ein Professor? Und du suchst nun den Übeltäter, ja? Cholesterin, Bewegungsarmut, Stress oder Viagra – sind das die Verdächtigen? Ich tippe auf Stress und mache den großen Reibach. Oder vielleicht das Viagra – das wäre besser, weil noch skandalträchtiger.«
Sie war jetzt hellwach, ihre Augen glänzten, da schon kleinste Dinge eine manische Erregung in ihr auszulösen vermochten. Stokes schaltete die Nachttischlampe an. Der feine goldene Ring in ihrem linken Nasenflügel fing das Licht ein, als sie sich zu ihm drehte. Er staunte, wie jung Saskia aussah: zwei Kinder, mit der Grundschule fast fertig, und sie ginge glatt für siebzehn durch. Gut, vielleicht dreiundzwanzig. Sein Blick fiel auf ihre neueste Strickarbeit, ebenfalls auf dem Nachttisch – sie strickte fanatisch, als ob es eine subversive Betätigung wäre.
»Na ja«, sagte er und spannte sie ein bisschen auf die Folter, damit er sie anschauen konnte. »Kein gewöhnlicher Professor. Du kennst ihn sogar.«
Für den Bruchteil einer Sekunde dachte sie wohl, er spräche von seinem Vater, dem einzigen Professor, der ihr als persönlicher Bekannter einfiel. Aber wenn es so wäre, würde er nicht lächeln und Scherze treiben.
»Ich kenne keine Professoren.«
»Ich meine, nicht persönlich.« Er stand auf und ging zu seiner Kommode, zog eine Schublade hervor. »Und meine Eltern kennst du beide, das nur nebenbei.«
»Wenn du es noch weiter in die Länge ziehst, fange ich an zu stricken«, drohte sie. »Oh, Gott, da ist es.« Sie starrte auf ihr angefangenes Stück, einen Berg aus brauner und schwarzer Wolle, ohne danach zu greifen.
»Es ist der, zu dem du die Auslage im Laden gemacht hast.« Vielleicht hatte sie sogar ein Bild von Thompson gestrickt – sie ging bei ihren Dekorationen gern aufs Ganze.
»Was? Der Oxford-Mensch? Thompson?«
»Genau. Ich glaube aber, er gehört zur Shakespeare-Fraktion.«
»Ich weiß, Dummerchen, ich meine das Oxford-Dings. Der? Oh weh! Ich mochte ihn. Ich meine, seinen Ansatz. Die Sache auf sich beruhen zu lassen. Dann wäre …«, sie hielt nachdenklich inne und sah ihm beim Anziehen zu. »… Stress also ein Oxfordianer?«
Er hatte keine Ahnung, wovon sie sprach.
»Ich meine, gehst du jetzt auf Spurensuche, ob er zu oft zu fettig gegessen hat oder so?«
Er lachte, nicht über den Scherz, sondern die Spurensuche. Sie waren seit dreizehn Jahren verheiratet, und trotzdem wusste er nicht, was er ihrer Vorstellung nach den lieben langen Tag tat, denn es waren immer nur solche Kleinigkeiten, die ihr Interesse weckten. Das meiste, er wusste es selbst, war zu prosaisch, als dass es ihre Aufmerksamkeit länger gefesselt hätte. Ja, das meiste war zu prosaisch, als dass es seine Aufmerksamkeit länger gefesselt hätte, aber mit Selbsttäuschung schaffte er es irgendwie. Spurensuche machte ihn zu jemandem, der mit einer großen, goldgeränderten Lupe Fäden von einem Teppich zupfte. Bei der Vorstellung hätte er sich am liebsten wieder ausgezogen und zu ihr ins Bett gelegt. Doch er sagte: »Ich hab dir noch nicht gesagt, dass sein Zimmer durchwühlt wurde.«
Das verschlug ihr die Sprache. Sie sah ihn groß an und schob verblüfft die Lippen hin und her. Dann sagte sie: »Gut, Stress scheidet damit aus. Es muss Viagra gewesen sein.« Sie streckte den Arm aus, griff nach ihrer Strickarbeit und begann, mit den Nadeln zu klappern, ohne ihn eines weiteren Blickes zu würdigen. »Wie soll so etwas gehen, Ian? Warte, sag’s mir nicht. Einer von der Oxford-Fraktion ist in das Zimmer rein und hat den Vortrag gestohlen. Durch mein Schaufenster weiß ich, worum es geht. Aber er – Moment, du glaubst nicht etwa, einer von der Oxford-Fraktion hat ihn − als Stress verkleidet − umgebracht? Ist das der Grund, weswegen sie dir das aufgehalst haben?«
Er nahm seine Armeejacke vom Haken an der Tür und zog sie über. Er war kein Schlips-und-Kragen-Detective, konnte Einengung jeglicher Art nicht ausstehen. »Ich muss los, Saskia. Und, nein. Akademiker bringen sich wegen ihrer kleinen Querelen nicht gegenseitig um. Ich weiß es. Ich bin mitten unter ihnen aufgewachsen.«
Er sah ihr Gesicht, das eines verzweifelt flehenden Engels, ihr langes braunes Haar mit einem Hauch von Henna gegen das weiße T-Shirt, das sie zum Schlafen anzog, ihre schmalen Schultern. Gott, er sehnte sich in einem fort nach ihr.
»Dazu fehlt ihnen der Mumm«, sagte er. Er winkte kurz und machte sich bedauernd auf den Weg in die Nacht.
Der Pub namens Blackfriar’s war nur wenige Straßenzüge vom Swan Theatre entfernt. Es war ein schwach beleuchtetes Lokal mit Beschlägen aus Messing, die sich hell glänzend von den dunklen Wänden abhoben, mit schweren Tischen und Stühlen in einem verwinkelten Innenraum, einem schimmernden Tresen und schäbigem Fußboden. Das Macbeth-Publikum strömte in Schüben herein, und die in unregelmäßigen Abständen zuschlagende Tür gab den Takt an, in dem die den Raum erfüllenden Gespräche abermals jäh anschwollen.
Die vier Oxfordianer, die auf der Konferenz sprechen sollten, zwängten sich an einen abseits in einer Nische stehenden kleinen Tisch. Sie hatten das Theater rasch verlassen, noch vor dem Tumult um Thompson in der ersten Reihe. Trotzdem beteiligten sie sich nicht an dem allgemeinen fröhlichen Treiben. Da die drei Amerikaner, die sich gut kannten, zumeist schwiegen, redete Zachary Parsons, der einzige Brite in der Runde, umso mehr und füllte mit seinen Einwänden gegen die Kostüme der Hexen und den Akzent, den sie im Stück sprachen, die Lücke. Vier Ale standen auf dem Tisch, kaum angerührt.
Parsons, der immer wieder den Kopf zur Seite warf, als fürchte er, etwas Wesentliches in einem anderen Teil des Pubs zu verpassen, blieb aber nicht lange bei den anderen. Als eine auffällige junge Frau mit einem Glas Wein in der Hand an ihren Tisch kam und fragte, ob sie nicht die Oxfordianer seien und ob sie ihr bitte erklären könnten, worum es bei dem Ganzen ging, bot sich Parsons sofort an. Er entschuldigte sich unvermittelt bei seinen Kollegen und lotste seinen Fang an einen anderen Tisch außer Sichtweite, zog einen Stuhl für die Frau hervor, und sie setzten sich.
Nach kurzem verlegenem Schweigen berichtete sie ihm, sie habe gerade den zweiten Diener in Macbeth gespielt.
»Ja, natürlich«, sagte er. »Und sehr gut.« Ihre strahlenden Augen, matten Sommersprossen und vollen Lippen faszinierten ihn; ihr dicht gelocktes dunkelbraunes Haar, wild über die Schultern geworfen, entzündete seine Fantasie. Wenn er je eine Frau gebraucht hatte, dann jetzt – und hier war eine, und was für ein Weib! Dankbar sah er sie über den kleinen Tisch hinweg an und trank einen großen Schluck von seinem süffigen dunklen Bier.
Sie beobachtete ihn beim Trinken. Sein schütterer brauner Bart war ungepflegt, sein lichter werdendes, aber noch nicht graues Haar, das glatt nach hinten gekämmt war, stieß an den Kragen des dunklen Seidenhemds und hinterließ dort weißliche Flöckchen.
Sie tippte mit dem Zeigefinger sacht an den Stiel ihres Weinglases. »Also, wie läuft so etwas ab?«, sagte sie. »So eine … Debatte. Wir sind alle neugierig.«
»Oh«, sagte er lässig. »Das kann ich Ihnen sagen. Es läuft so: Wir sind vier von uns und vier von denen. An den ersten beiden Tagen halten wir unsere Vorträge, und am dritten gibt es eine förmliche Aussprache. Unter Vorsitz keines Geringeren als eines Richters am Obersten Gericht.« Er lächelte forsch. »Die Veranstaltung wird von der Royal Shakespeare Company gesponsert und findet im Theater statt. Die Presse macht viel Wind darum, wie Sie sicher bemerkt haben. Die Karten sind seit Wochen ausverkauft. Nicht gerade eine wissenschaftliche Konferenz wie alle anderen, nicht?«
»Nein«, sagte sie. »Gar nicht.«
»Man möchte meinen, die Allgemeinheit interessiert sich mehr für Shakespeares Identität als für seine Stücke. Die Resonanz ist schlicht gewaltig.«
Sie lächelte. »Gratuliere. Aber ich würde gern wissen …«
»Sie wollen hören, worum es geht.« Er lächelte beflissen, breitete die Hände mit plumper Theatralik auf dem dunklen, zerschrammten Tisch aus und sah ihr verständnisinnig in die Augen. »Letztlich läuft es darauf hinaus: William Shakespeare war der Sohn eines Handschuhmachers aus einem Provinznest. Bei der Herkunft und dem Lebenskreis hätte er das Geschehen bei Hofe, wo fast alle Stücke spielen, nicht so genau und überzeugend schildern können. Der Gedanke ist lächerlich.«
Er trank wieder einen Schluck Ale, der seinen dunklen Lippen Glanz verlieh. Seine grünen Augen funkelten eigenartig; sie hörte etwas Manisches, fast Beängstigendes, in der Art, wie er seine Worte betonte, so als kämen sie ihm ohne sein Zutun über die Lippen. Sie fasste wieder nach ihrem Glas, trank aber nicht. Er lächelte breit – unecht, dachte sie – und fuhr fort: »Edward de Vere war ein Adliger, der im Zentrum der Macht aufwuchs und einen Universitätsabschluss hatte – zwei sogar. Er verfügte über die Intelligenz und die Voraussetzungen, um die Stücke zu schreiben – wir kennen sogar Teile seines Frühwerks. Aber, wissen Sie …«, er hielt inne und lächelte abermals, suchte ihren Blick, um ihr mit seinen Worten auch sein Verlangen mitzuteilen, » … es wäre ein Skandal gewesen, hätte man ihn damit in Verbindung gebracht. Stünde sein großer Name auf den Stücken, wären sie mit Sicherheit als das erkannt worden, was sie waren – intime Satiren auf das Hofleben und die Höflinge, bis hinauf zur Königin persönlich. Das wäre als Unterhaltung für die Massen nicht akzeptabel gewesen. Die Shows würden nicht weitergehen. Sich als Verfasser zu ihnen zu bekennen wäre für de Vere gefährlich gewesen. Man hat Menschen schon für viel weniger enthauptet.«
Er sah in ihr ratloses Gesicht und wurde noch emphatischer, sprach schnell, seine Augen flogen zwischen ihren und der Tischplatte hin und her, als müsse er sich beeilen, alles unterzubringen und sie mit seinem Expertentum matt zu setzen.
»Also suchte er sich ein Werkzeug, einen Kleininvestor, einen analphabetischen Raffzahn namens William Shakespeare – und gab ihm Geld dafür, dass er seinen Namen benutzen durfte. Alles, was wir mit Sicherheit über diesen Shakespeare wissen, ist nicht besonders schön: Er erwarb eine Immobilie in Stratford, ließ einen Schuldner vom Gerichtsvollzieher verhaften, häufte während einer Hungersnot Getreidevorräte an und stellte seiner Stadt sogar das bisschen Wein in Rechnung, das er einem Prediger ausgeschenkt hatte. Er beteiligte sich an einer Intrige, durch die Arme von der Nutzung der Allmende ausgeschlossen werden sollten. Klingt das wie der große Dramatiker? Für mich nicht. Für mich ist der Mann bloß ein Egoist und ein Snob. Manche behaupten, er sei ein zweitklassiger Schauspieler gewesen, aber selbst das ist nicht verbürgt. Wahrscheinlicher ist, dass er nur Teilhaber zweier Theater war – dadurch dürfte er de Vere kennengelernt haben, der übrigens mit gerade mal dreizehn Jahren die Theatertruppe seines Vaters erbte. Shakespeares Vater hingegen war Analphabet, und er selbst hatte, genau wie seine Frau und seine Tochter, Mühe, mit seinem Namen zu unterschreiben.«
Wie kam er bei der Frau an? Fachkenntnisse, Scharfsinn, Rebellion gegen die bestehende Ordnung – all das waren seines Wissens mächtige Aphrodisiaka, und hier bot sich nach langer Zeit eine ausgezeichnete Gelegenheit, sie wieder einzusetzen.
»Wenn man das einmal begriffen hat, wird einem alles klar. Es gibt Tausende Details in den Stücken und Sonetten, die total einleuchten, wenn de Vere sie geschrieben hat, bei Shakespeare als Verfasser aber überhaupt nicht. De Vere ist zum Beispiel lange durch Italien gereist, und wer immer die Stücke geschrieben haben mag, kannte Italien genau; die Städte, die Sitten, die Sprache. Oftmals verwendete er italienische Quellen im Original. Fast ein Drittel der Stücke spielt in Italien. William Shakespeare konnte kein Italienisch und hat nie den Fuß außerhalb von England gesetzt. Beweisstück A.«
Er hielt inne, lächelte und nippte an seinem Bier. Jetzt hatte er sie am Haken, er war sich sicher. Sein Blick verweilte auf ihren Brüsten, reichen Schätzen, kaum verhüllt von dem engen blauen T-Shirt, das sie nach der Vorstellung übergezogen hatte; im Geiste sah er ihre Hände nach dem Saum greifen und es nach oben und über den Kopf ziehen wie eine Katze, die sich in der Sonne streckt. Lass mich sie bitte mit meinem Auftritt gewinnen, dachte er. Ich habe Gott weiß genug durchgemacht. Ich brauche das jetzt.
»Hören Sie«, sagte er schlicht. »Die von Shakespeare am häufigsten genutzte Quelle ist Ovid in der Übersetzung von Arthur Golding. Der war de Veres Onkel, und raten Sie mal, wem er seine Übersetzung gewidmet hat. Keinem anderen als de Vere! Oder schauen Sie sich die Sonette an – dagegen wurde übrigens nie etwas gesagt. Die andere Seite äußert sich nicht dazu. Aber hören Sie: Nicht Marmor, nicht das Gold an Königssäulen / Kann überdauern dieses Reimes Macht. Mit anderen Worten: Meine Verse sind unsterblich. Der Dichter sagt es wieder und wieder, Sonett um Sonett. Er stellt ihm aber auch andere Zeilen gegenüber, solche etwa: Wenn mich auf ewig Staub der Welt verbarg. Es ergäbe aber keinen Sinn zu sagen Meine Verse sind unsterblich, ich aber werde vergessen sein, wenn ich sterbe, es sei denn, der Verfasser schreibt unter anderem Namen. Oder? Ich meine – ich hör schon auf, ich will Sie nicht langweilen, aber so etwas kommt bei ihm haufenweise vor. Wer unvoreingenommen hinschaut, zieht unweigerlich diesen Schluss. Sigmund Freud zog ihn. Orson Welles, John Gielgud, Derek Jacobi. Sogar bevor die Oxford-Hypothese am Horizont auftauchte, war klar, dass William Shakespeare die Stücke nicht geschrieben haben konnte: Whitman, Dickens, Mark Twain, Hawthorne, Emerson – sie glaubten es alle nicht. Man muss nur unvoreingenommen hinschauen …«
»Warum dann so ein Aufwand? Ich meine, der Professor, der Vortrag – ich kapier’s nicht.« Sie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück, befühlte das Glas Chardonnay, das vor ihr stand, wischte den kühlen Beschlag vom Kelch ab. Dieser Mensch interessierte sich eindeutig zu sehr für sie – außerdem war er irgendwie gestört, und der seltsame Zug um die Augen, dieser stechende Blick. Sie musste sich bald loseisen, wollte die Sensation aber trotzdem aus erster Quelle hören.
»Die Sache ist die.« Er beugte sich verschwörerisch nach vorn und sagte eindringlich, aber kaum laut genug bei dem Lärmpegel im Lokal: »Der Knackpunkt bei de Vere ist, dass er so früh starb. 1604. Einige große Dramen wurden offenbar erst später geschrieben. Genau genommen ist aber keineswegs klar, wann die Dramen geschrieben wurden. Sogar orthodoxe Gelehrte können sich nicht auf eine Chronologie einigen.«
Er leckte sich die Lippen und sah sie fiebrig an. »Könnte allerdings«, sagte er, »jemand nachweisen, dass nur eins der Stücke definitiv nach 1604 geschrieben wurde, bräche die ganze Oxford-These in sich zusammen. Wir würden alle mit eingezogenem Schwanz heimgehen und nie wieder einen Mucks von uns geben. Thompson hat seit Monaten durchblicken lassen, er könne so einen Beweis vorlegen. Er ist ein angesehener Wissenschaftler und steht selber an der Schwelle des Todes …«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Na ja, er ist alt und krank. Er hatte vor ein paar Monaten einen Schlaganfall, der ihm auch den Rest hätte geben können. Offenbar ist er mit intaktem Verstand davongekommen, hat aber jetzt einen gelähmten Arm. Und, wissen Sie, ich vermute, dass sein Blutdruck durch die Decke geht samt allen üblichen Begleiterscheinungen. Das hier, verstehen Sie, wäre also seine letzte große Geste, der krönende Abschluss seiner langen Laufbahn, mit dem er uns alle zum Schweigen bringt – danach könnte er in Frieden sterben. Ich gebe deswegen gern zu, dass wir alle wegen morgen durchaus ein bisschen nervös sind – dass Thompson wirklich etwas gefunden hat, glaubt zwar niemand, aber …«
»Was ist mit Macbeth?«
»Macbeth?«
»Ja. Könnte Macbeth nach seinem Tod geschrieben worden sein?«
»Allerdings! Das heißt, könnte es eben nicht, denn ich persönlich bin mir sicher, dass de Vere es geschrieben hat. In der Regel wird Macbeth aber auf 1606 datiert. Die Pförtnerszene, wissen Sie, wenn man die mit historischem Blick liest, scheint sich auf den Prozess gegen einen jesuitischen Priester zu beziehen, der in dem Jahr stattfand – genau genommen die Guy-Fawkes-Sache.«
»Ist das dann nicht der Beweis?«
»Nein, denn es könnte sich ebenso auf einen anderen Priester beziehen, der Jahre zuvor hingerichtet wurde, 1595. Oder später hinzugefügt worden sein. Schauspieler fügten immer Szenen zu Stücken dazu, genau wie sie auch welche herausnahmen. Ich vermute, heute tun sie das nicht mehr.«
»Ja, es ist ziemlich selten, Text zu einem Klassiker hinzuzufügen.« Sie tastete nach ihrem Autoschlüssel. Sie hatte genug gehört; es war Zeit, sich davonzumachen.
»Hören Sie«, sagte sie, »es war nett, sich mit Ihnen zu unterhalten – wie war der Name?«
»Zachary. Sie können Zack sagen.«
»Zack. Ich bin Kara Whitmore. Wissen Sie, Sie sollten diesen alten Knacker einfach abservieren.«
Sie schenkte ihm ihr charmantestes Lächeln, stand auf und zog ihre leichte Wolljacke über. Sein Kopf zuckte unwillkürlich; für den Moment war er so sprachlos, wie sie ihn haben wollte. Sie ließ den Schlüssel in die Jackentasche gleiten.
»Sind Sie sicher, dass Sie schon gehen müssen?«, sagte er bettelnd.
»Ich muss, ja.«
»Mein Vortrag ist um elf«, sagte er. »Falls Sie in der Nähe sind …«
»Es würde mich sehr freuen. Wenn ich kann. Vielleicht bis dann also.« Sie lächelte ein letztes Mal und hatte Mitleid mit ihm, wusste aber genau, wo ihre Interessen lagen. »Auf Wiedersehen.«
Sie ging davon, wie er es befürchtet hatte. So lässig und lebendig – sie war jung, sah gut aus, hatte Talent, alles. Er versuchte, sie sich noch einmal auf der Bühne vorzustellen, konnte es aber nicht, konnte sie nur am Tisch gegenüber sehen, hinter dem goldgeränderten Glas.
Das ging nun schon seit Jahren so. Er sollte sich daran gewöhnt haben. In diesem Moment, jetzt, brauchte er es aber besonders. Er hatte doch ein Recht darauf!
Sie fliehn vor mir, die einst mich suchen kamen. Die Zeile von Wyatt rauschte ihm durch den Kopf.
Er schloss die Augen. Immer flohen sie jetzt vor ihm. Früher oder später. Konnte er nichts dagegen tun?
Sogar seine liebe, süße Alicia, nach so viel Zärtlichkeit, so viel unschuldiger Verheißung. Alicia mit dem breiten Messingbett, den flauschigen grünen Handtüchern, mit Monogramm bestickt, den Sommersprossen rings um die Augen. Die schöne, jugendfrische Alicia. Die Wunde schmerzte Jahre später immer noch.
Was hatte er falsch gemacht? Warum hatte sie sich gegen ihn gewendet?
Und warum hatte sich jetzt sogar Oxford gegen ihn gewendet?
Ein Schauer fuhr ihm bis ins Mark. Rasch legte er die Hand um das kalte Glas, das sie stehen gelassen hatte. Er wollte sie so sehr.
Er berührte das Glas, wo sie es angefasst hatte, führte es an die Lippen und nippte, wo sie genippt hatte. Eine scharfe Süße überzog seinen Gaumen.
Und dann setzte er das Glas ab, sackte auf seinem Stuhl zusammen. Trank noch einen großen Schluck Ale.
Es ist mir nun so süß nicht, wie vorher.
Die Röte stieg ihm ins Gesicht. Er stand auf und ging hinaus, frische Luft schnappen.
Das Gedränge und Gelärm in dem Pub hatte stetig zugenommen, das rüpelhafte Grölen und das kreischende Gelächter, die vorher das Hintergrundgeräusch der Gespräche nur kurz unterbrochen hatten, bildeten nun ihrerseits den Hintergrund, unterbrochen von lautem Gläserklirren und dem Gebrüll, mit dem Bestellungen an die Köche durchgegeben wurden. Parsons Fraktionskollegen aber – Daley, Wilson und Bates – hatten kaum ein Wort gewechselt, seit er sie verlassen hatte.
»Das mit den Theaterkarten ist skandalös«, sagte James Wilson schließlich und brach das lange Schweigen. Der dunkle Bart und die goldgeränderte eckige Brille verwischten die Züge des rötlichen Gesichts – das üppige schwarze Haar hingegen war akkurat gekämmt. Seine Stimme war schneidend und zugleich verhalten, so als fürchte er, eine Szene zu machen. »Andere hätten sie nicht so abgefertigt. Schlechte Plätze, alle an der Seite.«
Julia Bates sah ihn gespannt an, bevor sie antwortete. Sie war eine gertenschlanke, anziehende Frau mit schulterlangem, auffällig schwarzem Haar; an diesem Abend trug sie ein schlichtes Sommerkleid und eine fein karierte Strickjacke mit kleinem, aber extravagantem fedrigen Kragen. Wie sie dasaß – ruhig und wachsam, sinnlich und unnahbar –, vermittelte den Eindruck, dass sie jedem Unglück, jeder verheerenden Flut standhielt, in der ihre Kollegen untergehen mochten. Eine Schachtel Sobranie ohne Filter lag geöffnet neben ihrem Ale auf dem Tisch.
»Mich hat’s nicht gestört«, sagte sie und pulte mit der Fingerspitze eine Zigarette aus der ordentlichen Reihe. »Ich hatte heute Abend das pralle Leben, das Geplapper des Parterres. Links von mir ging es dauernd: ›Wer ist das?‹, und hinter mir: ›Was hat er gesagt?‹ Und noch jemand anders hat nach Duncans Ermordung irgendwem erklärt, dass Lady Macbeth gerade ihren Vater hat umbringen lassen. Das Einzige, was in der Tragödie nicht vorkommt: Vatermord, begangen von einer Frau.«
»In diesem Pub aber schon«, sagte Chris Daley mit leuchtenden Augen. »Julia Bates, die Papa Shakespeare umbringen und durch einen Mann ersetzen will, der ihr besser gefällt. Wie war dein Vater eigentlich, Julia? Das frage ich mich oft.« Zwei leere Gläser und ein halb volles samt einem Haufen runder Bierdeckel müllten inzwischen den Tisch vor ihm zu, und davon bestärkt war er offenbar bereit, in den Kampf zu ziehen. Sein breites, flächiges Gesicht hatte etwas Kindliches; sein sich lichtendes dunkelblondes Haar reichte nicht aus, die große Fläche der Stirn zu bedecken, über die es gebreitet war. Sein neues Tweedjackett schlug auf seiner umfangreicher werdenden Mitte wenig schmeichelhafte Falten.
»Lass stecken, Chris, der ist alt«, blaffte Bates ihn an.
»Alt, so?«, keifte Daley zurück. »Alt? Vieles wird alt, Julia. Alt und langweilig. Derselbe alte Sermon pro Oxford, wo man doch auf etwas Neues gehofft hatte. Wo einem etwas Neues versprochen wurde.«
»Versprochen wurde? Achte mal auf deine Rhetorik, Herr Professor. Wem weichst du aus, Chris, wovor hast du Angst? Sag es einfach, wenn du es sagen willst. Raus damit!«
Sie schob sich die Sobranie zwischen die Lippen und strich gekonnt mit einem Streichholz über die Oberfläche eines glänzenden Schächtelchens; fast ohne Druck entlockte sie ihm eine Flamme, wie einzig und allein von ihrem Willen hervorgebracht. Sie atmete tief ein, hielt den Atem kurz an und ließ den feinen Nasenflügeln zwei Rauchfähnchen entströmen.
»Ich tue wenigstens etwas«, fuhr sie fort, »etwas mit ein bisschen Niveau. Du scheffelst bloß Geld. Immer dasselbe. Nie beim Thema. Immer nur am Rande. Du hast nicht ganz die Traute, Oxford in deinen Aufsätzen zu erwähnen, nicht? Verbindlich, das ja, aber ohne sich festzulegen, der Professor Daley.«
Ein Gedanke kam ihr, ein grausamer Gedanke, und sie spielte damit und richtete ihn höhnisch gegen ihn. »Mir hast du auch nie ganz gesagt, was du willst, nicht? Wenn daheim das Frauchen wartet, richtig, Chris? Wir wollen den Status quo doch nicht zu rigoros ändern, nicht? Lassen wir Geld sprechen, nicht? Mächtiger Investor Daley, bei dem es um das große Geld geht, reicht das nicht? Ein bisschen flirten, was ist das schon? Ein bisschen flirten ist kein richtiges Flirten, oder? Du bist ein Zweideutler, Daley – hast du dich heute Abend wiedererkannt? Ich fand die Pförtnerszene wirklich gut gespielt.«
Sie klopfte ihre Asche auf den Boden ab. Daley wollte ein abschätziges Lächeln aufsetzen, bekam es aber nicht hin. Er trank einen großen Schluck Stout und beugte sich vor.
»Julia«, flötete er und griff sie mit beißendem Spott an. »Du bist so eine bezaubernde Frau und hast so einen bezaubernden Ruf. Ist es nicht unfair, was man über dich sagt? Hast du Dobsons Frau gegenüber wirklich diese legendäre Äußerung getan? Während er dir half, die Festanstellung zu ergattern? Und du ihm – wie wollen wir es nennen – bei der Stillung eines gewissen Verlangens?«
Julia Bates wandte sich ihm zu und betrachtete ihn wie ein winziges Exponat in einem Kuriositätenkabinett. Mit den glatt rasierten vollen Wangen machte er trotz seiner unverkennbaren Verbitterung einen kindlichen Eindruck.
Sie lächelte höhnisch und sagte dann leise: »Morde eher ein Kind in der Wiege, als daß du unausgeführte Wünsche hegst.«
Sie ließ den Blick demonstrativ durch den Pub schweifen, betrachtete die dunklen Balken, die trüben Funzeln an der Wand und die Menge, die ihn füllte. Grüppchen drängten sich um den Tresen, Tische waren über ihre Platzanzahl hinaus besetzt, und der Lärm von Debatten und Späßen, von Anzüglichkeiten und Anmachversuchen, Enttäuschungen und Erwartungen – mit Alkohol, süßem englischen Ale, geschmiert – wogte in berauschenden Wellen durch den Raum. Julia drückte ihre Zigarette im Aschenbecher aus, wandte sich wieder dem Mann ihr gegenüber zu und feuerte ihre Worte ab: »Das sagt der Pazifist William Blake. Aber er ist nicht drauf und dran, Säuglinge zu töten, wie wir wissen – oder, Chris? Er protestiert nur dagegen, wie gewisse Leute leben.«
»Ah«, sagte Daley ironisch, und im Schweißfilm auf seiner Stirn spiegelte sich das schummrige Licht des Pubs, als er sich vorbeugte. »Wir spielen Mit-Zitaten-Werfen. Ausgezeichnet. Dann mach ich mal weiter, Julia, und frage dich – nein, es interessiert mich wirklich, ich habe mich das schon immer gefragt. Hast du – als du ihr bei den Vorspeisen für ausgerechnet das Weihnachtsessen geholfen hast − das wirklich zu ihr gesagt? Hast du wirklich gesagt: Wer die Hitze nicht ausstehen kann, hat in der Küche nichts verloren? Hast du? An welche Hitze hast du da gedacht, Julia? Und an welches Stehen? Sehr gut, ausgezeichnet. So anspielungsreich, so shakespear’sch – da spricht der Pförtner, Julia, ja? Macbeths eigener Pförtner und sein kleiner Riff über Buhlerei? Ist es wahr, dass sie kurz danach in eine Anstalt eingewiesen wurde? Ein Opfer deines kometenhaften Aufstiegs mehr, Julia, denn du hast die Gipfel der Wissenschaft ja nicht nur auf eine Weise erstiegen. Aber ein Gipfel hilft dem anderen, nicht?«
Julia Bates sah ihn an, als wäre er ein kleiner Junge, und schüttelte nur fast unmerklich den Kopf. Scheinbar gelangweilt lehnte sie sich auf ihrem Stuhl zurück und sah in die andere Richtung. Daley wandte sich an Wilson.
»Sag doch was, Wilson, verteidige sie, Herrgott noch mal. Sie hat dich hierhergebracht, nicht? Wie bringt es ein Informatiklehrer an einer Tagesschule sonst zu Ruhm und Ansehen? Was schuldet sie dir, Wilson, wenn ich das mal frank und frei fragen darf? Oder hatte sie bloß so viel zu tun, diese verdammte Konferenz zu organisieren, hatte so viel zu tun, nicht zu merken, dass es ein abgekartetes Spiel war, nicht zu merken, dass sie uns alle Thompson in den Rachen wirft, dass sie auch nicht merkte, dass in deiner Vita eine Kleinigkeit fehlt, ein scheiß Doktortitel nämlich …«
»Halt den Mund«, zischte Wilson in einem Ton, der zornig und zugleich beherrscht war. »Halt einfach den Mund. Du hast zu viel getrunken und führst dich auf wie ein Idiot. Thompson kann uns nichts anhaben. Gar nichts. Also halt die Klappe, Chris Daley. Lass mich in Ruhe. Ox…«
Anscheinend stieß Wilsons Zunge an ein Hindernis, er spitzte die Lippen und machte eine seltsame Bewegung wie jemand, der jemanden küssen will und die Lippen dann zurückzieht. Julia Bates schaute weiter in die andere Richtung. Wilsons Lippen fuhren vor und zurück, vor und zurück in einer Geste, die Daley zunehmend grotesk und anzüglich fand. Er starrte Wilson mit immer größer werdenden Augen an, bis das Vor und Zurück plötzlich aufhörte und Wilson sich nach erzürntem Kopfschütteln wieder in der Gewalt hatte.
»Unser Tag kommt schon noch«, sagte Wilson gereizt. Er griff so fest nach seinem fast noch unberührten Glas, dass die Fingerknöchel weiß wurden.
»Schön wär’s«, sagte Daley vielsagend.
Im selben Augenblick flog die Tür auf, die nicht weit von ihrem Tisch entfernt war, und Zachary Parsons blieb kurz im Eingang stehen, eine Hand an der Tür, mit dem Rücken zur Nacht, sodass ein willkommener Schwall frischer Luft in den Pub strömte. Dann kam er an ihren Tisch gestürzt, außer Atem, die geröteten Augen weit aufgerissen.
Er legte die verschwitzten Hände auf den abgescheuerten Tisch und stützte sich mit seinem ganzen Gewicht darauf, sammelte sich und ließ die Bombe platzen: »Ich komme gerade aus dem Hotel«, sagte er kopfschüttelnd und schwer atmend. »Thompson …«
»Ach«, sagte Julia Bates bissig. »Was ist jetzt wieder mit ihm?«
Parsons zögerte, dann sprach er es aus: »Er ist tot.«
Kapitel 3
Die Stadt war wie ausgestorben. Die Nacht war ruhig, als Ian Stokes am Stratford Arms eintraf. Er stieg aus dem Auto in den frühen Morgen und instruierte den Fahrer zu warten. Er hatte es nicht eilig gehabt herzukommen – die Kriminaltechniker gingen langsam und methodisch zu Werke, er wäre nur im Weg gewesen.
Die Informationen, die er von Lynch in der Zentrale in Leek Wootton bekommen hatte, und seine Bemerkungen dazu waren Stokes während der Fahrt noch einmal durch den Kopf gegangen. Lynch, ein Ex-Soldat, nörgelig, grauhaarig und derb, war erst spät zur Kriminalpolizei gestoßen. Dass er um drei Uhr nachts persönlich anwesend war, sagte etwas über den Fall.
»Wenn es schlecht läuft«, hatte er vor den wenigen Detectives, die in dem fast leeren Besprechungsraum zusammengekommen waren, geraunt, »wird das der Fall mit dem größten öffentlichen Interesse, in dem Sie je ermitteln werden. Selbst wenn es gut läuft, wird er das wahrscheinlich. Sie alle wissen, wie viel Wind die Presse um diese Konferenz gemacht hat, und der Todesfall – ich sage es ungern – ist bereits publik geworden. Um zwei haben hier die Telefone schon geglüht. Irgendjemand, ein Platzanweiser oder Sanitäter oder ein Polizist oder eine Krankenschwester – weiß der Teufel, wer –, hat sich ein, zwei Pfund dazuverdient und es ausgeplaudert. Jeder Pendler in Großbritannien bekommt heute Morgen zu lesen, dass Thompson gestorben ist, und die Boulevardpresse mag zwar dämlich sein, aber so blöd, nicht zu merken, wenn etwas kein Quatsch ist, ist sie nicht. Die kapieren genauso gut wie wir, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht, wenn Thompsons Zimmer so kurz nach seinem Tod verwüstet vorgefunden wurde. Das war geplant. Und sie kapieren so gut wie wir, dass der Diebstahl keinen Sinn ergibt, wenn Thompson am Leben wäre und in jedem Fall von seinen Entdeckungen berichtet hätte. Vielleicht kapieren sie sogar genauso gut wie wir, dass Gelehrte sich wegen ihrer kleinen Differenzen nicht gegenseitig umbringen. Scheren tun sie sich allerdings nicht darum, denn Großbritannien liebt Krimis, und hier kriegt es einen auf dem Silbertablett geboten. Die Sache wird also durch die Decke gehen, und je früher wir hieb- und stichfest wissen, was wirklich geschehen ist, und den Deckel auf diesen Mist draufmachen können, desto weniger wird das Land und die Welt auf uns schauen, wild herumspekulieren und uns belästigen. Wenn wir es vermasseln, vermasseln wir es auf den Fernsehschirmen der Welt, solange deren geschätzte kurze Aufmerksamkeitsspanne reicht.
Wir machen also Folgendes: Sie übernehmen den Fall, Stokes. Sie sind von hier und kennen diese akademische Welt, und ich kenne Ihren Stil und gebe Ihnen meinen Segen. Aber das darf diesen Raum nicht verlassen. Ich will Sie am Fall haben, nicht vor den verfluchten Mikrofonen. Sie ermitteln im Anbau in Stratford und zwar mit Jacobs, Harwell und Avery« – er sah die Genannten der Reihe nach an – »und haben völlig freie Hand. Was Sie brauchen, bekommen Sie. Für die Presse leite allerdings ich die Ermittlung und zwar im Stratforder Revier, wo ich, wenn es sein muss, zum Schein eine Einsatzzentrale einrichte für den Fall, dass jemand sehr genau hinschaut. Sie halten mich auf dem Laufenden, und ich mische mich nicht ein, Stokes – wir sind Ihre Deckung, wir sind der Köder, weswegen die Herren und Damen der Presse ihre Zelte vor dem Revier aufschlagen, während Sie in dem bescheidenen Nebengebäude ungestört ein- und ausgehen. Sind alle Mann an Bord?«
Offenbar ja. Lynch wartete ab, bis alle den Raum verlassen hatten, in dem Stokes auf einen diskreten Wink von ihm hin noch blieb. Als die Tür zum Besprechungsraum zu war, entspannte sich seine Miene, und er lächelte fast.
»Ich hab sie ein bisschen das Fürchten gelehrt, nicht? Aber, ehrlich, Ian, diese Sache macht mir Angst. Wir sitzen auf dem heißen Stuhl, er könnte heißer nicht sein, und ich hoffe bloß, dass es sich schnell aufklärt und wir alle mit trockenem sauberen Hintern nach Hause gehen. Mir schwant aber dunkel, dass das eine finstere Geschichte ist, und es gefällt mir gar nicht, dass die Weltöffentlichkeit uns im Visier haben wird wie ein Heckenschütze, während wir unser Bestes geben, was aber nie genug ist. Deswegen nehme ich Sie aus dem Blick. Ich weiß, dass es einen feuchten Hurenfurz nutzt, wenn der Teamchef es dem Schlagmann auflädt, den er dafür ausgesucht hat, und das meine ich auch so. Sie sind zwar ein komischer Kauz, Stokes, das weiß ich, aber ich hab selber Aufs und Abs erlebt – und ich habe Sie bei der Arbeit beobachtet, und mir hat gefallen, was ich da gesehen habe, auch wenn ich nicht alles nachvollziehen konnte. In dieser prekären Lage verlasse ich mich auf Sie. Also – sind Sie bereit?«
Was sollte er sagen? Ach, nein danke, suchen Sie sich einen anderen? Es war seine Arbeit, war Sold und Löhnung