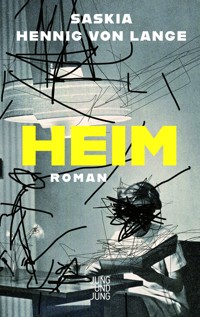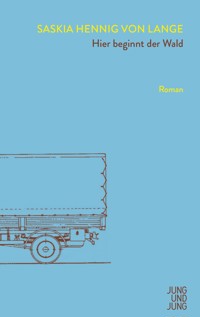
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung und Jung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Saskia Hennig von Lange versteht es, Geschichten zu erzählen, die man nicht glauben will, aber glauben muss, weil sie ihren Figuren so eindringlich und unwiderlegbar ins Abseits folgt, dass man an deren Seite bleibt.Der Namenlose dieser Erzählung ist unterwegs, er erledigt einen Job: Er soll einen Lastwagen voll Umzugsgut in eine andere Stadt bringen. Doch was harmlos beginnt, entwickelt sich bald zu einer abenteuerlichen Flucht: vor sich selbst und seinen Kindheitserinnerungen, aber vor allem vor seiner Frau und ihrem gemeinsamen, ungeborenen Kind. Nach einem Unfall verkriecht er sich im Wald. Hier kommt es zu einer Begegnung, die ihn herausfordert und mit sich selbst konfrontiert – und auch den Leser nicht unberührt zurücklässt.Hennig von Lange gelingt es, die zunehmende Verstörtheit ihres Helden mit irritierender Folgerichtigkeit als Ausdruck seiner Überforderung durch das Leben nachvollziehbar zu machen. Und das in einer ebenso präzisen wie musikalischen Sprache, die einen schon nach wenigen Seiten in Bann schlägt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autorin dankt dem Deutschen Literaturfondsfür die Unterstützung bei der Arbeit an diesem Buch.
© 2018 Jung und Jung, Salzburg und WienAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.comISBN 978-3-99027-216-9eISBN 978-3-99027-161-2
SASKIA HENNIG VON LANGE
Hier beginnt der Wald
Roman
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
1
Jetzt sitzt er hier und würde doch lieber woanders sitzen. Hinten, auf der Rückbank, die Hände unter den Oberschenkeln, damit sich das Muster seiner Cordhose in die Haut drücken kann, den Blick nach draußen gerichtet, auf eine dunkler werdende Landschaft, die sich aufbaut und zusammenstürzt im Rhythmus seiner Gedanken. Er könnte das kühle Gestänge der Kopfstütze vor sich umfassen, sich nach vorne ziehen, die Nase in ihrem Haar. Mit der Hand darüber streichen und ein paar Worte sagen, die sie abtun würde. Er könnte sich auch umdrehen, das Kinn auf die Ablage, den Blick zwischen die Scheinwerferlichter der Autos, die sie überholen. Die erst groß sind und dann verschwinden, und schon sind neue da. Als kämen die aus ihm. Wir sind schnell, denkt er. Aber darum geht es ja, dass man vorwärts kommt, und zur Ruhe.
Jetzt denkt er daran: wie er als Kind im Auto gesessen hat, hinter seiner Mutter, deren Umriss mit der vorbeiziehenden Landschaft verschwamm. Wie er dieses Auto wurde, sein Körper ein Brummen und Sirren, wie er vorankam zwischen den anderen Autos. Wenn sie angekommen waren, hatte er nicht geschlafen und war doch fort gewesen: ein Schlaf, der nicht mehr schläft. Der nicht ganz wach ist. Und so ist es jetzt auch, nur dass er vorne sitzt und das Lenkrad hält. Dass ich hier allein bin, denkt er, keiner beugt sich zu mir hin, keine Rückbank. Hinter ihm nur der Laderaum mit einer Fracht, die ihm nicht gehört, für die er sich überhaupt nicht interessiert. Die er irgendwohin bringt, um eine neue zu holen, und immer so weiter.
Denn eigentlich fahre ich ja nur, damit ich fahren kann, denkt er, damit ich von dir wegkomme. Nur deshalb hat er diesen Job angenommen, nachdem er so lange keinen mehr hatte. Deshalb hat er da angerufen, nicht viel verhandelt, zu allem ja gesagt. Damit ich wegkomme von dir und von dem, was du in dir hast, denkt er. Dieses Kind war ganz und gar ihre Idee. Dieses Kind, von dem sie gesprochen hat, als wäre es längst da, auf der Welt oder wenigstens in ihrem Bauch, als würde es sich dort regen und alles Mögliche anstoßen. Sie hatten beide schon genug miteinander zu tun, da brauchte es kein Kind. Und jetzt denkt er, dass es das gewesen sein muss, was dieses Kind so lange fernhielt.
Jetzt denkt er an dieses Kind, als wäre es schon da, so wie sie vorher immer daran gedacht hat. Als würde er es kennen oder könnte es sich wenigstens vorstellen. Aber das Kind gehört ja auch zu ihm, es besteht aus ihm. Und auch wenn er es nicht kennt, ihn müsste es doch kennen. So wie seine Mutter vor ihm auftaucht, wenn er sich durchs Haar fährt, wenn er die leichte Krümmung seines ausgestreckten rechten Zeigefingers betrachtet, wenn er etwas sagt oder denkt. Wenn er in einem Auto sitzt. So wie ich mich kenne, wie ich mich an mich erinnern kann, denkt er, wie ich auf der Rückbank eines Autos saß, wie ich meine Hand ausstreckte, wie ich diese Hand klar vor mir sehe. Diese Erinnerung ist etwas anderes als die an dich, denkt er.
Wenn ich an dich denke, wie du dir an die Stirn fasst und durch die Haare fährst, den Kopf weg von mir, ein Nicken und ein Ausatmen zur Seite, dann sehe ich dich klar vor mir, denkt er. Aber es ist doch kein Wiedererkennen, wie das, wenn er sich durchs Haar fährt und dabei an seine Mutter denken muss. Oder wenn er jetzt an sie denkt, mit seinen Händen auf diesem riesigen Lenkrad, den Fuß auf dem Gaspedal, den Blick auf der Straße, ein Summen in seinem Kopf, das bestimmt auch in ihrem Kopf so summte. So wird es diesem Kind auch einmal gehen. Nur dass es nicht wissen wird, wen es wiedererkennt an seinen Händen oder in seinem Gesicht. In seinen Gedanken. Denn er wird nicht zurückkommen. Er will dieses Kind nicht und will sich selbst nicht wiedererkennen in ihm. In seinem Geruch, im Geräusch seines Atmens. Und ich will auch dich darin nicht wiedererkennen, denn dich sehe ich sowieso die ganze Zeit vor mir, denkt er. Ich brauche niemanden, der mich an dich erinnert.
Er tritt aufs Gas, er fährt schneller und wird ruhiger davon, vom Fahren, vom Geräusch seines Fahrens, diesem Sirren, das er auch spürt. In seinen Händen und Armen, in seinem ganzen Körper sitzt dieses Sirren, während er durch die Welt fährt. Durch eine Welt, die sich ihm kaum zeigt. Das ist eine Welt ohne Städte und Menschen, nur Bäume gibt es dort, einzelne Häuser, Land, eine Weite, die da ist, die man aber nicht sehen kann. Es dämmert. Das Summen in seinen Händen erinnert ihn daran, wie lange er dieses Lenkrad schon hält. Seit er heute Mittag losgefahren ist, hält er sich an diesem Lenkrad fest.
Die Distanz zwischen ihm und seinen Händen auf dem Lenkrad ist unermesslich, sein Körper ins Riesenhafte, ins Unbeherrschbare ausgedehnt. Er ist losgefahren, den Weg zurück, den er vorher mit dem Fahrrad gekommen war. Er spürt den Schlüssel vom Fahrradschloss in seiner Hosentasche, ein leichter Druck am Oberschenkel seines rechten Beins, mit dem er das Gaspedal tritt, und das sagt ihm, dass er noch da ist. Und es sagt ihm auch, dass er es ist, der diesen Weg vorher gefahren ist. Er sah die Bäume und wie sie an ihm vorbeirauschten, und erinnerte sich, wie sie gerade noch langsamer auf ihn zugekommen waren, wie sie vor ihm wuchsen und aufragten und wieder verschwanden. Und während er bereits abbog, auf die Autobahn, sah er in gerader Richtung den Weg, den er mit dem Rad gekommen war, der immer weiter führt, vorbei an den Hochhäusern, in die Stadt und die Straßen hinein und schließlich auch in ihre Straße. Er sah, wo der Weg endet, vor dem Haus, dessen Tür er vor ein paar Stunden hinter sich zugezogen hatte. In diesem Haus gibt es Wohnungen, und in einer dieser Wohnungen hat er gewohnt.
Und so eine Wohnung fährt er mit sich herum, die Einrichtung einer solchen Wohnung, und diese Einrichtung wird sich nicht sehr von der unserer Wohnung unterscheiden, die meisten Wohnungen ähneln einander, denkt er. Er hat den ganzen Inhalt einer Wohnung da hinten drin, Möbel, Lampen, Bilder, und irgendwo gibt es jemanden, der auf die Sachen wartet, der das alles wiederhaben will. Als würde sich das lohnen, als könnte in ein paar Möbelstücken etwas von Bedeutung stecken. Als könnte man nicht auf jedem Stuhl sitzen, in irgendeinem Bett liegen, als käme es darauf an. Ich könnte auch unsere Sachen da hinten haben und sie jemand anderem bringen, denkt er.
Er lockert den Griff. Er denkt an sie und daran, dass morgen niemand in der Küche stehen wird, um zu sehen, wie im Hochhaus ein paar Straßen weiter das Licht in ihrem Büro angeht. Niemand wird am Fenster stehen, zwischen Spüle und Küchentisch, einen Becher mit lauem Kaffee in der Hand. Niemand wird dort stehen, gegen die Wand gelehnt. Niemand wird die Zeit messen, die Sekunden, die Minuten zählen, die verstrichen sind, seit sie die Wohnung verlassen hat. Zählen, bis in ihrem Büro das Licht angeht. In ihrem Büro, wo er noch nie war, dessen Lage er aber kennt, weil sie ihm manchmal, an Wintertagen, von dort Lichtzeichen gegeben hat. Die Entfernung ist zu groß, man kann sie gar nicht sehen. Wenn das Licht angeht, weiß er, sie ist jetzt dort und nicht mehr hier. Alles andere stellt er sich vor: Wie sie ihre Tasche neben dem Schreibtisch abstellt, Mantel und Tuch auszieht, die Mütze vom Kopf nimmt und in die Außentasche des Mantels steckt oder in den rechten Ärmel hineinzieht, den Mantel an die Garderobe hängt oder über den Besucherstuhl und sich an den Schreibtisch setzt. Auch was sie sonst noch tut, stellt er sich vor, und er denkt, dass sich das morgen niemand vorstellen wird, weil er morgen nicht in der Küche stehen wird. Er fragt sich, ob etwas anders sein wird, bloß weil er nicht versuchen wird, die Dinge mit seinen Gedanken in Gang zu halten. Er fragt sich, ob sie den Mantel anbehalten wird, bloß weil er nicht daran denken wird, dass sie ihn ausziehen könnte. Ob sie vergessen wird, das Licht einzuschalten. Ob sie im Dunkeln sitzen wird, weil er nicht in der Küche steht und an sie denkt. Ob sie überhaupt noch da sein wird, wenn er nicht mehr da ist. Das fragt er sich und kann gar nicht aufhören, daran zu denken, ob sie auch ohne ihn noch da sein wird.
Er hatte die Tür hinter sich zugezogen. Ich gehe nicht mehr hinter dir her, denkt er, ich kann dich sowieso nicht erreichen. Ich bin jetzt woanders, ich bin jetzt hier, in diesem Lastwagen, und fahre durch eine Welt, die nicht mehr da ist oder nur gerade noch. Auch du warst immer nur gerade noch da. Und jetzt bist du nicht einmal mehr das. Wie die Scheinwerferlichter, die auf mich zukommen, sich ausdehnen und verschwinden. In dieser Unschärfe erkenne ich dich, am Saum eines Schlafs, da zeigst du dich noch einmal, damit ich dich vergessen kann. Indem ich an dich denke, werde ich dich vergessen. Ich werde dich vergessen, weil ich an dich denke. An das, was in dir ist. Auch das werde ich vergessen. Dann wird es das nicht mehr geben, und das ist richtig so. Denn es kann ja nicht sein: dass da ein Kind in dir wächst, das aus uns beiden besteht. Was für ein Mensch soll das werden, der an einer Stelle wächst, wo vorher schon kein Platz war? Ein wenig Platz braucht man schließlich, wenigstens so viel wie zwischen einer halb offenen Tür und der Wand dahinter. Er steht in diesem Halbdunkel zwischen Tür und Wand, auf seinen nackten Zehen ein Streifen Licht. Er ist ein Tier in seiner Höhle. Er hört Stimmen aus dem Schlafzimmer. Diese Stimmen gehören zur Ausstattung seines Lebens. Wie das Lackplättchen, das er von der Tür gerieben hat. Jetzt liegt es am Boden, und er schiebt es mit dem großen Zeh unter dem Türspalt durch. Er beugt sich hinunter, er geht auf die Knie. Er rollt sich zusammen, Schläfe und Wange auf dem Boden. Schritte kommen auf ihn zu, Füße in hohen Schuhen. Ihre Hand an der Türklinke. Sie schaut ins Zimmer und sieht ihn nicht.
Lichter tauchen vor ihm auf, werden größer und verschwinden. Er wird immer schneller, seine Hände sind verwachsen mit dem Lenkrad. Er ist zu einem Teil dieses Lasters geworden, um ihn herum Kunststoff und Glas und Metall, und draußen die Welt. Hier kann er bleiben, hier ist alles, was er braucht. Er hält nicht mehr an, er fährt immer weiter, fährt schneller und schneller. Es ist dunkel, es ist plötzlich dunkel, und er ist müde. Er könnte den Kopf auf den Lenker legen, zwischen seine Hände, er könnte schlafen. Ein warmes Tier hockt auf seinem Schoß, das atmet, das stört ihn nicht. Er kann leise mit ihm sprechen, sonst hat er ja niemanden, nur er ist hier und diese warme Müdigkeit. Sie erinnert ihn daran, dass er etwas zu erledigen hat, dass er ein paar Möbel durch die Gegend fährt, die ihm nicht einmal gehören. Diese Ladung, die Lichter, die ihn blenden, der Regen, das alles hat nichts mit ihm zu tun. Und mit dir schon gar nicht, denkt er. Dass du hier bist, das denke ich nur, das bilde ich mir bloß ein. Er muss aufhören damit, er muss anhalten und eine Pause machen. Er muss raus.
Er stellt den Motor ab, stößt die Tür auf und ist draußen im Regen. Sein Gang ist etwas unsicher. Vom Parkplatz aus kann er die Autobahn noch deutlich erkennen und auch die Biegung, in der sie verschwindet. Am liebsten würde er mit dieser Straße verschwinden. Er setzt sich auf eine Leitplanke, er schaut die Straße entlang, er weiß ja, dass sie auch hinter diesem schroffen Dunkel noch weitergeht, auch wenn sie aussieht wie abgeschnitten. Und er weiß auch, dass er auf dieser Straße immer weiter fahren kann, dass er immer wieder irgendwo abbiegen kann und in eine andere Straße einbiegen und dann in noch eine und noch eine. Dass er so niemals zu irgendeinem Ende kommt, das weiß er.
Also kann er genauso gut noch eine Weile hier im Regen sitzen bleiben und an Dinge denken, an die er länger nicht gedacht hat, an die er vielleicht noch nie gedacht hat. Es kommt ihm vor, als sollte er für immer hier sitzen. Aber er will ja gar nicht bleiben. Da hätte er doch gleich zu Hause weiter auf den Fernseher starren können. Der gar nicht eingeschaltet war, in dem sich bloß das Wohnzimmerfenster gespiegelt hat und der Vorhang hell davor. Auf dieses Bild hätte er starren können oder auf ein Buch in seinen Händen. Er hätte da hineinschauen können, auf die schwarzen Zeichen, auf seine Daumen, die einzelne Buchstaben verdeckten, die ihm sowieso unlesbar erschienen und ihn daran erinnerten, dass er einmal nicht lesen konnte. Dass diese Zeichen für ihn einmal eine andere Bedeutung hatten. Eine Bedeutung, die sich unter seinem Blick und seinen Kinderhänden veränderte. Unter Händen, die sich an einem Buch oder einem Ast festhielten, wie sie das nun an der Leitplanke tun. Seinen Händen, in denen die Hände seiner Mutter stecken und die bald in den Händen dieses Kindes stecken werden. Aber er will das alles nicht mehr, herumsitzen und sich an irgendetwas festhalten und auf Dinge starren, die Straße, ein Buch, er selbst auf diesem Parkplatz. Da könnte er sich genauso gut hinten in den Laster legen, ein Bett wird da schon sein, und sich die Decke über den Kopf ziehen. Da hätte er gar nicht erst losfahren müssen. Schluss damit, er steht auf.
Der Fuß rutscht ihm weg, er kann sich nicht halten, er schlägt mit dem Hinterkopf auf den Schotterboden, die Beine in der Luft. Hier ist alles nass. Er spürt den Regen auf seinem Gesicht, Tropfen laufen in seine Ohren, das ist nicht unangenehm. Und doch kann er hier nicht bleiben. Er greift nach der Leitplanke und schwingt die Füße zur Seite. Er zieht sich hoch, steht vornübergebeugt, die Hände immer noch auf dem stumpfen Metall. Seine Hose ist nass, seine Jacke, seine Haare. Er sieht seinen Atem und einen Umriss. Jemand kommt auf ihn zu, kommt immer näher, fasst ihn an den Schultern. Er will ihn abschütteln, doch der andere hält ihn fest.
»Alles in Ordnung mit Ihnen?« Er schüttelt sich noch einmal, er schüttelt den Kopf und seinen ganzen Körper. Was denkt der denn, was will der bloß, so ein Idiot. »O.k.«, sagt er, »o.k. Alles o.k.« Doch der andere hört nicht auf, zieht und drückt. Also macht er einen Schritt über die Leitplanke und auf den anderen zu. Der weicht zurück, hält ihn aber immer noch fest. Sie geraten ins Straucheln, sein linker Fuß verhakt sich an der Leitplanke, der andere kann ihn gerade noch auffangen. »Um Gottes willen, was machen Sie denn für ein Theater, sind Sie betrunken?« Er reißt sich los, stößt an die Leitplanke, sie stehen einander keuchend gegenüber. Der andere starrt ihn an, er kann dessen Atem riechen. »Was soll das«, er schlägt ihm mit der flachen Hand gegen die Brust, »was wollen Sie denn von mir?« Er schubst ihn noch einmal, der andere macht einen Schritt nach hinten. Im Vorbeigehen rempelt er den Mann hart mit der Schulter an. Er hört, dass der fällt, doch er dreht sich nicht um.
Er geht auf den Lastwagen zu, tritt auf die metallene Stufe, greift mit der Linken nach dem Lenkrad, zieht sich daran hinein, schlägt die Tür zu, dreht den Zündschlüssel und lässt den Kopf auf das Lenkrad fallen. Er atmet ein und aus. Hier ist er sicher, bis hierher wird der andere ihm nicht folgen. Er spürt die Einkerbungen des Lenkrads und wie sie einen Abdruck auf seiner Stirn hinterlassen. Er spürt das Brummen und Rucken des Motors, das durch seinen Körper geht. So hat er auch heute Mittag gesessen, daran erinnert er sich jetzt. Er atmet aus und denkt daran, wie er, als das alles hier begann, seinen Kopf auf dieses kalte und klebrige Lenkrad fallen ließ. Wie er daran denken musste, wer das vor ihm gehalten hat, ob außer ihm überhaupt schon irgendjemand seinen Kopf darauf gelegt hat. Und ob der seinen Kopf dann auch kurz hat liegen lassen, bevor er einen Blick über die Schulter warf, die Kupplung trat und losfuhr.
Wasser läuft ihm in den Nacken, er greift sich in die nassen Haare. Ob der andere da immer noch liegt? Es ist dunkel, es regnet jetzt stärker, aber der wird schon zurechtkommen. Ein bisschen schwindlig ist ihm. Er wird es heute nicht mehr schaffen, aber er fährt, solange es geht. Was kann ihm schon passieren, er hat eine ganze Wohnung mit dabei. Große Tropfen fallen auf die Windschutzscheibe, bündeln sich zu Rinnsalen, Lichter brechen sich darin. Er tastet nach dem Hebel für die Scheibenwischer. Seine Kleider sind nass, ihm ist kalt, aber das hält ihn wach.
Jetzt sitzt er hier, und es gefällt ihm, wie er hier sitzt und schneller und schneller wird. Alles schießt auseinander. Er bleibt mit dem Blick an etwas hängen, ein kurzer Schrecken, ein Tier, schon ist es weg. Er schaut in den Rückspiegel, aber da sind nur die Lichter der anderen Autos. Wie schnell er ist! Er schaut wieder nach vorn, Warnleuchten. Wo gehen die Scheibenwischer aus? Er kann gar nichts sehen, er tritt auf die Bremse. Ein Krachen und Kreischen und Knirschen um ihn herum. Er wird nach vorne geschleudert, gegen ein riesiges Kissen. Ein Schnalzen ist zu hören, ein leises Klacken dort, wo der Kopf auf dem Hals aufsitzt. Das Fahrzeug schlingert, bricht hinten aus, dann steht es still. Er kann nichts sehen und ist froh darüber. Er will gar nicht sehen, was es da vor ihm zu sehen gibt. Deshalb steigt er auch nicht aus, er bleibt einfach sitzen, und er sitzt lange so. Ich denke an dich, denkt er. Alles in Ordnung, ihm ist nur ein bisschen übel. Ich denke an dich, so wie ich schon die ganze Zeit an dich gedacht habe. Er denkt an den kleinen Körper am Straßenrand, wegen dem er hier sitzt. Er kann seinen Kopf drehen, er kann nicken und ihn hin- und herwiegen, das zieht ein bisschen, aber es geht. Er hebt die Arme und lässt sie wieder sinken, er spürt seine Füße auf den Pedalen. Er bewegt sie, ein kleiner Tanz. Als wäre ich nicht mehr nur ich, als wäre ich nicht mehr allein, denkt er. Als wäre ich plötzlich zwei: einer, der tanzt, und einer, der mir dabei zuschaut, der das etwas seltsam findet.
2
Er dreht noch einmal den Kopf, er legt die Hände flach auf die Oberschenkel, die Füße hat er zwischen die Pedale auf den Boden gestellt. Es geht schon, es ist nicht viel passiert. Er lehnt sich zurück, gegen den Sitz und die Nackenstütze, er umfasst das Lenkrad und drückt den Rücken durch. Presst den Hinterkopf in das Polster. Seine Haare sind noch immer nass. Er zieht die Schultern hoch und lässt sie fallen, schließt die Augen und öffnet sie wieder. Alles ist noch da, ihm ist nur ein bisschen schlecht. Und der Airbag, der ist hin, er hängt riesig und schlaff aus dem Lenkrad. Liegt zwischen seinen Armen und auf seinem Schoß. Er rafft die Hülle zusammen und versucht sie zurück hinter die Klappe zu stopfen. Das geht nicht, immer wieder rutscht seitlich etwas heraus, und da ist natürlich auch noch Luft drin. Er knüllt den Sack zusammen und schiebt ihn oben durchs Lenkrad. So geht es, da stört er nicht.
Es klopft, jemand schaut durchs Seitenfenster, ein Sanitäter. Er nickt ihm zu, Daumen hoch, ich bin noch da. Der Sanitäter öffnet die Tür, nimmt seine Hand vom Lenkrad und zieht sie zu sich hin, beginnt zu zählen. Er hört es kaum, ein rhythmisches Flüstern. Der Sanitäter zählt und zählt und nickt dabei, hört gar nicht mehr auf zu zählen. Er würde gerne mitmachen, da ist immer etwas, was sich zählen lässt. Die Fenster im Haus gegenüber, die Kacheln an der Wand und die Fugen dazwischen. Die eigenen Schritte auf dem Weg in die Schule und wie oft er einem Hund begegnet. Die Minuten, in denen ich nicht an dich denke, denkt er. Aber der andere ist schon fertig und legt seine Hand zurück aufs Lenkrad. Er fasst ihm ins Gesicht, zieht mit Daumen und Zeigefinger sein Unterlid herunter, leuchtet ihm erst ins eine Auge, dann ins andere. Der Sanitäter klopft noch ein-, zweimal auf seinen Arm und wendet sich ab, er sieht ihn im Rückspiegel verschwinden. Hat er etwas gesagt, wie geht es denn jetzt weiter? Er könnte ihm hinterherrufen, doch das tut er nicht. Er könnte seinen Kopf aus der offenen Tür strecken und ihm hinterherrufen, aber wozu? Er kann ja auch alleine hier sitzen und zählen. Nach draußen schauen. Er riecht den feuchten Asphalt und hört den Regen darauf. Es regnet überall, nur hier drinnen regnet es nicht.
Nach vorne ist nicht viel zu erkennen. Die Scheibenwischer sind aus, die Scheibe ist nass. Im Rückspiegel sieht er Lichter, Blaulichter und Warnblinklichter, große Lampen stehen am Fahrbahnrand, dahinter ist alles schwarz. Autoscheinwerfer leuchten in alle Richtungen, Leute laufen dazwischen herum. Es regnet und regnet, er hört den Regen durch die offene Tür, er kann ihn sehen. Er will mit dem Zeigefinger die Spuren auf der Scheibe nachfahren. Also beugt er sich vor, seine Finger sind steif, er hat mit der Rechten die ganze Zeit das Lenkrad festgehalten. Das Glas ist kühl unter seiner Hand. Es war schon immer kühl. Selbst im Sommer, selbst in der größten Hitze ist eine Autoscheibe kühl. Er beugt sich ein Stückchen weiter vor, legt beide Hände gegen die Scheibe. Er sieht die Umrisse seiner Hände und die Lichter dazwischen. Er sieht sich selbst auf dem Beifahrersitz und wie die Sonne ihn blendet. Die Augen halb geschlossen. Das Radio läuft, seine Mutter summt dazu. Sie schlägt den Rhythmus auf dem Lenkrad und summt und summt. Er schaut zu ihr hinüber. Sie stößt ihn an, bohrt ihm den Zeigefinger in die Schulter, und er schaut wieder weg. Er sieht sich selbst im Außenspiegel. Er ist kein Kind mehr.