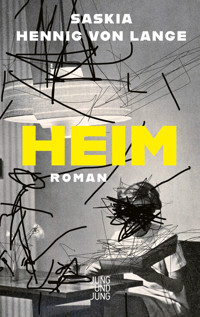Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung u. Jung
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Ein anatomisches Museum und sein Hüter: ein ebenso seltsames wie tiefgründiges Szenario und ein brillantes literarisches Debut.Wir sind nur dann ganz wir selbst, wenn wir außer uns sind. Sage keiner, dass aus dieser Tatsache nicht immer wieder schönste Literatur entstanden ist. Eine fulminante Geschichte der Entgrenzung erzählt auch Saskia Hennig von Langes ganz und gar erstaunliches Debüt "Alles, was draußen ist".Ein anatomisches Museum mit seinen Präparaten, Modellen und Totenmasken, eine schöne Unbekannte aus der Seine und ein Robespierre, und mittendrin ein Mann, der sich im Laufe der Jahre selbst zum Objekt geworden ist. In sprachlich genauen Notaten führt er Buch über sein Leben und seine Gänge durchs Haus, über das seltsame Inventar und über eine immer wieder hörbare, aber unsichtbare "Untendrunterwohnerin".Diese Novelle ist ein literarisches Kunststück, in dem das Unbewusste offenbar wird und in dem die menschlichen Oberflächen eine unergründbare Tiefe zeigen. Vom Körper, von der Haut und den Sinnen führt der Weg der Erzählung in Abgründe, in denen ferne Verhängnisse ebenso nachhallen wie die großen Stoffe der Literatur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2013 Jung und Jung, Salzburg und WienAlle Rechte vorbehaltenISBN print: 978-3-99027-027-1ISBN E-Book: 978-3-99027-101-8
SASKIA HENNIG VON LANGE
Alles, was draußen ist
Eine Novelle
Ich blieb immer hier drinnen. Nur mittags, da ging ich weiterhin alle Stufen hinunter und vor das Haus, und ging zweimal über die Straße und bog einmal um eine Ecke und aß beim Metzger, im Stehen, eine Kleinigkeit, einen Fleischkäse, eine Frikadelle, manchmal ein Schnitzel, etwas Sauerkraut dazu oder Kartoffelsalat, und nahm auch noch ein belegtes Brötchen mit, eine Flasche Bier für den Abend, und ging wieder zurück und nach oben und kam dabei an der Wohnung der Untendrunterwohnerin vorbei, und manchmal schaute sie heraus, und ich sagte Guten Tag, und sie sagte das dann auch, und manchmal fragte sie auch noch, wie geht’s, gut, sagte ich, danke, und selbst? Und dann lächelte und zwinkerte sie, und ihre Löckchen wippten. Und ich ging hinauf, gleich ganz nach oben, ins Zimmer, stellte das Bier auf die Kommode, legte die Brötchentüte dazu und setzte mich hierher, an den Tisch, nahm den Stift und das Papier, oder ich nahm mein Buch. So saß ich dann bis zum Abend, bis ich alles wieder beiseite räumte, noch mal nach unten ging, durch alle Räume lief. Das habe ich getan, bis die Schmerzen anfingen, in meinem Kopf, vor ein paar Monaten, und ich sie zunächst noch aushielt, weiter meine Arbeit tat, unbehelligt von der Welt, die nicht zu mir kam und die ich auch nicht bei mir haben wollte, bis ich immer länger im Bett bleiben musste, und es dann auch dort nicht mehr aushalten konnte, hin und her lief in meinem kleinen Zimmer, nicht mehr hinausging, seit Tagen auch nichts mehr gegessen hatte, bloß im Bett gelegen hatte oder hin und her gelaufen war, und eines Morgens beschloss, dass es so nicht weitergeht, dass ich doch hinausgehen müsste, nicht zum Metzger, zum Arzt, in ein Krankenhaus, und das tat ich dann auch, ich ging die Treppe hinunter und sah nichts von der Untendrunterwohnerin und hörte sie auch nicht. Ich trat vor das Haus, dachte noch, zum ersten Mal seit Langem wieder, an den alten Emeritus, und dann fiel einiges in mir zusammen, und ich gab diesem Fallen nach.
Im Krankenhaus waren sie bedenklich, die Schwestern schlichen herum, und es dauerte lange, bis ein Arzt kam, und als der zu sprechen anhob, hob ich die Hand und sagte: nein, lieber nicht hier, lassen Sie uns doch in Ihr Büro gehen, und er nickte, und eine Schwester half mir auf und half mir in die Jacke, zog mir auch die Hose an, an den Füßen hatte ich weiße Schlappen, aus Frottee, und sie führte mich in sein Zimmer, und es dauerte noch ein wenig, bis er kam, und dann setzte er sich mir gegenüber, legte die Hände vor sich auf den Tisch, hob sie noch einmal an, faltete die Finger ineinander und ließ sie sinken, wir schauten beide auf diese Hände, als er es sagte: Das hier scheint Ihr letzter Winter zu sein. Ich nickte, hatte es schon längst gewusst, hatte nur eine Frage, fragte: Und der Frühling? Er wiegte den Kopf. Vielleicht. Und ich wollte mich schon bedanken, wollte aufstehen und gehen, als er mich plötzlich ansah, die Hände blitzschnell auseinandernahm, mich am Arm packte und ausstieß: Sie werden fürchterliche, unvorstellbare Schmerzen haben. Er schaute noch einmal auf das Papier unter sich. Ich fragte, ob ich nach Hause könne. Er nickte, ich müsste bloß kommen wegen der Schmerzmittel, später, wenn es so weit sei, er könne mir jetzt nicht viel geben, das dürfe er nicht. Ich nickte. Er schrieb ein Rezept. Ich nahm es. Ich ging nach Hause. Ich saß auf meinem Bett. Ich ging durch mein Museum. Ich schaute aus dem Fenster. Erinnerungen kamen, lange nicht mehr Gedachtes. Ich ließ alles herein.
Ich fühlte auch meinen Körper, wie man ihn als Kind gefühlt hatte, wie ich ihn gefühlt hatte, an heißen Sommertagen, wie ich gespürt hatte, dass mein Herz in mir schlug, und wie ich dachte, dass ich es zum Stehenbleiben bringen könnte, durch einen einzigen, einen unachtsamen Gedanken. Ich fühlte auch da, wie mein Herz in mir schlug, und fühle das jetzt noch: Und ich will das nicht verlieren, dieses schlagende Herz in mir, das ich spüren und auch hören kann. Das will ich nicht verlieren und meinen Körper nicht, mit dem ich immer noch herumgehen kann, hier im Museum, mein Körper, der einen Raum einnimmt, der ich selbst bin, und einen Weg absteckt, den ich gehen kann.
Dieser Raum, den mein Körper einnimmt, und der auch nicht kleiner wird, der sagt ja deutlich, dass ich hier bin, dass ich noch hier bin und nicht im Verschwinden begriffen. Und diesen Raum wenigstens, den will ich behalten, das soll sichtbar bleiben: dass es einen Raum gibt in dieser Welt, der von meinem Körper eingenommen wird, den dieser überhaupt erst herstellt. Und so begann ich mit den Abdrücken. Ich ging in die Apotheke, holte meine Medikamente, holte Gips, holte Wachs und nahm mir jeden Tag einen anderen Teil meines Körpers vor. Und je weiter ich kam, desto klarer wurde mir, dass es nichts nutzen würde, dass ich trotzdem sterben würde, ohne dass jemand etwas von mir wüsste. Ich schüttelte den Kopf über mich, es schmerzte: Als wäre das Zurücklassen einer Spur so leicht. Und so habe ich versucht, mich aus einer anderen Perspektive zu betrachten, weniger direkt, ich bin wieder ans Fenster getreten, bin hier herumgegangen. Ich habe versucht, einen kleinen Abstand zu gewinnen, als wäre der Abdruck meiner Hand nicht bloß ein Abdruck, sondern als wäre er die Hand selbst, nahm ich ihn, hielt ihn vor mich hin, oder legte ihn auf den Tisch und ging um ihn herum, ging von ihm weg und auf ihn zu und schaute ihn an. Ich ließ meinen Blick darauf liegen und schaute sie immer länger an, diese Hand, diesen Abdruck meiner Hand, den ich ja selbst gemacht hatte, und ich dachte an die Hände, die ich mit dieser Hand gehalten hatte. Viele waren es nicht. Und ich dachte daran, was ich schon getan hatte mit meiner Hand, und was ich noch tun würde, wozu sie mir noch dienen könnte, und was ich anrichten würde mit ihr, in der Welt. Was ich schon angerichtet hatte. Und wonach ich noch greifen könnte, und was sich mir entziehen würde, was ich nicht würde erreichen können. Und dann schloss ich meine Augen, und ich dachte, dass alles, was unbegreiflich ist, ja dennoch weiter besteht, und dachte, dass das ein tröstlicher Gedanke ist, und ich dachte auch, dass ja nicht dieser Raum, den meine Hand einnimmt, und auch nicht diese Zeit, in der ich mich bewege, das ist, was mich ausmacht, und dass ich diesen Raum und diese Zeit ja auch niemals ausfüllen könnte, und dass das Entscheidende genau dieses Wissen darum ist: das Wissen um dieses haltlose Treiben auf einer weiten Mitte, und dass einem ja nichts anderes bleibt als Mensch, als sich seine Gedanken darüber zu machen. Und dass ein solches Sich-Gedanken-Machen ja den Menschen ausmacht, und auch seine Moral. Und dass ohne eine solche Moral der Mensch ja nicht bestehen könnte. Und so begann ich, all diese Zettel hier vollzuschreiben. Habe dies und das aufgeschrieben, aus dieser und jener Perspektive. Habe Altes und Neues einfach so kommen lassen. Durch mich durch. Ich habe es hingeschrieben, wie ich es gesehen habe. Und jetzt habe ich sogar das hier aufgeschrieben. Habe es aufgeschrieben und kann es jetzt lesen, meine Augen müssen auf dem Papier nur ein paar Zeilen zurückspringen. Ich kann es lesen oder es auf den Stapel mit den Papieren legen. Später, heute Nacht, wenn ich nicht werde schlafen können, wenn ich wach liege, hier in meiner Kammer, und nach allem horche, was unter mir ist, nach Stimmen und Schritten, nach einem Klopfen, dann kann ich aufstehen aus meinem schmalen Bett und mich an den Schreibtisch setzen, einfach irgendwo hineingreifen, ein Papier herausziehen und etwas lesen über mich und es dann wissen. Gleich werde ich den Stift hinlegen, eine Pause machen. Das Geschriebene durchsehen.
Ich hebe meinen Kopf vorsichtig und lasse ihn dann doch noch einmal auf den Stoß mit den Papieren fallen, ruhe mich dort kurz aus, lege mir auch die Hände noch auf den Hinterkopf, so dass die Ohren frei bleiben, lege die Ellenbogen auf den Tisch neben mich und bleibe noch eine kleine Weile sitzen. Drehe den Kopf hin und her und lausche nach ihr. Kein Ton ist zu hören von meiner Untendrunterwohnerin, kein Zirpen und Rascheln. Alles ist still dort unten. Also stütze ich meine Hände auf, hebe auch den Kopf, löse mich von dort und von dem, was ich nicht hören kann, richte mich auf und gehe los. Ich steige die Stufen hinunter, näher zu ihr hin, vielleicht kann ich sie dann auch besser hören. Jetzt gehe ich durch den Eingangsbereich, jetzt trete ich in den langen Flur. Ich fange meine Runde im Schädelzimmer an, wie immer. Hier ist alles in Ordnung: Es ist schon hell, es fällt Licht durch das schmale Fenster, und auch von hinten, durch die Tür, die ich gerade geöffnet habe, in der ich noch stehe, leuchtet es. Ich kann alles ganz deutlich sehen: Kein Schulkind hat sich über Nacht hinter einer der Vitrinen versteckt, niemand hat an den Köpfen, den Kalotten herumgespielt, niemand hat die Hand in einen offenen Schädel, in einen Unterkiefer gesteckt und ist dort hängen geblieben, niemand hat sie durcheinandergebracht. Wer hätte es schon tun sollen: Seit Jahren kommt keiner mehr hierher. Sie liegen alle noch in ihrer schönen, ruhigen Ordnung im Regal, die Schädel. Blicken, als ich zur Tür hereinkomme, herüber, sie lächeln, ich nicke ihnen zu und wische mit der hohlen Hand etwas Staub von ihren Glatzen. Während ich schon den Kopf zur Vitrine mit den Säuglings- und Kinderunterkiefern drehe, streiche ich noch über die glatte Kühle eines der Schädel hinter mir im Regal, bleibe mit dem rechten Zeigefinger in seiner Augenhöhle hängen.
Fünf Höhlen hat der menschliche Schädel. In eine davon meine Hand zu legen; hier mit dem eigenen Kopf dagegen zu schlagen, die Stirn voran mit dem eigenen Schädel diesen anderen Schädel zertrümmern. Sich schneiden an den Knochensplittern, in die Wunde die eigene Hand hineinstecken, sie auf den Schädel legen. Ein Mal aus Blut an die Unterseite des Schädels tupfen, in die Stirnhöhle, direkt hinter das Auge. Eines Tages hier zwischen diesen Schädeln zu ruhen. Unter einer anderen Hand.
Ich sollte noch einmal zurückgehen, ich sollte die Eingangstür wieder aufmachen und auch offen lassen, sie verdeckt dann gut die Hälfte des einen Muskelmannes, den Holzkeil unter die Tür schieben. Ich sollte die Kasse aus dem Schrank nehmen, ich sollte die Karten bereitlegen und meinen Hocker unter dem kleinen Tisch hervorziehen. Ich sollte mich darauf setzen und die Hände vor mich auf die dunkelgrün lackierte Platte legen, dazwischen die Karten, zu meiner Rechten die Kasse. In die noch vollen Haare sollte ich mir die Brille schieben, denn die brauche ich ja trotz allem nur für eine Arbeit, die ich schon längst aufgegeben habe, und ich brauche sie nicht, um die Leute hier hereinzulassen, die sowieso nicht kommen, und so könnte ich sie wenigstens benutzen, meine Haare zusammenzuhalten. Rechts, etwas oberhalb der Schläfe, habe ich einen Wirbel, eine kleine Palme wächst mir dort aus dem Kopf. Wenn ich nicke, wippt sie nach vorn und ich kann sie sehen. Früher, da habe ich sie immer nach hinten gestrichen, habe Frisurcreme benutzt am Morgen, um dieses Haar zu bändigen, und habe es gehasst, wenn ich aus dem Augenwinkel sah, oder eher spürte, als dass ich es sah, wie es sich wieder aufrichtete, dieses kleine Bündel meiner Haare, wie es sich aus den dann schon frisurcremesteifen Strähnen emporkämpfte und plötzlich stand, mit einem letzten Schwung, und dann wippte bei jeder Bewegung, beinahe noch elastischer, noch gravitätischer als zuvor, durch die dank der Haarcreme neu gewonnene Schwere und Feuchte. Und also habe ich dann darübergestrichen, in der Hoffnung, das Büschel bändigen zu können, es mit den letzten Resten der Frisurcreme noch mit den umliegenden Haaren zu verkleben, und habe vorher schon gefühlt und gestrichen und bin mir hinterher auch noch mit der Hand durch das Gesicht gefahren: von der Stirn hinauf auf der rechten Seite meines Kopfes entlang nach hinten zum Nacken, dort, am Hemdkragen, die Frisurcremereste abwischend und von da nach vorn und einmal durch das Gesicht. Jetzt ist mir das gleich, und auch durch mein Gesicht streiche ich nicht mehr so oft: Das kenne ich ja nun, es verändert sich auch nicht mehr, wie ich hoffe. Ich sollte also schon längst bereit sein und bin es ja auch. Doch erst mache ich meine Runde fertig. Ich schiebe also meine Brille in die Haare und schaue noch mal in der Kraniologie vorbei. Es regnet, und unterwegs, im Flur, bin ich nicht sicher, ob ich das Fenster gestern Abend geschlossen habe. Dass es regnet, höre ich am Rauschen des Flusses, das zugenommen hat. Ich gehe quer durch den Raum auf das Fenster zu, unter meinen Schritten knarzt der Dielenboden, und ich höre noch etwas anderes da unten, ein regelmäßiges Glucksen und Zirpen, ein Atmen. Ich stehe am Fenster und stütze mich mit den Händen auf der Vitrine ab, die darunter steht, lehne die Stirn gegen das Fensterglas. Das Fenster ist geschlossen, und es regnet tatsächlich in Strömen: Ein brauner Strom fließt hinter der Grenze meines Fensters. Der Fluss rauscht vorüber wie ein einziger Regen, und zwischen meinen Armen, unter mir in der Vitrine, liegt der Robespierre.
Ich schaue ihn an: Auch in seinen Zügen strömt etwas, etwas blickt auf mich zurück. Hinter den geschlossenen Augen seiner Totenmaske kann ich Robespierre schauen sehen. Hinter den geschlossenen Augen des Gipsabgusses seiner Totenmaske. Wahrscheinlich ist es sogar der Abguss eines Abgusses. Ich lege mein Gesicht, die rechte Wange, auf das Vitrinenglas und fühle, wie sie breit und flach gedrückt wird, wie das Fleisch meiner Wange sich emporschiebt, als würde da etwas wachsen, und mir schließlich mein rechtes Auge verschließt. Ich mache auch das andere noch zu.
Hier, unter mir, hat etwas Form erhalten, das schon längst verloren ist, denke ich, verloren und verrottet. Hier, unter mir, liegt etwas, das nur deswegen da liegt, weil es für einen anderen verloren ging. Und auch ich werde es nicht halten können. Das ist seine wesentliche Bestimmung: für uns verloren zu sein. Hier sind bloß Spuren über Spuren gelegt worden, immer wieder aufs Neue hat sich hier jemand genähert, hat seine Hand oder ein Stück Wachs auf die Gipsmaske gelegt, ihre Spur mit sich genommen und etwas anderes zurückgelassen. Wer wohl der Erste war, der mit der hoffnungsfrohen Geste des Bewahrens nach dem rollenden Kopf griff, ihn mit einer Hand am Schopf aus der Kiste unter der Guillotine zog oder mit beiden Händen tief hinein fasste in den frischen Strom? Wie konnte er wissen, ob er den Richtigen wählte? Und trug er ihn dann nach Hause, in ein Tuch geschlagen, die blutigen Lappen mühsam unter der Jacke verbergend? Legte ihn dort auf den Tisch, schob das Brot und auch die Kerze, schob Feder und Papier zur Seite und entblößte das Gesicht, und der Schädel nickte kurz nach rechts oder links hin, eine Locke fiel über die Stirn. Das halb geronnene Blut schrieb den Bruchteil eines Kreises auf die hölzerne Platte. Wozu rettete er dieses Gesicht; wozu nahm er es, es wem zu zeigen? Hier ist etwas zur Spur geworden, was niemals eine sein sollte. Und doch sagt auch diese Maske etwas, das über sie hinausgeht, wie ein Schuhabdruck am Tatort etwa sagt sie: Da war jemand und ist weitergegangen. Hier, in der Geschichte, war jemand, hat etwas angerichtet und ist nun fort. Doch sie sagt noch mehr: Hier hat nicht nur ein Moment Gestalt gewonnen, sondern auch das, was nun nicht mehr da ist, die Bedingung dieses Moments: die Hände, die nach dem Kopf griffen, die blutigen Lappen, die hoffnungslose Geste des Bewahrenwollens, das schwere, das ganz und gar hohle Rollen und Kollern des Kopfs auf der hölzernen Tischplatte. Und sie sagt noch etwas: Meine Anwesenheit, dass ich hier liegen kann in deinem Museum, unter der Glasplatte, und du mich ansehen kannst, dass ich wirklich da bin, das verdankst du der Abwesenheit von etwas anderem: des Lebens. Das höre ich die Totenmaske des Robespierre sagen. Und was mich hier anblickt, wenn sie mich anblickt, ist gar nicht weit weg. Es könnte genauso gut ich sein, der hier wartet, unter dem Glas der Vitrine. Hier liegt mein Schicksal: dass ich sterben werde.
Ich drehe mich um. Durch den Raum und die offene Tür kann ich in den schmalen Flur blicken. Ich sehe auch den Eingangsbereich, den schwarz und weiß gefliesten Boden. Ich sehe den grünen, etliche Male lackierten Tisch, den Hocker darunter, vor dem in die offene Wand eingelassenen Glasschrank mit den wächsernen Lungen, dem Kopfpräparat eines Mannes, dem sie auch die Schultern noch gelassen haben und sonst nichts: keinen Brustkorb, keine Arme und Beine, keine Hand, sie auszustrecken, und keine Haut, sich darunter zu verbergen. Nur die Adern sind sichtbar, die Lymphbahnen und ein Paar Glasaugen und Zähne aus Porzellan. Gegenüber, an der Wand, dicht bei der Eingangstür, hängen die beiden Kupferstiche mit den Muskelmännern.