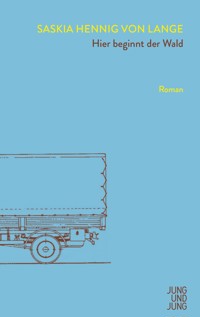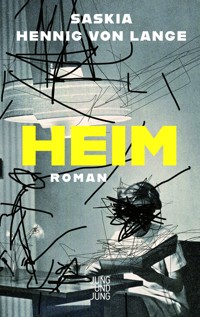
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung und Jung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte von Tilda und Willem beginnt auf offenem Meer, Mitte der 1930er Jahre. Während Tilda eine Vergnügungsreise macht, ist Willems Mission eine mörderische: Als Mitglied der »Legion Condor« ist er mit dem Schiff unterwegs nach Spanien, wo der Krieg gegen alles, was anders ist, geprobt wird. Anders ist auch Hannah, die gemeinsame Tochter, geboren als der Krieg längst vorbei ist: Wild und unbeherrschbar, lässt sie sich durch nichts zwingen, weder durch Strenge noch durch die unbeholfenen Versuche ihrer Eltern, sie zu lieben. Willem verkriecht sich im Keller des Hauses, um ungestört Jazz zu hören, nachdem er tagsüber als Chemiker daran arbeitet, künstliche Fruchtaromen herzustellen. In den Augen von Tilda ist der schneidige Held von einst eine lächerliche Figur geworden. Und Hannah eine Verrückte … »Heim« erzählt vom Ungesagten, vom Unaussprechlichen, vom langen Nachwirken der Vergangenheit und davon, wie sehr wir selbst Teil davon sind. Konsequent folgt es der beklemmenden Logik einer Familienkonstellation, eröffnet ihren Figuren aber auch Wege des Ausbruchs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HEIM
© 2024 Jung und Jung, Salzburg
Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung,
Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten
Umschlagabbildung: Vintage Victim © Micosch Holland
Umschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.com
Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-99027-309-8
Saskia Hennig von Lange
HEIM
Roman
I
1
Sie liegt neben mir. Sie schläft. Ich streiche durch die Luft, über ihren Kopf, den Nacken und den Rücken entlang, ohne sie zu berühren. Sie soll nicht aufwachen, sie soll weiterschlafen. Wenn sie schläft, ist sie ganz da. Wenn sie schläft, habe ich Mami für mich. Ich richte mich vorsichtig auf, das macht ein Geräusch. Ich atme aus. Sie bewegt sich, aus ihrem Mund kommt etwas, ein langer Atem, an dem ein Ton klebt. Ihr Haar rutscht über meinen Unterarm. Sie löst es nur, wenn sie sich hinlegt. Meine eigenen Haare sind kurz, jedes einzelne. Papa und Berti haben sie mir an Ostern geschnitten. Ich saß im Korbstuhl auf der Terrasse auf einem wackeligen Kissenberg, Papa und Berti mit Kamm und Schere um mich herum. Meine Locken fielen auf den hellen Steinboden und ich stürzte hinterher, um nach ihnen zu sehen. Ich habe mich zu ihnen auf den Boden gelegt, die Wange auf den kühlen Steinplatten, und sie mit den Außenkanten meiner kleinen Finger zu einem Haufen zusammengefegt. Aber der Haufen hat mir nicht gefallen: Da lagen nicht nur meine Haare, da war auch Staub, und da waren Grashalme und Krümel vom Kuchen, ein großes Durcheinander. Also habe ich die Haare herausgenommen und eins ans andere gelegt. Das war nicht leicht, wegen der Locken, das hat lange gedauert. Oben hat Berti immer weiter an mir herumgeschnitten, es wurden immer mehr Haare. Eine fürchterliche Unordnung. Das fand Mami auch, als sie dazukam. Mit ihrer lauten Stimme. Ich kann sie in meinem Kopf abspielen, so wie Papa im Keller seine Platten abspielt. Ich kann sie anschalten und dann hören, was sie damit gesagt hat, doch meistens lasse ich sie lieber in ihrer Schachtel. Ich mag Mamis Stimme nicht leiden. Deshalb habe ich auch nicht zugehört, als sie damit über Berti und Papa und mir herumgefuchtelt hat. Aber in meiner Kopfschachtel ist sie jetzt trotzdem, da kann man nichts machen, da kommt alles hinein. Jedes Schreien, jedes Geflüster. Alle Worte. Aber ich will sie mir nicht anhören und auch nicht an sie denken. Ich mag Mami lieber, wenn sie still ist. Wenn sie schläft. Am liebsten mag ich sie, wenn sie schläft. Neben dem Tagesbett, auf dem Fußboden, ist ein kleiner Stapel Papiere. Mamis Füller. Ich lehne mich vor und streiche darüber, ich fahre über einen der rauen Umschläge, lasse meine Hand kurz darauf liegen. Ich spüre Mamis Haare weich auf meinem Arm. Eine leichte Decke. Ein Fell. Gerade stört es mich nicht. Die Sprungfedern drücken hart gegen meine Brust, meine Hand schwitzt. Das Papier wird sich verformen, ich weiß es und nehme sie doch nicht weg. Ich sehe meine Hand und die Linien, die darunter hervorkommen. Zeichen und Striche, wie Ameisenbeine, und meine Hand ist ihr Körper. Sie wollen davonlaufen, aber ich lasse sie nicht.
Jetzt ist sie wach. Sie rührt sich nicht, ich weiß es trotzdem. Ihr Haar hängt immer noch über meinem Arm, es ist kalt und schwer. Als wäre es nass. Ich hebe die Hand. Da ist ein welliger Fleck auf dem Umschlag. Sie räuspert sich, noch steckt der Ton in ihrem Hals. Ich richte mich auf. Ich sitze auf der Bettkante zu ihren Füßen und schaue nach draußen. Das Fenster reicht bis zum Boden und ist doch keine Tür. Ich sehe die hohe Tanne, ihren großen Schatten auf dem Rasen und wie das Gras dort weniger grün ist. Zwischen jedem Grashalm die Erde. Und in der Erde Milliarden von Tieren. Milliarden winziger Körper, die ich zählen könnte und doch nicht zähle. Die ich nicht zu zählen brauche, denn ihre Zahl steckt schon in meinem Blick. Und hinter dem Baum der Zaun. Papa hat ihn gestern gestrichen, ich stand dabei. Ich hätte gerne einmal meine Hand auf den vom Lack feuchten Zaun gelegt, aber ich wusste schon, dass Mami das nicht gefallen würde. Weil es der Nachbarin nicht gefällt. Die Liege ist so schmal, Mami berührt mich, als sie die Füße an mir vorbeihebt, ihre Nylons streifen meinen Rücken. Bevor sie aufsteht, sitzt sie einen Moment neben mir. Wir sitzen nebeneinander, wir schauen beide nach draußen. Ich sehe die unscharfe Spiegelung unserer Körper im Fensterglas. Ich strecke meine Hände danach aus. Sie greift sich in die Haare, dreht sie zu einem Knoten. Sie hält ihn mit der Rechten zusammen, während sie mit der Linken nach den Haarnadeln angelt, die zwischen den Papieren liegen. Ich sehe das alles im Fenster und spüre es auch neben mir. Wie ihr Rücken sich bewegt, wie ihre Hand herumwischt, wie die Umschläge dabei über den Boden schaben, an meine Zehen stoßen. Das Sehen, das Spüren und die Geräusche, die Mami macht, vermischen sich, das ist mir unangenehm. Ich rücke ein Stück zur Seite. Als sie sich weiter nach vorn beugt, berührt sie mich mit ihrer Hüfte. Der Wollstoff ihres karierten Rocks rutscht über meine Cordhose. Jetzt steht sie schon. Das Karomuster schiebt sich vor das Bild von uns, das ich gerade noch in der Fensterscheibe gesehen habe. Die Mittagsruhe ist vorbei.
Tilda hält den Anblick kaum aus: Wie sie da sitzt, so plump und klein. Können ihre Haare nicht am Kopf anliegen, kann sie nicht den Rücken gerade halten? Tilda könnte ihr Knie da hineinbohren, in diesen Rücken, zwischen diese schlappen Wirbel, so sehr stört sie dieser Anblick, aber das gibt ja doch nur Geschrei. Und nach einer Sekunde ist sie wieder krumm. Schon wieder war Hannah an ihren Sachen, hat alles auf dem Boden verteilt. Wieso kann sie nicht in ihrem Zimmer bleiben, wenn ich schlafe? Ich habe es ihr schon tausendmal gesagt, denkt Tilda, sie hört einfach nicht auf mich. Schleicht heran, legt sich neben mich, fingert an mir herum. Tilda richtet sich auf. Ein kleiner Troll, mit ihren schwarzen Augen, den wilden Haaren. Wenn Tilda nicht aufpasst, verhext das Mädchen sie eines Tages im Schlaf. Aber sie muss sich doch auch einmal ausruhen. Sie kann doch nicht immer wach sein, Hannah nicht dauernd im Blick haben. Sie muss mit Willem reden, auf ihn hört sie. Aber der sitzt unten, im Hobbyraum, mit seiner Musik, und raucht. Merkt gar nicht, was hier oben passiert. Jetzt muss sie erst mal aufräumen und dann Hannah vom Boden weg und an den Tisch kriegen. Das wird schwierig genug. Doch es ist Sonntag und Zeit für Kaffee und Kuchen.
Mami ist in die Küche gegangen. Ich knie im Halbdunkel auf dem Holzboden vor der Liege und streiche über den hellen Überwurf. Von nebenan fällt in Streifen Licht herein, das stört mich nicht. Da sind schmale Falten in der Decke, die verschieben das Würfelmuster. Ich streiche mit dem Daumen darüber, wieder und wieder, die Falten verschwinden davon nicht. Ich versuche mit dem Daumennagel eine Reihe gerade zu halten, doch wenn ich hinten angekommen bin, ist vorne wieder alles schief. Die Decke besteht aus winzigen Karos, drei davon gehen auf die Länge meines Daumennagels. Unter die Fläche meiner Hand passen vierhundertneun ganze und einhundertneunundvierzig angeschnittene Kästchen. Diese Zahlen sind nicht aufgetaucht, halbe Sachen zählt mein Blick nicht. Ich musste den Umriss meiner Hand abzeichnen und dann die Karos zusammenrechnen. Ich habe die Zahlen in den Umriss hineingeschrieben. Mit Zahlen kenne ich mich aus. Sie hat die Decke gewaschen und wieder gewaschen, ein Schatten ist geblieben. Wenn ich meine Hand darauflege, verschwindet er. Meine Hand ist größer geworden. Ich wachse, das ist normal, sagt sie. Ich bin sieben Jahre und einhundertachtundzwanzig Tage alt. Auf der Decke sind nicht nur Karos, da ist auch noch ein anderes Muster. Das sieht man nicht leicht, nur wenn man den Kopf nach hinten legt und den Blick schräg über die Decke hält, dann sieht man es. Es ist schwierig, diesem Muster zu folgen, ich gehe dichter heran, ich beuge mich weiter nach hinten. Heran und nach hinten, heran und nach hinten. Die Liege quietscht, das Bild kommt und geht. Mit dem Zeigefinger fahre ich über das Muster, ich verliere es. Ich greife nach dem Füller, so geht es besser. »Hannah«, sie steht in der Tür und sagt meinen Namen. »Hannah, Hannah!« Sie sagt ihn immer wieder. Ich mag meinen Namen, man kann ihn in der Mitte zusammenfalten. Man kann ihn auf einen Zettel schreiben und den Zettel dann in der Mitte falten, das hat Berti mir gezeigt, ich habe es nicht vergessen. Man kann den Zettel in die Hosentasche stecken, in eine Kopfschachtel oder in den Mund. Einmal habe ich ihn hinuntergeschluckt, er ist nicht wieder herausgekommen. Ich bin fast fertig, ein blauer Strich quer über die Liege. Sie kniet jetzt neben mir, sie reißt mich an sich, sie schüttelt mich. Ich mache mich los, ich will das zu Ende bringen. Ich will auf die Liege, sie zerrt an meinem Fuß, ich bin doch gleich fertig, dann komm ich ja! Sie lässt mich nicht los. Sie ist stärker als ich, ich gebe nach. Aber ich wachse. Eines Tages bin ich so groß wie sie.
Sitzen bleiben und rauchen, eine Zigarette an der nächsten anstecken und nicht mehr aufstehen. Nur an den Aschenbecher auf dem rechten Oberschenkel denken und dass der nicht herunterfallen darf. Eine Flasche Bier auf dem Boden. Der Clubsessel ist niedrig genug, dass er an sie heranreicht, ohne sich zu strecken. Wenn alles so leicht ginge wie der Griff nach dieser kleinen Flasche, die jetzt kühl in seiner Hand liegt. Oben wieder das Gerangel. Dass Tilda das Mädchen nicht in Ruhe lassen kann! Es ist gleich vier. Eine Zigarette noch, noch ein Lied, dann gehe ich hinauf, denkt Willem.
Der Schlag sitzt noch immer auf meiner Wange, ich achte nicht darauf. Ich male den Umriss meines Fußes auf den Teppich. Der große Zeh und dann die kleineren und dann der ganz kleine, ein langer Strich und dann die Rundung der Ferse. Mit Schwung in die Wölbung und dann wieder nach vorne zum großen Zeh. Das ist nicht einfach, die Füllerspitze verhakt sich in den flauschigen Schlingen. Papa und Mami sitzen am Tisch und essen Kuchen. Ich höre die Gabeln auf den Tellern, Papas Kauen und wie die Krümel auf den Boden fallen, die Worte, die Mami nicht sagt, die sie in ihrer Kopfschachtel lässt. Und höre, wie die Schachtel über das Tischtuch schabt, als Mami sie zu Papa hinüberschiebt.
Es ist ein fürchterliches Gefummel, den Briefbogen, das Durchschlagpapier und das dünne Papier in die Schreibmaschine einzuspannen. Aber Tilda besteht darauf, dass er den Brief heute noch aufsetzt. »Ich kann nicht mehr«, hat sie gesagt, »das Kind muss weg. Die Nachbarn gucken und reden, ich traue mich nicht mit ihr hinaus. Wie sie neben mir schlingert und hüpft, wie ein kaputtes Nachziehtierchen. Doch für den Kinderwagen ist sie schon viel zu groß! Selbst in den Garten kann ich sie kaum noch lassen. Immer steht schon die Schmelzki am Zaun. Und für Hannah ist es auch besser. Besser, wenn sie unter ihresgleichen ist. Bei Menschen, die sich von Berufs wegen mit solchen Kindern auskennen.« Tilda hat die Teller zusammengeräumt und aufs Tablett gestellt und dabei geredet und geguckt, als läse sie den Text irgendwo ab. Dann hat sie sich umgedreht und ist in die Küche marschiert. Willem hat noch eine Weile am Tisch gesessen und nach draußen geschaut. Hat Kuchenkrümel auf der Tischdecke aufgeschichtet und sie wieder flach geklopft. Er mag den Wintergarten nicht, lieber sitzt er auf der Terrasse, aber Tilda fand es zu kühl heute und wozu haben sie ihn schließlich angebaut. Die Tanne ist riesig, sie macht den ganzen Garten dunkel und das halbe Haus. Wir hätten sie längst fällen sollen, denkt er, jetzt ist es zu spät, jetzt wächst sie einfach weiter. Irgendwann werden die Wurzeln das gesamte Grundstück einnehmen. Er weiß, wovon er redet, er ist Naturwissenschaftler. Der Brief muss gleich beim ersten Versuch sitzen, er fummelt das alles bestimmt nicht noch mal da rein. Wenn Berti nur hier wäre, der weiß, wie man so etwas formuliert, der hat immer die richtigen Worte parat. Unten, im Hobbyraum, könnte er wenigstens eine Zigarette rauchen beim Nachdenken. Hier oben lässt sie ihn nicht. »Das ist nicht gut für das Kind!«, sagt sie. Als würde eine Zigarette da noch etwas ausmachen. Ich muss Berti anrufen, denkt er und lässt die Finger noch eine Weile auf den Tasten der Schreibmaschine liegen.
2
Es ist unbequem, ihre Füße ragen ein Stück über die hölzerne Kante der Liege hinaus, die Hände unter dem Kopf, der Nacken schmerzt, sie lässt sie trotzdem liegen. Hannah tut irgendetwas, sie weiß nicht, was, es ist ihr egal. Hauptsache Ruhe. Doch in ihrem Kopf ist es nicht still: Noch eine Woche. Noch eine Woche, dann bringen wir sie dahin, denkt sie. Wie auch immer Willem das angestellt hat, sie haben einen Platz bekommen. Nach den Sommerferien. Und jetzt ist der Sommer fast vorbei. Sie hat den Brief nicht gelesen und auch das Antwortschreiben nicht. Darum soll Willem sich kümmern, wenigstens darum, sie hat Tag für Tag genug mit Hannah zu tun. Willem hat ihr die Papiere auf den Schreibtisch gelegt, und Tilda hat sie in die rote Mappe gesteckt, zu allem anderen. Zu den Briefen und dem schmalen Tagebuch aus der Zeit, als sie Willem kennengelernt hatte, als alles sich noch neu anfühlte und gut. So gut, dass sie dachte, es lohnt sich, das aufzuschreiben. Die Telegramme mit den Glückwünschen zur Geburt liegen auch darin. Sie kennt sie auswendig, sie tauchen vor ihr auf, die großen, bunten Karten mit den hübschen Babyzeichnungen darauf, den fröhlichen Texten. Sie erinnert sich an jeden einzelnen, die Worte mischen sich unter das Gebrabbel und Stöhnen von Hannah: Dem goldigen Baby viel Glück auf seiner Weltreise. Neben ihr röhrt Hannah. Wir wünschen herzlich Glück zur Hannah und für die Zukunft das Beste. Tilda rührt sich immer noch nicht. Herzliche Glückwünsche zur Geburt des Töchterleins stop Alles Glück wünscht Familie E. stop. Diese Worte haben längst keine Bedeutung mehr. Es ist ihr Kopf, der sie abspult, ganz von selbst, ohne Tildas Zutun. Einen herzlichsten Glückwunsch zur Ankunft der kleinen Hannah. Und immer so weiter. Die Mappe hat sie zum Abitur bekommen, mitten im Krieg, rotes Leder mit Messinginitialen. Wo Vati die wohl herhatte? Da hinein hat sie die beiden Briefe getan. Auf den Bericht vom Arzt hat sie sie gelegt, zu dem Mutti Hannah geschleppt hat, als sie schon eineinhalb war und noch immer nicht sitzen wollte. Als schon alle wussten, dass etwas nicht stimmt. Nicht stimmen konnte. Willem vor allen anderen. Tilda hat es nicht hören wollen und will es noch immer nicht hören. Sie hat Hannah süß finden wollen und lieb haben. Zum Anbeißen süß wollte ich sie finden, denkt Tilda, doch sie ist nicht süß. Und das war sie auch damals nicht. Ich habe sie trotzdem auf dem Arm halten und an ihr riechen wollen. An ihrem Haar, in ihrer Halsbeuge, hinten im Nacken, selbst zwischen ihren kleinen Zehen habe ich riechen wollen. Anfangs hat sie sie nachts mit ins Ehebett genommen, obwohl Mutti gesagt hat, sie solle das nicht, auf keinen Fall. Tilda hat es trotzdem gemacht, ganz nah wollte sie bei ihrem Baby liegen, doch Hannah hat sich gesträubt, völlig steif ist sie neben ihr geworden. Sie hat mich nicht haben wollen, von Anfang an hat sie mich nicht haben wollen. Noch eine Woche, denkt Tilda, dann ist sie weg. Dann sehen wir sie nur noch in den Ferien.
Ich liege unter der Tanne und höre dem Boden zu. Wie meine Haare durch das Gras streifen, wenn ich den Kopf drehe. Ich spüre den Unterschied zwischen den Tannennadeln, den Grashalmen und meinen Haarspitzen, die mich im Nacken kitzeln. Mami findet sie zu lang, die Haare, wir müssen sie schneiden. Am Sonntag kommt Berti, das sind noch achttausendfünfhundertzweiunddreißig Minuten, und danach bin ich weg. Wenn ich meine kurzen Haare wiederhabe, dann bin ich weg von hier. Ich weiß nicht, wo ich dann bin, Mami hat gesagt, dass da auch andere Kinder sind. So welche wie ich. Ich bin lieber allein mit den Sachen. Oder mit Papa. Zur Not auch mit Berti. Noch achttausendfünfhunderteinunddreißig Minuten. Mami hat nicht gesagt, ob es da auch eine Mami gibt. Dann muss ich für die noch eine Kopfschachtel anfangen. Hoffentlich hat die Mami dort nicht so eine Stimme. Ich rupfe Grashalme aus und lege einen an den anderen. Ich bin schon einmal quer durch den Garten und wieder zurück. Eine feine Linie. Manche Halme sind heller, manche haben dünne, bräunliche Streifen. Ich muss sie noch mal ordnen, so kann das nicht bleiben. Ich sammle sie ein und lege sie auf die Terrasse. Die hellen zu den hellen, die dunkleren zu den dunkleren.
Wie sie durch den Garten hopst, wie ein verletztes Fohlen, wie ein schadhaftes Kalb. Tilda steht am Fenster und würde sich lieber abwenden. Zu groß der Kopf und die Glieder durcheinander. Und was sie mit dem Gras wieder anstellt! Ihr wäre lieber, Hannah bliebe drin, aber Willem meint, die frische Luft tut ihr gut. Und bald ist sie ja weg. Die Schmelzki hat erst letzte Woche gefragt, ob sie überhaupt in die Schule kommt, sie sei doch schon über sieben, wenn sie richtig gerechnet habe. Natürlich, hat Tilda geantwortet, natürlich kommt Hannah in die Schule, wieso auch nicht. Auf ein Internat wird sie gehen, hat sie noch hinzugefügt, die Schulen hier sind nichts. »Soso«, hat die Schmelzki bloß gesagt. »Ein Internat. Soso.« Und dann: »Das wird sicher teuer. Wer zahlt das denn?« Tilda hat sie am Zaun stehen lassen und ist ins Haus gegangen. Es geht die Schmelzki nichts an. Nicht, wo Hannah hingeht, nicht, wer das bezahlt. Und es stimmt doch, die Schulen hier sind nichts für sie. Sie haben es ja versucht, bei allen Grundschulen in der Gegend sind sie gewesen, überall das Gleiche. Nein, nein, ein Kind wie Hannah können wir nicht aufnehmen. Einer der Direktoren ist sogar richtig wütend geworden. Was sie sich dächten! Er hat die Akte zugeschlagen. Mit so einem Kind zu kommen! Vor zehn Jahren wären solche Fragen noch ganz anders beantwortet worden. Da ist Willem aufgestanden, hat sich, beide Hände auf dem Schreibtisch des Direktors abgestützt, zu ihm hinüber gebeugt und ihn gefragt, ob er denn vor zehn Jahren auch schon Grundschuldirektor gewesen sei oder was er da so gemacht habe. Dann hat er alles, was auf dem Schreibtisch des Direktors lag, hinuntergefegt. Mit einer einzigen, großen Bewegung. Hannah ist aufgesprungen, Willem hat sie auf den Arm genommen und Tilda an die Hand, das hat er lange nicht gemacht. Gemeinsam haben sie diese Schule verlassen.
3
Berti ist da. Zum Glück, ich wüsste nicht, wie ich den Tag sonst durchstehen sollte, denkt Willem. Berti hat immer die richtigen Worte parat. Und er weiß auch, wann er schweigen muss. Berti hat an Hannah nichts auszusetzen. Sie ist eben ein Kind, sagt er. Das eine ist so, das andere anders. Ob er auch so reden würde, wenn sie sein Kind wäre? Wenn sein Stefan so wäre? Tilda sagt gar nichts mehr. Sie hat gepackt, der Koffer steht in Hannahs Zimmer. Seit ein paar Tagen schon. Jedes Mal, wenn ich in ihr Zimmer kam, um ihr gute Nacht zu sagen, hat er mich angeschaut, der Koffer, denkt Willem, und das tut er immer noch. Er hätte ihn gern geöffnet und alles zurück in den Schrank geräumt. Die kleinen Blusen und Hemden, die Pullover und winzigen Strümpfe. Die Unterwäsche. Die Latzhosen. Wieso hat sie eigentlich keine Röcke, sie ist doch ein Mädchen. Sie hat keinen einzigen Rock. Vielleicht würde sie es mögen, wie so ein Rock um ihre Knie flattert, wenn sie springt? Was weiß er schon von Röcken und wie man sich darin fühlt. Aber sie hat keinen. Er sitzt in Hannahs Zimmer, auf der Bettkante, die Hand am Koffergriff. Er schaut auf den Koffer und dann zum Fenster hinaus. Überall ist es dunkel, überall ist diese verdammte Tanne. Was wird hier noch sein, wenn Hannah weg ist? Willem steht auf und legt den Koffer aufs Bett. Er hat das nicht zu entscheiden.
Ich sitze auf Bertis Schoß, und Papa schneidet mir die Haare. Ich würde lieber auf dem Korbstuhl sitzen, doch Papa meinte, das sei zu wackelig, da schneidet er am Ende daneben oder mir ein Ohr ab. Und ich soll doch schön sein. Für die Schule. »Schule« ist ein anderes Wort für das, wohin sie mich bringen. Ich weiß immer noch nicht, wo das ist, wo ich dann bin, ich habe das alles in die Weg-Schachtel gesteckt. Still und stetig will ich werden, leis und lieblich, flink und fein, um mit Mut ein Mensch zu werden, und mit Maß ein Mensch zu sein. Ich habe den Spruch gelernt und kann ihn aus der Kopfschachtel holen, nur über meine Lippen bringe ich ihn nicht: In mir klingt er wunderbar vielfältig, jeder Buchstabe hat seinen Platz und seinen eigenen Klang. Wie ein Gedicht. Wie ein Lied. Ich sehe in Papas Gesicht, dass es für ihn nicht so klingt, dass er nicht hören kann, was ich höre. Berti auch nicht und Mami schon gar nicht. Und doch muss ich es singen, dieses Lied, denn es durchströmt meinen ganzen Körper. Es bleibt nicht, wo es bleiben soll, es ist schon längst nicht mehr in der Schachtel, es bewegt sich draußen, wie die Zahlen. Dieses Lied ist eine schöne Schlange, auf die ich meine Hand legen, die ich lang ziehen kann. Ich kann es hin und her drehen, dann rührt es sich leise und knirscht ein bisschen dabei. Ich kann es ausdehnen oder zu einer winzigen Murmel rollen, dann passt es ganz in meine Hand. Oder in meinen Mund. Ich schlucke das Lied hinunter und lasse es wieder raus. Ich kann es mir um den Hals wickeln und es eine Weile mit mir herumtragen. Ich könnte es unter Mamis Kopfkissen schieben, aber ins Schlafzimmer darf ich nicht. Vielleicht hat Mami gar kein Kopfkissen. Auf der Liege im Arbeitszimmer schläft sie immer ohne. Dann müsste ich das Lied direkt unter ihren Kopf quetschen. Das würde sie bestimmt nicht mögen.
Schon wieder dieses Gebrabbel, denkt Tilda, seit Tagen nichts anderes. Seitdem Tilda Hannah den Spruch vorgelesen hat, gibt es für sie nichts anderes mehr. Sie hätte das nicht tun sollen, sie hätte es sich denken können. Sie hätte ihn ihr erst auf der Fahrt sagen sollen. Man kann es ohnehin kaum verstehen. Ein einziges Gestöhne und Gestammel. Ein Gemurmel, das von allein spricht. Ein paar Wortfetzen dazwischen. »Mutamensch, Mutamensch.« Willem und Berti machen ihre Scherze, »Mutamensch, Gutamensch!«, singen sie, und Willem lässt Hannah auf seinem Schoß auf und ab springen. Tilda kann es kaum noch aushalten. Ich bin froh, wenn das aufhört, denkt sie.
4
Sie sind doch zu dritt gefahren. Willem sitzt am Steuer, Hannah juckelt hinten herum. Sie mag das Autofahren eigentlich, aber dieser Weg ist lang. Die ganze Zeit leiert sie den Spruch herunter, und Willem summt dazu. Als wäre es ein Lied. Als wäre das ein Ausflug. Als wäre hier irgendetwas schön, denkt Tilda und richtet den Blick nach draußen. Willem hat zu singen begonnen: »Still und stetig will ich werden, leis und lieblich, flink und fein.«
Ich würde am liebsten immer weiterfahren, geradeaus und nicht anhalten, denkt er. Was tun wir hier? Bringen unser Kind fort. Unser einziges. Ein weiteres Kind wird es nicht geben, das hat Tilda deutlich gesagt. Und wenn sie gewusst hätte, was Hannah für ein Kind wird, dann würde es auch Hannah nicht geben, auch das hat Tilda gesagt. Aber wir haben das nicht gewusst, konnten das nicht wissen. Ich bin Naturwissenschaftler und Organiker, ich stehe den Problemen nicht unwissend gegenüber, denkt er. Das lässt sich machen. Irgendwann wird man solche Dinge schon vor der Geburt herausfinden können. »Still und stetig will ich werden, leis und lieblich, flink und fein.«
Ich sitze hinter Papa. Ich streiche über seinen Nacken. Er kann meine Hand nicht wegschieben, er muss das Lenkrad festhalten. Seine Haut ist zart, mit kleinen Pickelchen da, wo die Haare herauswachsen. Ich schaue lange hin, die Zahl taucht nicht auf zwischen den Kopfschachteln. Da ist nur das Lied. »Mutamensch, Mutamensch!« Wir fahren schon ziemlich lange.
Hannah brummelt ihr Sprüchlein. So ein trauriges Sprüchlein, und so falsch. Willem macht trotzdem mit. Er singt die Melodie, ihr Gebrumme gibt den Takt vor. Es macht ihr Spaß, es macht es ihr leichter. Vielleicht ist es für sie gar nicht schwer. Für Tilda schon, das spürt er, obwohl sie nichts sagt. Hannah trällert unbekümmert vor sich hin. Zupft dabei in seinem Nacken und an sich selbst herum. Als wären mein Körper und ihr eigener, als wären unsere Körper ein Instrument, denkt Willem, zupft sie und reißt an mir und an sich selbst herum. Eine Gitarre, ein Kontrabass. Sie singen jetzt zusammen, »Still und stetig, leis und lieblich«, »Mutamensch, Mutamensch!«, und Willem hat begonnen, auf dem Lenkrad zu trommeln, mit beiden Händen. Hannah haut ihm auf den Kopf dabei. Sie hüpft auf der Rückbank auf und ab und haut ihm auf den Kopf. Es rumst im Rhythmus seines Trommelns, wenn sie mit dem Kopf gegen das Wagendach donnert, wenn ihre kleinen Hände auf seine Glatze schlagen. »Mutamensch, Mutamensch!« Sie werden immer schneller, Willem hat das Seitenfenster heruntergekurbelt und schreit nach draußen. »Flink und fein, Mutamensch!« Er schlägt mit der Linken von außen auf das Wagendach, Hannah rumst von unten dagegen. Sie schreit und quiekt. Der Wagen schlingert. Tilda hält sich die Ohren zu. Willem hört, dass auch sie zu schreien begonnen hat. Sie schreit, sie schreien und singen jetzt alle zusammen.
Tilda und Willem haben Hannah eine Weile nachgeschaut. Tilda stand noch da, beide Hände am Gitter des Tors, den Blick über den weiten Vorplatz, als Hannah an der Hand der Schwester schon längst in der Villa, mehr ein Schloss, mehr eine Burg als eine Villa, als sie schon längst in dieser Festung verschwunden war. Die Schwester trug den Koffer und Hannah hüpfte und schlingerte neben ihr, ab und an schlug sie sich auf den Kopf. Willem tappte mit dem Fuß auf den Kiesboden. Die Hände in seinen Hosentaschen zuckten. Die Schwester hatte schon am Tor gestanden, als die drei ankamen. »Herr Brandes meint, sie sollten sich heute hier verabschieden, das macht die Trennung leichter«, sagte sie und öffnete das Tor gerade so weit, dass Willem den Koffer hineinreichen und Hannah hindurchschieben konnte. Dann schloss sie es wieder. Tilda und Willem blieben davor. Sie haben Hannah noch eine Weile nachgeschaut, durch das Gitter.
5
Sie liegt mit dem Gesicht zur Wand. Die Augen geschlossen. Eine Hand unter dem Kissen, die andere zwischen ihren angezogenen Knien. Sie atmet flach, sie wagt nicht, sich zu bewegen, nicht einmal ihre Hand auf den glatten Laken. Alles um sie herum schaukelt, dreht sich. Sie befindet sich auf einem schlingernden, trunkenen Boot. Ich bin ruhig in diesem Gewoge, denkt sie. Ich bleibe ruhig. Ihr Kopf oben auf dem Kissen beschwert die Hand darunter, so kann sie nicht herausrutschen, nicht aus dem Bett und über den Bettrand auf den schwankenden Boden fallen. Sie könnte durch ihn und alles, was darunter ist, Teppiche, Holzböden, durch die Zeit könnte sie rutschen, ihre Hand, bis in den Maschinenraum hinein und durch ihn hindurch. Sie könnte ins Meer stürzen. Sie mag die Augen nicht öffnen. Sie mag dem Schwanken nicht nachgeben. Sie will es aushalten, bis es vorbei ist. Bis sie es nicht mehr aushalten kann. Und dann auch das aushalten. Einfach liegen bleiben und aushalten, dass sie hier liegt und noch mindestens zehn Tage und Nächte liegen muss, ob sie das nun will oder nicht. Vielleicht ist sie gar nicht mehr auf diesem Schiff. Vielleicht ist sie längst alt und tot und von aller Welt vergessen. Vielleicht ist sie ins Meer gefallen. Nicht nur ihre Hand, die ganze Tilda, mit ihrem ganzen Körper. Dem Morgenmantel überm Nachthemd und dem Kissen unterm Kopf. Treibt im Wasser, wenn sie die Augen öffnete, sähe sie Fische. Und wie sie sie anglotzen. Vielleicht atme ich nur deshalb, weil ich die Augen geschlossen und mich damit an der Vorstellung festhalte, ich läge immer noch in meinem Bett, denkt sie. Unter ihr Gerda, in der Kabine nebenan die Eltern. Wie kann ich sicher sein, dass nicht alles verschwindet, wenn ich die Augen öffne, um es anzuschauen. Wie kann ich sicher sein, dass ich auch dann da bin, wenn ich mich selbst und die Teile meines Körpers, die sich normalerweise in meinem Sichtfeld befinden, nicht sehe. Meinen Brustkorb, wie er sich hebt und senkt, die Schultern mit den Armen daran, der Bauch und die Beine. Die schmalen Hände und Füße. Wie kann ich wissen, dass mein Gesicht noch da ist, wenn ich es nicht im Spiegel betrachte. Dass es nicht nur aus meinem Blickfeld, sondern überhaupt verschwindet, wenn ich die Augen schließe. Dass das alles noch da ist und ich mir meinen Körper und seine Glieder nicht bloß herbeidenke. Dass das Gewicht auf dem Kissen und auf meiner Hand darunter nicht ein Stein ist. Oder ein toter Fisch. Sondern mein eigener Kopf.
Das Schaukeln nimmt kein Ende. Tilda ist jetzt draußen, auf dem Meer. Sie umklammert den Schiffsrand, oder ist es ihre Hand, die das Schiff auf dem Wasser hält? Was, wenn sie losließe? Etwas rauscht herunter, schlägt hart auf. Sie liegt zusammengekauert auf dem Boden. Jemand fasst sie am Arm, neigt sich über sie. Etwas schlägt in ihr Gesicht. Tilda öffnet die Augen, kann aber nichts erkennen mit dem Laken über dem Kopf.
»Was fuhrwerkst du denn hier so herum, Tildchen? Hattest du einen Albtraum? Ich habe prima geschlafen. Und geträumt. Dieses Schaukeln ist richtiggehend einschläfernd.« Gerda sitzt neben ihr, in eine Bettdecke gewickelt, schiebt Tilda ihre warmen Füße unter die Schenkel, rüttelt an ihrer Schulter. Kann ihre Schwester sie nicht einmal in Ruhe lassen mit ihrem endlosen Geplapper! Schon geht es weiter. »Na, was soll es. Wenn wir schon auf sind, können wir ja in Ruhe das Schiff erkunden, bevor Mutti und Vati wach werden. Vielleicht gibt es ein paar fesche Matrosen hier.« Es ist also noch vor halb sieben, die Wecktrompete hätten sie sicher nicht überhört. Die wurde ihnen gestern vorgeführt. Als wäre das nötig! Gerda schiebt ihre Zehen noch etwas tiefer in Tildas Fleisch. Ihre langen Zöpfe streifen hart über ihr Gesicht, die von Tilda sind zum Glück schon ab. Sie reibt mit dem Hinterkopf über die Bettkante. Sie hätte gerne eine Kabine für sich allein. Sie verschränkt die Hände im Nacken. Fesche Matrosen, wenn sie das schon hört! Gerda kann an nichts anderes denken, aber wehe, ein solcher Matrose taucht auf, dann kriegt sie den Mund nicht auf und Tilda muss ran. Sie schiebt sich weiter nach oben, lehnt mit dem Rücken am Stockbett. Ich bin offenbar herausgefallen, denkt sie. Trotz der Absturzsicherung. Das fängt ja gut an. »Na, komm schon«, Gerda zerrt an ihrem Ellenbogen, »zieh dich an!« Was soll es. Ein Gang über das Schiff ist allemal besser, als weiter in der muffigen Kabine zu hocken. Wenn man doch wenigstens das Bullauge öffnen dürfte.
Es ist noch nicht mal sechs Uhr, als sie an Deck ankommen. Außer ihnen ist niemand unterwegs, auch aus der Kabine der Eltern war noch nichts zu hören. Kaum zu glauben, dass über tausend Passagiere an Bord sind, aber sie hat sie ja gesehen, gestern, als sie sich eingeschifft haben. Und später, bei der Ansprache vom Kapitän auf dem Vorderdeck. Bei der Wecktrompetendemonstration. Wie sie alle den Arm emporgerissen haben! Tilda natürlich auch. Sie war auch in dieser Masse. Dicht an dicht, einer neben dem anderen. Überall Geschiebe und Gedränge. Jeder will nach vorne, jeder will den besten Platz haben. Außer Tilda scheint das niemanden zu stören, Gerda schon gar nicht. Die kommt in einer solchen Menge erst richtig zu sich. Da hört dir immer jemand zu, und immer hast du irgendjemandes Ellenbogen in deiner Seite, eine fremde Hand auf der Schulter, eine andere Hüfte an deiner. Selbst in den Speisesälen: Die Tische sind winzig, man kann kaum essen, ohne jemandem ins Gehege zu kommen. Sechs Mann pro Tisch. Gestern saß ein kauziges Ehepaar bei ihnen, Herr und Frau Meckel. Die Frau hat in einer Tour geredet, wie schön das Schiff ist und das köstliche Essen, die geräumigen Kabinen und dass wir das alles dem Führer zu verdanken hätten und dass der Führer bei einer Fahrt der Robert Leysogar einmal an Bord aufgetaucht sei, einfach so, zwischen den ganzen Leuten, ein echter Mensch eben, und ob er sich hier auch einmal zeige, vielleicht sei er ja schon da und trete gleich, im nächsten Moment, durch die Tür des Speisesaals, und was sie dann tun solle, ob sie aufstehen sollte, auch wenn die Gefahr bestehe, dass sie dann in Ohnmacht falle, ob man danach überhaupt noch weiteressen könne, vor lauter Ehrfurcht und Begeisterung. Da hat selbst Gerda geguckt. Die beiden bleiben ihnen wohl für den Rest der Reise. Da sind keine privaten Worte mehr möglich, doch die sprechen sie ohnehin kaum. Aufs Zimmer mitnehmen darf man seine Mahlzeiten auch nicht, außer man ist krank. Dann lieber nichts essen. Tausend Leute auf so einem kleinem Raum, was soll daran Urlaub sein oder Erholung? Wo soll da die Freude herkommen? Aus einer solchen Menschenmasse kann doch niemand Kraft schöpfen.
Die schlafen alle noch. Oder kotzen. Liegen in ihren Betten und trauen sich nicht heraus, wagen es nicht einmal, sich umzudrehen. Gut so. Hier oben ist es ruhig. Hier ist es besser, der Schwindel ist weg. Tilda schaut über die Reling, das Meer ist so weit unten. Der Wind fährt in ihre Bluse und durch die Haare, sie lehnt sich nach vorn, das Geländer drückt hart in ihren Magen. Sie hat keinen Hunger. In ihrem Rücken plappert Gerda, die kann einfach nicht still sein. Kann ihre Gedanken nicht für sich behalten. Tilda hört nicht hin. Am liebsten würde sie ihre Hand für einen Moment ins Wasser halten, aber es ist so weit weg, bestimmt fünfzehn Meter. Sie streckt den Arm aus, beugt sich noch ein Stück weiter nach unten. Gerda lehnt sich von hinten an sie, und in dem Moment ertönt die Wecktrompete. Gerda krallt sich an ihr fest, etwas zerreißt. Sie wären beinahe über die Reling gefallen. Tildas Bluse ist hin.
Sie hat ihr blaues Kleid angezogen, das ist eigentlich für abends, aber was soll es. Sie spürt Gerdas begehrliche Blicke, aber das ist ihr Kleid, Gerda wird da sowieso nie reinpassen. Vati verträgt die Reise auch nicht. Tilda sieht es ihm an, obwohl er sich zusammennimmt. Er isst nur ein bisschen Haferschleim und trinkt Tee. Ich bleibe beim Kaffee, denkt sie, aufs Essen verzichte ich vorsichtshalber. Mutti und Gerda haben sich schon die zweite Portion Rührei aufgeladen und unterhalten sich mit Frau Meckel. Die drei passen gut zusammen. Herr Meckel sagt auch nicht viel, wie soll er auch. Außerdem ist er Lehrer, das hat er ihnen gleich gestern Abend eröffnet, der hat in seinem Beruf genug zu reden, da hält er in den Ferien wohl lieber den Mund. Eben erzählt die Meckel, dass es heute Abend einen Kostümball gibt, dass sie als Leopard gehen wird. Mutti und Gerda sind ganz aufgeregt. Ein Kostümball, das wussten sie gar nicht, was sollen sie bloß anziehen! Ein Kostümball, auch das noch. Wenn es nicht so schrecklich schaukeln würde, würde sie am liebsten in der Kabine bleiben. Doch das überlebt sie nicht.
Die anderen sind schon weg. Gerda hat ihr das blaue Kleid abgeschwatzt, hoffentlich reißt es nicht. »Na, was sagst du?« Sie hat den Bauch eingezogen, sich hin und her gedreht, mit ihrem grünen Seidenschal um den Kopf und Muttis Granatkette an der Stirn. »Was soll das sein?«, hat Tilda ihre Schwester gefragt, und schon war Gerda beleidigt, hat sich die Stola geschnappt und die Tür hinter sich zugeknallt. Ihr empörter Ruf hallte durch den Gang: »Ich bin eine morgenländische Prinzessin!« Nun gut. Tilda jedenfalls kriegen keine zehn Pferde auf diesen Ball. Wer will denn schon tanzen bei diesem Geschaukel? Da geht sie lieber noch eine Weile an Deck, Meerluft atmen, sich für die Nacht wappnen. Als sie oben ankommt, steht da schon einer. Sie will unbemerkt die Treppe wieder herunter, zu spät, er hat sie gehört und dreht sich um. Sein Gesicht liegt im Dunkeln, Tilda erkennt ihn trotzdem. Sie hat ihn gestern schon gesehen und heute beim Mittagessen. Sie weicht einen Schritt zurück und geht dann doch auf ihn zu, greift mit der rechten Hand nach der Reling. Er lächelt mit halb geschlossenen Augen. Lange Grübchen ziehen sich über seine Wangen, eine dunkle Haarsträhne fällt ihm in die hohe Stirn. Er streicht sie nicht zurück. Er ist ein bisschen kleiner als Tilda, aber er gefällt ihr trotzdem.
6