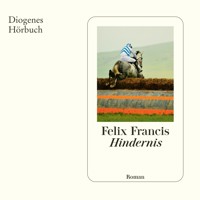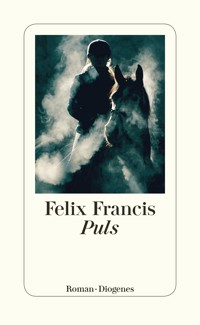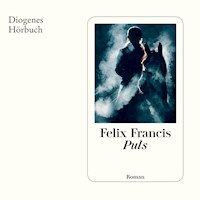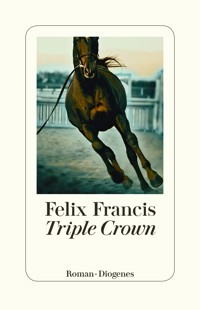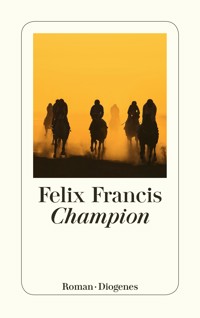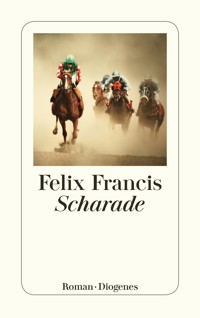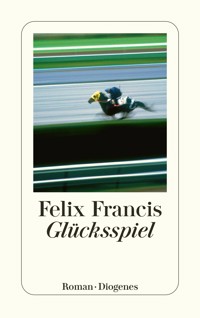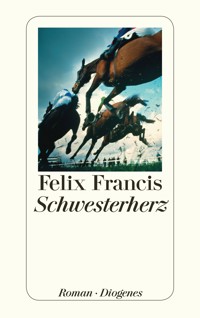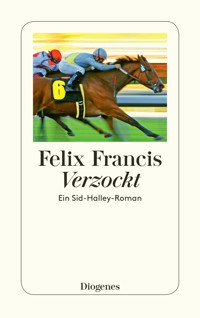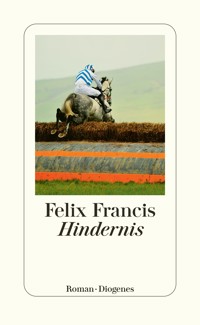
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Harrison Foster ist Anwalt. Bei einer Londoner Beraterfirma hilft er gut betuchten Klienten, ihre Krisen so zu meistern, dass sie sie nicht die Reputation kosten. Als das Rennpferd eines saudi-arabischen Kronprinzen bei einem Stallbrand in Newmarket getötet wird, fordert der Scheich Foster zur Aufklärung an. Foster tauscht die Budapester gegen Gummistiefel und wird fündig: In der Ruine des Stalls liegen nicht nur ein Tierkadaver, sondern auch menschliche Überreste.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Felix Francis
Hindernis
Roman
Aus dem britischen Englischen von Malte Krutzsch
Diogenes
Für meine Enkeltochter
Sophie Elizabeth Francis
geboren im Juni 2018
Mit herzlichem Dank an
Merrick Francis, Vorsitzender der Lambourn Trainers’
Association, Matt Bosworth, Rechtsanwalt und Krisenmanager, sowie die Trainer und anderen überaus hilfsbereiten Leute in Newmarket.
Und an meine Frau Debbie, in Liebe.
Bei einer Auktion im Rahmen des
»Guineas Balls« 2018 in Newmarket wurde ein
Los versteigert, das den Meistbietenden einen
Platz in diesem Buch sicherte. Der Gesamtertrag
ging der Stiftung für verletzte Jockeys zu,
insbesondere dem Peter O’Sullevan House als
neu entstehendem Rehabilitationszentrum der
British Racing School in Newmarket.
Da Mrs Michelle Morris das Los
ersteigerte, finden sie und ihr Mann Mike
sich auf diesen Seiten wieder.
Alle anderen Personen sind erfunden.
1
Mai 2018
Meine Visitenkarte wies mich als Harrison Foster, Rechtsberater, aus, doch allgemein bekannt war ich als Harry, spezialisiert auf Krisenmanagement.
Und bei der aktuellen Krise ging es um Mord, auch wenn das damals niemand wusste.
»Newmarket!«, sagte ich. »Von Pferderennen hab ich doch keine Ahnung. Die widern mich an, ich beteilige mich ja noch nicht mal an der Betriebswette zum National.«
»Egal«, antwortete ASW. »Sie kennen sich im Geschäftsleben aus, und Sie werden gebraucht.«
ASW war Anthony Simpson-White, Gründer, Vorstand, Geschäftsführer, Eigner und die treibende Kraft hinter dem Beratungsunternehmen Simpson White, mein alleiniger Chef, und er stand dicht vor meinem Schreibtisch an der Tür.
»Kann’s nicht einer von den andern machen? Rufus ist doch ein Pferdefan. Er trägt sein halbes Einkommen zum Buchmacher.«
ASW schüttelte den Kopf. »Rufus sitzt in Italien bei den Weinhändlern fest. Sie sind mein bester verfügbarer Mann.«
Mein Blick schweifte über die anderen Schreibtische im sogenannten Einsatzraum. Alle waren unbesetzt. Selbst am Montagmorgen war ich der einzige verfügbare Mann.
»Außerdem«, sagte er, »hat der Kunde ausdrücklich Sie verlangt.«
»Oh«, sagte ich ein wenig überrascht. »Wer ist denn der Kunde?«
»Steht alles im Dossier. Das maile ich Ihnen unterwegs. Nehmen Sie einen Schnellzug von King’s Cross nach Cambridge.«
»Nicht nach Newmarket?«, fragte ich.
»Cambridge ist besser. Da müssten Sie sowieso in den Regionalzug umsteigen. Ich sehe zu, dass Georgina Ihnen einen Wagen mit Fahrer schickt.«
Georgina war seine persönliche Assistentin: vierundfünfzig, geschieden, zwei erwachsene Söhne, immer schick, aufgeweckt und guter Dinge. Außerdem war sie ASWs Geliebte, auch wenn sie beide das nie zugegeben hätten. Wir Mitarbeiter wussten es. Klare Sache. Der Chef sagte uns ja immer wieder: »Ich erwarte von meinen Leuten, dass sie alles über jeden wissen.«
»Welcher Stall in Newmarket?«, fragte ich.
»Auch das steht im Dossier. Ich lasse Ihnen von Georgina ein Zimmer buchen. Und jetzt mal los, Harry, seien Sie so gut.«
Ungeachtet des freundlichen Tons war das keine Bitte, sondern ein Befehl. Sofort klappte ich das Laptop auf dem Schreibtisch zu, stand auf, zog meine Jacke an und holte meinen für die sofortige Abreise in jeden Teil der Welt wetterunabhängig vorgepackten Koffer aus dem Schrank in der Ecke.
Das Packen war mit das Erste, was neue Mitarbeiter bei Simpson White zu lernen hatten. Vor allem musste der Koffer in die Handgepäckablage eines Fliegers passen – das Warten an der Gepäckausgabe kostete Zeit, die sinnvoller mit dem Kunden verbracht werden konnte.
Zwei frische Hemden, Unterwäsche zum Wechseln, Waschzeug, Bürste, Rasierer, Ladegeräte für Handy und Laptop waren unerlässlich, Chinos, Turnschuhe und ein Polohemd optional, Shorts und Badesandalen verpönt. Die Mitarbeiter hatten in Anzug und Krawatte Dienst zu tun, damit sie beides nicht erst einzupacken brauchten.
Mein Koffer enthielt zusätzlich einen kleinen Verbandskasten (minus Schere), eine Badehose und einen zusammengerollten kleinen Union Jack.
Auch der konnte immer mal nützlich sein.
Alles, was sie sonst noch brauchten, sollten sich die Mitarbeiter »am Einsatzort« kaufen, wie ASW es nannte, und dafür stand uns eine Firmenkreditkarte zur Verfügung, wenn auch die Notwendigkeit der Ausgaben genau geprüft wurde.
Nicht, dass Simpson White gegenüber seinen Angestellten geknausert hätte. Ganz im Gegenteil. Auf Langstreckenflügen reisten die Mitarbeiter in der Business Class, um bei der Ankunft ausgeruht und sofort einsatzbereit zu sein, und auf einen bequemen Wagen mit Fahrer konnten sie ebenso selbstverständlich zählen wie auf die Unterbringung in einem Vier- oder Fünfsternehotel.
»Mein Stab muss frisch sein«, pflegte ASW zu sagen und bat seine Kunden entsprechend zur Kasse.
Anthony Simpson-White, Oberst a.D., hatte die Simpson White Consultancy Ltd Mitte der 1990er-Jahre aufgebaut, unter anderem mit dem Geld aus seiner Abfindung nach achtzehn Jahren vorbildlichen Dienstes beim britischen Militär. ASW war jedoch kein kämpfender Soldat gewesen, sondern Anwalt. Er hatte als leitender Offizier in der Rechtsabteilung der Armee gedient und Premierminister wie auch das Oberkommando in Fragen des Militärrechts und des internationalen Rechts beraten, unter anderem bei den britischen Kriegen im Südatlantik, im Persischen Golf und in Bosnien.
»Die meiste Zeit habe ich den hohen Tieren verklickert, was sie eigentlich nicht hören wollten«, meinte er einmal zur Erklärung, warum er schließlich den Dienst quittiert hatte, obwohl er als künftiger Generalintendant der Heeresrechtsberatung im Gespräch gewesen war. »Viel geändert hat sich für mich ja nicht«, hatte er lachend ergänzt, »außer dass mir die hohen Tiere meinen Rat jetzt besser bezahlen.«
Angefangen hatte er als Ein-Mann-Unternehmen. In finanzielle oder betriebliche Schwierigkeiten geratene Firmen bekamen seinen Rat oder seine Einschätzung genauso strikt und unverblümt vorgesetzt wie zuvor das Verteidigungsministerium. Auch den Firmenlenkern schmeckte vielleicht nicht, was sie zu hören kriegten, aber er hatte die unheimliche Gabe, ohne Umwege zum Kern eines Problems vorzustoßen, ehe er den Rettungsanker präsentierte, ob genehm oder nicht. Die Firma konnte dann selbst entscheiden, ob sie seiner Empfehlung folgte – ob sie durchkam oder unterging.
Und ASW war keiner, der untätig herumstand und schwieg, wenn er sein Einschreiten für sinnvoll hielt. Ein Lieblingsspruch von ihm hieß: Was ändert es, ob du gelebt hast, wenn du im Leben nichts bewirkst?
Im Lauf der Jahre war sein Unternehmen ebenso gewachsen wie sein Ansehen, sodass er jetzt über zehn Mitarbeiter wachte und Kollegen elf und zwölf eingeplant waren.
Die meisten von uns waren Anwälte, aber auch der frühere Sergeant einer Spezialeinheit gehörte dazu und zwei Finanzgenies aus der City, die sich zwar keinen dicken Gehaltsscheck, doch ein abwechslungsreicheres und spannenderes Leben von uns versprachen.
Und Abwechslung und Spannung bekamen sie auch.
Ich war Mitarbeiter Nummer 7 – 007, dachte ich gern – und seit knapp sieben Jahren dabei, weil Grundstücksübertragungen, Testamente und Scheidungsurkunden – die Hausmannskost des Rechtsanwalts im ländlichen Devon – mich nur noch gelangweilt hatten.
Eines besonders nassen und öden Mittwochnachmittags in Totnes war mein Blick auf eine unscheinbare kleine Annonce in den Stellenanzeigen der Law Society Gazette gefallen.
»Vis mutare aliquid magis excitando tuum?«, stand da nur, mit einer Londoner Telefonnummer nebendran.
Vis mutare aliquid magis excitando tuum?
Mein Jahr Latein in der Schule hatte offensichtlich nicht gereicht. Ich tippte die Zeile in einen Online-Übersetzer, und der spuckte aus: »Möchten Sie zu etwas Aufregenderem wechseln?«
Spaßeshalber rief ich die Nummer an.
»Können Sie zu einer Beurteilung in unser Büro kommen?«, fragte eine Frauenstimme ohne jedes Vorgeplänkel.
»Gern«, erwiderte ich. »Wann?«
»So bald wie möglich«, kam die Antwort.
»Und wohin?«, fragte ich.
»Das liegt bei Ihnen. Rufen Sie hier nicht noch mal an, sonst sind Sie raus.« Damit hatte sie aufgelegt und mich perplex, aber brandneugierig zurückgelassen.
Ich weiß noch, wie ich mit dem Telefon in der Hand dasaß und halb mit einem Rückruf der Frau rechnete. Nichts da. Das Telefon blieb stumm. Ein Name war nicht gefallen, auch kein Firmenname. Nicht mal nach meinem Namen hatte die Frau gefragt.
War das eine Betrugsmasche? Zog da jemand irgendeinen Scheiß ab?
Oder war das ernst gemeint?
Wo fing ich jetzt an? Es gab über zehntausend Anwaltsbüros in Großbritannien, fast die Hälfte davon in London. Sollte ich das Branchenverzeichnis nach der passenden Nummer durchgehen? Die Nummer galt offenbar nur für die Anzeige, nicht für die Kanzlei.
Ich googelte sie und bekam wie vorauszusehen keinen direkten Treffer, aber doch ein paar Hinweise. Wenn ich nur die ersten sieben Ziffern eingab, wurde mir unter anderem eine Reihe ausländischer Botschaften angezeigt, eine Arztpraxis und mehrere Restaurants. Sämtliche Adressen gehörten zum Londoner Postbezirk SW1, die meisten zum Unterbezirk SW1X.
SW1X erkannte Google als Knightsbridge und Belgravia – die schicksten Gegenden Westlondons, beide aber mit zigtausend Anschriften.
Aussichtslos.
Statt meine Arbeit zu tun, hatte ich vom Schreibtisch aus den Leuten zugeschaut, die im Regen die Totnes High Street rauf und runter hasteten, und mich gefragt, welcher Idiot diese bescheuerte Annonce aufgegeben haben mochte.
Aber ich gedachte es herauszufinden.
Also rief ich bei der Law Society Gazette an und verlangte die Anzeigenabteilung. Über Inserenten dürften sie leider keine Auskunft geben, hieß es mit Hinweis auf den Datenschutz. Der Mann in der Leitung schien sogar ein wenig amüsiert über meine Anfrage, als würde er sie nicht zum ersten Mal hören.
Danach suchte ich am Computer die Anwaltsfirmen in London SW1X heraus und legte eine Liste an. Es waren ganze acht.
Das sah schon besser aus.
Danach glich ich die Nummer in der Anzeige mit den Rufnummern der Firmen ab. Keine Übereinstimmung, aber drei fingen mit den gleichen sieben Ziffern an, wenn auch die letzten vier ganz anders lauteten.
So langsam kam ich doch voran.
Ich rief erneut bei der Law Society Gazette an und verlangte die Finanzabteilung.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte eine Frauenstimme.
»Ich suche die Rechnung für eine Annonce in Ihren Stellenanzeigen«, sagte ich.
»Von welcher Firma?«, fragte sie.
»Da kommen drei infrage«, antwortete ich. »Wir betreuen mehrere Unternehmen.« Ich nannte ihr den ersten Namen auf meiner Liste.
»Leider nein«, sagte sie nach ein paar Sekunden. »Fehlanzeige.«
Ich nannte ihr den zweiten Namen.
»Ah ja«, ließ sie mich hoffen. »Die haben vor zwei Jahren über uns eine Rechtsanwaltssekretärin gesucht. Sind die’s?«
»Haben Sie nichts Neueres von denen?«, fragte ich, bemüht, mir meine Verzagtheit nicht anmerken zu lassen.
Ich hörte sie tippen.
»Leider nein«, sagte sie.
Ich gab ihr den dritten Namen durch.
»Tut mir leid. Auch wieder nichts.«
»Komisch«, meinte ich. »Ich bin mir sicher, dass es sich um eine Firma von uns im Postbezirk SW1X handelt. Sehen Sie bitte noch mal nach?«
»SW1X, ja?« Ich hörte, wie sie das Kürzel eingab.
»Wir haben nur noch eine andere Rechnung an eine SW1X-Adresse in der Datei, aber das ist kein Anwaltsbüro.«
»Wann ist die Rechnung rausgegangen?«, fragte ich schnell.
»Vorige Woche. Und zwar für die aktuelle Ausgabe. Die ging aber an eine Privatperson, keine Firma.«
»Könnten Sie mir den Namen sagen?«, fragte ich in meinem liebenswürdigsten Ton. »Da liegt wohl eine Verwechslung vor.«
»Das darf ich nicht«, antwortete sie fast, als müsse sie sich entschuldigen. »Ob Verwechslung oder nicht, das ist gegen die Vorschriften.«
»Könnten Sie mir denn die vollständige Postleitzahl sagen?«, fragte ich. »Dann finde ich die Firma schon.«
Sie zögerte und überlegte offensichtlich, ob auch das gegen die Vorschriften wäre. Ihrem Gefühl nach nicht.
»SW1X8JU.«
»Gut, danke.« Ich notierte es. »Damit versuch ich’s mal.«
Schmunzelnd legte ich auf. Das musste es doch sein. Aber die Postleitzahl passte zu keinem der acht Anwaltsbüros auf meiner Liste.
Folglich lief ich zwei Tage später die Motcomb Street in Belgravia mit ihren Designerläden, Kunstgalerien und angesagten Restaurants rauf und runter und rätselte, welche dieser achtundzwanzig eher unwahrscheinlichen SW1X8JU-Adressen die gesuchte sein könnte, wenn sie überhaupt dabei war.
Da nirgends etwas nach Anwaltskanzlei aussah und auch kein Messingschild an einer Tür mir weiterhalf, klopfte ich die Läden, Galerien und Gasthäuser einzeln ab und fragte das Personal, ob sie von einer Kanzlei in der Nähe wüssten oder von jemandem, der eine Anzeige in der Law Society Gazette aufgegeben haben könnte. Leider nein, aber so konnte ich immerhin die Hälfte der Adressen auf meiner Liste abhaken.
Die meisten Gebäude hier waren schöne Beispiele georgianischer Architektur, dreistöckig, mit kunstvoll geschmiedeten Balkongeländern. Ursprünglich als Einfamilienhäuser konzipiert, waren sie längst in Ladenlokale mit darüberliegenden Wohnungen umgewandelt worden, mit einer schmalen Haustür, die direkt auf den Gehsteig ging.
Ich schaute zu den hohen Fenstern hinauf, ob da vielleicht jemand an einem Schreibtisch saß oder sonst etwas auf Arbeitsplatz statt Wohnung deutete, doch der Blickwinkel von unten ließ mich hauptsächlich gespiegelten Himmel sehen.
Schließlich klopfte ich dann einfach an die Haustüren oder klingelte, um zu sehen, ob jemand da war.
Als ich zur letzten kam, verlor ich so langsam den Mut. An acht der vierzehn Türen hatte sich niemand gemeldet, und fünf Herausgeklingelte hatten offensichtlich keine Ahnung, was ich damit meinte, dass ich »wegen meiner Beurteilung« gekommen sei.
»Verschwinden Sie«, schrie mich einer an. »Ich kauf nix.«
Und eine andere Tür öffnete sich mit vorgelegter Sicherheitskette. »Sind Sie von der Stadt?«, fragte eine ältere Frau durch den Spalt.
»Nein«, erwiderte ich. »Ich komme wegen meiner Beurteilung.«
»Ich brauche eine vernünftige Beurteilung«, sagte sie. »Sind Sie wirklich nicht von der Stadt?«
Ich versicherte ihr, ich sei ganz bestimmt nicht von der Stadtverwaltung, und sie war sichtlich ungehalten darüber, dass ich sie umsonst runter zur Tür hatte kommen lassen – »in meinem Zustand!«.
Als ich die billige Plastikklingel an der allerletzten Tür drückte, war ich deshalb in Gedanken eher bei den Abfahrtszeiten der Züge von Paddington nach Totnes als sonst irgendwo.
Die Tür war grau vor Schmutz. Ich nahm an, sie war mal weiß oder cremefarben gewesen, aber die Zeit hatte es nicht gut mit dem stark abblätternden Lack gemeint. Der messinggerahmte Briefkasten war grün korrodiert, und der Türknauf hing wegen fehlender Schrauben lose am Holz.
»Ja?«, tönte es aus dem winzigen Lautsprecher über der Klingel.
»Ich komme wegen meiner Beurteilung«, sagte ich noch einmal, ohne mir etwas davon zu erhoffen oder zu versprechen.
»Gut«, hörte ich. »Kommen Sie rauf.« Mit einem Klicken öffnete sich die Tür.
Und so war ich in die Welt von Simpson White eingetreten.
Wie ich sie gefunden hatte, wurde ich nie gefragt. Nur, dass ich sie gefunden hatte, zählte. Drei Stunden später hatte ich ein Jobangebot, auch wenn mir damals kaum schwante, um was es dabei eigentlich ging.
»Wir sind definitiv kein Anwaltsbüro«, erläuterte mir ASW, »und auch kein PR-Unternehmen. Aber wir haben mit Public Relations zu tun, und wir brauchen Anwälte.« Insgesamt ging er mehr darauf ein, was sie nicht waren, als darauf, was sie denn nun waren, als wüsste er das selbst nicht so genau. Aber ich mochte ihn und er mich offensichtlich auch. »Wollen Sie also den Job?«
»Was zahlen Sie?«
Dass ich nach etwas so Ordinärem wie Geld fragte, schien ihn etwas zu irritieren.
»Wie alt sind Sie?«, fragte er, statt auf meine Frage zu antworten.
»Dreißig«, erwiderte ich.
»Verheiratet?«
»Nein.« Ich fragte mich, ob das eine angemessene Frage für ein Bewerbungsgespräch war.
»Verlobt?«
»Nein.«
»Sonst eine Beziehung?«
»Momentan nicht«, sagte ich, obwohl ihn das wahrhaftig nichts anging.
»Was kümmert es Sie dann, wie viel ich zahle?«
Jetzt war ich meinerseits etwas irritiert.
»Ich muss doch von irgendwas leben.«
»Das klappt schon«, erwiderte ASW lachend, »und obendrein werden Sie feststellen, dass Sie noch nie so müde, so erregt und so wichtig gewesen sind.«
»Was genau mache ich denn in dem Job?«
»Alles und jedes«, antwortete er wenig hilfreich. »Im Prinzip sind wir ein Beratungsunternehmen, und wir beraten Präsidenten und Premierminister ebenso wie die Geschäftsführer großer internationaler Firmen. Letztlich jeden, der unsere Hilfe braucht und bereit ist, unsere Honorare zu zahlen.«
Er holte Luft, und ich saß still da und wartete darauf, dass er fortfuhr.
»Wir sind Spezialisten für Krisenbewältigung. Krisen treten immer auf, ob naturbedingt oder vom Menschen verursacht, und zu beobachten, wie die Krise bewältigt wird, ist fast genauso wichtig wie die Hilfsmaßnahmen selbst. Unsere Aufgabe ist, kurz gesagt, dafür zu sorgen, dass ein Notzustand nicht durch unbedachte oder einfach dumme Worte und Handlungen derjenigen, die helfen sollen, ihn zu beseitigen, noch verschlimmert wird.«
»Wie bei Deepwater Horizon«, sagte ich.
»Genau.«
Deepwater Horizon war eine von BP betriebene Bohrplattform, deren Explosion im April 2010 eine Umweltkatastrophe im Golf von Mexiko auslöste. Die BP-Führung behauptete zunächst, es handele sich nur um ein kleines Problem, an dem man keine Schuld trage. Der Imageschaden war für BP fast so verheerend wie der materielle.
»Wir flüstern den Leuten Ratschläge ins Ohr und hoffen, man hört auf uns – mit der Bohrinsel hatten wir dankenswerterweise aber nichts zu tun.«
»Okay«, sagte ich.
»Was ist okay?«, fragte ASW.
»Der Job. Ich nehme ihn.«
Und so kam es, dass ich mich jetzt, elf Jahre später, durch ebenjene schmutzig graue Tür auf den Weg nach King’s Cross und nach Newmarket machte.
Pferderennen! Du lieber Gott!
2
Auch ohne mein Dossier erfuhr ich bald, um was es ging.
PRINCE OF TROY BEI STALLBRAND GESTORBEN!, verkündeten sämtliche Schlagzeilenbanner an den Kiosken im Bahnhof King’s Cross.
Von Prince of Troy hatte selbst ich schon gehört. Er war das aktuelle Wunderrennpferd, nach vorherrschender Meinung das beste seit Frankel. Manche hielten ihn sogar für noch besser.
Ich schnappte mir die Frühausgabe des Evening Standard und sah mir die Titelseite mit der dicken Schlagzeile PRINCE OF TROY TOT an. Dem Bericht zufolge war das Pferd ein sicherer Tipp für das Derby in knapp zwei Wochen gewesen, nachdem es in seinen acht bisherigen Rennen, darunter das Two Thousand Guineas vor gerade mal neun Tagen, die gesamte Konkurrenz mühelos geschlagen hatte.
Jetzt aber war er tot, offenbar in seinem Stall stehend bei lebendigem Leib gegrillt. Und er war wohl auch nicht allein gestorben. Dem Blatt zufolge waren sechs weitere Spitzenhengste mit ihm ein Raub der Flammen geworden, die, angefacht von einem direkt aus den Fens kommenden starken Nordwind, in der Nacht ein ganzes Stallgebäude verschlungen hatten.
»Ein unermesslicher Verlust für den Rennsport«, schrieb die Zeitung weiter, »und eine menschliche Tragödie für den Trainer der sieben Pferde, Ryan Chadwick, und alle Angehörigen der Familie.«
Ich klemmte die Zeitung unter den Arm, holte mir bei Starbucks einen Kaffee und suchte mir im nächsten Schnellzug nach Cambridge einen Tisch. Da WLAN in Zügen immer noch Glückssache war, versah Simpson White seine Mitarbeiter durchweg mit einem »Dongle«, der jeden Laptop in ein großes Mobiltelefon verwandelte.
Ich lud meine E-Mails herunter, einschließlich der von Georgina mit dem Dossier. Unser Klient war nicht wie erwartet Ryan Chadwick und auch sonst niemand von den Chadwicks. Es war mein alter Freund, Seine Hoheit Scheich Ahmed Karim bin Mohamed Al Hamadi, allgemein schlicht als Scheich Karim bekannt, und ihm hatte Prince of Troy gehört.
Ahmed Karim war ein lebensfroher, sorgloser arabischer Kronprinz gewesen, als sein Vater, der regierende Emir, von den eigenen Generälen ermordet worden war, weil er ihre Versuche, wieder einmal gegen einen Nachbarstaat Krieg zu führen, vereitelt hatte. Der neue junge Herrscher hatte die Mörder seines Vaters aus der Armee entfernt, der Region anhaltenden Frieden beschert und sein ölreiches Land vom Mittelalter ins einundzwanzigste Jahrhundert geführt. Ganze dreißig Jahre später zählte es jetzt zu den führenden Finanz- und Touristikzentren des Nahen Ostens.
Hin und wieder war seine Führung allerdings in Gefahr geraten oder infrage gestellt worden. Er regierte gerecht, aber mit durchaus fester Hand, und verschiedentlich hatte es Wellen geschlagen, wenn übereifrige Beamte seiner Verwaltung gerade im Umgang mit Touristen aus liberaleren Ländern Europas ihre Befugnisse überschritten. Daher hatten er und ich schon zweimal zusammengearbeitet.
Dem Dossier entnahm ich, dass Scheich Karim nach und nach ein Lot hochklassiger Rennpferde zusammengestellt hatte und sich mit der Absicht trug, Besitzern aus anderen arabischen Königshäusern Konkurrenz zu machen. Nur neun Jahre zuvor hatte er dem Trainer Oliver Chadwick seinen ersten Zweijährigen anvertraut, und jetzt hatte er gut zwanzig Vollblüter in mehreren Ländern in Training.
Sein Hauptstützpunkt in England waren nach wie vor die Castleton House Stables der Chadwicks an der Bury Road in Newmarket, und mit Prince of Troy hatte er seinem ersten Derbyerfolg überhaupt entgegengesehen.
Ich hatte Anweisung, als Scheich Karims Vertreter zu handeln und direkt mit Oliver Chadwick in Verbindung zu treten. Er sei auf mein Kommen vorbereitet.
Oliver war offenbar Ryans Vater und das derzeitige Oberhaupt der Chadwick-Rennsportdynastie. Georgina hatte noch ein paar Eckdaten zu den Chadwicks hinzugefügt, darunter einen Link zu einem Artikel aus der Racing Post von vor fünf Jahren, als Oliver sich zur Ruhe gesetzt und Ryan ihn als Trainer abgelöst hatte.
Oliver Chadwick selbst war der Sohn eines gewissen Vincent Chadwick, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Castleton House an der Bury Road gekauft hatte. Er hatte den ersten Stallhof angelegt und 1950 angefangen, Rennpferde zu trainieren.
Ursprünglich hatte Olivers älterer Bruder James die Trainingslizenz übernommen, als ihr Vater Anfang der 1970er-Jahre bei einem Autounfall ums Leben kam, doch sie war auf Oliver übergegangen, als James nur vier Jahre später nach Südafrika auswanderte.
In den darauffolgenden dreißig Jahren baute Oliver den Ruf der Castleton House Stables aus, bis sie als eines der besten Trainingszentren für Galopprennpferde im Land galten und nicht nur Scheich Karim, sondern die Crème des britischen Rennsports zu ihren Besitzern zählte.
Aber Oliver hatte offensichtlich auch noch anderes zu tun gehabt. Laut Dossier war er dreimal verheiratet gewesen und hatte mit seinen ersten beiden Frauen je zwei Kinder – drei Söhne und eine Tochter insgesamt. Die drei Söhne waren nach wie vor im Rennsport zugange.
Ryan, mit zweiundvierzig der Älteste, war ein zweifacher früherer Champion-Jockey, der mit Siegern im Derby, Oaks, St Leger und im Breeders’ Cup viele große Trainingserfolge Oliver Chadwicks geritten hatte, ehe er verletzungshalber aufhörte und die Castleton House Stables von seinem Vater übernahm.
Declan, der zwei Jahre jüngere zweite Sohn, war zwar auch sehr erfolgreich gewesen, hatte es aber nicht ganz zum Champion-Jockey gebracht, ehe er wie Ryan Trainer wurde. Jetzt betrieb er einen kleinen Stall am Rand von Newmarket und fing gerade an, sich als möglicher Star der Zukunft zu empfehlen.
Danach kam mit zweiunddreißig Tony, und er war der einzige unverheiratete Spross Oliver Chadwicks. Er ritt immer noch Rennen, und obwohl er die schwindelnden Höhen seiner beiden älteren Brüder nie erreicht hatte, war allgemein erwartet worden, dass er beim bevorstehenden Derby Prince of Troy reiten würde.
Mit neunundzwanzig Jahren die Jüngste war Zoe, die einzige Tochter der Chadwicks. Auch als verheiratete Robertson nannte sie sich offenbar noch manchmal Zoe Chadwick. Schon mit achtzehn war sie von Newmarket nach London gezogen, mit zwanzig hatte sie geheiratet, und jetzt lebte sie mit ihrem Mann und zwei Kindern nicht weit vom U-Bahnhof South Ealing.
Georgina hatte im Dossier nur vermerkt, dass Zoes Mann Peter hieß und offenbar Grundstücksmakler war; mehr hatten unsere Rechercheure auf die Schnelle nicht herausbekommen.
Ich lehnte mich auf meinem Sitz zurück und ließ die Welt mit hundert Stundenkilometern an mir vorüberrauschen. Eigentlich fand ich, das Rechercheteam habe in der knappen Zeit, die ihm zur Verfügung stand, hervorragende Arbeit geleistet, bloß hatte mir das Dossier nicht verraten, dass in der Familie Chadwick ein handfester Geschwisterkrieg ausgebrochen war.
Das sollte ich erst bei meiner Ankunft in Newmarket herausfinden.
Die Bury Road war in beiden Richtungen gesperrt und von drei großen roten Feuerwehrwagen blockiert, aus denen sich dicke, prall gefüllte Hochdruckschläuche schlängelten. Dazu kamen zwei Ü-Wagen mit großen offenen Satellitenschüsseln auf dem Dach. Kameraleute und Moderatoren liefen wohl in Erwartung des nächsten Stichworts ziellos herum. Der Fahrer, den Georgina mir zum Bahnhof Cambridge geschickt hatte, setzte mich so nah wie möglich am Eingang von Castleton House Stables ab. Er sprang vor mir heraus und hielt mir die hintere Tür des eleganten Mercedes auf.
»Ich versuche hier zu warten, Sir«, sagte er. »Werde ich weggeschickt, parke ich irgendwo in der Nähe.«
»Gut«, sagte ich. »Danke. Wenn ich Sie brauche, rufe ich an. Ich habe aber keine Ahnung, wie lange das dauert.«
»Ich warte«, antwortete er. »Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ich habe ein gutes Buch dabei. Ihre Tasche können Sie gern im Kofferraum lassen.«
»Mach ich. Danke.«
Ich nahm die Zeitung, vergewisserte mich, dass ich mein Handy einstecken hatte, und stieg aus.
Sofort traf mich starker Brandgeruch – nicht das Nasestreicheln eines Gartenfeuers, sondern der beißende Gestank von verbranntem Fleisch, der mir so übel in den Rachen stach, dass ich mich beinah übergeben hätte.
Mit Bränden hatte ich schon zu tun gehabt, und sie waren mir verhasst. Sie hatten etwas Willkürliches, Wahlloses an sich und waren einfach nur zerstörerisch. Bei einer Überschwemmung lassen sich die kostbaren Familienfotos oder Kunstgegenstände wieder trocknen. Sie mögen beschädigt sein, sind aber noch da. Bei einem Brand gehen sie brutal und endgültig verloren. Und meistens sind Brände ein Unfall oder das Ergebnis höherer Gewalt – Blitzeinschlag, elektrischer Defekt oder Funkenflug. Niemand hat es gewollt, aber der Drang, jemanden für sein Unglück verantwortlich zu machen, steckt in uns. Wieso hat keiner die Flammen früher bemerkt? Wieso war die Feuerwehr nicht schneller da? Warum hat man uns einen defekten Heizlüfter verkauft? Warum uns? Warum? Warum? Warum?
Es ist kein Wunder, dass dann vor allem Wut aufkommt und die Betroffenen auf jede Art von Autorität einschlagen. Das Bedürfnis, jemanden zur Rechenschaft zu ziehen, ist stark.
Die Bewohner des vom Brand zerstörten Grenfell Tower in Westlondon forderten lauthals Gerechtigkeit, als würde es irgendwie ihre Freunde und Verwandten zum Leben erwecken, ihre Habseligkeiten zurückbringen und alles wäre wieder gut, wenn erst ein Sündenbock gefunden war.
Und ich hielt ihnen das nicht vor. An ihrer Stelle hätte ich mich genauso verhalten.
Es ist, als wäre jemand eingebrochen und hätte alles mitgehen lassen, was einem lieb und wert ist, nur schlimmer. Nach einem Einbruch weiß man, wohin mit der Wut, hat einen Schuldigen und kann im Stillen hoffen, dass man Verlorenes wiederbekommt. Nach einem Brand bleibt nichts als völlige Verzweiflung.
Vorausgesetzt, der Brand war wirklich ein Unfall.
Ich ging durch das hohe Tor von Castleton House Stables, und sofort trat mir ein junger Polizist in Uniform entgegen, der dahinter stand.
»Kann ich Ihnen helfen, Sir?«, fragte er.
»Ich suche Oliver Chadwick.«
»Warum? Sind Sie von der Presse?«
»Nein. Ich bin Harry Foster.« Ich gab ihm meine Visitenkarte. »Ich werde erwartet.«
»Warten Sie hier«, befahl er und ging zu zwei ranghöheren Polizeibeamten herüber, die vor dem großen Haus zu meiner Linken standen.
Auch von meinem Standort aus war leicht zu sehen, wo der Brandgeruch herkam. Rauchfähnchen stiegen aus den verkohlten Überresten eines Stallgebäudes auf, neben dem noch zwei baugleiche standen, und den Boden rings um mich bedeckte eine Ascheschicht, die Flocken stoben wie im Wind wehender schwarzer Schnee.
Die drei Gebäude hatten zusammen mit dem großen Haus die vier Seiten eines Quadrats um einen Innenhof gebildet. Vor den Gebäuden verlief ein breiter Gehweg, und in der Mitte lag ein makellos gepflegter Rasen, gesäumt von einer Reihe bunter Frühlingsblumen, deren Rosa, Grün und Rot in scharfem Kontrast zu den schneeweißen Wänden und grauen Schieferdächern der Stallgebäude stand.
Wunderschön.
Bloß waren die weißen Wände auf der mir gegenüberliegenden Seite des Vierecks jetzt brandgeschwärzt und das Schieferdach gänzlich verschwunden. Nur ein Skelett stand noch von dem Stall, ein paar verkohlte Dachbalken zeigten himmelwärts, als wollten sie vor Gott klagen, dass er eine solche Tragödie zugelassen hatte.
Rechts von mir saßen, an die Wand des nächsten unversehrten Stalls gelehnt, fünf Feuerwehrleute auf dem Boden. Ihre gelben Helme hatten sie abgenommen, die schweren feuerfesten Mäntel geöffnet. Ich lächelte sie an und bekam nur Grimassen zurück. Sie waren sichtlich erschöpft, der Schweiß stand ihnen in dicken Tropfen auf dem Gesicht.
»Gute Arbeit«, meinte ich zu ihnen.
»Die armen Pferde«, erwiderte einer von ihnen kopfschüttelnd. »Da konnten wir nichts machen.«
»Immerhin haben Sie die anderen Ställe gerettet«, sagte ich und wies auf die intakten Gebäude. »Und das Haus.«
Tatsächlich sah ich, dass andere Feuerwehrleute noch dabei waren, das Haus an der Seite abzuspritzen, damit es durch die immer noch vom Brandherd ausgehende Hitze kein Feuer fing.
Der junge Polizist kam wieder und hatte von seinen Vorgesetzten offenbar die Erlaubnis bekommen, mich reinzulassen.
»Sie sind in der Küche«, sagte er. »Die Tür da.« Er zeigte hin.
»Wer ist sie?«, fragte ich.
»Alle miteinander. Die Familie.«
Seinem Tonfall entnahm ich, dass er kein Fan war, aber zumindest blieb er höflich.
Laut Georginas Dossier hatte Ryan zwar das Training der Pferde im Hof übernommen, doch sein Vater bewohnte nach wie vor das Haus, und Ryan und seine Frau waren in dem modernen Haus in der Fordham Road geblieben, das sie im Jahr seines ersten Jockey-Championats gebaut hatten.
Ich trat über die dicken Schläuche hinweg und ging zu der Tür, die mir der Polizist gezeigt hatte.
Ich klopfte an.
Keine Reaktion, sicher auch, weil ich drinnen schwer zu hören war. Die Männer an den Schläuchen riefen, die Löschpumpen an der Straße dröhnten fortwährend, aber auch hinter der Tür ging es laut her.
Ich trat ein und stand in einem Büroraum mit Holzschreibtischen an zwei Wänden und zwei Stühlen mit erneuerungsbedürftigen Sitzpolstern. Auf beiden Schreibtischen stand je ein ausgeschalteter PC, und an Holzhaken darüber hingen reihenweise Renndresse in leuchtenden Farben. Vom hinteren Schreibtisch hatte man durch das Fenster neben der Tür freie Sicht auf den Stallhof.
Da die Stimmen von weiter drinnen kamen, ging ich durch einen kurzen Flur zur Küche, deren Tür einen Spaltbreit offen stand.
»Was kümmert dich das überhaupt?«, hörte ich eine laute, zornige Männerstimme. »Ihr habt mir doch immer nur Knüppel zwischen die Beine geworfen.«
»Das ist unfair!«, verwahrte sich eine Frau mit vor Aufregung leicht zitternder hoher Stimme. »Declan kann nichts dafür, dass der Scheich die Pferde abziehen will. Er hat immer versucht, dir zu helfen.«
»Ha! Das nennst du Hilfe? Du machst wohl Witze. Blöde Kuh!«
»Red nicht so mit Bella.« Eine zweite zornige Männerstimme. »Wenn du mit mir ein Problem hast, lass uns vor die Tür gehen, und wir regeln das von Mann zu Mann.«
»Schluss jetzt!«, rief eine ältere Männerstimme. »Wir haben schon genug Ärger, da müsst ihr euch nicht noch wie die Sandkastenknilche benehmen. Gebt jetzt endlich Ruhe!«
Ich blieb aus zwei Gründen im Flur stehen. Erstens wollte ich die Familie nicht in Verlegenheit bringen, indem ich mitten hineinplatzte, wenn sie sich gegenseitig beschimpften, und zweitens lernte ich vielleicht dazu. Man konnte nie wissen, ob etwas zufällig Mitgehörtes sich nicht einmal als nützlich erwies.
Da aber außer vagem Stimmengewirr zunächst nichts mehr kam, trat ich an die Küchentür und klopfte laut.
Prompt verstummten alle.
Ich wartete.
Einige Sekunden später hörte ich Schritte, und ein kleiner älterer Mann mit vollem, welligem grauen Haar riss die Tür weit auf.
»Mr Chadwick?«, fragte ich. »Oliver Chadwick?«
Er nickte. »Der bin ich.«
»Harrison Foster«, sagte ich. »Von Simpson White. Ich glaube, Sie erwarten mich.« Ich gab ihm meine Visitenkarte.
»Ja«, sagte er nicht sonderlich erfreut. »Kommen Sie rein.«
Sie waren zu siebt in der Küche, vier Männer und drei Frauen.
»Ich bin Ryan Chadwick«, sagte einer der Männer, indem er selbstbewusst vortrat und mir die Hand bot. »Der Trainer hier.« Er war unverkennbar der Sohn seines Vaters, klein und drahtig, mit den gleichen Gesichtszügen und dem gleichen welligen Haar, wobei das seine noch vorwiegend braun war und nur an den Schläfen leicht angegraut. »Das ist meine Frau Susan.«
Susan Chadwick war eine zierliche Brünette, und auch der verheerende Brand am Arbeitsplatz ihres Mannes hatte sie nicht von eleganter Kleidung und rotem Lippenstift abgehalten.
»Declan Chadwick«, sagte der nächste Mann, der vortrat und mir die Hand gab. »Ryans Bruder. Und meine Frau Arabella.«
Arabella war an die zehn Zentimeter größer als ihr Mann und trug die langen, glatten blonden Haare in der Mitte gescheitelt. Auch sie hatte Zeit gefunden, sich zu schminken, inklusive getuschter künstlicher Wimpern und rosa Lidschatten.
»Und ich bin Tony«, sagte der vierte Mann im Vortreten. »Der Zwerg unter den Chadwick-Jungs.« Er lachte dabei, aber die anderen nicht.
Ich wusste zwar, dass Tony über dreißig war, aber mit seiner schmächtigen Statur und den roten Wangen sah er viel jünger aus. Seine dünnen Beine steckten in hautengen Jeans, und ich fragte mich, ob er die in der Kinderabteilung gekauft hatte.
Blieb nur eine Frau noch übrig, und eine verlegene Pause entstand, ehe sie herüberkam. »Maria«, sagte sie. »Die Frau von Oliver.«
Sie machte als Einzige der Frauen den Eindruck, durch den Brand aus dem Bett geschreckt worden zu sein – ihr langes blondes Haar war ungekämmt zum Pferdeschwanz gebunden, und sie trug ein weites graues T-Shirt über der Jogginghose.
Laut Georginas Dossier war Maria Olivers dritte Frau, und offensichtlich war sie weder die Mutter von Ryan noch von Declan. Zum einen sah sie kaum älter aus als die beiden, und beide verzogen keine Miene, als ich ihr die Hand gab. Im Gegenteil, sie wandten sich ab, als wäre ihnen schon ihr Anblick unerträglich.
Die böse Stiefmutter, dachte ich. Eindeutig unbeliebt.
»Können wir uns irgendwo unter vier Augen unterhalten?«, fragte ich Oliver.
Er sah mich etwas überrascht an. »Es gibt nichts, was Sie nicht vor meinen Söhnen sagen dürften.«
Anders wäre es mir lieber gewesen, aber wenn es ihm recht war, auch gut.
Ich sah sie reihum an. »Mein Name ist Harry Foster. Ich bin Anwalt und fungiere hier als persönlicher Vertreter von Scheich Karim.« Ich teilte weitere Visitenkarten aus. »Dem Scheich liegt sehr daran, dass nichts gesagt oder getan wird, was sich in irgendeiner Weise nachteilig auf ihn oder seinen Ruf auswirkt. Und das bedeutet, dass ihm ebenso Ihr Wohl und das Ihres Stalles am Herzen liegt. Es muss klar sein, dass niemand von Ihnen zu irgendwem – und schon gar nicht zur Presse – auch nur ein Wort sagen sollte, ohne es vorher mit mir abzuklären. Kein Wort bitte – nicht mal ›kein Kommentar‹. Das klingt nur, als hätten Sie etwas zu verbergen. Schweigen ist besser. Haben Sie verstanden?«
Ich sah erst Oliver, dann Ryan, Declan und Tony an.
Es gefiel ihnen nicht. Ich konnte es ihnen von den Gesichtern ablesen: Wer ist denn dieser Piefke, der uns sagen will, was wir in unserem eigenen Haus dürfen und was nicht?
»Haben Sie verstanden?«, wiederholte ich.
»Ja«, sagte Oliver.
Ich schaute die anderen an, und sie nickten.
»Gut. Würden Sie mir dann bitte erzählen, was heute Morgen passiert ist? Wer wusste, dass Prince of Troy zu den Pferden gehörte, die umgekommen sind? Und wie hat die Presse das erfahren?« Ich zeigte ihnen die Titelseite des Evening Standard mit der fetten Schlagzeile.
»Ich habe mit allen erreichbaren Besitzern gesprochen«, sagte Ryan. »Dem Scheich habe ich eine Nachricht hinterlassen.«
Aber die Zeitungen hatte er wohl kaum informiert.
»Und sonst?«
»Ich habe Weatherbys verständigt.«
»Weatherbys?«, fragte ich.
»Die verwalten den gesamten britischen Rennsport. Ich muss sie umgehend benachrichtigen, wenn ein für ein Rennen genanntes Pferd zu streichen ist. Prince of Troy war ja für das Derby genannt. Weatherbys wird eine dringende Pressemitteilung gebracht haben, damit keine Vorwetten mehr auf ihn abgeschlossen werden.«
»Wann haben Sie sie informiert?«
»Um halb neun, da öffnet ihr Rennterminbüro.«
»Haben Sie erklärt, warum Prince of Troy gestrichen werden musste?«
»Natürlich«, antwortete Ryan. »Ich habe ihnen wie vorgeschrieben mitgeteilt, dass er und die sechs anderen gestorben waren. Und dass es hier gebrannt hat, ist nicht gerade ein Geheimnis. Seit Mitternacht sind die Feuerwehrwagen auf der Straße. Um das zusammenzubringen, muss man kein Genie sein.« Mit einer Kopfbewegung wies er auf die Zeitung, die ich noch in der Hand hielt.
Wer hätte ihm verdenken können, dass er sich aufregte? Sieben seiner besten Pferde waren tot. Sein Derbytraum war buchstäblich in Rauch aufgegangen.
Ein lautes Klopfen an der Vordertür unterbrach uns. Oliver ging hinaus und kam mit einem der beiden hohen Polizeibeamten wieder, die ich schon gesehen hatte. Der Beamte nahm seine silbern bekordelte Schirmmütze ab, als er in die Küche kam.
»Mr Ryan Chadwick?«, fragte er.
»Der bin ich«, sagte Ryan im Vortreten.
»Superintendent Bennett«, stellte sich der Beamte vor. »Ist Ihr Stallpersonal vollzählig?«
»Ich glaube schon«, sagte Ryan. »Wieso?«
»Am Brandort wurden menschliche Überreste gefunden.«
3
Die Entdeckung eines toten Menschen neben den toten Pferden änderte alles.
In Minutenschnelle wimmelte es auf dem Gelände von Polizisten, viele in weißen Schutzanzügen, etliche mit Kapuzen und Mundschutz, und überall, auch vor der Tür vom Büro zum Stallhof, spannten sie ihr blau-weißes Absperrband.
Bald darauf erschien ein weiterer Beamter in der Küche und bat Ryan um eine Namensliste seines Personals und eine Bestätigung ihrer Anwesenheit.
Die Liste war kein Problem, sie lag im Büro, doch der Aufenthalt der sechsundzwanzig Personen war weniger klar und nicht so leicht festzustellen.
»Die sind mit den Pferden raus«, erklärte Ryan.
Newmarket hatte sich in der Notsituation offenbar zusammengetan, und die am Leben gebliebenen Pferde waren schnell in Nachbarställen mit freien Plätzen untergebracht worden. Der Aufenthalt der umquartierten Vierbeiner war sorgfältig dokumentiert, doch die Zweibeiner hatten weniger Aufmerksamkeit bekommen.
»Wie viele Ihrer Mitarbeiter wohnen hier auf dem Hof?«, fragte der Polizist.
»Achtzehn«, erwiderte Ryan. »Sechs in Wohnungen über den alten Ställen und zwölf in einem extra Wohnheim hinten im neuen Hof.«
»Neuer Hof?«
»Ja«, sagte Ryan. »Ich trainiere derzeit hundertfünf Pferde, jedenfalls bis gestern. Jetzt sind es achtundneunzig. In die drei alten Stallgebäude beim Haus passen jeweils zwölf, das sind nur sechsunddreißig, und im neuen Hof haben wir vier Ställe mit jeweils vierundzwanzig Boxen, insgesamt also hundertzweiunddreißig Stallplätze. Wir nennen es den neuen Hof, obwohl er größtenteils schon über dreißig Jahre alt ist. Der letzte Stall entstand kurz vor der Jahrtausendwende.«
»Hat in dem abgebrannten Stall jemand gewohnt?«
»Gott sei Dank nicht. Die beiden Dachwohnungen dort haben wir gerade renoviert. Und waren fast fertig damit. So eine elende Verschwendung.« Er beugte sich mit einem schweren Seufzer über den Schreibtisch, als wäre schon das Aufrechtstehen zu anstrengend für ihn.
»Mr Chadwick«, sagte der Polizeibeamte energisch, »jemand liegt tot in Ihrem Stall. Wir müssen dringend den Aufenthalt Ihrer Mitarbeiter klären, um sie als mögliches Opfer auszuschließen.«
»Ja, natürlich. Ich telefoniere.«
Ryan verbrachte die nächsten beiden Stunden damit, sein Personal und seine Nachbarn anzurufen. Unterdessen verließen Declan und Arabella das Haus durch die Tür zur Bury Road und kehrten zu ihrem eigenen Stallhof zurück, während Ryans Frau Susan zu ihrer Mutter fuhr, um die Kinder abzuholen. Schließlich machte sich Tony auf den Weg nach Windsor, wo er am Abend zwei Ritte hatte.
Der Rennsport und das Leben gingen weiter, zumindest für die meisten.
Oliver und ich setzten uns an den Küchentisch, und er besprach mit mir die Ereignisse der Nacht.
»Abends um zehn lieg ich meistens im Bett. Mein Schlafzimmer blickt auf den alten Hof, und um Mitternacht bin ich vom Geschrei der Pferdepfleger aufgewacht. Ich dachte, ich hätte einen Albtraum. Nur war es keiner. Das Gebäude brannte schon wie verrückt, und die Flammen schossen aus dem Dach. Ich spürte die Hitze durchs Fensterglas.«
»Sind Sie zuerst aufgewacht oder Ihre Frau?«, fragte ich.
»Ich«, antwortete er. »Maria und ich haben jetzt getrennte Schlafzimmer.«
Er lächelte gezwungen, halb verlegen. »Sie sagt, mein Schnarchen hält sie wach.«
»Wo liegt ihr Schlafzimmer?«
»Auf der anderen Flurseite«, sagte er.
»Blickt es auch auf den Hof?«
»Nein, auf den Garten. Jedenfalls habe ich sofort die Feuerwehr alarmiert und dann Ryan angerufen. Und an Marias Tür geklopft, um sie zu wecken. Dann bin ich raus, um mit den anderen die Pferde in Sicherheit zu bringen. Die Hölle war los! Die Hölle. Pferde hassen Feuer. Es bringt sie um den Verstand. Wir mussten auf sie losgehen, um sie rauszukriegen. Es war furchtbar.«
Er schluckte schwer und kämpfte mit den Tränen.
»Es war so heiß, dass wir an den brennenden Stall nicht rankamen. Wir hörten nur die armen Pferde drinnen schreien, und den anderen setzte das erst recht zu. Ryan und mir war klar, dass sie alle wegmussten, und die wir retten konnten, schafften wir die Straße runter und banden sie an die Bretterzäune hinter den Severals. Da ließen wir sie einfach und holten die anderen raus. Am Ende hatten wir fast hundert Top-Vollblüter im Zentrum von Newmarket angebunden. Trotzdem mussten wir die Hengste noch von den Stuten fernhalten, besonders von den rossigen. Sie hatten zwar eine Heidenangst wegen des Feuers, aber da ihr Trieb doch recht stark ist, war es ein ziemlicher Kampf.« Er rang sich ein Lachen ab. »Jetzt mag das lustig sein. War es aber wirklich nicht.«
»Nein«, sagte ich mitfühlend. »Was sind die Severals?«
»Trabkreise. Hier am Ende der Bury Road.« Er hielt inne. »Die Leute waren prima. Als sie von dem Brand hörten – und die Buschtrommel funktioniert ganz gut bei uns –, kamen sie uns alle zu Hilfe. Etwa die Hälfte der Pferde wurde beim alten Widgery untergebracht, die anderen auf Ställe in der ganzen Stadt verteilt, wo gerade Platz war.«
»Beim alten Widgery?«, fragte ich.
»Wird Ihnen doch ein Begriff sein. Tom Widgery. Hat an der Fordham Road trainiert. Großes Ding. Steht jetzt leer, seit er vorigen Dezember gestorben ist.«
Ich sah ihn bloß an.
»Haben Sie denn überhaupt keine Ahnung vom Rennsport?«, fragte er vorwurfsvoll.
»Nein«, sagte ich.
»Tom Widgery war der berühmteste Trainer, der je gelebt hat«, erklärte mir Oliver geduldig, als spräche er mit einem Kind. »Hat alles x-mal gewonnen. Bei den Klassikern hält er nach wie vor den Rekord.«
»Pardon«, sagte ich. »Ich war immer mehr für Cricket.«
Sein missbilligender Blick grenzte an Abscheu, aber dann fiel ihm ein, weshalb ich da war, und er lächelte.
»Ein schönes Spiel«, sagte er sichtlich gegen seine Überzeugung. »Nur im Grunde kein Geschäft.«
Für manche schon, dachte ich, aber es lohnte sich nicht, darauf herumzureiten.
»Was ist mit den anderen Pferden von Scheich Karim, außer Prince of Troy? Sind sie alle in Sicherheit?«
Olivers Gesicht nahm einen gequälten Ausdruck an.
»Leider nicht«, sagte er. »Eines der sechs anderen toten Pferde gehörte auch dem Scheich, ein vielversprechender zweijähriger Hengst namens Conductivity. Hat als Jährling im Oktober ein kleines Vermögen gekostet. Sollte am kommenden Wochenende hier in Newmarket debütieren. Für mich war er ein künftiger Champion. Elende Schande.«
»War er versichert?«
»Von uns nicht«, sagte Oliver. »Das liegt in der Verantwortung des Besitzers. Sagen Sie’s mir.«
Ich nahm stark an, dass Conductivity nicht versichert war. Auch Prince of Troy nicht. Jemand wie Scheich Karim war sein eigener Versicherer und trug das Risiko selbst.
»Was ist mit den Ställen? Waren die versichert?«
»Selbstverständlich!«
»Und wem kommt das zugute? Ihnen oder Ryan?«
»Mir. Ryan ist mein Pächter. Gegen Geschäftseinbußen sind wir allerdings beide nicht versichert.«
»Der Hof war ja nicht ausgelastet. Ryan hat also wenigstens Platz, um den Verlust von zwölf Boxen aufzufangen.« Zumal mit sieben Pferden weniger, dachte ich, sprach das aber lieber nicht aus.
»Mag sein«, räumte Oliver ein. »Nicht wie zu meiner Zeit. Da war jeder Platz belegt und die Warteliste ellenlang.«
»Steckt das Geschäft in Schwierigkeiten?«, fragte ich.
»Nein, nichts dergleichen. Es liegt nur … wie soll ich mich ausdrücken? … Er ist nicht ich. Ein Sohn, der die Geschäfte eines erfolgreichen Vaters übernimmt, hat es wohl immer schwer. Ich halte mich nach Möglichkeit raus, aber die Besitzer … sie wollen nach wie vor, dass ich ihn anleite.«
Für mich klang das nach einem Rezept für völliges Desaster.
»Sinkt die Zahl der Pferde im Hof denn immer noch, oder steigt sie an?«
»Es sind schwere Zeiten«, gab Oliver zur Antwort. »Die Leute haben nicht mehr so viel Geld übrig wie früher.«
Demnach gingen die Zahlen immer noch zurück.
Mir fiel ein, was Arabella Chadwick zu Ryan gesagt hatte, als ich draußen vor der Küchentür stand: Declan kann nichts dafür, dass der Scheich die Pferde abziehen will.
Es war höchste Zeit, entschied ich, mit meinem Klienten persönlich zu sprechen.
Bis zum späten Nachmittag waren einige weitere Fakten geklärt, vor allem aber hatten sämtliche Mitarbeiter Ryans ausfindig gemacht werden können. Die Leiche in dem ausgebrannten Stallgebäude blieb also unidentifiziert.
»Haben Sie Videoüberwachung?«, fragte ich, als wir am Küchentisch saßen.
»Jede Menge«, erwiderte Ryan. »Unsere Kameras decken jedes Stallgebäude und jeden Ausgang ab.«
»Und was sieht man?«
»Nichts.« Er warf empört die Arme hoch. »Der Schaltkasten mit dem Festplattenrekorder befand sich im Dachraum des abgebrannten Stalls. Alles futsch. Unglaublich. Vom neuen Hof habe ich die schönsten Bilder. Massenhaft. Der Schaltkasten dafür steht im Wohnheim. Aber vom alten Hof – nichts.«
»Keine Sprinkleranlage?«, fragte ich.
»Im neuen Hof haben wir eine«, sagte Ryan. »Und bei der Renovierung der Wohnungen im alten wollten wir sie nachträglich einbauen. Ich fasse es einfach nicht. Noch acht Tage, und die wäre da angesprungen.«
»Warum stand Prince of Troy denn in einem Gebäude ohne Sprinkler?«, fragte ich. »Das wertvollste Gut gehört doch wohl am sichersten untergebracht.«
»Ich dachte ja, da wäre es am sichersten«, antwortete er schnell. »Es ist nah am Haus. Im neuen Hof hatten wir schon Eindringlinge. Und ich halte sämtliche Hengste im alten Hof. Sie sind leichter zu handhaben, wenn keine Stuten dabei sind. Vor dem Brand hatte ich sechsundzwanzig Hengste – sechzehn Drei- und zehn Zweijährige.«
»Alles andere sind Stuten?«, fragte ich.
Ryan sah mich komisch an.
»Nein. Wir haben auch Wallache, und Stute ist nicht gleich Stute.«
»Wonach wird unterschieden?« Was ein Wallach war, wusste sogar ich.
»Nach dem Alter«, sagte er in einem Ton, als hätte er einen Schwachsinnigen vor sich. »Im britischen Rennsport wird das Stutfohlen an seinem fünften Geburtstag zur Stute.«
»Am ersten Januar«, ergänzte ich stolz, wusste ich doch, dass bei allen Pferden der erste Tag des Jahres unabhängig vom eigentlichen Geburtsdatum als ihr Geburtstag zählt.
»Auf der Nordhalbkugel, ja«, sagte Ryan. »In Australien ist es der erste August.«
»August?«, wunderte ich mich. »Wieso nicht Juli? Das wäre ein halbes Jahr später.«
Jetzt war er seinerseits verblüfft.
»Ich habe keine Ahnung. Aber es ist definitiv der erste August.«
»Was passiert denn dann, wenn ein Pferd von hier nach Australien auswandert oder umgekehrt – wird’s dann ein halbes Jahr älter oder jünger?«
Er zuckte die Achseln. Offensichtlich hatte er sich lange genug mit mir abgegeben.
»Hören Sie«, sagte er, »ist sonst noch was? Ich muss mich auf meine Nennungen konzentrieren. Das ist auch ohne so ein Palaver schwer genug.«
Er stand auf, um zu gehen.
»Nur eines noch«, sagte ich. »Welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es nachts? Sind die Tore abgeschlossen?«
»Ja, selbstverständlich«, sagte er gereizt. »Alles wird verrammelt. Mein Futtermeister wohnt hier, und er kontrolliert das vor dem Schlafengehen.«
»Gestern Abend auch?«
»Bestimmt. Er macht das jeden Abend.«
»Wie ist denn dann jemand reingekommen und verbrannt?«
»Ich hab keinen Schimmer«, sagte er. »Das wird irgendein Penner gewesen sein. Übern Zaun geklettert und auf der Suche nach einem Schlafplatz in den Stall eingebrochen. Mit einer weggeschmissenen Fluppe dann womöglich alles in Brand gesteckt. Zu Recht krepiert, wenn Sie mich fragen.«
Für den Menschen, der in ihrem Stall sein Leben verloren hatte, zeigten die Chadwicks auffallend wenig Mitgefühl. Das brachten sie nur für die Pferde auf.
Die Anrufe der Trainerkollegen, die ihr Beileid wegen der gestorbenen Tiere und insbesondere Prince of Troy bekundeten, rissen den ganzen Nachmittag nicht ab. Das wusste ich, weil ich einige über einen Zweitapparat mitgehört hatte, um sicherzugehen, dass der Anrufer nicht von der Presse war und Ryan nichts Unerwünschtes sagte. Nach einiger Zeit ließ ich ihn aber einfach gewähren.
Die Presse erfuhr aus anderen Quellen, was geschehen war.
Höhere Beamte der Polizei wie auch der Feuerwehr gaben vor dem Tor von Castleton House Stables stehend Interviews, und alle wurden live in den Nachrichten übertragen.
Ich sah es mir mit Oliver, Maria und Ryan auf dem Fernseher in der Küche an.
Zuerst kam der Brandmeister von der Feuerwehr Suffolk zu Wort und erzählte, dass sich neben der Feuerwehr aus dem benachbarten Cambridge sogar Wehren aus Bury St Edmunds und Ipswich an der Brandbekämpfung beteiligt hatten. Jetzt sei der Brand gelöscht, berichtete er und dankte den Feuerwehrleuten für ihre Arbeit. Insgesamt fünf Löschzüge seien eingespannt gewesen, die beiden aus Newmarket würden zum Ablöschen noch für den Rest des Tages am Ort bleiben. Die Brandursache, ergänzte er, sei noch nicht geklärt, die Brandermittler würden aber ans Werk gehen, sobald sie das ungefährdet tun könnten.
Der Einsatzleiter der Polizei lieferte wesentlich mehr Informationen.
Er bestätigte der Presse, dass sieben Pferde in dem Brand umgekommen waren, und enthüllte den gespannten Reportern auch, dass mindestens ein Menschenleben zu beklagen war. Deshalb werde der Stall als potenzieller Tatort behandelt, sagte er, hob jedoch nachdrücklich hervor, dass noch keine Todesursache festgestellt worden sei.
Das aber kümmerte die Reporter wenig. Sie ergingen sich vergnügt in Spekulationen über Fremdverschulden und wer dahinterstecken könnte.
»Das ist doch einfach lächerlich«, schrie Ryan den Fernseher an. »Wer setzt denn absichtlich einen Stall voller Pferde in Brand?«
Da fielen mir eine Menge möglicher Gründe ein, aber ich behielt sie für mich.
Am Nachmittag um fünf verwehrte die Polizei Ryan noch immer den Zutritt zu den Stallgebäuden, sogar zum neuen Hof, der nicht mit Absperrband versehen war.
»Hören Sie mal«, sagte er zunehmend verärgert. »Trotz allem habe ich noch ein Geschäft zu führen. Meine Pferde haben heute noch nicht gearbeitet, außer dass sie am frühen Morgen in die Stadt spaziert sind. Die Rennleitung hat mir zwar erlaubt, meine beiden für Wolverhampton heute Nachmittag zurückzuziehen, aber für morgen in Beverley hab ich auch eins genannt, und gegen Ende der Woche hab ich einen ganzen Schwung Starter in York, Newbury und hier in Newmarket. Ist ja gut und schön, dass sie woanders im Stall stehen, aber ihre gewohnte Streu und ihr gewohntes Futter sind hier. Pferde mögen keine Veränderungen. Auch ohne Prince of Troy hab ich noch zwei fürs Dante am Donnerstag. Wenn ich die heute Abend nicht wieder herhole, haben sie keine Chance.« Und als wäre es ihm gerade noch eingefallen, fügte er hinzu: »Außerdem kommen meine Leute nicht in ihre Wohnungen. Ein paar sind noch im Schlafanzug.«
Nach weiterem hitzigen Hin und Her zwischen Ryan und den Polizeioberen wurde ihm der Zugang zum neuen Hof schließlich gewährt, unter der Bedingung, dass alle das obere Tor zur Straße auf der anderen Seite benutzten, weit genug weg vom alten Hof und vom Haus. Die Pfleger durften auch in ihr Wohnheim, aber die alten Ställe und die Wohnungen darüber blieben tabu.
»Was ist das Dante?«, fragte ich, als die Polizei fort war.
»Das Dante Stakes. Ein Rennen über zweitausend Meter in York am kommenden Donnerstag. Die letzte Probe, sechzehn Tage vor dem Derby. Prince of Troy wäre im Rahmen seiner Schlussvorbereitung vielleicht angetreten.« Er seufzte schwer. »Das brauche ich jetzt nicht mehr zu entscheiden. Fasse immer noch nicht, dass er tot ist. Das beste Pferd, das ich je hatte. Unersetzbar.«
Ich dachte bei mir, dass ich mir an seiner Stelle mehr Sorgen wegen des toten Menschen als wegen der toten Pferde gemacht hätte.
4
Seine Hoheit Scheich Ahmed Karim bin Mohamed Al Hamadi rief man nicht einfach so zum Plaudern an. Man musste per E-Mail einen Gesprächstermin vereinbaren, und meiner wurde auf sieben Uhr britischer Zeit am nächsten Morgen festgelegt.
Der Abend in Castleton House Stables war nach den vorausgegangenen Ereignissen relativ ruhig verlaufen.
Um kurz nach sechs wurden die vorübergehend in Tom Widgerys Stall untergebrachten Pferde im Schritt die Straße hinauf zum oberen Tor und auf den neuen Hof geritten.
Oliver, Maria und ich traten in der Abendsonne vor die Tür und schauten zu, wie sich die lange Reihe der Vollblüter am letzten verbliebenen Feuerwehrwagen vorbeischlängelte.
Weil Pfleger aus ganz Newmarket eingesprungen waren, lief die Rückkehr ohne Unterbrechung ab.
»Was für ein Anblick«, kommentierte ich das nicht enden wollende Hufgeklapper auf dem Asphalt.
»Wohl wahr«, stimmte Maria lachend bei. »Wie der Aufmarsch der Zirkustiere bei uns im Ort, als ich klein war.«
»Nur fehlen hier die Elefanten«, sagte ich.
»Ja«, meinte Oliver nüchtern. Dann drehte er sich um und ging wieder ins Haus. Maria und ich folgten ihm.
»Was zu trinken?«, fragte mich Oliver. »Ich brauch jetzt was. Unbedingt.«
»Ich habe ein Zimmer im Bedford Lodge Hotel gebucht«, sagte ich. »Ich sollte Sie beide jetzt in Frieden lassen.«
»Gin und Tonic?«, fragte Oliver und gab Eis in zwei Gläser.
»Ein Fahrer wartet auf mich.«