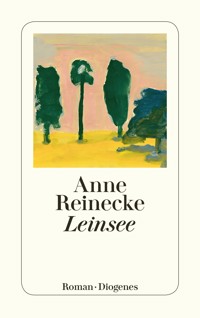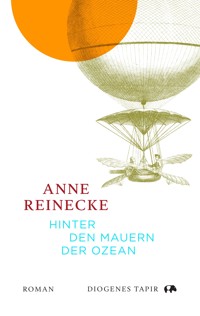
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Tapir
- Sprache: Deutsch
Die Welt ist im Wasser versunken. Der Stadtkern Berlins ist innerhalb einer gigantischen Mauer verschont geblieben. Fünf Menschen leben darin, fünf ›Ewige‹, die jeden Sommer den anreisenden ›Fremden‹ die alte Welt zeigen und ihr Wissen weitergeben. Im Winter sind sie sich selbst überlassen und leben und lieben in verschiedenen Konstellationen. Wird eine der zwei Frauen und drei Männer krank oder altert, verschwinden sie und ein Kind gleichen Namens und gleichen Aussehens kommt in die Stadt. Bis eine der ›Ewigen‹ diesen Zyklus durchbrechen will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Anne Reinecke
Hinter den Mauern der Ozean
Roman
Diogenes
I
Es gibt keinen Anfang. Es gibt kein Ende.
Wir sind die Ewigen. Es gab uns immer. Es wird uns immer geben.
Wir sind an den Ort gebunden. Der Ort ist an uns gebunden. Es gab ihn immer. Es wird ihn immer geben. Wir garantieren ihn. Er garantiert uns. Es gibt keinen Anfang. Es gibt kein Ende.
II
Natürlich stimmt das nicht. Natürlich gibt es einen Anfang. Der Anfang liegt im Dunkeln. Der Anfang liegt im Sumpf.
Man hat in der Nähe Feuersteine gefunden, die etwa sechzigtausend Jahre vor Beginn der Alten Zeit bearbeitet wurden. Damals müssen Menschen in der Nähe gewesen sein. Ob sie sich niederließen oder nur vorbeiwanderten, wissen wir nicht.
Wann die ersten Menschen hier sesshaft wurden, wissen wir nicht. Man hat eine Bohle eines alten Hauses ausgegraben und die Jahresringe gezählt. Der Baum war eine Eiche und wurde ungefähr im Jahr eintausendeinhundertachtzig alter Zeitrechnung gefällt. Es kann aber sein, dass es schon vorher Behausungen gegeben hatte, von denen nichts geblieben ist. Es hat oft gebrannt in der Alten Zeit. Es gab Kriege. Es gab Naturkatastrophen. Holz hält sich nicht gut. Wir wissen nicht viel.
Das älteste Schriftstück, in dem der Ort erwähnt wird, entstand siebenundfünfzig Jahre nachdem der Baum gefällt worden war. Das älteste Schriftstück, das noch erhalten ist. Vielleicht hat es noch ältere gegeben. Papier ist aus Holz gemacht. Es zerfällt oder verbrennt oder löst sich auf.
Als das Schriftstück entstand, war der Ort eine Stadt, die aussah wie eine befruchtete Eizelle nach der ersten Teilung, die Zellkerne zwei Kirchen, von denen eine heute noch steht. Das Fundament der Kirche ist aus unbearbeiteten Feldsteinen gebaut. Diese Steine müssen hier herumgelegen haben, als die Alten ankamen. Die oberen Schichten sind später entstanden. Steinquader, Backsteine. Kein besonders komplizierter Bau. Der Ort kann noch keine große Bedeutung gehabt haben, als diese Kirche errichtet wurde.
Kirchen waren Gotteshäuser. Die Alten hatten Götter. An diesem Ort zu dieser Zeit hatten sie einen dreigeteilten Gott, der unteilbar war, der ewig war und sterblich.
Wir sind fünf. Wir sind ewig. Wir sind sterblich.
Wir sind Friedrich, Wilhelm, Alexander, Else und Lola.
Ich bin Lola. Es gab mich vor mir, und es wird mich nach mir geben. Kein Anfang, kein Ende.
Natürlich stimmt das nicht. Natürlich wird es irgendwann ein Ende geben.
III
Im Sommer kommen die Schiffe. Ich stelle sie mir groß vor, weiß und glänzend. Sehr groß, sehr weiß und sehr glänzend. Ich stelle mir vor, dass sie aus einem Material gemacht sind, das mir unbekannt ist. Ein Material, das aussieht wie Eis und das härter ist als alles, was es innerhalb der Mauern gibt.
Das Härteste, was es innerhalb der Mauern gibt, ist Stahl. Ein Stahlskelett ist oft das Letzte, was stehen bleibt. Die Alten haben damit gebaut. Stahl, Beton, Glas, Backstein, Sandstein. Die Fußböden haben die Alten aus Holz gemacht und auch die Möbel. Es ist erstaunlich, wie oft ich intakte Stücke finde. Stühle, Tische, Schränke. Vergraut, spröde, aber noch ganz.
Wir sollen nicht ins ungesicherte Gebiet gehen. Wir sollen auf den instand gehaltenen Wegen bleiben. Wir sollen ausschließlich die instand gehaltenen Gebäude betreten. Ungesicherte Gebäude können jederzeit einstürzen.
Aber das passiert nur selten, und ich bin vorsichtig. Ich teste den Boden, bevor ich auftrete, ich halte mich von Löchern und morschen Stellen fern, ich misstraue den Geländern, jetzt im Winter habe ich einen Besen dabei, um den Schnee vor meinen Füßen wegzufegen und zu sehen, was darunterliegt, und zu beiden Jahreszeiten meide ich Räume, in denen größere Steine auf dem Fußboden liegen, denn Steine auf dem Fußboden sind aus der Decke gebrochen, und wo einer ist, kommen noch mehr.
Das Glas in den unteren Etagen der ungesicherten Gebäude ist längst zersplittert und weggewaschen, ich kann durch die Fenster in die Räume steigen. Nach etwas zu suchen lohnt sich dort selten, alles ist verwittert. Aber weiter oben gibt es ab und zu noch Scheiben in den Fenstern, sodass es dort wettergeschützt ist, dadurch ist der Erhaltungszustand besser.
Manchmal mache ich mir die Mühe, ein oder zwei Fenster zu putzen. Das ist eine heikle Angelegenheit, ich muss sehr vorsichtig sein, damit sie nicht aus den Rahmen brechen, zu viel Druck ist nicht gut, die Bauten im ungesicherten Gebiet vertragen das schlecht, nicht übertreiben, sonst war der ganze Einstieg umsonst. Aber wenn es mir gelingt, werde ich belohnt. Mit der Helligkeit wird es wärmer, und es treten Schätze zutage.
Im Licht kann ich Reste der Wandfarbe erkennen, sie muss einmal rosa gewesen sein. Ich ziehe meine Handschuhe aus und streiche mit den Fingerkuppen über die Wand, es fühlt sich glatter an, als ich gedacht habe. Beim Weitergehen bleibe ich mit dem Zeigefinger an der Wand: Farbe, Putz, Beton, Backstein, Putz, Backstein, Mörtel. Die Wand ist trocken.
In der Alten Zeit, der Dampfmaschinenzeit, als diese Häuser gebaut wurden, da gab es Menschen, die dort einzogen, so lange das Mauerwerk noch feucht war, weil sie sich nichts Besseres leisten konnten. Wenn dann alles trocken war und die echten Mieter kamen, zogen sie weiter, in das nächste feuchte Loch.
Trockenwohnen. Mietskasernen. So voll war die Stadt.
Jetzt gehört das alles mir. Genau genommen gehört es uns allen. Friedrich, Wilhelm, Alexander, Else und mir. Aber soweit ich weiß, bin ich die Einzige, die im ungesicherten Gebiet herumklettert. Es gibt Gegenden, in denen ich nicht mehr nachvollziehen kann, wo in der Alten Zeit die Straßen verliefen. Trümmer, dazwischen Grasflächen, Moos, Sand, im Sommer mit Eidechsen, im Winter mit Schnee. Birken, Linden und Essigbäume, im Winter kahl, im Sommer erst grün, dann rot. Der Blick reicht dort weit, und in der Ferne ragt die innere Mauer auf.
An anderen Stellen sind noch ganze Häuserblocks erhalten, vier Stockwerke. Kopfsteinpflaster oder aufgeworfener Asphalt. Wenn ich den Blick nicht hebe, kann ich mir hier vorstellen, dass die Ausdehnung der Stadt endlos ist. Oder dass sie an den Rändern in eine sanfte Landschaft übergeht, Hügel, Wiesen, Felder. Erst wenn ich nach oben sehe, erscheint über den Dächern der Hintergrund: Beton, darüber Himmel.
Durch das Fenster kann ich das gegenüberliegende Haus sehen. Es ist beinahe schwarz, darüber leuchtet weiß das schneebedeckte Dach, und aus dem Dach wächst eine einzelne Birke. Hier in meinem Raum ist der Boden trocken und stabil, es ist windgeschützt, und ich habe noch ein Stückchen Käse, eine Handvoll Rosinen und etwas Milch, das reicht bis morgen, dann muss ich zurück ins instand gehaltene Gebiet. Abseits der sicheren Wege kommen keine Pakete.
Ich nehme meinen Besen vom Gürtel, fahre den Stiel aus und fege ein Stückchen Boden frei. Dielen. Ich würde gern meine Stiefel ausziehen und barfuß auf dem rauhen Holz herumlaufen, aber ich widerstehe. Kalte Füße sind gefährlich. Splitter und Nägel sind gefährlich. Tetanus. Eiter. Blutvergiftung. Wir sollen auf uns achtgeben. Im Winter müssen wir alle Notfälle und Krankheiten selbst behandeln, das kann unangenehm werden.
Die Reste eines Sofas und eines Regals sind nur noch zu erahnen. Aber ein größerer Tisch, einer der Stühle und ein Schrank sehen beinahe unversehrt aus. Der Stuhl trägt mein Gewicht, doch ich bleibe nicht lange sitzen.
Mich interessieren der Schrank und sein Inhalt. Die Tür stellt sich bei näherer Betrachtung als Schiebetür heraus. Schiebetüren sind verklemmt, verzogen, eingerostet, immer. Auch diese hier lässt sich nicht bewegen, mit aller Kraft nicht, und selbst mit einem Hebel nicht, ich rutsche ständig ab. Ich überlege, einfach den ganzen Schrank kaputt zu schlagen. Das sollen wir nicht. Wir sollen das Erbe ehren. Wir sollen von den Alten singen. Wir sollen Bestehendes erhalten. Schlimm genug, dass ich das instand gehaltene Gebiet verlassen habe. Aber andererseits – da öffnet sich die Tür ein Stückchen, mit einem lauten Seufzen, als hätte sie meine Gedanken gehört.
Der Spalt ist breit genug für meinen Arm. Erst ertaste ich nur zerfallende Fetzen und rostige Kleiderbügel, das Übliche. Aber dann greife ich etwas Glattes, Flexibles, Großes und ziehe es heraus. Es ist gelb und aus Gummi. Ein Mantel. Er hat eine Kapuze, nur drei kleine Risse und keinen Verschluss mehr. Aber mit meinem Gürtel werde ich ihn schließen können. Ich schlüpfe hinein, er passt über meinen Thermoanzug. In der rechten Tasche entdecke ich Schimmel, aber auch ein rundes, verrostetes Stück Metall, wahrscheinlich eine alte Münze, so etwas findet sich immer wieder. Die Alten haben sie für kleineren Handel benutzt, zum Tausch gegen Waren oder Dienstleistungen. In der linken ertaste ich etwas, das ich zuerst für einen ausgerissenen Teil des Mantelstoffes halte. Es dauert einige Zeit, bis ich erkenne, was ich da in der Hand halte. Und nachdem ich es erkannt habe, dauert es noch einmal doppelt so lange, bis ich es auch glaube.
Papier im ungesicherten Gebiet zu finden ist eigentlich unmöglich. Natürlich gibt es noch Papier in der Stadt. Es gibt die umfangreichen Bestände in der Staatsbibliothek, die erhaltenen Schriften, die wir hüten und pflegen. Ohne sie wäre unsere Überlieferung nicht denkbar. Aber außerhalb hatte kein Papier Bestand. Eigentlich.
Vorsichtig. Nichts kaputt machen. Mit einem meiner Handschuhe wische ich ein Stück der Tischplatte so sauber wie möglich, bevor ich das Papier darauflege. Ich setze mich auf den Stuhl, atme möglichst flach und streiche es glatt, ganz sanft. Es ist ungefähr so breit wie zwei meiner Finger und so lang wie einer. An drei Seiten ist der Rand ausgefranst, die vierte Kante ist gerade. Farblich liegt es zwischen Hellgrau und Gelb, und es ist deutlich dicker als die Buchseiten in der Bibliothek. Ich betrachte es eine Weile, dann schiebe ich vorsichtig links und rechts die Nägel meiner Zeigefinger darunter und drehe das Papier um. Ich kann Reste einer gedruckten Schrift erkennen, aber sie ist sehr verblasst und schwer zu entziffern. Ich brauche einige Minuten, nur um herauszufinden, dass die Schrift auf dem Kopf steht. Lateinische Buchstaben. Ich nehme das Papier wieder auf meine Handfläche und gehe damit zum Fenster. Hier ist das Licht besser. Zeichen für Zeichen taste ich mich vor. Da steht:
01 – nicht übertragbar – berec
Mehr ist nicht zu entziffern. »Nicht übertragbar«, ich sage es vor mich hin und versuche, mir das Schriftbild einzuprägen.
»Nicht übertragbar, nicht übertragbar«, keine Serifen, »nicht übertragbar«, die Buchstaben dicht beieinander, »nicht übertragbar«. Ich verstaue das Papier so glatt und sicher wie möglich in meinem Notfalletui zwischen den Mullbinden und stecke es in die Innentasche meines Anzugs, links über der Brust.
Bei Anbruch der Dämmerung rolle ich meine Matte auf dem Holzboden aus, lege mich darauf und versuche, mir die Menschen vorzustellen, die hier gewohnt haben.
Wohnung. Flur, Küche, Bad, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer.
In der Alten Zeit haben die Leute in kleinen Gemeinschaften zusammengelebt.
Familie. Üblicherweise je zwei Erwachsene mit üblicherweise zwei sexuell gezeugten Kindern.
Jedes Kind sah anders aus. Geschwister unterschieden sich nicht nur untereinander, sondern auch von ihren Eltern. Ich versuche, mir das vorzustellen. Ich versuche, mir immer neue Kindergesichter auszudenken, indem ich Gesichter mische, die ich von Gemälden kenne. Die Marsham-Kinder, Amor als Sieger, Catharina Hooft. Wenn ich allein bin, spiele ich dieses Spiel vor dem Einschlafen. Neue Gesichter entstehen zu lassen gelingt mir erst, wenn ich unsere eigenen Kindergemäldegesichter mit hineinmische: Friedrich, Wilhelm, Else, Alexander, ich.
Die Gemälde von uns sind oft älter als wir selbst. Ich sehe aus wie die Lola vor mir, und die Lola vor mir sah aus wie die vorangegangene Lola und immer so weiter. Auf den Lolagemälden kann ich mich als Zweijährige sehen, mit fünf Jahren, mit fünfzehn, ich kann sehen, wie ich jetzt aussehe, und ich kann sehen, wie ich altern werde. Auf den letzten Gemälden zähle ich vielleicht fünfundsechzig oder siebzig Sommer. Was danach kommt, weiß ich nicht.
Wie die Kinder der Fremden aussehen, weiß ich nicht. Mit den Schiffen kommen keine Kinder.
Die Einzigen, die die Festung als Kinder betreten dürfen, sind wir. Wenn wir ankommen, können wir allein laufen und essen. Das Sprechen lernen wir in den Mauern. Das Erinnern lernen wir in den Mauern.
Die Einzigen, die in der Festung bleiben dürfen, sind wir.
Wir sind die Glücklichen. Wir sind die Ewigen.
IV
Im Winter bewegt sich Friedrich kaum noch aus Tempelhof weg. Von Jahr zu Jahr wird es schlimmer mit ihm. »Das ist der sicherste Ort«, sagt er. »Wir müssen am Rand bleiben. Wir müssen so weit wie möglich vom Tor wegbleiben. Und wir müssen höhergelegene Gebiete aufsuchen.« Wenn ich ihn sehen will, muss ich ihn besuchen.
Wir sitzen mit dem Rücken an der inneren Mauer und hören der Brandung zu. Die Wellen brechen an der Außengrenze. Im Sommer ist das kaum zu hören, ein leises Rauschen, das mit dem Brummen der Pumpen verschwimmt, monoton und beruhigend. Aber jetzt ist es ein Donnern, und wir spüren die Erschütterung in unseren Wirbelsäulen. Wir spüren sie, obwohl das unmöglich ist. Friedrich hat seismische Messungen angestellt, der Doppelring bewegt sich nicht.
»Das ist der sicherste Ort«, sagt er.
Dir fehlt das Vertrauen, denke ich, nirgendwo könnte es sicherer sein als in der Festung. Die Festung ist ewig und heilig, wir sind ewig und heilig, die Fremden ehren und bewahren uns. Und wenn sie uns wirklich fluten wollten, wäre es egal, wo wir uns aufhalten.
»Ja«, sage ich.
Der Nebel verbirgt die Stadt, wie wir sie kennen. Wenn wir den Blick nach vorn richten, sehen wir die Dächer nicht und nicht die Türme, wir sehen die Kuppeln nicht und nicht die Mauer. Wir sehen nur unser Feuer und dahinter die große Ebene der Freiheit, in der Ferne verwischt sich das Panorama, kein Himmel, kein Beton, nur Weiß. Dahinter könnte sich alles verbergen.
Mit der Schneedecke sieht die Freiheit aus wie eine vereiste Wasserfläche, vereinzelt ragen kleine Inseln mit Sträuchern heraus. Auf der anderen Seite stehen zwischen den Bäumen die Büffel und die Pferde. Die Tiere bleiben beieinander, und sie meiden die Nähe der Mauer. Vielleicht ein Instinkt, den wir verloren haben.
»Ich weiß noch, wie du angekommen bist«, sagt Friedrich. Ich kenne die Geschichte, er hat sie mir tausendmal erzählt, früher habe ich sie gern gehört. Klein war ich, dünn und blass, geschrien habe ich und getreten, wie eine Verrückte getreten und geschrien, und trotzdem habe ich schon ausgesehen wie eine echte Lola, wie die alte Lola, seine Lola. Das hat Friedrich gleich erkannt, an meinen großen, dunklen Augen hat er erkannt, wer ich bin, und es hat ihn traurig gemacht und gleichzeitig glücklich, er hat mich in die Arme genommen, und da hat er geweint, zum ersten Mal, seit er sich erinnern kann.
Drei Nächte vorher, als die alte Lola entschwunden war, hat er nicht geweint.
»Ich weiß auch nicht, warum nicht«, sagt Friedrich.
»Vielleicht hast du bis dahin gehofft, dass sie doch noch zurückkommt«, sage ich, »dass sie nicht wirklich entschwunden ist. Es hätte ja sein können, dass sie sich nur versteckt, irgendwo im ungesicherten Gebiet. Die Stadt ist groß.«
»Nein«, sagt Friedrich, »ich wusste, dass ich sie nicht wiedersehen werde. Ich habe sie gerufen, drei Mal, mit dem Linearfunk und mit dem Echo, sie hat nicht geantwortet, und da wusste ich es.«
Er steht auf, dreht mir den Rücken zu, greift sich eine Handvoll Reisig und wirft es ins Feuer. Die Flammen lodern kurz auf, dann beruhigen sie sich.
Das Entschwinden der alten Lola stellt eine Ausnahme dar. Sie ist entschwunden, bevor ich angekommen bin. So etwas passiert eigentlich nicht. Eigentlich hätten wir einen Winter zusammen in der Festung leben sollen.
»Hast du schon mal überlegt –«, sage ich.
Friedrich schüttelt den Kopf. »Nein. Sie wäre nicht abgehauen, ohne etwas zu sagen. Das hätte sie nicht gemacht. Mir hätte sie es gesagt.«
»Ja«, sage ich, »ganz bestimmt.«
»Sie ist entschwunden«, sagt Friedrich.
»Ja.«
»Außerdem ist noch nie jemand abgehauen.«
Das kannst du gar nicht wissen, denke ich. Ich sage: »Ja, ich weiß.«
»Noch nie«, sagt Friedrich.
»Du wärst der Erste«, sage ich.
»Wir«, sagt Friedrich. »Wir werden die Ersten sein. Du und ich.«
Ich sage nichts.
Später, als es kälter wird, will er mir das Boot zeigen. Arm in Arm gehen wir über die verschneite Freiheit, unsere Schritte klingen wie Zähneknirschen. Bei den Büffeln und Pferden machen wir halt. Die Tiere brauchen nicht viel Pflege, ihr Futter finden sie auch unter dem Schnee, im Grunde könnten wir sie sich selbst überlassen, aber es ist gut, wenn sie an uns gewöhnt sind, vor allem die Pferde. Wenn wir uns nähern, kommen sie auf uns zu und begrüßen uns, sie schnauben, und manchmal legen sie ihre warme Stirn an unsere. Die Büffel heben die Köpfe.
Vor vier Wintern hat Friedrich damit begonnen, die Büffelmütter zu melken. Sie produzieren jetzt mehr, als die Kälber brauchen, und wir können Milch trinken und Käse machen. Es ist wichtig, nicht von den Paketen abhängig zu sein, sagt Friedrich. Am Rande der Freiheit hat er einen Acker angelegt. Dort zieht er Rüben. Sobald es taut, wird er die Aussaat vorbereiten.
Ich bin gern bei den Tieren. Sie dampfen warm, riechen nach Kraft, und es gefällt ihnen, wenn ich sie am Kopf kraule. Ihr Fell ist rauh und dicht.
Beim Melken ist die Reihenfolge wichtig. Erst sind die Kälber an der Reihe, der Rest ist für uns. Heute sind es etwa vier Liter, die wir mitnehmen, nicht übertreiben, melken wir sie zu viel, produzieren die Büffelmütter noch mehr, und dann fangen sie an, nach uns zu rufen, wenn wir unserer Aufgabe nicht nachkommen. Das kann im Sommer zum Problem werden oder spätestens, wenn wir irgendwann nicht mehr hier sein sollten.
Tief im Keller des Flughafengebäudes, dort, wo sonst niemand hingeht, weil es viel zu dunkel und viel zu verwinkelt ist, liegt das Boot. Ich bin die Einzige, die davon weiß. Ich musste versprechen, niemandem davon zu erzählen, vor allem Wilhelm nicht.
Der Weg führt durch unzählige Gänge, obwohl ich schon tausendmal hier war, würde ich ohne Friedrich nicht zurückfinden. Er hat uns Helme mit Stirnlampen gebaut. Tagsüber legt er sie in die Sonne, damit sie sich aufladen. Wir gehen mit gesenkten Köpfen, sodass wir den Boden vor unseren Füßen beleuchten.
Das Boot liegt in Einzelteilen in einer großen Halle. Seit ich mich erinnern kann, baut Friedrich daran. Schon als ich noch ein Kind war, hat er mich hierher mitgenommen, sobald ich alt genug war, ein Geheimnis zu hüten. Er hat mir Stoffballen gezeigt, Werkzeuge, Holz- und Metallstücke und gesagt: »Das ist unser Boot, Lola. Damit fahren wir weg.«
Ich suche die Bruchstücke mit meinem Lichtkreis ab. In meinen Augen hat sich nichts verändert, seit ich zuletzt hier war. Ich glaube nicht, dass Friedrich jemals damit fertig wird. Das ist ein beruhigender Gedanke. Er soll hierbleiben. Seit ich mich erinnern kann, ist er da. Ich stelle mich neben ihn und lehne meinen Kopf an seinen Hals. Dort hat er eine helle Narbe, wie eine Mondsichel. Wenn wir nebeneinander stehen, leuchtet dieser Mond genau auf der Höhe meines Mundes. Das ist meine Lieblingsstelle. Unsere Lichtstrahlen kreuzen sich. Friedrich legt seinen Arm um mich. Er atmet schwer. Der Weg hat ihn angestrengt, und er ist aufgeregt.
»Siehst du«, sagt er, »der Rumpf«, er leuchtet ein größeres Metallstück ab, »ich habe ihn leichter gemacht, schmaler und stabiler, so wird das Ganze einfacher zu heben und zu senken sein.«
»Ja«, sage ich.
»Und ich habe die Beschichtung für die Nähte verändert. Der Ballonteil kann so größere Hitze aushalten.«
»Ja«, sage ich, »das ist gut.«
Die Konstruktion besteht aus zwei Teilen. Es gibt den Ballon, der nach der Überwindung der Doppelmauer eingeholt werden soll, vielleicht wird er auch abgeworfen werden müssen, das hat Friedrich noch nicht entschieden.
Ballons waren die ersten Fahrzeuge, mit denen Menschen in die Luft stiegen, auch unter den Alten gab es immer mal wieder welche, die so etwas selbst gebaut haben. Das System ist nicht sehr kompliziert, bloß die Näherei ist eine endlos monotone Arbeit.
Der Ballon muss nur aufsteigen, er muss groß genug sein, um zu tragen, was unten daranhängt, er muss die vermutlich recht kurze Distanz zwischen der äußeren und inneren Mauer überwinden und dann wieder absinken. Wenn man es richtig macht, ist das nicht gefährlich, sagt Friedrich, wir verwenden ja Gas nur für den Brenner. Er hat dafür Kartuschen gesammelt, die eigentlich für seinen Kocher bestimmt waren. Gas im Ballon selbst wäre viel zu riskant, Brandgefahr, schwer zu kontrollieren, auch besteht das Risiko, zu hoch aufzusteigen und dann zu erfrieren oder zu wenig Sauerstoff zu bekommen, das alles lässt sich aus den Fehlern der Alten lernen, sagt Friedrich. Deshalb will er Heißluft verwenden, das können wir gut kontrollieren, wenn wir den Brenner erst richtig eingestellt haben.
Der Knackpunkt ist der untere Teil, das Boot. Es muss leicht genug sein für den Ballon und stabil genug für die Fahrt von unbestimmter Länge.
Unzählige Modelle hat Friedrich sich ausgedacht, zu bauen begonnen, getestet und wieder verworfen, diverse Flöße, zwei Mini-U-Boote, einen Katamaran, ein Schilfboot, alles umsonst.
Das aktuelle Modell ist recht klein und eine Art Kapsel. Es ist aber kein U-Boot, es soll an der Oberfläche schwimmen und mit einem Segel angetrieben werden.
Der Innenraum wird sich wasserdicht schließen lassen. Links und rechts müssen noch Auftriebskörper angebracht werden. Friedrich hat eine Belüftung entworfen, und es gibt eine Kuppel aus durchsichtigem Kunststoff, durch die man nach draußen sehen kann, ohne die Kapsel zu verlassen.
Etwa 370 Seemeilen. Plus/minus.
Wenn es die Alpen wirklich gibt. Ich habe Gemälde gesehen. Der Watzmann. Das alles könnte auch ausgedacht sein.
Ich löse mich von Friedrich, gehe einen Schritt zur Seite und leuchte sein Gesicht an. Wenn er lacht, sieht er jung aus und anders. Er leuchtet mich auch an und legt den Kopf schräg.
»Das wird funktionieren, Lola«, sagt er, »du wirst sehen. Weißt du noch, wie ich dir von Odysseus erzählt habe?«
»Ja«, sage ich, »ich weiß. Es war aussichtslos, aber er hat nicht aufgegeben, und am Ende ist er angekommen.«
»Genau.« Friedrich lacht.
Ich habe die Landkarten gesehen. Wieder und wieder habe ich mich mit Friedrich darübergebeugt. Entfernungen, Höhenlinien, Himmelsrichtungen, das alles haben wir mit unseren Fingern nachgefahren, das alles haben wir uns gemerkt. Südsüdwest. Warum sollten die Landkarten ausgedacht sein?
»Warte mal«, sage ich. »Ich hab was für dich.« Ich gehe in die Hocke, wühle in meinem Rucksack und ziehe den gelben Mantel heraus. »Da«, sage ich. »Vielleicht kannst du das brauchen. Eine Stelle ist ein bisschen verschimmelt, aber der Rest ist gut.«
»Gummi! Lola!« Friedrich umarmt mich, hebt mich hoch und dreht uns im Kreis. »Gummi, Lola, wunderbar! Wo hast du das her?«
»Aus dem ungesicherten Gebiet. Und ich hab noch was gefunden. Das zeig ich dir oben.«
Friedrich hat eine Ecke des südwestlichen Hangars mit Fellen und Stoffen abgeteilt und sich dort eine Behausung eingerichtet. Alle Möbel hat er selbst gebaut. Es gibt ein großes Bett, einen Tisch mit fünf Stühlen und verschiedene Truhen und Kästen, in denen er Karten und Bücher aufbewahrt. Das sollen wir nicht. Die Bestände sollen in der Staatsbibliothek verbleiben. So steht es in den Schriften. Aber die Schriften sind alt und müssen interpretiert werden, sagt Friedrich, und außerdem wird er alles zurückbringen, und wer im ungesicherten Gebiet herumwandert, soll mal lieber die Klappe halten.
Ich setze mich an den Tisch.
»Willst du was trinken?«, fragt Friedrich.
»Nein, nichts Flüssiges, bitte!«
Vorsichtig packe ich das Papier aus. Es ist noch intakt.
Friedrich setzt sich, sieht sich meinen Schatz an und nickt.
Ich hatte mir mehr Begeisterung erhofft.
»Papier«, sage ich. Er nickt.
»Nicht aus der Staatsbibliothek«, sage ich.
»Ja«, sagt Friedrich.
»Und da steht was drauf.« Er nickt.
»Nulleins, nicht übertragbar, berec«, lese ich vor. Er schweigt.
»Es könnte vielleicht berechtigt heißen«, sage ich, »oder berechnet oder berechnend.« Nichts.
»Friedrich?«
»Ja«, sagt Friedrich. »Entschuldige bitte. Manchmal wird mir die Ähnlichkeit zu viel.«
Ich bin still, sehe ihm in die Augen und warte.
Friedrich seufzt. »Entschuldige, du kannst das ja gar nicht wissen. Lola, also, die alte Lola, meine Lola, die hat auch manchmal Papier gefunden. Im ungesicherten Gebiet. Sie hat es gesammelt und bei mir gelassen. Ich dachte immer, das ist ein Geschenk, für mich. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, vielleicht war es auch für dich.«