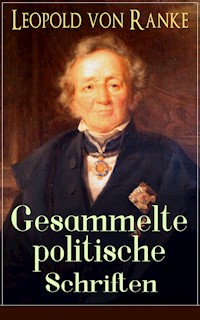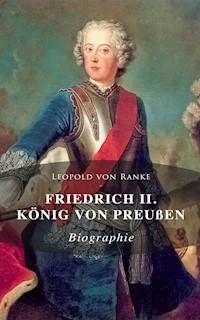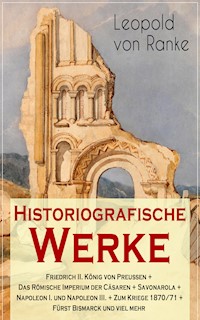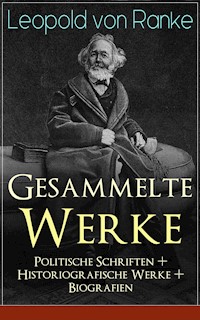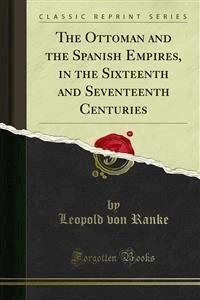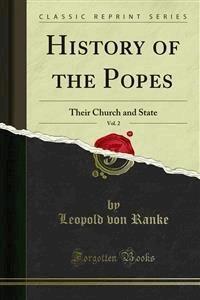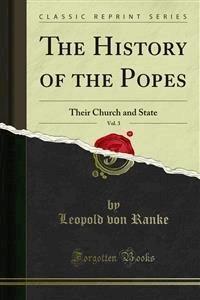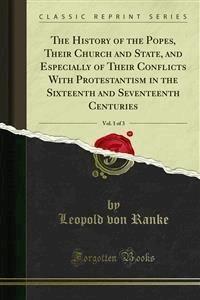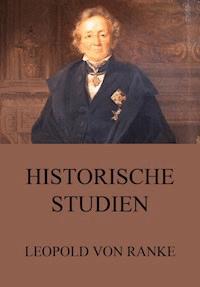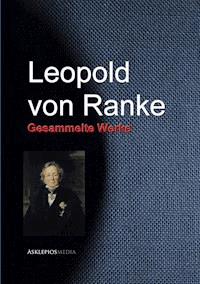Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Leopold von Ranke war ein deutscher Historiker, Historiograph des preußischen Staates, Hochschullehrer und königlich preußischer Wirklicher Geheimer Rat. Dieser Sammelbandbeinhaltet die folgenden historischen Schriften: Frankreich und Deutschland Vom Einfluß der Theorie Politisches Gespräch Geschichte und Philosophie Über die Epochen der neueren Geschichte Über die Verwandtschaft und den Unterschied der Historie und der Politik Friedrich II. König von Preußen Zum Kriege 1870/71
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Historische Schriften
Leopold von Ranke
Inhalt:
Leopold von Ranke – Biografie und Bibliografie
Frankreich und Deutschland
Vom Einfluß der Theorie
Politisches Gespräch
Geschichte und Philosophie
Über die Epochen der neueren Geschichte
Erster Vortrag
Zweiter Vortrag
Dritter Vortrag
Vierter Vortrag
Fünfter Vortrag
Sechster Vortrag
Siebenter Vortrag
Achter Vortrag
Neunter Vortrag
Zehnter Vortrag
Elfter Vortrag
Zwölfter Vortrag
Dreizehnter Vortrag
Vierzehnter Vortrag
Fünfzehnter Vortrag
Sechzehnter Vortrag
Siebzehnter Vortrag
Achtzehnter Vortrag
Über die Verwandtschaft und den Unterschied der Historie und der Politik
Friedrich II. König von Preußen
Zum Kriege 1870/71
Historische Schriften, Leopold von Ranke
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849639037
www.jazzybee-verlag.de
Leopold von Ranke – Biografie und Bibliografie
Deutscher Geschichtschreiber, geb. 20. Dez. 1795 (nach dem Kirchenbuche. nach der Familienüberlieferung 21. Dez.) zu Wiehe in Thüringen, gest. 23. Mai 1886 in Berlin, in Schulpforta erzogen, studierte in Halle und Berlin Theologie und Philologie und wirkte seit 1818 als Oberlehrer am Gymnasium in Frankfurt a. O., wurde aber infolge seiner »Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494–1535« (Bd. 1, Berl. 1824) und die dazu gehörige Schrift »Zur Kritik neuerer Geschichtschreiber« (das. 1824; von beiden 3. Aufl., Leipz. 1885) 1825 als Professor der Geschichte an die Universität Berlin berufen. 1827 sandte ihn die Regierung zur Sammlung archivalischen Materials nach Wien, Venedig, Rom und Florenz, und er entdeckte dabei die von ihm erfolgreich verwerteten venezianischen Gesandtschaftsberichte. Die Resultate seiner Forschungen legte R. nieder in den Werken: »Fürsten und Völker von Südeuropa im 16. und 17. Jahrhundert« (1. Bd.: »Die Osmanen und die spanische Monarchie«, Hamb. 1827, 4. Aufl. 1877); »Die serbische Revolution« (das. 1829, 3. Aufl. u. d. T.: »Serbien und die Türkei im 19. Jahrhundert«, Leipz. 1879); »Über die Verschwörung gegen Venedig im J. 1618« (Berl. 1831) und die Vorlesungen »Zur Geschichte der italienischen Poesie« (das. 1837). In seiner damals begonnenen »Historisch-politischen Zeitschrift« (Bd. 1, Hamb. 1832; Bd. 2, Berl. 1833–36) suchte er durch ein auf Einsicht in die geschichtlichen Vorbedingungen des Staatslebens gebautes Programm den Liberalismus zu bekämpfen. Großen Beifall fand das erste seiner Hauptwerke, zugleich als 2. Band der »Fürsten und Volker«: »Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im 16. und 17. Jahrhundert« (Berl. 1834 bis 1836, 3 Bde.; 10. Aufl. 1000). Die andre Seite des europäischen Lebens im 16. und 17. Jahrh., die Gründung des Protestantismus, behandelte er in seinem zweiten Hauptwerk, der »Deutschen Geschichte im Zeitalter der Reformation« (Berl. 1839–47, 6 Bde.; 7. Aufl., Leipz. 1894, 6 Bde.). 1841 zum Historiographen des preußischen Staates ernannt, schrieb er »Neun Bücher preußischer Geschichte« (Berl. 1847–1848, 3 Bde.), wovon eine neue, mit einer Einleitung: »Genesis des preußischen Staats«, vermehrte Ausgabe u. d. T.: »Zwölf Bücher preußischer Geschichte« (Leipz. 1874, 5 Bde.; vermehrt 1878–79, 5 Bde.) erschien. Er wandte sich darauf der französischen und englischen Geschichte zu und lieferte die »Französische Geschichte, vornehmlich im 16. und 17. Jahrhundert« (Stuttg. 1852–61, 5 Bde.; 3. Aufl. 1877–79) und »Englische Geschichte, vornehmlich im 16. und 17. Jahrhundert« (Berl. 1859–68, 7 Bde.; 4. u. 3. Aufl. 1877–79, 9 Bde.), bei der er ebenfalls neueröffnete Quellen benutzte. Daran schlossen sich: »Geschichte Wallensteins« (Leipz. 1869, 5. Aufl. 1895); »Zur deutschen Geschichte. Vom Religionsfrieden bis zum Dreßigjährigen Krieg« (das. 1869, 3. Aufl. 1888); »Der Ursprung des Siebenjährigen Kriegs« (das. 1871); »Die deutschen Mächte und der Fürstenbund« (das. 1871, 2 Bde.; 2. Aufl. 1876); »Abhandlungen und Versuche« (das. 1872, 2. Aufl. 1877; neue Sammlung, hrsg. von A. Dove, 1888); »Aus dem Briefwechsel Friedrich Wilhelms IV. mit Bunsen« (das. 1873, 2. Aufl. 1874); »Ursprung und Beginn der Revolutionskriege 1791 und 1792« (das. 1875, 2. Aufl. 1879); »Zur Geschichte von Österreich und Preußen zwischen den Friedensschlüssen zu Aachen und Hubertusburg« (das. 1875); die »Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten von Hardenberg« (das. 1877 vis 1378, 5 Bde.), daraus als Auszug: »Hardenberg und die Geschichte des preußischen Staats von 1793 vis 1813« (das. 1880–81, 2 Bde.); ferner: »Friedrich d. Gr.; Friedrich Wilhelm IV. Zwei Biographien« (das. 1878); »Historisch-biographische Studien« (das. 1878); »Zur venezianischen Geschichte« (das. 1878); »Zur Geschichte Deutschlands und Frankreichs im 19 Jahrhundert« (hrsg. von A. Dove, das. 1887). Einen großartigen Abschluß seiner historiographischen Tätigkeit sollte die noch in spätem Alter begonnene und daher nicht vollendete »Weltgeschichte« (Leipz. 1881–88, 9 Bde. in wiederholten Auflagen; Bd. 7–9 hrsg. von Dove, Wiedemann und Winter; Textausgabe in 4 Bdn. 1895, 2. Aufl. 1896) bilden; sie behandelt nur das Altertum und einen Teil des Mittelalters. Als Separatausgabe aus dem 9. Band erschienen die 1854 vor König Max II. von Bayern gehaltenen Vorträge »Über die Epochen der neuern Geschichte« (3. Abdruck, Leipz. 1906). Eine Gesamtausgabe der Werke Rankes erschien 1868–90 zu Leipzig in 54 Bänden. Im akademischen Unterricht (bis 1872) pflegte R. außer seinen Vorlesungen besonders die historischen Übungen. Aus diesen Übungen ist die Rankesche Schule hervorgegangen, der namhafte Historiker der 2. Hälfte des 19. Jahrh. angehören. Die von ihm begründeten »Jahrbücher des Deutschen Reiches unter dem sächsischen Haus« (Bd. 1–3, Abt. 1, Berl. 1837–40) enthielten Arbeiten seiner Schüler. Am 21. Dez. 1865 wurde er geadelt und nach Böckhs Tod 1867 Kanzler des Ordens Pour le mérite. Bei der Feier seines 50- und 60jährigen Doktorjubiläums (20. Febr. 1867 und 1877) ward er von der deutschen Geschichtswissenschaft als ihr Altmeister geehrt und 1882 zum Wirklichen Geheimen Rat mit dem Prädikat »Exzellenz« ernannt. Als Geschichtschreiber nimmt R. eine hervorragende Stelle in Deutschland ein. Er besaß einen seltenen Fleiß und Scharfsinn im Aussi uden von Quellen und im Sichten des Materials und übte methodische Kritik; sein Sinn für die konkreten Erscheinungen des Lebens, sein zugleich scharfer und tiefer psychologischer Blick geben seinen Darstellungen eine plastische Form von hoher Vollendung; namentlich in der Charakteristik einzelner hervorragender Personen und der sie bestimmenden psychologischen Elemente ist er Meister. Am 3. März 1906 wurde in seiner Vaterstadt, wo ihm schon vorher ein Denkmal errichtet war (enthüllt 27. Mai 1896), ein Leopold von Ranke-Verein begründet, der sich die Erhaltung des im Geburtshaus untergebrachten Rankemuseums zur Pflicht macht. Rankes Bildnis s. Tafel »Deutsche Geschichtschreiber« (Bd. 7). Vgl. Rankes Schrift »Zur eigenen Lebensgeschichte« (hrsg. von Dove, Leipz. 1890); Winckler, Leopold v. R. Lichtstrahlen aus seinen Werken (Berl. 1885); v. Giesebrecht, Gedächtnisrede auf Leopold v. R. (Münch. 1887); Guglia, Leopold v. Rankes Leben und Werke (Leipz. 1893); M. Ritter, Leopold v. R. (Rede, Stuttg. 1895); Nalbandian, Leopold v. Rankes Bildungsjahre und Geschichtsauffassung (Leipz. 1901); Helmolt, Leopold R. (das. 1907).
Frankreich und Deutschland
1832
Der Aufgabe, die Revolution in ihrem Wesen, in ihrer eigentümlich französischen Natur aufzufassen, steht eine andere zur Seite, ihre Wirkung auf Europa wahrzunehmen.
Ich meine nicht allein jene Wirkung, welche, durch Kriegstaten und Friedensschlüsse hervorgebracht, sich in Veränderungen der Gebiete zeigt. Auch wenn man alle Schlachten und alle Bewegungen der Diplomatie und all dies Hin- und Wiederwogen der streitenden Kräfte von Moment zu Moment verfolgt hat, so könnte sich finden, daß man die eigentlich politische Frage, auf die es dem gegenwärtigen Augenblick vor allem ankommt, nicht allein nicht erledigt, sondern kaum berührt hätte.
Die Frage ist, welchen innern Zustand der europäischen Länder die Revolution fand, wie sie auf ihn einwirkte und ihn abänderte, welche Rückwirkungen hierauf im Gefolge der Ereignisse eingetreten sind. Nicht in ein paar allgemeinen Gedanken, sondern in diesem unvermeidlichen Wechsel sehr bestimmter Zustände liegt alles, was es in unserer Lage Peinliches oder Zufriedenstellendes geben mag, liegen alle unsre Hoffnungen und Gefahren.
Ich wollte, es wäre mir gelungen, die individuelle Physiognomie der Restauration in Frankreich wenigstens einigermaßen vor Augen zu legen. Man würde, denk' ich, durch das unmittelbare Selbstgefühl überzeugt sein, daß wir mit dem rein französischen Kampfe, in welchem man dort begriffen ist, mit dem eigentlichen Inhalt jener Bewegungen wenig gemein haben.
Allerdings haben Revolution und Restauration in ganz Europa, sie haben auch bei uns Analogien gehabt; allein es fehlt viel, daß sie sich in irgendeinem Lande, daß sie sich bei uns in ihrem Wesen wiederholt hätten.
Als die Revolution zu erobern anfing, hatte sie bereits die Stadien ihrer großen Gärung vollendet; sie hatte das alte Frankreich bereits von oberst zu unterst gekehrt und ein neues gegründet; sie bedurfte wieder der Ordnung. Wo sie erschien, zerstörte sie zwar unerbittlich die alten Formen; aber die Elemente des Vorhandenen konnte sie nicht so völlig zersetzen, wie in Frankreich: sie mußte sie schonen, um sie sich sofort dienstbar zu machen.
Italien hat mehr mit Frankreich gemein, als so leicht ein anderes Land; es ist romanisch, katholisch, zum Teil von Bourbonen regiert und denn auch am längsten in den Händen der Eroberer gewesen; italienische Bildung und Literatur hängt schon durch die Sprache mit der französischen genau zusammen. Bei alledem – hat es wohl die Revolution vermocht, Italien in den wesentlichsten Momenten dem Zustande von Frankreich gleichzumachen? Man vergleiche nur jene sechzehn Millionen Quoten der Grundsteuer, die in Frankreich bezahlt werden, mit der Anzahl der Besitzer in Italien! Diese unveränderlichen Stadt-Aristokratien von Italien, die sich von Jahrhundert zu Jahrhundert unwandelbar vererbt haben, sie bestehen noch; sie besitzen das Land noch heute. Es gibt daselbst eine Aufregung; allein ein Irrtum wäre, zu glauben, die Worte, deren man sich dort bedient, hätten die nämliche Bedeutung, wie in Frankreich: die Aufregung ist in der Aristokratie. Wenn ich nicht irre, so kommt sie hauptsächlich daher, weil einige von den gegenwärtigen Regierungen das Geheimnis nicht gefunden haben, die Landbesitzer in ihre Interessen zu ziehen, ein Geheimnis, das die früheren recht gut verstanden. Und sollte es nun der Revolution wohl gelungen sein, die deutschen Dinge den französischen gleichzumachen?
Es ist auch bei uns eine große Veränderung vorgegangen; allein mit der kann sie nicht verglichen werden, welche in Frankreich eingetreten ist. Jene völlige Umwälzung des Besitzes und des Rechtes, jene Schöpfung einer neuen Nation und eines neuen Daseins, jene vollkommene Lossagung von aller Vergangenheit, die in Frankreich stattgefunden, bei uns ist sie nicht wiederholt worden. Wo wäre vollends in protestantischen Ländern jener Haß wider den Klerus, der einen so hauptsächlichen Grundbestandteil der französischen Bewegungen bildet? Wo wäre der Gegensatz eines alten und eines neuen Adels? Eines zwischen der alten und einer neuen Generation streitigen Besitzes? Wo wären bei uns zwei so entschieden, zwei durch so blutige Vorgänge entzweite Parteien, ja Bevölkerungen? Wo hätte man endlich die alte Treue so ganz verleugnet und die Bande, welche ein fürstliches Geschlecht mit seiner Landschaft verknüpfen, so völlig in den Staub getreten und dem Hasse, der Verhöhnung preisgegeben?
Nein! so weit ist es nicht gekommen, – damals, als die Revolution auf uns einwirkte. Ebensowenig hat auch die Restauration eine Wiederholung in Deutschland gefunden.
Es ist wahr, es sind auch bei uns einige verjagte Fürsten aus der Verbannung zurückgekommen; aber welch ein Unterschied! Nicht von ihrem Volke waren sie verjagt worden, sondern von den verhaßten Fremden. Jenes Gefühl der Nationalunabhängigkeit, welches die Franzosen in der Herstellung der Bourbonen verletzt zu sehen geglaubt haben, es kam den deutschen Fürsten zu Hilfe: es rief sie herbei; es war befriedigt, als man dieselben in den Schlössern ihrer Hauptstädte wieder Platz nehmen sah. Gewiß! diese Fürsten haben, eben weil sie entfernt gewesen waren, besondere Schwierigkeiten vorgefunden; allein mit der Aufgabe der Bourbonen läßt sich die ihre nicht vergleichen; auch waren ihrer nur wenige. Will man wissen, was eine Restauration in Deutschland gewesen sein würde? Wofern man daran gedacht hätte, das Kaisertum wiederherzustellen, Kurfürstentümer, bischöfliche Sitze, alle die alten Unmittelbarkeiten und das gesamte Gerüst des Römischen Reiches Deutscher Nation wiederaufzurichten, wofern eine solche Erneuerung des alten mit allem, was seitdem in Widerspruch mit demselben zum Leben gekommen war, in Kampf gesetzt worden wäre, dann würde von einer Ähnlichkeit die Rede sein können. Auch dann selbst wäre sie nicht einmal vollkommen. Es hätte erst dazu gehört, daß jene Institute wahrhaft eingreifend, wirksam, herrschend gewesen wären, und daß sie zu einer ähnlichen Macht wieder hätten erhoben werden sollen. Allein man bekenne: sie waren bereits abgestorben, sie waren reif zum Tode; wenn man sie an einigen Orten vermißt, so wünscht man sie nicht zurück, wie sie waren, sondern wie sie hätten sein sollen.
Was uns demnach von den Franzosen unterscheidet, es ist zwar – man weiß es – ohne Zweifel auch jener von Grund aus verschiedene Nationalcharakter, der ganz andere Bedürfnisse hat, ganz andere Gesichtspunkte verfolgt; doch ist er es lange nicht allein: die Lage der Dinge ist eine andere. Revolution und Restauration haben auch uns betroffen: doch hat uns jene nicht so vollkommen verändert, sie ist entfernt davon gewesen, eine neue Generation zu bilden: diese aber hat das Alte bei weitem nicht wieder auferweckt.
Käme es darauf an, das Unterscheidende, was diese Ereignisse in Deutschland gehabt haben, in der Kürze mit einem Worte zu bezeichnen, so ließe sich sagen: "Die Neuerung ist im Bunde mit den Fürsten vollbracht worden." Durch ebendieselbe Veränderung, welche den inneren Zustand der Länder zwar nicht wie in Frankreich umgewälzt, aber doch so wesentlich anders gestaltet hat, sind die Fürsten zu der Macht gekommen, die sie jetzt haben. Man betrachte einmal das Schicksal der geistlichen Güter. In dem katholischen Deutschland sind sie nicht viel anders in den Privatbesitz übergegangen, als in Frankreich: der Unterschied ist nicht groß. Aber wenn dort die Bourbonen ein Interesse dabei hatten, den Klerus in sein altes Eigentum wieder herzustellen – denn in den Fall der Geistlichkeit waren sie selber verwickelt gewesen – so beruht dagegen die Macht unsrer deutschen Staaten, unsrer deutschen Fürsten zum guten Teil auf den nämlichen Säkularisationen; und wollten sie sich den Grundsätzen, auf denen diese beruhen, widersetzen, so würden sie gegen die Bedingungen ihres eigenen Daseins streiten. Die Bestrebungen jener Jahre, ich will sie nicht loben, ich will sie nicht tadeln; aber einmal waren sie nichts Neues: – Kaiser Joseph hatte auf eine ganz ähnliche Weise reformiert, und noch vor der Revolution hat ein namhafter deutscher Publizist die Einziehung sämtlicher geistlicher Güter empfohlen; – sodann waren sie nicht freiwillig: das Bedürfnis war da, die Bewegung ist nicht willkürlich hervorgerufen worden. Als das alte deutsche Reich mit dem revolutionierten Frankreich zusammenstieß – ein irdenes Gefäß mit dem eisernen –, fiel es in Trümmer. Da hat freilich der deutsche Adel die größten Verluste erlitten: er war es doch, dem auch die Stifte zugute kamen; allein sollte er wohl mit Recht andere anklagen? Wenn sein Dasein an dem Bestehen des Reiches hing, wenn er so große Vorteile von demselben genoß, warum setzte er nicht Gut und Blut ein, um es zu retten? Und wie? Wofern er nicht bei den Fürsten einen Rückhalt gefunden hätte, wie wollte er den Leidenschaften der Revolution, die am Ende auch diesseits des Rheins aufzuwecken waren, gegenüber auch nur sein Lehen, sein Allodium, sein persönliches Dasein gerettet haben? Allerdings verlor er nun seine Unmittelbarkeit; aber was will eine Unabhängigkeit sagen, die sich nicht selber verteidigen kann? Es war ein Krieg, man ward geschlagen; es war ein Sturm, man litt Schiffbruch: rette sich, wer es vermag! Glücklicherweise war das Reich nicht die Nation: die lebenden Kräfte derselben hatten sich jenem schon lange entzogen; sie schlossen augenblicklich zu den neuen Fürstentümern zusammen: in diese retteten sie sich vor der unmittelbaren Herrschaft der Fremden. Es war das Interesse der Fürsten, die doch lange nach der Unabhängigkeit gestrebt hatten, welche sie nunmehr erwarben, es war das Interesse der Gemeinden, welche zu einigen wesentlichen Verbesserungen ihrer Zustände gelangten, es war am Ende auch das Interesse des Adels; denn es gab keinen andern Ausweg.
Allerdings litt man hiebei acht bis zwölf schwere Jahre lang von dem Einfluß der Fremden, und auch in dem Innern machte sich derselbe hie und da fühlbar. Jedoch nicht überall. Es gab einen deutschen Staat, der zwar, so mächtig und groß er auch war, demohnerachtet – denn in seinen alten Formen trug er etwas in sich, was ihm den Sieg aus den Händen riß in den allgemeinen Ruin verwickelt worden, der aber glücklicherweise nicht ganz zugrunde gerichtet noch aufgelöst wurde, noch auch so völlig in Abhängigkeit geriet. Vielmehr blieb er selbständig und sein eigen genug, um in diesem äußersten Unglück, in der unaufhörlichen Gefahr, in der er sich befand, die sich selber regenerierende Kraft eines jugendlichen Daseins zu entwickeln. Im Gegensatz gegen die Fremden griff er zur Neuerung. Man bemerke wohl, daß dieselbe nicht von der Theorie oder der Nachahmung, sondern von dem unabweislichen Bedürfnis und dem entschlossenen Willen, ihm zu entsprechen, in einigen einzelnen Zweigen ohne Zweifel von dem Wurfe des glücklichen Genius ausging. Es sei, daß dieselbe, wie alles Menschliche, auch eine Schattenseite hatte; sie konnte nicht allen Interessen gleich angenehm sein; aber man bekenne: sie war nun einmal nicht zu vermeiden; von den Umständen ward sie gebieterisch gefordert, und sie trug ihr eigenes Korrektiv in sich. Sie gründete sich auf den gesetzmäßigen Willen des Fürsten, der kein anderes Interesse hatte, als das Interesse des Ganzen und der Nation.
So ist die Veränderung, welche der Revolution entspricht, in Deutschland geschehen; sie ist nicht durch einen Ausbruch der in sich selber gärenden Elemente, sondern durch die aus dem Erfolg hervorgehende Untauglichkeit der früheren Institutionen hervorgerufen worden; sie ist, und dies ist die Hauptsache, nicht, wie in Frankreich, im Widerspruch mit den Fürsten vollzogen worden, sondern unter ihrer Leitung, in ihrem Vorteil.
Und was war nun, im großen und im ganzen angesehen, unsere Restauration? Sie bestand darin, daß man die Fremden verjagte. Die neuen Königreiche blieben, und wenn ihnen die Umstände eine besondere Aufgabe machten, so war es vor allen, sich dessen zu entledigen, nicht, was im Drange der Umstände notwendig verändert, sondern was durch den unmittelbaren Einfluß von Frankreich hervorgebracht worden war. Das Alte eigentlich herzustellen, durch dessen Zertrümmerung sie stark geworden, wie hätte es ihnen beikommen können? Mächtig trat die preußische Monarchie wieder hervor; allein mit demjenigen, was wesentlich erneuert worden, hätte sie am wenigsten sich in Widerspruch gesetzt; sie war selber erneuert und verjüngt; sie war sich der Entwicklung, in der sie stand, der Aufgabe, die sie hatte, wohlbewußt; selbst die Grundsätze ihrer auswärtigen Politik waren verändert.
Man verkenne nicht mutwillig, wieviel wir durch unsre angestammten Fürsten vor den Franzosen, ja vor allen Nationen der Welt voraus haben. Nur in zwei Fällen, glaube ich, könnten wir ihrer entraten. Wenn die Recht hätten, welche fortwährend auf dem Alten verharren wollen, so bedürfte man nur des strengen, einmal gegebenen Gesetzes und etwa der Unwandelbarkeit einer Aristokratie. Wäre dagegen den anderen zu glauben, welche in unermüdlicher Bewegung einem immer zurückweichenden und immer wechselnden Ziele nachjagen, so würden allerdings die Zügel der Dinge einer demokratischen Versammlung anzuvertrauen sein. Allein etwas anderes braucht die Welt: gesetzmäßige Entwicklung tut ihr not; die Gegenwart bedarf zugleich der Vergangenheit und der Zukunft. Unsere Fürsten sind auf der einen Seite die Bewahrer des Rechts; aus dem Dunkel der vergangenen Jahrhunderte sind sie, in lebendiger Vereinigung mit ihren Völkerschaften, in den heutigen Tag eingetreten; auf der anderen sind sie die Verbündeten der Entwicklung; alle ihre Größe und all ihr Ruhm beruht auf derselben. Man wird nicht sagen, daß sie in dem Falle Napoleons wären: ihre Herrschaft stammt nicht von dem gestrigen Tage, noch von der Gewalt; sie sind rechtmäßige Fürsten, so rechtmäßig, wie irgendein Besitzer in dem ganze Lande; sie sind durch die Natur der Dinge beschränkt. Ebensowenig aber sind sie in dem Falle der Bourbonen; sie sind nie von ihrem Volke ausgestoßen gewesen; sie haben ihr Interesse nie von dem Interesse der Landschaft getrennt. Es ist eine uralte, angestammte, unauflösliche Verbindung: mit der Gesamtentwicklung des Landes ist ihr Dasein, ist ihre Macht verwoben. Sie verlassen uns nicht; wir verlassen sie nicht: miteinander bestehen wir Kampf und Gefahr, wir bilden eine Familie.
In diesem alten Verhältnis einer gegenseitigen Treue und gesetzlichen Verpflichtung haben die stürmischen Jahre der Revolution und Restauration keine wesentliche Veränderung hervorgebracht; wie ganz anders als in Frankreich, wo alles, was demselben analog war, völlig vernichtet worden ist! Wie aber? Wären wir etwa seit der Wiederherstellung der Bourbonen in den Fall der Franzosen geraten, oder sie in den unsern?
Auf der Oberfläche, es ist nicht zu leugnen, zeigen die Dinge eine gewisse Ähnlichkeit. In Frankreich, wo man sich im ganzen ruhig hielt, sprach man nur von dem Bedürfnis guter Staatseinrichtungen, das man nach so großen Erschütterungen allenthalben mitfühlen mußte. Dort wechselten die Ministerien; und allenthalben glaubte man Klage zu haben. Dort wurden in täglichen Sitzungen die Verhältnisse zwischen der fürstlichen Gewalt und der Verwaltung, der Aristokratie und dem Lande, den verschiedenen Ständen verhandelt; wo hätte man sich so behaglich fühlen sollen, daß man nicht der Notwendigkeit inne geworden wäre, eben dieselben auseinanderzusetzen?
Es ist jedoch leicht zu bemerken, daß diese Ähnlichkeiten nur sehr allgemein sind. In der Tat kann es keinen Staat geben, der nicht so wichtige Fragen auf seine Weise zu lösen hätte. Sowie wir ein wenig tiefer eingehen, so nehmen wir wahr, daß die Franzosen fern davon waren, ein allgemeines, daß sie ein sehr besonderes und ihnen eigentümliches Ziel verfolgten; ein Ziel, das ihnen durch die Ergebnisse ihrer Revolution gesetzt war.
Diese, man wollte sie nicht aufgeben noch verlieren. Man hat sie während aller Jahre der Restauration gegen ebendieselben verfochten, über welche man sie erobert hatte. Schien es nicht, als wollten diejenigen, die durch die Restauration zurückgekommen waren, den Schatten der erschlagenen alten Monarchie heraufbeschworen und wieder beleben? Das revolutionäre Frankreich nahm alle seine Kräfte zusammen, ihnen zu widerstehen.
Nun ereignete sich, und ich habe zu zeigen gesucht, auf welche Weise, daß sich der Kampf der Interessen in die Verfassung warf und den Schein annahm, als gelte er die Auseinandersetzung der königlichen Gewalt und des Volkes. Man täusche sich nicht, er war nicht darin. Während man beeifert schien, die beste Verfassung zu entdecken und sie auf das vollkommenste auszubilden, verfocht ein jeder das ihm durch seine Stellung zu der Revolution angewiesene Interesse. Tausendmal haben die Franzosen bekannt, daß es ihnen bei den Verhandlungen während der Jahre der Restauration gar nicht auf Untersuchung und eigentliche Erörterung ankam. In fünf Minuten, sagen sie, konnte man sich auf alle Fälle für und wider entscheiden. Es kam darauf an, ob man die Interessen der neuen Nation teilte oder die Ansprüche der alten festhielt. Zwischen beiden wurde der alte Krieg fortgesetzt.
Ich weiß nicht, ob es im Laufe der Jahrhunderte noch ein andermal vorgekommen ist, daß Prinzipien und Dasein dergestalt ineinandergewachsen und unauflöslich vereinigt gewesen wären. Die Ideen, die an der Bildung der Zustände so großen Anteil gehabt haben, ließen sich von denselben nicht wieder sondern. Wollte man behaupten, was man erworben, wollte man fernerhin auch nur äußerlich und bürgerlich leben wie bisher, so mußte man die Gedanken geltend erhalten, auf denen die Zustände beruhten. Im Anfange der Revolution hat man die Ideen eher mit freier Wahl ergriffen; man nahm für dieselben keine andere, als eine rationelle Wahrheit in Anspruch und suchte sie durch Beweis geltend zu machen. Jetzt hatte man keine Wahl weiter: durch seine Existenz war man an die Ideen gefesselt, um so mehr, da man sich ihrer fortwährend bedienen mußte, um sich zu verteidigen; sie waren durch die Gesetze anerkannt und ausgesprochen; was früherhin rationell gewesen, trat nunmehr als Legalität auf; und es kam nur darauf an, es als solche weiter auszubilden, es wider die Gegner, deren Bestrebungen ein anderes System, ein anderes Interesse zugrunde lag, ohne Abbruch zu behaupten. Es ist merkwürdig, zu beobachten, wie oft man die besonderen Bedürfnisse und Wünsche der Parteien durch allgemeine und konstitutionelle Bestimmungen zu erfüllen sucht. Selten ist ein Vorschlag, ein Gesetz ohne eine Absicht im Rückhalt, einen versteckten Nebengedanken. Was die Leidenschaft fordert, rüstet man mit Gründen aus; jenes Gebiet von Ideen, das zuerst Montesquieu im großen abgegrenzt und darauf die Konstituante in Besitz genommen, ist zum Kampfplatz geworden. Es ist, wie gesagt, der alte Krieg. Die Meinungen sind fertig, es sind die Waffen.
Und diese wären auch bei uns anwendbar, wo Vorgänge und Entwicklungen von so ganz verschiedenem Charakter gewesen sind? Ist etwa auch bei uns eine verjagte Generation wiedergekommen, ihren verlorenen Rechten nachzufragen? Ist bei uns das Fürstentum mit einer solchen verbündet? Kann es irgendwo, ohne mit sich selber in Widerstreit zu geraten und sich seiner eigenen Vergangenheit entgegenzusetzen, eine verfallene Aristokratie zu neuem Leben aufzurufen gesonnen sein? Wo ist das Volk, man nenne es, das wirklich Grund hätte, in unaufhörlichem Verdacht zu leben, als werde es in den Bedingungen seiner Existenz bedroht und gefährdet? Nein! von der allgemeinen Fassung, in welcher die französischen Parteien ihre Ansprüche vortragen, muß man sich nicht blenden lassen; jenem Strome des Raisonnements, mit welchem die französischen Zeitungen und Tagesschriften Europa überfluten, muß man sich nicht blindlings ergeben.
Die Übermacht, welche französische Sitte und Literatur seit Jahrhunderten auf Nahe und Ferne ausübt, hat sich gegenwärtig auf diesen Zweig geworfen, der in der Tat mit so viel Gewandtheit, geistiger Behendigkeit und glücklichem Erfolg bearbeitet wird, daß er den glänzendsten Teil ihres Lebens ausmacht. Sollte es zu billigen sein, wenn die europäische und denn auch die deutsche Opposition sich in die Formen der französischen wirft und deren Verwandlungen, die einen ihr eigentlichen Grund haben, in analogen Schwingungen mitmacht?
Nicht als ob bei uns alles wohleingerichtet wäre, als ob man die Schwierigkeiten, die sich nach so großen Unfällen und Zerstörungen, nach einem so völligen Umschwung der Dinge allenthalben zeigen mußten, eben sehr glücklich überwunden hätte. Ich sage nicht, daß nicht viel Unrecht geschehen, daß nicht viele Ansprüche zu vergleichen, viel Übel gutzumachen übrig sei. Es ist dies nur allzu gewiß. Allein durch die Eigentümlichkeit der Ereignisse in unserm Lande ist uns eine ganz andere Aufgabe gestellt worden.
Einmal liegt uns nicht sowohl ob, zu behaupten, was wir durch die Revolution erworben, als vielmehr das zu ersetzen, was wir durch dieselbe verloren haben. So mangelhaft die alte Einrichtung des Reiches sein mochte, so bedeutete sie uns doch jene nationale Einheit, an welcher alle deutschen Herzen hangen. Wer sollte es nicht fühlen? Freilich wäre es schwer gewesen, unter den Umständen, wie sie waren, eine engere Verbindung durchzusetzen, als diejenige geworden, mit welcher man das Reich am Ende hat ersetzen wollen; der Mangel ward vielleicht eben von dort aus am meisten veranlaßt, wo man ihn jetzt am meisten empfindet; allein soll man sich darum verbergen, daß unser Vaterland allerdings einer besseren Vereinigung bedürfte? Es bedarf derselben für den Fall eines fremden Angriffs, da ist kein Zweifel. Es bedarf ihrer aber, wenn wir nicht irren, auch für den Frieden. In den kleinen Fürstentümern sind es zuletzt wohl beide Teile selber inne geworden. Kann es, frage ich, nicht einen Fall geben, in welchem die Autorität für ihren beschränkten Wirkungskreis, für den Umfang ihrer täglichen Pflichten allzuviel Kräfte in Anspruch nimmt und dennoch nicht stark genug wird, um der Erhebung ungesetzlicher Gewalten zu widerstehen? Dieser Fall, ist er nicht hie und da eingetreten? Hat man nicht hie und da den Widerstand aufgereizt, ohne doch stark genug zu sein, ihn zu überwinden und die empörten Kräfte in die Bahn der Ordnung zu leiten? Unglücklicher Zustand! Alle deutschen Patrioten werden, denke ich, übereinstimmen, daß die Folgen desselben so gut wie möglich beizulegen, seine Wiederkehr, seine Fortsetzung so sorgsam wie möglich zu verhüten wären. Allein nicht minder werden sie überzeugt sein, daß diese Übelstände durch Gewaltsamkeiten, durch den Umsturz des Bestehenden nicht allein nicht gehoben, sondern tausendfach vermehrt werden würden. Auf eine vernünftige, schonende Weise, in freier Übereinkunft, in allmählichem Fortschritt, durch nähere und nähere Vereinigung der lebendigen Interessen, wozu die Verfassung, in der wir sind, uns allen Spielraum läßt, wäre es zu versuchen. Dazu aber gehört etwas mehr, als die Debatten der Franzosen wiederholen, die gerade an dem Übermaß derjenigen Einheit leiden, deren völligen Mangel wir beklagen.
Ebensowenig, dünkt mich, kann es uns in den innern Verhältnissen unserer Staaten fördern, auf deren Beispiel zu sehen. Was ist es doch, worüber man sich beschwert? Man hört klagen, daß die Verwaltungen nicht selten hart seien, starr, drückend, daß man die besonderen Bedürfnisse der Personen, Städte, Landschaften allzuwenig berücksichtige.
Wer wollte es leugnen? Allein man erlaube mir, zu bemerken, daß diejenige Richtung, welche die Ständeversammlungen gegenwärtig zu nehmen scheinen, schwerlich dienen kann, diesem Übelstande jemals abzuhelfen. Wenn es ihnen gelingen sollte, von den Rechten der höchsten Gewalt immer mehr an sich zu bringen, ungefähr wie es in Frankreich geschehen ist, so würden sie zwar das Ansehen des Fürsten schmälern und sich einen entscheidenden Einfluß auf dessen Entschlüsse verschaffen; aber das Übel der Zentralisation würden sie, – ganz wie es dort stattfindet, – nicht anders als vermehren. Die Verwaltung, gestützt auf die Beschlüsse der Mehrzahl, würde nur um so durchgreifender werden und sich um so weniger verpflichtet glauben, auf lokale und provinzielle Unterscheidungen Rücksicht zu nehmen. Dieser Despotismus der Einheit, die überdies nur künstlich gemacht ist, welchen Sinn hat er in einem kleinen Lande? Durch welche Vorteile entschädigt er für die Aufopferungen, die er gebietet? Dort in Frankreich suchen sich die Interessen der Revolution, – welche mit den Interessen der nationalen Einheit zusammenfallen, – einen selbständigen Einfluß auf eine Regierung zu verschaffen, die nicht ihres Sinnes sein möchte. Hier, wo wären die Interessen der Revolution, wo die Gewalten, von denen dieselben bedroht würden? Die Neuerung, welche geschehen – ohne Vergleich weniger durchgehend und vollständig –, ist, wie gesagt, im Bunde mit den Regierungen, durch sie selbst, vollbracht worden und ist ihr eigener Vorteil. Ganz eine andere Aufgabe haben wir. Sie geht ohne Zweifel dahin, die Ansprüche der verschiedenen Stände ruhig und rechtlich auszugleichen, die Bedürfnisse der verschiedenen Landesteile gleichmäßig zu berücksichtigen, jene Wunden, welche die Jahre der Bewegung geschlagen, zu heilen und nicht immer wieder aufzureißen, in Wohlfahrt, Ordnung, Entwicklung aller Kräfte fortzuschreiten und dabei die Treue und Gesetzlichkeit zu behaupten, die den Deutschen so wohl ziemt.
Statt dessen hat man wohl erlebt, daß sich hie und da die Mitglieder deutscher Stände in die Rolle der französischen Kammern versetzt zu sehen geglaubt haben. Es haben sich etliche berufen gefühlt, sich ihren Fürsten, mit denen sie fast eine gemeinschaftliche Sache hatten und nur über untergeordnete Interessen streitig sein konnten, entgegenzusetzen, wie dort etwa ein General, ein Staatsrat Napoleons, ein Foy, ein Benj. Constant der bourbonischen Regierung, mit der sie kämpften auf Leben und Tod. Allerdings sind am Ende auf der anderen Seite analoge Irrtümer entstanden. Fürstentümer und Reiche bieten auch bei großer Verschiedenheit immer gewisse Ähnlichkeiten dar. Allein wenn man sich überredet hat, die Interessen der Fürsten seien allenthalben den bourbonischen gleich, die Interessen der Völker dem Interesse der Französischen Revolution, so ist das ein ungeheurer, der Wahrheit der Dinge schnurstracks zuwiderlaufender Irrtum. Und wie verderblich! Eine uns eigene, große, deutsche Aufgabe haben wir zu lösen: den echtdeutschen Staat haben wir auszubilden, wie er dem Genius der Nation entspricht. Dazu gibt es schwerlich einen andern Weg, als die unleugbaren und augenscheinlichen Mängel, deren so viele sind, ins Auge zu fassen, sie, soviel an uns liegt, zu heben und immer das zu leisten, was not tut. Sich erdichtete Bedürfnisse zu schaffen, weil man anderswo davon redet; durch kleinliche Reibungen einer Trennung, die man aus allen Kräften vermeiden sollte, erst das Dasein zu geben; – es scheint mir nicht förderlich. Vor allem aber soll man sich vor den Formen hüten, welche die Franzosen in ihrem eignen Interesse, das von dem unsern so ganz verschieden ist, erfunden haben.
Nachahmung ist bei jeder menschlichen Tätigkeit bedenklich und hemmend; in Staatseinrichtungen aber ist sie – es kann nicht anders sein – höchst gefährlich. Wie schwer ist es schon, irgendeine Idee, sie sei so rein und angemessen wie sie wolle, ins Leben zu führen! Sowie man aber nachahmt und herübernimmt, hat man es überdies nicht mehr mit reinen Gedanken, mit dem Ideale zu tun; man sucht die Formen, die ein fremdes Leben hervorgebracht hat, auf das eigene überzutragen. Was uns als Idee erscheint, es ist oft nur das Abstraktum einer fremden Existenz. Wie aber dann? Sollte es nicht sein Prinzip auch bei uns geltend machen? Immer tiefer und tiefer wird die Wirkung gehen, und was in einem andern Lande natürlich ist, kann das unsre zur Revolution führen. Als man die Mißbräuche des altfranzösischen Staates abzuschaffen unternahm, war es ein großes Übel, daß man englische, ja nordamerikanische Formen ins Auge faßte. Jene Gedanken, die in Nordamerika aus dem Dasein unmittelbar hervorgingen, es reinigten und belebten, haben dazu beitragen müssen, das alte Frankreich von Grund aus zu zerstören.
Ganz etwas andres ist es, das Ideal auf eignem Wege zu verfolgen, auf dem Wege, welchen unsre Väter eingeschlagen, die die Bewunderung der Welt waren, den Veränderungen gemäß, die seitdem eingetreten sind. Stehen bleiben: es wäre der Tod; nachahmen: es ist schon eine Art von Knechtschaft; eigene Ausbildung und Entwicklung: das ist Leben und Freiheit.
Unsre Lehre ist, daß ein jedes Volk seine eigne Politik habe. Was will sie doch sagen, die Nationalunabhängigkeit, von der alle Gemüter durchdrungen sind? Kann sie allein bedeuten, daß kein fremder Intendant in unsern Städten sitze und keine fremde Truppe unser Land durchziehe? Heißt es nicht vielmehr, daß wir unsre geistigen Eigenschaften, ohne von andern abzuhängen, zu dem Grade der Vollkommenheit bringen, deren sie in sich selber fähig sind? Daß wir die Natur, die wir von Gott haben, unser ursprüngliches Eigentum, unser Wesen, auf die von demselben geforderte Weise selbständig ausbilden?
Warum gibt es endlich verschiedene Staaten? Ist es nicht darum, weil es verschiedene gleich gute Möglichkeiten derselben gibt? Die Idee der Menschheit, Gott gab ihr Ausdruck in den verschiedenen Völkern. Die Idee des Staates, sie spricht sich in den verschiedenen Staaten aus. Gäbe es nur eine untadelhafte Möglichkeit des Staates, gäbe es nur eine rechte Form desselben, so wäre die Universalmonarchie allein vernünftig.
Man redet viel von der Forderung des Geistes der Zeit. Seltsam wäre es, zu behaupten, sie reiche weiter, als die Gemeinschaftlichkeit unsrer Natur überhaupt. Auch ist der Geist nicht von so groben Fäden, daß er sich einem Volke bloß in den Formen mitteilen ließe, die ein andres erfunden hat, daß man diese von verschiedenen Zuständen auf verschiedene übertragen müßte. Er ist als Prinzipium wirksam und wird sich auf natürlichem Wege aus seiner Gegenwart und seiner Vergangenheit eine neue Zukunft entwickeln.
Ein großes Volk, sowie ein selbständiger Staat, wird nicht allein daran erkannt, daß es seine Feinde von den Grenzen abzuwehren wisse. Die Bedingung seiner Existenz ist, daß es dem menschlichen Geiste einen neuen Ausdruck verschaffe, ihn in neuen, eignen Formen ausspreche und ihn neu offenbare. Das ist sein Auftrag von Gott.
Und wie? Wir sollten uns jetzt von den französischen Richtungen übermannen lassen? Ich tadle die Franzosen nicht: seien sie, wie sie sind, wie sie sein können. Allein als sie uns jene Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts, die zum Teil auch aus England übertragen war, und die mit ihr zusammenhängende Ansicht der Religion und Natur überliefern wollten, haben wir uns damals von ihnen überreden lassen? Es ist gerade im Gegensatz mit ihnen gewesen, daß wir, wie sie nun selber gestehen, um soviel tiefer eingedrungen und der Wahrheit nähergekommen sind. In allen Zweigen der Wissenschaft, niemand wird es leugnen, ist ihre Ansicht geschlagen und verdrängt worden. Ihre Poesie und Kunst? Glücklicherweise sind wir, seit wir eine Literatur haben, ihren Spuren nicht weiter gefolgt. Alle geistigen Bestrebungen unsrer guten Zeit, alle wissenschaftlichen Erwerbungen unsrer großen Männer, alles was den Deutschen einen Namen macht, es ist im Gegensatz gegen Frankreich gelungen. Und den Staat, den die Franzosen überdies in Anschauung fremder Formen hervorgebracht, der aber ganz auf dem nämlichen Zusammenhange der Ideen, auf jener mechanischen Ansicht der Dinge, die ihnen so natürlich ist, beruht, – der eben darum jeden Augenblick in sich selber zu verfallen droht – den sollten wir nachahmen und herübernehmen! Nachdem wir sie in allen einzelnen Zweigen zurückgeschlagen, nachdem wir, in jener großen geistigen Richtung weiterschreitend und zu den Waffen greifend, sie auch im Felde überwunden haben, sollten wir uns in dem wichtigsten Lebenselement, in der Form des Staates, an sie anschließen und ihre dürren Erfindungen nachahmen? Es sei ferne! Alles, was wir leben und sind, alles, was wir in den Jahrhunderten unsrer Vergangenheit erworben haben, lehnt sich dawider auf.
Vom Einfluß der Theorie
1833
Selbst wenn es glücklicher Spekulation gelänge, die allgemeinen Forderungen der Theorie über jeden Zweifel zu erheben, so wäre erst von neuem zu erörtern, welches vernünftigerweise ihr Einfluß auf das Leben und die praktischen Elemente sein konnte.
Vielleicht wirft es ein gewisses Licht auf diese Frage, wenn wir verwandte Disziplinen mit der Politik vergleichen.
Betrachten wir aber, daß in den Kreis der großen menschlichen Hervorbringungen mit dem Staate zunächst die Sprache und die Kunst gehören, so erscheinen philosophische Grammatik und Ästhetik in der nächsten Verwandtschaft mit der Politik.
Sprache und Kunst beruhen wie der Staat auf den ursprünglichen Gesetzen des menschlichen Geistes, welche dann die Wissenschaft zu erkennen und mit dem Produkt zu vergleichen hat.
Schon oft ist indessen ein naheliegender Abweg bemerkt worden. Diese Disziplinen haben ein spekulatives Element; doch gehören sie zugleich einer geistigen Naturforschung an. Wenn die philosophische Sprachlehre untersucht, inwiefern sich die Regel des menschlichen Denkens in den feinen und leisen, aber wesentlichen Abwandlungen des Wortes offenbart, so ist sie unmittelbar auf ein Gegebenes angewiesen. Indem die Ästhetik die Gesetze poetischer und künstlerischer Hervorbringung aus der Natur des Geistes entwickelt und die Bedingungen der verschiedenen Gattungen unterscheidet, würde sie doch in ihrem Urteil fehlgreifen, wofern sie nichts als ihre Regeln in die Augen faßte. Sind doch diese, man wird es nicht leugnen, häufig nur Abstrakta von dem bereits Geleisteten. Aber ewig neu und unerschöpflich ist der Genius, und die Aufgabe wird allemal sein, sich in den Gegenstand zu vertiefen, sei es eine Sprache oder ein Kunstwerk, und seine innere Notwendigkeit aufzufassen; denn in sich selber trägt er sein Gesetz.
So bemüht sich Aristoteles, wie er sagt, das Göttliche seines Gegenstandes zu begreifen; es ist das demselben inwohnende Wort, das er zu entdecken und auszusprechen sucht. Auch die Staaten aber sind Produkte eines schöpferischen Genius, nicht einzelner Menschen, noch einer einzigen Generation, so wenig wie die Sprache, sondern einer Gesamtheit und vieler Geschlechter; wie groß auch der Einfluß sein möge, den ausgezeichnete und hochgestellte Männer darauf ausüben können: sie sind der Ausdruck des nationalen Charakters; und wie sie aus einer ursprünglichen Energie des menschlichen Geistes kommen, so haben sie ihre eigenen Gesetze innerer Bildung.
Für Politik gibt man uns oft das trockene Schema weniger Begriffe, die aus einem angeblichen Naturstand und den Forderungen des Augenblicks abgezogen sind. Wie weit wäre davon eine Politik entfernt, die sich auf die großen Anschauungen des realen Lebens der Gegenwart und der Vergangenheit in aller seiner Fülle gründete!
In diesem Sinne hat Montesquieu den Geist der Gesetze unternommen, den man völlig verkennt, wenn man ihm einen theoretischen Ursprung in dem unechten Sinne zuschreibt. Dieses Werk hat einen historischen Grund und ging aus den ausgebreiteten Wahrnehmungen hervor, welche tiefe und für jene Zeit höchst außerordentliche Studien an die Hand gaben.
Allein in der Politik ist man nicht zufrieden, die Realitäten nach ein paar willkürlichen Begriffen zu beurteilen; man tut einen Schritt weiter, vor dem man sich in den verwandten Wissenschaften hütet.
Es fällt niemand mehr ein, nach spekulativen Ergebnissen eine allgemeine und beste Sprache formieren, oder eine vorhandene nach angeblichen Forderungen der Vernunft umgestalten zu wollen. Jedoch in der Politik scheint etwas Ähnliches sehr ausführbar. Sonderbar, daß ein Neuerer, wie Wolke, der in Lexikographie und Grammatik wenig Nachfolger erwerben können, deren unzählige in der Politik gefunden hat; tausend Anleits werden geschrieben, alle Welt arbeitet daran mit.
Die Ästhetik ruft zuletzt aus: der Poet wird geboren, und sie bezieht sich wie billig auf eine Kraft, die außer ihrem Wirkungskreise liegt; aber wie viele bilden sich ein, man dürfe ihnen nur einen Staat anvertrauen, leicht würden sie der Werkmeister sein und ihn trefflich einrichten!
Gerade an dem, was das allerwichtigste, was die Grundlage des gesamten Daseins bildet, versucht man sich mit unberufenen Händen.
Insofern aber diese Bemühungen nicht etwa zerstörend wirken, sind sie ganz vergeblich. Mit dem besten Diskurs ist es nicht ausgerichtet. Die Grammatik kann nie eine Sprache, die Ästhetik nicht einmal ein Gedicht, die Politik aber nimmermehr einen Staat hervorbringen. Euer Vaterland werdet ihr euch nicht erklügeln.
Einen andern Ursprung hat die lebendige Hervorbringung: sie kommt von der Kraft und dem Genius. Genius heißt der Erzeuger, und die Etrusker nannten ihn den Sohn ihres höchsten Gottes. Auf ihre Götter führten die Alten die Stiftung ihrer Staaten zurück.
Und keineswegs ist hiemit einer wohlverstandenen Theorie ihr Nutzen abgesprochen.
Man hat oft die historische und die philosophische Schule unterschieden; doch werden wahre Historie und wahre Philosophie miteinander nie in Widerstreit sein.
Deutlicher tritt ein anderer Gegensatz hervor, zwischen den mechanischen Lehrmeinungen, die das Heil allein in gewissen Formen erblicken, welche sie ohne alle Rücksicht allgemein angenommen zu sehen wünschen, und der lebendigen Ansicht, welche die geistigen Realitäten der Dinge zu durchdringen und die Forderung derselben zu begreifen sucht.
Denn soviel ist gewiß: nicht außerhalb des Staates liegt seine Idee; in ihm selber wird sie gefunden. Sie gibt seiner Bewegung den Antrieb, ohne den er erstarren, stillstehen oder absterben würde; sie ist sein geistiges Leben; aus verborgenem Grunde entsprungen, hält sie das gegenwärtige Geschlecht zusammen und verbindet die Reihen der Generationen miteinander.
Die echte Theorie nun – Anschauung, wie das Wort sagt – die lebendige Ansicht sucht dies innere Wesen des Daseins und seine Gesetze zu begreifen. Mit weiter Umsicht, denn ein Staat bildet doch nur einen Teil der Gesamtheit, in dem Lichte, der tieferen Gründe der Spekulation wird sie die Idee auffassen. Ihrer Natur nach ist sie nicht auf das Praktische angewiesen. Wäre sie dies, so würde der Philosoph als solcher zugleich der Poet sein; er würde die Sprache machen, und in dem Genius gäbe es nichts Unbewußtes.
Praktisch lebt die Idee in den wahren Staatsmännern: sie ist die Regel ihres Verhaltens. In ihrem Denken, in ihrem Geiste konzentriert sich das geistige Dasein des Staates. Die materiellen Bedingungen, welche sie zu beschränken scheinen, geben ihnen vielmehr, da sie die Vergangenheit in sich fassen, Maßstab und Anhalt. Etwas Neues zu machen, werden sie an sich nicht beabsichtigen. Sie sind nicht der Staat, obwohl der Staat in ihnen ist. Deutlich liegt ihre Aufgabe vor ihnen: es ist die Fortleitung des schon begonnenen Lebens, seine Erhöhung von Moment zu Moment, die Befestigung seiner Gesundheit, die in dem frischen Umlauf, ich möchte sagen, des geistigen Blutes durch alle Adern besteht.
Die echte Theorie, weit entfernt, den Staatsmann zu stören, wird ihn vielmehr fördern. Den Inhalt des Lebens vergegenwärtigt sie dem Gedanken. Der Zug der Dinge und die große Anschauung unterstützen sich dann wechselseitig. Die vollere Klarheit kann die Entwicklung nicht anders als begünstigen und das Dasein in sich kräftiger machen.
Darauf aber kommt alles an. Es liegt alles daran, daß man etwas leiste, etwas Haltbares darstelle, selber etwas sei.
Den Bau der Staaten hält ein moralisches Zement zusammen. Unser Leiden ist, daß es an so vielen Stellen lose und locker geworden.
Nicht dadurch wird man es herstellen, daß man nach allen Seiten hinhört, bald einem, bald einem andern Prinzipium folgt, bald diese, bald jene Neuerung macht und den Parteien nachgibt, sondern dadurch, daß man stark ist, Vertrauen einflößt, sich selber treu bleibt und, indem man das Neue mit dem Alten, den Widerstand mit dem Fortgang verbindet, auf der Bahn der Entwicklung sicher und groß einhergeht. Vor einem in sich selber gegründeten Dasein verbleichen die Nachahmungen und falschen Forderungen; die Parteien werden ihm nichts anhaben.
Den Sand der Wüste treibt der Sturmwind dahin und dorthin; das Gebirge läßt er wohl stehen.
Politisches Gespräch
1836
Friedrich: So glänzend kommst du zu mir, in der Staatsratsuniform, sogar mit deinen ausländischen Orden?
Karl:Ich wette, du hast nicht einmal die Wagen vorbeirollen hören; wolltest du aber zwei Schritte mit mir gehen, so würde ich dir die hellerleuchteten Fenster zeigen, von denen ich herkomme. Sie strahlen über die ganze Straße daher.
Friedrich:Und aus alle dem Glanze stiehlst du dich in die Einsamkeit dieser Studierstube?
Karl:Um meinem benediktinischen Bruder guten Abend zu wünschen. Nachdem man Welt gesehen, sucht man auch einen Menschen auf; nachdem man Konversation geführt, will man auch eines Gespräches genießen.
Friedrich:Ich kann mir den Unterschied, den du da machst, schon gefallen lassen; sei mir desto herzlicher willkommen!
Karl:Du glaubst ja ohnehin nicht, daß es mich befriedigen könnte, mich unter alle den Herrschaften zu bewegen, die mancherlei Meinungen und Notizen, die einen Salon beherrschen, mit der Nuance der meinigen zu versetzen.
Friedrich:Du redest, wie die meisten Weltkinder reden, von Byron an; du fühlst dich ermüdet, abgespannt.
Karl:Welt und Konversation geben doch nur eine Berührung im Elemente des Allgemeinen, an der Oberfläche des Geistes: man sieht Menschen, welche die Gunst der Umstände oder die Geburt auf die Höhe der Gesellschaft gehoben; man hört von den Dingen, auf welche der Augenblick die Aufmerksamkeit gelenkt hat; es ist eine Gemeinschaft der flüchtigsten Art, die sich unaufhörlich verwandelt und dabei doch jahraus jahrein die nämliche bleibt. Es gibt Leute, die darin ihre Befriedigung sehen; mir ist dieses abwechselnde Einerlei etwas drückend.
Friedrich:Gleichwohl wirst du es nicht völlig entbehren wollen. Es müssen in der vornehmen Gesellschaft doch zugleich die Interessen der Welt, durch welche sie wirklich in Bewegung gesetzt wird, wäre es auch nur flüchtig und, wie du sagst, an der Oberfläche, zutage kommen. Es muß euch interessant sein, sie hervortauchen, immer stärker werden, zur Herrschaft gelangen, wieder verschwinden zu sehen. Wovon sprach man heute vorzüglich?
Karl:Mein Gott, es wiederholt sich die Zeitung, wie ein jeder sie auffaßt: Spannung zwischen England und Rußland; Portfolio; Rückgabe von Silistria; die Reise der französischen Prinzen; Alibaud; die geringe Aufmerksamkeit, welche man heutzutage den Kammerverhandlungen widmet; Eisenbahnen und Perkussionsgewehre; Krieg und Friede: mit einem Worte alles, was du willst.
Friedrich:Aber einige Gesichtspunkte, einige Meinungen walteten vor?
Karl:Nach den verschiedenen Ständen. Den jungen Offizieren leuchten die Augen bei dem bloßen Gedanken an Krieg, ohne daß sie viel danach fragen sollten, gegen wen es gehe; – sie ergreifen die Feindseligkeiten des Portfolio; – sie glauben, man wolle es in England ernstlich zum Bruche bringen; – sie zweifeln nicht, daß das Feuer dann unverzüglich das übrige Europa und die Welt ergreifen werde.
Friedrich: Was wäre es auch für eine Armee, die den Krieg nicht von Herzen herbeiwünschte: Tätigkeit, Geltung, Avancement? Ich verdenke es keinem.
Karl: Es ist nur sonderbar, daß man niemals gewaltiger und allgemeiner gerüstet war als jetzt, und daß man niemals längeren Frieden hatte.
Friedrich: Das bedingt sich nun wohl. Der Krieg wurde sonst mit dem Überschuß der Kräfte geführt, mit den Leuten, die man entbehren konnte, mit dem Gelde, das sich entweder im Schatze fand oder doch ohne allzu große Anstrengung aufzubringen war; jetzt schlagen die Nationen, bewaffnet wie sie sind, beinahe Mann bei Mann, mit aller ihrer Kraft; die Kosten der ersten Ausrüstung schon sind unerschwinglich; zu einem Kampfe auf Leben und Tod müßte man sich gefaßt machen; kein Wunder, daß man sich ein wenig besinnt. – Aber du wolltest noch von einer andern Meinung reden.
Karl: Die Administration dagegen sieht mit Vergnügen den langen Frieden kommen. Man hört auf, den Gegensatz der absoluten und konstitutionellen Monarchien zu fürchten, der die Aussicht alle die Jahre daher bewölkte und so gefährlich schien. Justemilieu, das sich so lange ruhig halten mußte, schöpft wieder Atem. Man hofft, alles werde die Unmöglichkeit einsehen, in den Extremen zu regieren.
Friedrich: Und zu dieser Meinung, dünkt mich, wirst auch du dich halten.
Karl: Wie könnte ich anders? Darf sich die Politik der unaufhörlichen Bewegung der populären oder den retardierenden Prinzipien der aristokratischen Tendenzen ergeben? Und muß man nicht in ihrem Kampfe eine Stellung zwischen ihnen ergreifen, schon darum, um ihnen nicht dienstbar zu werden und sich nicht durch ihren Impuls von dem, was man will, zu dem, was man nicht will, fortreißen zu lassen?
Friedrich: Sehr weise.
Karl: Und sehr notwendig. Wo wäre auch ein Staat, der sich nicht in der Notwendigkeit sähe, diesen Ausweg zu ergreifen? Man hätte glauben sollen, nach der letzten französischen Revolution würden Bewegung und Liberalismus ein unwiderstehliches Übergewicht davontragen; aber die aus dem Umsturz hervorgegangene Regierung selbst sah sich nach wenig Tagen gezwungen, sich in den Widerstand zu werfen, und es liegt vor Augen, welche Rückwirkung dies, wie auf das gesamte Europa, so besonders auf unser konstitutionelles Deutschland ausgeübt hat. Die Whigs schiffen zwischen Radikalismus und konservativen Prinzipien: sie mögen jenen noch so sehr zu begünstigen scheinen, so haben sie diese nicht aufgegeben.
Friedrich: Glaubst du in der Tat, daß sich auf solche Weise regieren läßt?
Karl: Wärst du nicht dieser Meinung?
Friedrich: Ich befinde mich in dem besonderen Falle, dir im ganzen beizustimmen und dabei doch widersprechen zu müssen.
Karl: Was kannst du aber dagegen sagen? Erkläre mir deine Meinung!
Friedrich: Hast du auch Neigung, indem du aus einer heiteren Gesellschaft kommst, geduldig auf die Erörterung einer sehr ernsten Frage einzugehen? Denn tiefer, als du denkst, möchten wir fortgezogen werden.
Karl: Wie sollte ich nicht: auf diese Weise gelangen wir ja allein von der Konversation zum Gespräch, von dem Abgemachten zu dem Suchen und Finden.
Friedrich: Antworte mir denn zunächst auf eine Frage: hast du wohl je bestätigt gefunden, was so häufig ausgesprochen wird, die Wahrheit liege in der Mitte?
Karl: Ich habe wenigstens immer bemerkt, daß sie nicht in den Extremen zu suchen ist.
Friedrich: Aus den Extremen aber wirst du nicht auf die Wahrheit schließen können. Die Wahrheit liegt überhaupt außer dem Bereiche des Irrtums. Aus allen Gestalten des Irrtums zusammengenommen könntest du sie nicht abstrahieren: sie will gefunden sein, angeschaut, an und für sich, in ihrem eigenen Kreise. Aus allen Ketzereien der Welt könntest du nicht entnehmen, was das Christentum ist; du mußt das Evangelium lesen, um es kennenzulernen. Ja, wir dürfen behaupten, aus allem Lob und Tadel der Welt wird sich noch kein gesundes Urteil bilden lassen, so gewissenhaft du auch die Mitte zwischen beiden aufsuchen magst.
Karl: Ich will deinen Satz fürs erste gelten lassen; was hat das aber mit dem Justemilieu zu schaffen?
Friedrich: Auch in dem Staat nimmst du Extreme der Meinung wahr. Ich gebe dir zu, daß sie die rechte nicht enthalten mögen; wer sagt dir aber, daß diese in der Mitte liegt?
Karl: Der Staat ist kein Doktrin. Die Parteien verteidigen nicht bloß Meinungen: sie selbst sind Kräfte, Gewalten, die einander gegenüberstehen, einander bekämpfen, sich aus der Stelle treiben, wie wir ja täglich wahrnehmen.
Friedrich: Und zwischen denen nun, meinst du, soll die Regierung das Gleichgewicht erhalten?
Karl: Jawohl. Regieren ist Führen, Lenken.
Friedrich: Ich frage dich aber, wie sie das vermag? Wo nimmt sie die Kraft dazu her?
Karl: Es gibt in unserer Zeit keine Verfassung, welche der Regierung, auch einer beschränkten, nicht ein bedeutendes Maß von Macht zugestünde.
Friedrich: Erlaub mir! Macht an sich tut es nicht; sie ist ein Instrument, bei dem es erst darauf ankommt, wozu man es braucht, ob man es überhaupt zu brauchen versteht. Deine Regierung würde keine Bedeutung in sich selbst haben.
Karl: Wieso das? Hat es keine Bedeutung, den Kampf zu verhüten, das allgemeine Beste zu befördern? – Höre mich an! – Wie wir auch Staat und Gesellschaft definieren mögen, so bleibt immer ein Gegensatz zwischen Obrigkeit und Untertan, zwischen der Masse der Regierten und der kleinen Zahl der Regierenden. Die Dinge mögen nun stehen, wie sie wollen, so wird sich allemal finden, daß zuletzt das Interesse der großen Zahl überwiegt, der Regierende sich auf eine oder die andere Weise unterordnet. In der Masse aber wird es immer Entzweiungen geben, verschiedene Parteien, was wir nicht eben allemal als Desorganisation betrachten dürfen; es ist häufig nur eine Lebensform, bei welcher das allgemeine Wohl recht gut gedeiht. Was kann da die Regierung Besseres tun, als daß sie die Übermacht der einen und der andern oder ein gefährliches Zusammentreffen beider vermeidet?
Friedrich: Du entschlüpfst mir damit nicht. Auf diese Weise wird die Welt den Parteien gehören; in ihnen wird das Leben liegen, die Regierung wird nur der Punkt der Indifferenz sein; eben dies kann ich dir nicht zugeben.
Karl: Und warum nicht?
Friedrich: Du wirst mir zugestehen, und es liegt in deinen Worten, daß die Parteien, von denen du redest, geistige Kräfte repräsentieren, nicht allein ein gewisses Maß von Macht.
Karl: Ohne Zweifel Kräfte und Tendenzen.
Friedrich: Muß nicht die Regierung, um diese Kräfte zu bekämpfen, in Zaum zu halten, selber eine stärkere geistige Kraft sein? Du schreibst ihr eine Handlung zu: was ist das Agens, das Wirksame? Mit dem bloßen guten Willen der Vermittlung wirst du es nicht ausrichten. Eine Wesenheit, ein Selbst mußt du haben.
Karl: Wie dem auch sei, soviel bleibt immer wahr, daß die Regierung die Mitte zwischen den Parteien wird behaupten müssen.
Friedrich: Eben hier liegt unsere Übereinstimmung und unsere Differenz. Es gibt, deucht mich, eine doppelte Vorstellung von Justemilieu. Nach der einen ist es eigentlich negativer Art: da machen die Parteien den Staat aus; die herrschende Gewalt ist nur beflissen, keiner unrecht zu tun, sich zwischen ihnen zu halten. Das schien mir deine Vorstellung zu sein. Nach der andern aber ist es vielmehr positiv: es stößt allerdings die Parteien, die Extreme von sich aus, aber nur darum, weil es seinen eigenen positiven Inhalt hat, seine natürliche eigentümliche Tendenz, die es vor allem durchsetzen muß.
Karl: Insofern hast du freilich recht, daß diese Frage uns tiefer führen wird. Es ist das Wesen des Staates überhaupt, zu dem unser Gespräch – und ich gestehe, zu meiner Genugtuung – sich wendet. Schon öfter habe ich empfunden, daß du dir darüber eine von der meinen abweichende Vorstellung gebildet hast. Wenn dich nichts abhält, so stehe mir heute ausführlicher Rede. Was verstehst du unter dem positiven geistigen Inhalt des Staates? Gehen sie nicht alle von demselben Anfang aus? Haben sie nicht alle die nämlichen Pflichten? Ist ihre Verschiedenheit nicht zufälliger Art?
Friedrich: In der Tat, alle diese Fragen, die du zu bejahen scheinst, beantworte ich mit einem entschlossenen Nein. Wenn wir uns verstehen wollen, müssen wir allerdings einen Schritt weiter gehen.
Kennst du das kleine Buch, das da auf dem Tische liegt?
Karl: Les deux derniers chapitres de ma philosophie de la guerre.Von wem?
Friedrich: Lies auch den innern Titel.
Karl: Ah! von Chambray, dem fleißigen und einsichtsvollen Geschichtschreiber des Feldzuges in Rußland. Auch den Inhalt gibt sogleich der Titel an: Chap. IX.Des institutions militaires dans leurs rapports avec les constitutions politiques et avec les institutions civiles.Schon ein glücklicher Gedanke! – Ich wäre begierig, zu erfahren, wohin seine Meinung geht.
Friedrich: Er findet, daß die militärischen Einrichtungen mit innerer Notwendigkeit dem Zustande der Gesellschaft, der bürgerlichen Verfassung entsprechen.
Karl: Führe mir ein Beispiel an.
Friedrich: Die englische Armee entspricht dem unreformierten Parlament. Die Aristokratie, welche beide Häuser erfüllte, votierte jährlich die Existenz derselben; wie es das Interesse der Aristokratie war – denn sie machte ja im Grunde den Staat aus –, die bestehende Ordnung der Dinge zu erhalten, so hatte sie infolge einiger eigentümlicher Einrichtungen die Offizierstellen eingenommen und hat sie noch behauptet. Unteroffiziere und Gemeine dagegen werden angeworben; durch bessere Löhnung und sorgfältigere Pflege, als irgendeine andere europäische Truppe genießt, wie sie aber der Zustand der Nation fordert und möglich macht, werden sie bei gutem Willen und zugleich durch die strengste Zucht, durch die härtesten Strafen in Unterordnung gehalten.
Karl:Daraus scheint sich zu ergeben, daß, wenn die Verfassung fernere Abänderungen erfährt, solche auch in der Armee nicht ausbleiben werden.
Friedrich:Ich zweifle nicht, sowie die Abänderungen nur noch tiefer eingreifen.
Karl:Auch leitet sich der Gegensatz daher ab, in welchem die englische mit der preußischen Armee steht.
Friedrich:Auch in Preußen findet der Autor militärische und bürgerliche Institutionen in vollkommener Übereinstimmung; die allgemeine Dienstpflicht mit der individuellen Freiheit und der Teilung des Eigentums; die Einrichtung der Landwehr mit den munizipalen Berechtigungen; die Bevorzugung der gebildeten Klassen beim einjährigen Dienst mit der Stellung, welche diese überhaupt einnehmen. Daß der Unteroffizier Aussicht auf Versorgung habe, knüpfe ihn um so enger an den Staat. "Ein Land", ruft er aus, "welches eine Miliz hat, wie die Landwehr, und Institutionen, wie die Städteordnung, besitzt die Freiheit in der Tat".
Karl:Wie waren es zwei so durchaus verschiedene Armeen, welche Napoleon bei Waterloo überwanden, von nahe verwandten Nationen, aber nach verschiedenen inneren Motiven gebildet, die eine angeworben, wohlverpflegt, ausharrend, aristokratisch, die andere national, beweglich, bereit, auch allenfalls Mangel zu leiden, unermüdlich. Es ist recht bedeutend, daß die Vereinigung zwei so entgegengesetzter Waffenbrüderschaften, von denen die eine den alten, die andere den neuen Zustand des germanischen Europa in sich schloß, den letzten entscheidenden Sieg erfocht. Man begreift es, daß Wellington damals die Verfolgung ablehnte und daß er auch seitdem keine Lust bezeigt, die Institutionen seiner Armee zu verändern. Er ist eben auch hier ein Antireformer. Von seinen Mitstreitern vermochte er sich nicht einmal einen Begriff zu verschaffen. – Spricht Chambray auch von der französischen Armee nach Napoleon?
Friedrich: