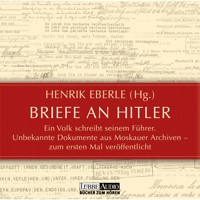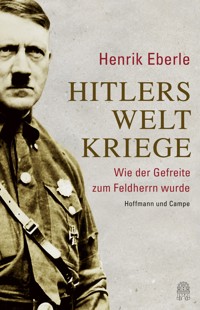
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vom Gefreiten der Reichswehr zum Oberbefehlshaber der Wehrmacht - Mit neuesten Erkenntnissen zeigt der Historiker und Nationalsozialismus-Experte Henrik Eberle, wie Hitlers Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg dessen Politik, Ideologie und militärische Vorstellungen beeinflussten. Nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes attestierte Generaloberst Franz Halder dem einstigen "Führer" mangelndes strategisches Denken, als Politiker habe er versagt, und "er war erst recht kein Feldherr" - ein einfacher Gefreiter eben, der nie an vorderster Front gekämpft habe. Andere bezeichneten Hitler als feigen Soldaten des Ersten Weltkriegs, er habe sich das Eiserne Kreuz erschlichen und sei am Ende als "Hysteriker" in der Psychiatrie gelandet. Henrik Eberle spürt diesen Aussagen anhand gründlicher Recherchen in Archiven und Bibliotheken nach und findet ein anderes Bild. Zugleich beantwortet er viele umstrittene Fragen. Formierte Hitler die Gesellschaft neu, um einen weiteren "Dolchstoß" im Zweiten Weltkrieg zu vermeiden? Resultierte Hitlers Achtung vor dem britischen Empire aus seinem Einsatz gegen die Engländer im Ersten Weltkrieg? Unterschätzte er die Russen, weil er sie nicht kannte? Ein Buch, das den Gefreiten mit dem Diktator in Verbindung setzt und Zusammenhänge verständlich macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Henrik Eberle
Hitlers Weltkriege
Wie der Gefreite zum Feldherrn wurde
Hoffmann und Campe
1Ein Gefreiter als Feldherr
Smolensk 1943 – Mühlhausen 1947
13. März 1943. Adolf Hitler besucht das Hauptquartier der Heeresgruppe Mitte in Smolensk. Beim Gespräch mit den Kommandeuren entspinnt sich ein heftiger Disput über die mangelnden Fortschritte an der Ostfront. Hitler bekommt einen seiner typischen Wutanfälle und wirft den Generalen vor, dass es ihnen an Fronterfahrung mangele. Sie hätten im letzten Weltkrieg weit hinten in den Stäben gehockt, er hingegen habe vielfach erlebt, was die Truppe auch bei widrigen Wetterbedingungen zu leisten bereit sei. Er kenne den Krieg im Schützengraben, er wisse um die Motivation, den Kampfgeist der Soldaten. Generaloberst Rudolf SchmidtSchmidt, Rudolf kommentiert die Suada kühl: »Ihre Kriegserfahrung trägt ein Spatz auf dem Schwanz weg.«
Die Verachtung, die ein außerordentlich erfolgreicher Karriereoffizier Hitler entgegenbrachte, findet sich in der wissenschaftlichen Literatur als Beispiel für den ständig schwelenden Konflikt zwischen dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht, also Hitler, und seinen Generalen, hier SchmidtSchmidt, Rudolf. Der Generaloberst war nicht irgendwer. Im Ersten Weltkrieg hatte er an der Ostfront gedient und schon 1914 das Eiserne Kreuz I. Klasse erhalten. Danach war er an der Westfront und in der Türkei eingesetzt. In der Weimarer Republik war er bei den Nachrichtentruppen und wechselte bald zur neuen Panzerwaffe. Im Westfeldzug 1940 führte er das XXXIX. Armeekorps, die von ihm kommandierten Fallschirmjäger nahmen die »Festung Holland«. Beim »Unternehmen Barbarossa«, dem Krieg gegen die Sowjetunion, war er Kommandeur von Großverbänden in den Kesselschlachten 1941. Seit Dezember 1941 befehligte er die 2. Panzerarmee, nachdem Hitler deren Kommandeur Heinz GuderianGuderian, Heinz wegen zu großer Milde gegenüber der Truppe entlassen hatte. Kurz nach seiner abfälligen Bemerkung gegenüber Hitler wurde SchmidtSchmidt, Rudolf in die »Führerreserve« versetzt und wenig später wegen »Defätismus« verhaftet. Als Beleg dienten zwei von der Gestapo abgefangene Briefe. Ein sympathisierender Heeresrichter befand allerdings, sie seien als Beweismittel untauglich, sodass SchmidtSchmidt, Rudolf nicht angeklagt wurde.[1]
Erneut verhaftet wurde SchmidtSchmidt, Rudolf1947 bei einem Besuch in der Sowjetischen Besatzungszone. Bei dem Verhör im thüringischen Mühlhausen erinnerte er sich genau an die defätistischen Briefe, die er seinem Bruder geschrieben hatte. Den Dialog vom 13. März 1943 schilderte er den sowjetischen Offizieren nicht, obwohl er alle seine Begegnungen mit Hitler detailliert beschrieb.[2]
Die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei dem angeblichen Wortwechsel zwischen dem Generaloberst und Hitler um eine Geschichte aus der nach der deutschen Niederlage in vielen Varianten präsentierten Großerzählung handelt. Ihr Inhalt: Der minderqualifizierte Gefreite des Ersten Weltkriegs riss zuerst die Macht im Staat an sich, enthauptete dann die Führung der Wehrmacht und maßte sich schließlich die Befehlsgewalt im Zweiten Weltkrieg an. Deshalb wurde der Krieg verloren. Die Generalität trug daran keine Schuld, denn sie war nur ausführendes Organ, das den Entscheidungen Hitlers ohnmächtig Folge leisten musste. Sie hatte oft genug widersprochen – so wie Generaloberst SchmidtSchmidt, Rudolf und unzählige andere Generale –, war aber angesichts der ständig präsenten politischen Polizei und Heinrich HimmlersHimmler, HeinrichSS ins Hintertreffen geraten.
Im Hinblick auf den Generaloberst SchmidtSchmidt, Rudolf trifft wohl zu, dass er die defätistischen Briefe schrieb, sich jedoch niemals offen verächtlich über Hitlers Kriegserfahrungen äußerte. Letzteres ist eine Legende. Die Besprechung in Smolensk verlief in entspannter Atmosphäre, auch deshalb, weil Wehrmacht und Waffen-SS gerade dabei waren, die ukrainische Industriestadt Charkow zurückzuerobern.[3] »Die Stimmung war gut und zuversichtlich«, erinnerte sich Hitlers Luftwaffenadjutant Nicolaus von BelowBelow, Nicolaus von in seinen Memoiren an diesen angeblich so denkwürdigen Tag.[4]SchmidtSchmidt, Rudolf selbst bewarb sich nach seiner Versetzung in die »Führerreserve« mehrfach um ein neues Kommando und bot sich auch HimmlerHimmler, Heinrich für eine Verwendung in der Waffen-SS an.[5]
Der gut gelaunte und optimistisch gestimmte Hitler unterzeichnete noch am Abend des 13. März die maßgebliche Weisung für die Kriegführung im Jahr 1943. Das Dokument wirkt nicht, als sei es von einem Oberbefehlshaber autorisiert worden, der seine Generale zwanghaft zu seinen Plänen hätte bekehren müssen. Es sei damit zu rechnen, dass »der Russe« seine Angriffe nach Beendigung der Schlammperiode fortsetzen werde, weshalb alles getan werden müsse, um diese Angriffe in der Defensive »verbluten« zu lassen. Aber wenigstens an einem Frontabschnitt sollte das offensive Gesetz des Handelns bei der Wehrmacht liegen.[6] Dieses Vorhaben mündete in die Schlacht am Kursker Bogen im Sommer 1943, die größte Panzerschlacht der Geschichte. Die Niederlage der deutschen Panzerverbände besiegelte die Wende im Zweiten Weltkrieg. Das Konzept für den Vorstoß war vom Generalstab erarbeitet worden und wurde von den Kommandeuren der Ostfront gebilligt. Davon wollte allerdings später niemand etwas wissen.
Der Generalstab, der Feldzugsplan 1939 und der HalderHalder, Franz-Zusammenstoß
Das Verhältnis zwischen Hitler und seinen Generalen war jedoch während des Zweiten Weltkriegs keineswegs durchgängig so harmonisch wie bei dem Treffen in Smolensk. Zwar akzeptierte die Reichswehr, die sich ab 1935 stolz Wehrmacht nannte, den Politiker Adolf Hitler, vor allem dessen innenpolitischen Kurs. Aber als sich abzeichnete, dass er eine militärische Revision der Ergebnisse des Ersten Weltkriegs anstrebte, äußerte sich der Chef des Generalstabs Ludwig BeckBeck, Ludwig kritisch. Er hielt Deutschland für zu wenig gerüstet und »bis auf Weiteres« für zu schwach, um einen Krieg zu führen.[7] Hitler sah das anders. Er akzeptierte zwar den Hinweis auf die momentane Unfähigkeit des Heeres, einen Angriffskrieg zu führen, doch die Zeitangabe »bis auf Weiteres« ging ihm gegen den Strich. So ersetzte er kurzerhand den zurückhaltenden BeckBeck, Ludwig durch den optimistischen Franz HalderHalder, Franz. Der gelernte Artillerist war hoch dekoriert und hatte sich in der Reichswehr einen Ruf als aggressiv agierender Leiter der Ausbildungsabteilung erworben. BecksBeck, Ludwig Denken war von einer Devise beherrscht, die Hitler nicht brauchen konnte. »Wie vermeide ich einen Krieg?«, lautete seine handlungsleitende Maxime in den Krisen 1937/38 – HalderHalder, Franz war von solcherart Pessimismus, so der zeitgenössische Sprachgebrauch, nicht »angekränkelt«.[8]
Die Mehrzahl der Kommandierenden in den höchsten Stellen war allerdings auch nach dem gewonnenen Feldzug gegen Polen noch pessimistisch gestimmt, wie sich an Reaktionen auf ein Treffen in der Reichskanzlei am 27. September 1939 zeigte. Hitler verkündete seine Absicht, Frankreich so schnell wie möglich anzugreifen. Der Oberbefehlshaber des Heeres Walther von BrauchitschBrauchitsch, Walther von hielt das für »Wahnsinn«, ebenso der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe C Wilhelm Ritter von LeebLeeb, Wilhelm von. Im Gespräch äußerten andere Offiziere die Vermutung, Hitler sei in einen »Blutrausch« verfallen, und selbst der später so gefügige Generaloberst Wilhelm KeitelKeitel, Wilhelm erwog seinen Rücktritt. Der Chef der Heeresrüstung Generalmajor Georg ThomasThomas, Georg betrachtete den Plan aus kriegswirtschaftlichen Gründen als aussichtslos. Andere Heeresgruppenführer glaubten nicht daran, dass die Niederwerfung Frankreichs möglich sei, weil sich eine Offensive wie im Ersten Weltkrieg unweigerlich festlaufen würde. Sie sei bei dem derzeitigen Tempo der Aufrüstung keinesfalls vor 1942 zu wagen.[9] Hitler, dem diese Bedenken zugetragen wurden, beantwortete sie am 23. November mit einer Ansprache auf einem Empfang in der Reichskanzlei. Sein Entschluss sei »unabänderlich«, sagte er zu den anwesenden Offizieren. »Ich werde Frankreich und England angreifen zum günstigsten und schnellsten Zeitpunkt.« Die Verletzung der Neutralität Belgiens und Hollands sei dabei bedeutungslos, kein Mensch frage später den Sieger. Drohend schob Hitler nach: »Ich werde vor nichts zurückschrecken und jeden vernichten, der gegen mich ist.«[10]
Als 1940 ein erfolgversprechender Angriffsplan vorlag und der Westfeldzug zügig vorankam, waren die Generalstabsoffiziere wieder auf Hitlers Seite. Nach dem Sieg wurden mehrere Heerführer zu Feldmarschällen befördert, was sie ebenfalls zum Verstummen brachte.
Unterschwellig blieb das Verhältnis jedoch gespannt, wofür später Hitlers einstiger Vorgesetzter im Ersten Weltkrieg und damals amtierender Adjutant Fritz WiedemannWiedemann, Fritz den Diktator verantwortlich machte. Zwar sei Hitler eine »soldatische Natur« gewesen, die alle Unannehmlichkeiten des Frontdienstes »willig ertragen« und sich »widerspruchslos« der harten Disziplin im Heer unterworfen habe. Für die Arbeit des Generalstabs habe er jedoch wenig »Verständnis« gehabt. Letztlich »überschätzte er«, meinte WiedemannWiedemann, Fritz rückblickend, »den Frontsoldaten und glaubte, dass Tapferkeit allein genüge, um einen Krieg zu gewinnen«.[11]
Zu den ersten ernsthaften Zerwürfnissen kam es im Dezember 1941, als der deutsche Angriff vor Moskau stecken blieb. Generaloberst Heinz GuderianGuderian, Heinz, der die 2. Panzerarmee führte, nahm seine Truppen danach in eine besser ausgebaute Stellung zurück und wurde deshalb ins Führerhauptquartier einbestellt. Dort erläuterte GuderianGuderian, Heinz seine Rückzugsstrategie, worauf Hitler heftig ausrief: »Nein, das verbiete ich!« GuderianGuderian, Heinz antwortete, dass die Befehle schon ausgegeben seien. Ihm bleibe keine Wahl, als sie zu billigen, wenn er Wert darauf lege, die Truppe zu erhalten. Danach entspann sich ein aufschlussreicher Dialog.
Hitler: »Dann müssen Sie sich in den Boden einkrallen und jeden Quadratmeter verteidigen!«
GuderianGuderian, Heinz: »Das Einkrallen in den Boden ist nicht mehr überall möglich, weil er 1–1½ Meter tief gefroren ist und wir mit unserem kümmerlichen Schanzzeug nicht mehr in die Erde kommen.«
Hitler: »Dann müssen Sie sich mit schweren Feldhaubitzen eine Trichterstellung schießen. Wir haben das im Ersten Weltkrieg in Flandern auch getan.«
GuderianGuderian, Heinz antwortete, damals habe jede Division Abschnitte von vier bis sechs Kilometern verteidigt, und das mit verhältnismäßig reichlicher Munition. Seine Divisionen hätten jetzt Frontbreiten von 20 bis 40 Kilometern und pro Feldhaubitze noch genau 50 Schuss. Jeder Schuss reiße eine waschschüsselgroße Mulde in den Boden, mehr nicht. Selbst die Löcher für Fernmeldemasten müssten gesprengt werden, schließlich sei es an manchen Tagen bis minus 50 Grad kalt. Das Gespräch ging noch eine Weile so weiter, wenige Wochen nach dem Dialog wurde GuderianGuderian, Heinz durch Rudolf SchmidtSchmidt, Rudolf ersetzt.[12]
Auch bei dem im Spätsommer 1942 auflodernden Streit zwischen dem Generalstab und Hitler spielten dessen Weltkriegserfahrungen eine wichtige Rolle, und wieder waren es seine Zumutungen für die kämpfende Truppe, welche die Situation am 24. August eskalieren ließen. Stabschef HalderHalder, Franz hatte einige Tage zuvor Bericht über den Zustand der Truppe erstattet, wobei er auch auf die aussichtslose Lage der Heeresgruppe Mitte bei Moskau eingegangen war. Die Kämpfe im Frontabschnitt von Rshew weiteten sich um diese Zeit zu einer der größten (und dennoch heute vergessenen) Schlachten des Zweiten Weltkriegs aus. Die deutsche Wehrmacht verlor dort zwischen Januar 1942, dem Ausbau der Stellung, und März 1943, der Räumung des Bogens, etwa 400000 Mann und die Rote Armee ein bis zweieinhalb Millionen Soldaten.[13]HalderHalder, Franz betrachtete die Stellung als unhaltbar, Hitler setzte ihre Verteidigung durch. Beim Lagevortrag am 24. August forderte HalderHalder, Franz erregt die Rücknahme der 9. Armee, was Hitler mit der Bemerkung quittierte, dass er von der »Führung« die »gleiche Härte wie von der Front« verlange. Das wiederum veranlasste HalderHalder, Franz zu der Versicherung, er selbst habe diese Härte, aber »da draußen fallen die braven Musketiere und Leutnants zu Tausenden und aber Tausenden als nutzlose Opfer in aussichtsloser Lage, nur weil die Führung nicht den einzig möglichen Entschluss« fassen dürfe, nämlich den Rückzug. Hitler brüllte HalderHalder, Franz daraufhin an: »Was wollen Sie, Herr HalderHalder, Franz, der Sie nur, auch im Ersten Weltkrieg, auf demselben Drehschemel saßen, mir über die Truppe erzählen, Sie, der Sie nicht einmal das schwarze Verwundetenabzeichen tragen?« Hitler setzte sich durch, auch deshalb, weil er seinen durch die Teilnahme am Ersten Weltkrieg erworbenen Frontkämpferbonus ausspielte. HalderHalder, Franz hatte tatsächlich fast ausschließlich als Stabsoffizier gedient.[14] Wenige Wochen später wurde er entlassen. Seinen Posten übernahm Kurt ZeitzlerZeitzler, Kurt, der sich dann im Sommer des folgenden Jahres nach heftigen Auseinandersetzungen mit Hitler und dem Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte dauerhaft krankmeldete.
Der Alleinschuldige: ein Konstrukt HaldersHalder, Franz
Nach dem verlorenen Krieg, der vielen Millionen das Leben gekostet hatte, suchten die Militärs nach den Ursachen der Niederlage. Dabei trieb die Offiziere auch ein psychologisches Motiv: Sie wollten sich von dem Makel reinwaschen, Hitler gedient zu haben. Zur Schlüsselfigur dieser Geschichtspolitik wurde Generaloberst Franz HalderHalder, Franz, der sich 1945 den Amerikanern zur Verfügung stellte und von ihnen zum Leiter der deutschen Abteilung ihrer »Historical Division« ernannt wurde. Während seiner Amtszeit entstanden in den Kriegsgefangenen- und Internierungslagern mehr als 2500 Studien zum Zweiten Weltkrieg, auf die er massiv Einfluss nahm, indem er die Verfasser anhielt, Befehlsketten zu verschleiern und vorsätzlich für Ungenauigkeiten und Widersprüche zu sorgen.[15] Die Studien über die Schlachten bei Moskau, El Alamein und Stalingrad wurden in diesem Sinne erstellt und benannten einen Alleinschuldigen der »fatalen Entscheidungen«: Adolf Hitler.[16]
Wie HalderHalder, Franz seinen Oberbefehlshaber gesehen haben wollte, zeigt eine Broschüre, die er 1949 unter dem marktschreierischen Titel »Hitler als Feldherr – Der ehemalige Chef des Generalstabes berichtet die Wahrheit« veröffentlichte. Dieser »dämonische Mann« sei »kein soldatischer Führer« gewesen und erst recht »kein Feldherr«.[17] Dann arbeitete sich HalderHalder, Franz an einzelnen Punkten ab. Rüstung? Hitler habe durch seine Hektik oft mehr zerstört, als er geschaffen habe. Luftwaffe? Hier »triumphierte der Zahlenrausch« statt echter Kampfkraft. Vorstoß auf Stalingrad? Ideologisch motiviert, meinte HalderHalder, Franz und verschwieg, dass er selbst die Fortsetzung des Feldzugs in den Süden der Sowjetunion ausgearbeitet hatte. Mehr noch, bei der Definition der Kriegsziele Stalingrad und Leningrad habe es sich um blanken »Größenwahn« gehandelt. Sie seien »bloße Augenblickseingebungen« gewesen, verursacht durch die »krankhafte Überschätzung« der eigenen Kraft, die mit einer »verbrecherischen Unterschätzung« des Feindes einhergegangen sei. Für andere Behauptungen seiner Broschüre blieb HalderHalder, Franz die Belege schuldig, etwa für das ständige Zaudern Hitlers. Selbst bei dem innovativen Feldzugsplan gegen Frankreich 1940 sprach HalderHalder, Franz dem einstigen Oberkommandierenden jede Mitwirkung ab, obwohl es Hitler gewesen war, der den »Sichelschnitt-Plan« durchgesetzt hatte, und zwar gegen den Willen des Generalstabs.[18]
Legendenbildung 1949. Der ehemalige Generalstabschef Franz Halder stilisierte Hitler zum Alleinschuldigen an der Niederlage im Zweiten Weltkrieg. Der ehemalige Gefreite, behauptete er, habe zahllose falsche strategische und taktische Entscheidungen getroffen. Die Militärs hätten an ihnen nicht mitgewirkt.
(Copyright ©: Sammlung Eberle)
Zugleich vermied es HalderHalder, Franz, Fragen anzuschneiden, die andere, klügere Generale beschäftigten. So befand Heinz GuderianGuderian, Heinz den italienischen Angriff gegen Griechenland für ebenso »leichtfertig wie überflüssig«. Es hätte »gemeinsamen« deutschen und italienischen Interessen entsprochen, auf das »griechische Abenteuer« zu verzichten und stattdessen die Lage in Afrika zu »festigen«, schrieb er in seinen 1951 veröffentlichten Memoiren.[19] Er sah es auch als falsch an, aus »eigenem Entschluss« Krieg gegen Russland zu führen, zumal der Feldzugsplan seinen persönlichen Vorstellungen widersprach. »Klotzen, nicht kleckern«, hatte GuderianGuderian, Heinz immer wieder gefordert, und so hielt er den Versuch, drei nahezu gleich starke Heeresgruppen mit divergierenden Zielen in den russischen Raum hineinzutreiben, für unsinnig.[20] Der ranghöhere HalderHalder, Franz war an beiden Entscheidungen beteiligt gewesen. GuderianGuderian, Heinz hatte ihm seine Bedenken durch seinen Stabschef übermitteln lassen, ohne, wie er in seinen Memoiren schrieb, »das mindeste zu erreichen«.[21] Der Generalstab war, ausgehend von den Erfahrungen der Invasion in Frankreich, zu dem Schluss gekommen, die Sowjetunion ließe sich in einem neun- bis siebzehnwöchigen Feldzug niederringen.[22]
Bei den davongekommenen Generalen herrschte ein starker Drang, alle Niederlagen auf einsame Beschlüsse Hitlers zurückzuführen und alle Siege für die militärischen Stellen zu reklamieren. Dabei scheuten sie auch vor Lügen und Ungenauigkeiten nicht zurück. So behauptete der Schöpfer des V2-Raketenprogramms Generalmajor Walter DornbergerDornberger, Walter, Hitler habe die Entwicklung durch mangelnde Zuteilung von Arbeitskräften und Material eineinhalb Jahre zurückgeworfen.[23] Tatsächlich verweigerte Hitler lediglich zusätzliche Stahlzuteilungen, die DornbergerDornberger, Walter einforderte, um seine Bauvorhaben in Peenemünde schneller als geplant voranzutreiben.[24] Auch der General der Jagdflieger Adolf GallandGalland, Adolf führte die zahlreichen Leser seiner Memoiren vorsätzlich in die Irre. »Was hatten wir für Möglichkeiten«, seufzte er rhetorisch in einer Kapitelüberschrift, um dann mehrere Seiten lang über die verpasste Chance zum Einsatz des ersten Düsenjägers der Welt, der Messerschmidt 262, zu lamentieren. Hitler persönlich habe 1940 einen Entwicklungsstopp befohlen, sodass mindestens anderthalb Jahre Zeit verloren worden seien. Dann sei Hitler im Dezember 1943 auf die Idee verfallen, das Flugzeug zum »Blitz-Bomber« umkonstruieren zu lassen, was wieder Zeit gekostet habe. Überhaupt sei das der abwegige »Einfall eines Laien« gewesen, den niemand, schon gar nicht die Experten der Luftwaffe, ernst genommen habe.[25] Das Gegenteil ist wahr. Gerade die technischen Experten, und mit ihnen die gesamte Luftwaffenführung, fieberten der Fertigstellung eines Bombenflugzeugs entgegen, das schneller sein sollte als die feindlichen Jäger. Die Me 262 war von Anfang an als Bombenträger konzipiert, Schwierigkeiten bei der Fertigung verzögerten den ohnehin erst für 1945 geplanten Einsatz, nicht die angeblich laienhaften Einfälle Hitlers.[26]
Noch wolkiger als die Davongekommenen argumentierten die Befehlshaber und Generalstäbler, die angeklagt wurden. Die wenigsten übernahmen Verantwortung für das, was sie getan hatten[27], die meisten stilisierten sich zu Verführten Hitlers oder gar zu dessen Opfern. Ein Beispiel dafür bietet Hitlers Anwalt Hans FrankFrank, Hans, der für seinen Einsatz mit dem Posten als Generalgouverneur der einst polnischen Gebiete belohnt worden war. Bei Hitler habe sich eine Charakterveränderung vollzogen, versuchte er zu suggerieren: »Aus Mut wurde Übermut, aus Kraft wurde Kraftmeierei, aus Vernunft wurde Unsinn, aus Energie wurde Gewalt, aus Macht wurde Brutalität, aus lichtem Traum reiner Hoffnungen wurden furchtbare, hassverzerrte Nachtvisionen.«[28] Welchen »lichten Traum reiner Hoffnungen« er bei Hitler erkennen wollte, verschwieg er allerdings.
Hitlers engster militärischer Berater Alfred JodlJodl, Alfred, Chef des Wehrmachtführungsstabs, versuchte beim Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg eine noch radikalere Verteidigungsstrategie. Die ganze deutsche Wehrmacht habe 1939 vor einer »unlösbaren Aufgabe« gestanden, sagte er dem Gericht, »nämlich: einen Krieg zu führen, den sie nicht gewollt, unter einem Oberbefehlshaber, dessen Vertrauen sie nicht besaßen und dem sie selbst nur beschränkt vertrauten, mit Methoden, die oft ihrem Führungsgrundsatz und ihren erprobten Anschauungen widersprachen, mit Truppen und Polizeikräften, die nicht ihrer vollen Befehlsgewalt unterstanden, und mit einem Nachrichtendienst, der teilweise für den Gegner arbeitete«.[29] Gegenüber seiner Frau flüchtete er dann allerdings in die gleiche Opferrolle, die schon FrankFrank, Hans öffentlich eingenommen hatte. »Hat er nicht auch mit meinem Idealismus gespielt«, fragte er rhetorisch, »und ihn nur benutzt zu Zwecken, die er in seinem Innersten verbarg?« JodlsJodl, Alfred Ehefrau klammerte sich an diese Version des Geschehens und gestattete die Veröffentlichung des in der Nürnberger Zelle geschriebenen Briefs.[30] Wie stark sich JodlsJodl, Alfred Bild von Hitler gewandelt hatte, zeigt eine Aussage, die er einem sowjetischen Vernehmungsprotokoll zufolge 1945 im Kriegsgefangenenlager Mondorf (Luxemburg) machte. »Unbestreitbar« sei Hitler »ein Genie, ein ungewöhnlicher Mensch« gewesen, urteilte er, als von einer Anklage als Kriegsverbrecher noch nicht die Rede war. »Die Fähigkeit zur Arbeit« sei diesem angeboren gewesen, er habe ständig gearbeitet und alle mit seinem bemerkenswerten Gedächtnis überrascht. Bewundernd setzte er hinzu: »Privat lebte er so, wie er es auch selbst predigte – bescheiden und einfach.« Das Einzige, was er in der Rückschau an ihm bemängele, sei die übermäßige Härte: »Trotz der angeborenen Weichherzigkeit, der Liebe zu Kindern und Tieren, wurde er während des Kriegs sehr hart und grausam.«[31] Von Verbrechen und Mordbefehlen wollte JodlJodl, Alfred nichts wissen, anders als andere, die sie für »richtig« hielten. Ein SS-Brigadeführer, der eine Einsatzgruppe in Russland kommandiert hatte, betonte das ausdrücklich in seinem Kriegsverbrecherprozess. Die Ermordung der Juden hielt er für geboten, weil das »ein Teil unseres Kriegszieles und deshalb notwendig war«.[32]
Fehlerdiskussion – Der Gefreite als Feldherr?
Die These vom alleinschuldigen Hitler wurde in Deutschland begeistert aufgegriffen. Die Zeugnisse der Generale sortierten die Verantwortung und reduzierten sie damit auf eine Befehlskette, die sie selbst entlastete und die Deutschen insgesamt von jeder Verantwortung freisprach. Erst die heftigen und zum Teil erbittert geführten Debatten in der deutschen Geschichtswissenschaft verschoben den Fokus seit den achtziger Jahren weg von Hitler, der als Person mehr und mehr verblasste, hin zu den Verbrechen der Deutschen während des NS-Regimes.[33] Die entscheidenden Impulse setzten dabei allerdings britische und amerikanische Historiker, die versuchten, Ereignisse genau zu rekonstruieren, und wissen wollten, wie es zu dem millionenfachen Mord an den Juden hatte kommen können.[34] Auch in Deutschland schlug das Pendel nach dieser Seite aus, weshalb sich Historiker inzwischen dafür rechtfertigen, wenn sie sich der Geschichte biographisch nähern.[35]
Die Fragen, die von den Kommandeuren der verschiedensten Wehrmachtseinheiten nach 1945 aufgeworfen wurden, erfordern trotzdem Antworten. Das Militärgeschichtliche Forschungsamt der Bundeswehr veröffentlicht seit 1979 Studien zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs, die eine Art »amtlichen« Charakter tragen. Jeder der bis heute veröffentlichten zehn Bände wurde von Offizieren und Historikern Satz für Satz debattiert und einer fachlichen Kritik im Kollegenkreis unterzogen.[36] Die persönliche Ebene des Oberkommandierenden der Wehrmacht blenden diese Studien üblicherweise aus, es sei denn, nachweisbar existierende Befehle Hitlers beeinflussten den Kriegsverlauf maßgeblich. Der Gedankengang des inkompetenten Feldherrn, der nur den Horizont eines »Gefreiten des Ersten Weltkriegs« hatte, fand trotzdem ihren festen Platz in der Forschungsliteratur. In einem Band des »offiziellen« Weltkriegswerks urteilte der Bearbeiter des Abschnitts Rüstung, Hitlers kriegstechnisches Wissen sei über die Erfahrungen des Weltkriegs kaum »hinausgekommen«.[37] Das impliziert, dass Hitler die modernen Kampfmittel nicht verstanden hätte. Warum investierte das Deutsche Reich dann aber Milliarden in den Aufbau einer leistungsfähigen Luftwaffe, in elektrisch betriebene U-Boote und das Projekt einer Fernrakete, die große Sprengstoffmengen tragen konnte? Auch die Annahme von Gerhard P. GroßGroß, Gerhard P., Oberst im Militärgeschichtlichen Forschungsamt, dass die zahlreichen Fehlentscheidungen Hitlers die Ursache für den Untergang der Heeresgruppe Mitte im Sommer 1944 gewesen seien, muss hinterfragt werden. Die Ansicht russischer Militärhistoriker, die mehrfache Überlegenheit der sowjetischen Armee spreche für einen geplanten Sieg der Roten Armee, erscheint plausibler.[38]
Immer wieder verweisen Historiker und Publizisten auf den geringen Rang Hitlers im Ersten Weltkrieg und versuchen so, seine Führungsfehler und auch seine vermeintlichen Fehlentscheidungen zu erklären. Zwei Beispiele für solche »Fehlentscheidungen« Hitlers aus dem Jahr 1940 werden bevorzugt zur Illustration herangezogen. Der Haltebefehl für GuderiansGuderian, Heinz voranstürmende Panzerverbände im Mai 1940 habe die Vernichtung des britischen Expeditionskorps verhindert – je nach Standpunkt eine »kriegsentscheidende Katastrophe« oder ein glücklicher Missgriff.[39] Als Beispiel für Hitlers Führungsschwäche dient auch seine Nervosität bei der Eroberung Norwegens – er gab zwar nicht die Operation selbst verloren, geriet aber in Panik, weil der überaus wichtige Erzhafen Narvik nicht gehalten werden konnte. Er habe sich die Gegenattacke der Engländer »so drastisch ausgemalt«, meinte der britische Militärhistoriker John KeeganKeegan, John, dass er den deutschen Gebirgsjägern sogar den Rückzug nach Schweden erlaubte.[40]
Der Haltebefehl bei Dünkirchen ging, wie Historiker rekonstruierten, nicht auf Hitler, sondern auf GuderiansGuderian, Heinz Vorgesetzten Gerd von RundstedtRundstedt, Gerd von zurück. Der Chef der Heeresgruppe A befürchtete Gegenstöße der Franzosen in die Flanke der aus seiner Sicht zu weit vorgerückten Panzer.[41] Dank der Zeitverzögerung und, was häufig übersehen wird, des erbitterten Widerstands der auf kleinstem Raum zusammengedrängten Briten und Franzosen gelang es der britischen Marine, mehr als 338000 Soldaten zu evakuieren.[42] Bei Tunis gerieten mehr als 300000 Deutsche und Italiener in Gefangenschaft, bei Stalingrad summierten sich die Verluste der Deutschen, Italiener, Rumänen, Ungarn und Kroaten auf mehr als 800000. Aus Hitlers Perspektive war das zu verschmerzen, wie sein Chef des Oberkommandos der Wehrmacht nach Kriegsende zu Protokoll gab. Am 17. Juni 1945 sagte Generalfeldmarschall Wilhelm KeitelKeitel, Wilhelm sowjetischen Militärs bei einer Vernehmung, dass 1944/45 »die rüstungswirtschaftliche Lage Deutschlands und die Lage der menschlichen Ressourcen nicht katastrophal waren«. Die Produktion konnte auf »ausreichend hohem Niveau« gehalten werden, meinte KeitelKeitel, Wilhelm, die Luftangriffe hätten zwar »in einigen Betrieben zum Ausfall der Produktion« geführt, aber deren Wiederherstellung sei immer wieder sehr rasch gelungen. Die rüstungswirtschaftliche Lage Deutschlands wurde, so KeitelKeitel, Wilhelm, »erst gegen Ende 1944 hoffnungslos und die Versorgung mit menschlichen Ressourcen erst Ende Januar 1945«.[43]
Wenige Wochen vor dem Haltebefehl von Dünkirchen konnte die Wehrmacht die Stadt Narvik unter ihre Kontrolle bringen. Die Eroberung Norwegens war der dringlichste Wunsch der Kriegsmarine gewesen, die so ihre Ausgangsbasis für den Seekrieg gegen Großbritannien verbessern wollte. Die Rüstungsstrategen waren dafür, weil das zweifellos die wohlwollende Neutralität Schwedens sichern würde.[44] Hitler ließ sich leicht von dem Plan überzeugen, schon deshalb, weil Deutschland gerade einmal 27,14 Prozent seines Eisenerzes selbst erzeugte. Der größte Teil wurde aus Schweden importiert.[45] Die Verschiffungshäfen waren das nicht immer eisfreie Lulea an der schwedischen Ostsee und Narvik, der Hafen am anderen Ende der sogenannten Erzbahn.
Die Besetzung Norwegens gelang nur zum Teil im ersten Angriff. Die britische Flotte erreichte die Küste des Landes zur gleichen Zeit wie die Deutschen, bildete einen Brückenkopf auf den vor Narvik gelegenen Inseln und verdrängte dann die etwa 2500 angelandeten Gebirgsjäger der Wehrmacht. Das löste eine Führungskrise in Berlin aus. Hitler gab die Operation mit der Bemerkung, man habe eben Pech gehabt, verloren. Zeitzeugen berichteten sogar von »Szenen kopfloser Erregung«. Später gelang es, Bodentruppen nachzuführen, doch bevor sich eine wirkliche Schlacht um Narvik entwickeln konnte, entschied das britische Kriegskabinett, Narvik zu zerstören und zu räumen. Mehr als 24000 alliierte Soldaten verließen den Stützpunkt im Juni 1940.[46] Warum die Regierung in London beschloss, die strategisch ungemein wichtige Stellung freiwillig aufzugeben, ist unklar. Mit einem ausgebauten Brückenkopf rund um Narvik hätte die Erzzufuhr nach Deutschland unterbunden werden können. Ein nach 1945 von englischen Verhörspezialisten befragter einstiger Kommandeur der deutschen Truppen in Norwegen gab unumwunden seiner Verwunderung Ausdruck, dass Großbritannien diese »große Gelegenheit« verschenkte.[47]
In Erinnerung blieb jedoch nicht das Versagen der britischen Regierung, sondern die Krise in der Berliner Reichskanzlei. Hitlers angebliche Führungsschwäche im April 1940 wurde rückblickend immer wieder als das erste Beispiel für die Ausgabe unsinniger Halte- oder Rückzugsbefehle interpretiert – obwohl seine Anordnungen von einer gewissen Stringenz zeugen. Er versuchte, die Marine zum Nachführen weiterer Truppen zu bewegen, was der Chef der Seekriegsleitung Erich RaederRaeder, Erich ablehnte. Angesichts der Tatsache, dass alle bis dahin nach Narvik entsandten Schiffe versenkt worden waren, erschien ihm das Risiko zu groß. Es war also RaederRaeder, Erich, der Narvik preisgab. Hitler hingegen befahl jetzt das Nachführen von Truppen auf dem Landweg und die Entsendung von Fallschirmjägern, weil er den britischen Brückenkopf unbedingt beseitigen wollte. Er konnte nicht wissen, dass die Briten und Franzosen sich zurückziehen würden.[48]
Hitlers Zaudern und Zögern, seine Wutanfälle und willkürlichen Entlassungen, deutsche Erfolge und das Versagen der Wehrmacht – all das gehört zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Seine Führungsrolle kann, wie gezeigt, nicht nur auf die Überforderung des »Gefreiten des Ersten Weltkriegs« zurückgeführt werden. Schon Zeitgenossen bemerkten bei ihm »einen gewissen Blick für operative Möglichkeiten«, den man aber auch bei ungebildeten Laien finden könne.[49] Diese Ansicht äußerte Erich von MansteinManstein, Erich von, ein Generalfeldmarschall, der Hitlers Krieg im Osten ebenso prägte wie sein Vorgesetzter und Rivale Franz HalderHalder, Franz. MansteinManstein, Erich von, der eigentliche Autor des Plans für den Feldzug gegen Frankreich, verehrte Hitler so stark, wie HalderHalder, Franz ihn nach seiner Entlassung verachtete.
Die publizistisch ausgetragene Kontroverse der beiden Militärs wirkt sich bis heute auf die Geschichtsschreibung aus. Zugleich hat sie den Blick verengt. Beide stritten sich über Details, vermieden aber eine Antwort auf die Frage, wie es eigentlich zum Zweiten Weltkrieg kommen konnte. Die Akteure suggerierten, es sei eine Art Naturgesetz gewesen, dass die Katastrophe, die mehr als 60 Millionen Opfer forderte, über Europa und Asien hereinbrach. Sie hinterfragten nicht, warum ein Mann wie Hitler, ein erfolgloser Künstler und Weltkriegsgefreiter, den Anstoß zum Krieg geben konnte.
Der naive Panzergeneral Heinz GuderianGuderian, Heinz machte dafür Hitlers vermeintliche Erfolge als Reichskanzler geltend: »die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, die Hebung der Arbeitsmoral, die Hebung der nationalen Gesinnung, die Beseitigung des Parteienwirrwarrs«.[50] Wie Hitler dieser Aufstieg zum Politiker gelang, war für ihn nebensächlich. Er nahm ihn hin, ebenso wie die anderen Spitzenmilitärs. Denn GuderianGuderian, Heinz stand mit dieser Meinung nicht allein, HalderHalder, Franz und von MansteinManstein, Erich von hatten den Umbau des Deutschen Reichs von einer Demokratie zur Diktatur ebenso begrüßt wie die meisten Offiziere und ein großer Teil des deutschen Volks. Sie akzeptierten den Primat der Politik, solange in ihrem Sinne Geschichte gemacht wurde. Der Gefreite des Ersten Weltkriegs, der Führer der NSDAP und Reichskanzler erschien ihnen als der richtige Mann am richtigen Platz, bis das Kriegsglück sich wendete.
2Hitlers erster Weltkrieg
Adolf Hitler, geboren am 20. April 1889 in der oberösterreichischen Grenzstadt Braunau am Inn, hätte sich im Jahr 1910 zur Musterung melden müssen. In der Doppelmonarchie war ein dreijähriger Wehrdienst zu leisten. Die Dienstpflicht wurde jedoch nicht besonders streng gehandhabt, denn das Heer war sehr klein, und es gab deshalb viele »Überzählige«. An die Wehrpflichtigen wurden hohe Anforderungen gestellt, schon geringfügige gesundheitliche Schwächen reichten für eine Ausmusterung.[51]
Obwohl er als Jugendlicher nicht selten unter Erkältungskrankheiten und wohl auch an einer Mandelentzündung gelitten hatte, häufig blass aussah und ein wenig schmächtig wirkte, wollte Hitler sich darauf nicht verlassen. Denn das »schwere Lungenleiden«, das er laut Mein Kampf als Schüler durchgemacht haben wollte und das zur Rückstellung gereicht hätte, gab es nicht.[52] Der Musterung entging Hitler vielmehr durch mehrere Wohnungswechsel. Er zog nach Wien, wohnte dort bei Verwandten und später in einem Männerwohnheim. Seinen Lebensunterhalt verdiente er als Kunstmaler, Zuschüsse von Angehörigen ermöglichten ihm gelegentlichen Luxus, etwa Opernbesuche.[53] Im Mai 1913 packte er seinen Koffer erneut und siedelte nach München über. Fortan galt er als »stellungsflüchtig«. Die behördlichen Ermittlungen waren erfolgreich, und er wurde aufgefordert, sich auf dem österreichischen Konsulat zu melden. Dort stimmte Hitler ein phantasievolles Klagelied von Armut, Krankheit und Not an. Es gelang ihm, so die Historikerin Anna Maria SigmundSigmund, Anna Maria, beim Konsul einen »derart leidensvollen Eindruck zu erwecken, dass dieser gegen seine Vorschriften verstieß« und vom Antrag auf Auslieferung Abstand nahm. Zugleich bestand das Gremium auf einer Überprüfung des Befundes. Der erneuten Musterung musste sich Hitler dann in Salzburg stellen, wo die Kommission am 5. Februar 1914 konstatierte: »Zum Waffen- und Hilfsdienst untauglich, zu schwach. Waffenunfähig.«[54]
Soldat im Bewegungskrieg 1914
Hitlers Bestreben, sich dem Dienst im Heer des Vielvölkerstaates zu entziehen, liegt vermutlich darin begründet, dass er schon damals stark deutschnational empfand. Zwar verneinte Max AmannAmann, Max, der im Ersten Weltkrieg als Feldwebel zeitweise Hitlers Vorgesetzter gewesen war, nach dem Zweiten Weltkrieg die Frage, ob Hitler bereits in dieser frühen Zeit ihrer Bekanntschaft über gefestigte politische Vorstellungen verfügte. Aber er habe den Leuten immer Vorträge über die schrecklichen Zustände in Österreich gehalten, das innerlich »zerfallen« sei.[55] Auch in Mein Kampf sparte er nicht mit Tiraden über das von den Tschechen unterwanderte Wien. Das war eine abwegige Behauptung, wie Brigitte HamannHamann, Brigitte nachgewiesen hat, aber bei der Lektüre deutschnationaler Pamphlete und ätzender Satireblätter konnte sich dieser Eindruck aufdrängen. Es ist sicher, dass Hitler solche Publikationen kannte und für zutreffend hielt, sang er doch in Mein Kampf das Hohelied auf die rechts stehenden deutschnationalen Politiker, die dieser »Unterwanderung« entgegentreten wollten.[56]
Am 2. August 1914 eilte also ein deutsch-patriotisch empfindender junger Mann zur Kundgebung auf dem Münchner Odeonsplatz, mit der Tausende die Mobilmachung jubelnd begrüßten.[57] Am Sinn dieses Kriegs ließ Hitler später keinen Zweifel. Die Deutschen hätten für das erhabenste und gewaltigste Ziel gekämpft, das sich für Menschen denken lasse, formulierte er pathetisch, »die Freiheit und Unabhängigkeit unseres Volkes, die Sicherheit der Ernährung für die Zukunft und – die Ehre der Nation«.[58] Am 5. August, die Deutschen belagerten Lüttich, meldete sich Hitler als Freiwilliger, wurde jedoch weggeschickt, da es keine Verwendung für ihn gab. Am 16. August erhielt er dann den Befehl, sich beim Rekruten-Depot zu melden, und wurde dem neu formierten 16. Reserve-Infanterieregiment zugeteilt. Die Soldaten wurden im Waffengebrauch unterwiesen und gedrillt. Eine größere »feldmarschmäßige« Übung im September beendete die Ausbildung.
Als das Regiment an die Front verlegt wurde, war der deutsche Feldzug im Westen bereits gescheitert. Paris war nicht wie geplant innerhalb kurzer Zeit gefallen, stattdessen konnten die Franzosen die Front stabilisieren und wichtige Punkte, etwa die Festung Verdun, halten. Das Ziel der Deutschen war jetzt die Inbesitznahme eines möglichst breiten Küstenstreifens am Ärmelkanal, um Großbritannien von seinem Verbündeten Frankreich zu trennen und seine Truppen vom Krieg auf dem Kontinent fernzuhalten. Sie starteten einen »Wettlauf zum Meer«, aus dem Nebenkriegsschauplatz Flandern war im Oktober 1914 der einzig mögliche Durchbruchspunkt an der Westfront geworden.
Hitlers Regiment sollte bei einer Operation gegen die Stadt Ypern eingesetzt werden. Mit der Einnahme dieses Verkehrsknotenpunktes wären die Verbände der Engländer vom französischen Hinterland abgeschnitten worden und hätten so einfacher bekämpft werden können. Die Eroberung Yperns hätte möglicherweise sogar eine strategische Bedeutung gehabt.[59] Das erkannten auch die Entente-Mächte im Westen, weshalb der Kampf um diese Stadt in eine der erbittertsten Schlachten der Kriegsgeschichte mündete, wie der britische Historiker Martin GilbertGilbert, Martin urteilte.[60] Das Ergebnis war ein Unentschieden. Den alliierten Truppen fiel es nicht schwer, einen »Wettlauf«, der in Marschgeschwindigkeit stattfand, zusätzlich zu verlangsamen. Briten und Franzosen gruben sich ein und errichteten Systeme aus Gräben, Stacheldraht und Sprengfallen, in denen sich der Kampf erschöpfen musste. Zugleich setzten die verbliebenen belgischen Truppen große Gebiete durch Deichsprengungen unter Wasser. Der Durchbruch zur Kanalküste war zu einem erbitterten Ringen um Dörfer, Anhöhen, Wäldchen und Straßen geworden. Die Briten hielten die Schlacht praktisch für gewonnen. Die Reserveregimenter seien der letzte Trumpf, den die deutsche Führung noch ausspielen könne, glaubte der Oberbefehlshaber des Expeditionsheeres in Flandern Feldmarschall John FrenchFrench, John.[61]
Die britischen Gräben in Flandern wurden noch 1914 zu undurchdringlichen Sperrwerken ausgebaut.
(Copyright ©: Sammlung Eberle)
In diese im Erstarren begriffene Front wurde Hitlers Regiment Mitte Oktober geworfen. Nach einem fröhlichen Auszug aus München und einem Eisenbahntransport über Augsburg und Köln trafen die Soldaten am 23. Oktober auf dem völlig zerschossenen Hauptbahnhof in Lille ein. Inmitten der rauchenden Trümmerhaufen sahen sie weinende und bettelnde Frauen und Kinder, trotzige und verschlossene Männergestalten, wie der Divisionsgeistliche in sein Tagebuch notierte.[62] Sie verbrachten einige Stunden der Ruhe in einer zerstörten Vorstadt von Lille, dann zwei Tage in Lille selbst. Am 27. Oktober brach das Regiment um vier Uhr morgens auf. Im Laufe des Nachmittags überschritten die Soldaten den französisch-belgischen Grenzfluss Lys. Nach 40 Kilometern Fußmarsch biwakierten die Kämpfer bei Panemolen. Die Stimmung war so gut wie die Verpflegung. Kaffee wurde ausgegeben, in den Feldküchen brodelten in großen Kesseln Suppen mit frisch von den umliegenden Feldern geerntetem Gemüse. In den verlassenen Gehöften fand sich noch manches Stück Vieh, das geschlachtet und zubereitet wurde. Und nicht zuletzt gab es genügend Stroh für Lagerstätten.[63]
Die Front bei Ypern im Oktober 1914. Die deutschen Armeen sollten den wichtigen Eisenbahnknotenpunkt im Sturm nehmen, was nicht gelang. Die Karte stammt aus dem Weltkriegswerk von Hermann Stegemann, das Hitler später griffbereit in seinem Bücherregal platzierte.
(Copyright ©: Hermann Stegemann, Geschichte des Krieges, Stuttgart 1917–1921)
Andererseits konnten viele Soldaten nicht schlafen, weil die Kadaver verendeter Pferde unerträglich stanken. Hitler und seine Kameraden vergruben die Tierkörper und befanden den Platz danach für tauglich zur Nachtruhe. Nur wenige Minuten später wurden sie geweckt, um befehlsgemäß einen anderen Schlafplatz zu beziehen.[64] Tags darauf zogen die Offiziere das Regiment auseinander und machten es bereit, zur eigentlichen Front vorzustoßen.
Am 29. rückten die einzelnen Bataillone aus und trafen schon bald auf feindliche Verbände. Furcht hätten sie nicht gehabt, schrieb Hitler einige Monate später an einen Bekannten in München, denn: »Wir hatten noch keine rechte Ahnung von der Gefahr.«[65] Die bayerischen Soldaten griffen an und warfen den Gegner, ein abgekämpftes Regiment schottischer Highlander, aus einer gut ausgebauten Stellung. Beim anschließenden Sturm ging jedoch, wie die offizielle Regimentsgeschichte vermerkt, »augenblicklich alle Ordnung verloren«. Jeder wollte vorn sein, um die anscheinend leicht zu erringenden Lorbeeren zu ernten. Wie die Highlander in ihren blau-grün-rot gestreiften »Knieröckchen« mit blanken Beinen die Ackerfurchen hinaufrannten, erregte Heiterkeit: »Da schauns hin, Herr Hauptmann, die haben ja Weiber dabei …«
Wenige Minuten später wurde einer der stürmenden Offiziere erschossen, was die Heiterkeit schlagartig verstummen ließ.[66] Die Offensive der Bayern stockte an den Drahtverhauen der zweiten und dritten Linie, in deren Ecken und Winkeln die Engländer aus gut getarnten Feuerstellungen schossen. Sie stießen trotzdem weiter vor und eroberten ein kleines Waldstückchen, den später nach ihnen benannten »Bayernwald«. Die Briten stellten jetzt ihr Artilleriefeuer auf diesen Wald ein, schleuderten so Wolken von Steinen, Erde und Sand empor, entwurzelten Bäume und erstickten alles in einem »gelbgrünen, scheußlichen, stinkigen Dampf«, wie sich Hitler erinnerte. Sie retteten sich in einen Graben, der von Württembergern erstürmt worden war. Jetzt setzte auch die deutsche Artillerie ein. In »stellenweise blutigem Zweikampf« eroberten sie weitere Gräben. Hitler: »Was sich nicht ergibt, wird niedergemacht.« Die Bayern erreichten eine Straße, liefen in einen Wald, aus dem sie die Gegner vertrieben, und versuchten, einige Gehöfte einzunehmen, die heftig verteidigt wurden. Zusammen mit anderen wurde Hitler zurück in das Wäldchen geschickt, um versprengte Kämpfer zu finden. Als er zurückkam, waren die ersten Angriffe schon gescheitert, der Major lag mit zerschossener Brust am Boden, um ihn herum Verwundete und weitere Tote.
An den nächsten Versuchen, die Gehöfte zu erstürmen, nahm Hitler teil. Ein Schuss riss ihm den rechten Ärmel herunter, »wie durch ein Wunder bleibe ich unverletzt und heil«. Drei Stunden dauerte der Kampf um die Bauernhäuser, den die Bayern schließlich nachmittags um fünf gewannen. Sie gruben sich ein, die Opfer wurden liegen gelassen und erst später gezählt.[67] Noch fiebernd von den Anstrengungen des ersten Kampftages und ohne jede Verpflegung, hüllten sich die Männer in ihre Mäntel, um sich vor dem Regen zu schützen. Die Feldküche kam erst gegen Mitternacht an, in den geplünderten Gräben fand sich jedoch manch Verwertbares, Corned Beef etwa oder eine Dose Keks.[68]
Ohne jede Artillerieunterstützung mussten die Bayern am nächsten Nachmittag einen erneuten Vorstoß unternehmen, und schon nach wenigen Minuten, so die Regimentsgeschichte, setzte Schrapnellfeuer ein, und die Soldaten fielen »wie reife Garben unter der Sense des Schnitters«. Kriechend in den frischen Ackerfurchen suchten die Soldaten nach Deckung, um im geeigneten Moment wieder zum Sprung anzusetzen. War der gestrige erste Ansturm der Deutschen noch erfolgreich, war er es an diesem Tag nicht mehr. Es ist aufschlussreich, dass Hitler in seinem Feldpostbrief nur den ersten Tag beschreibt. Der Gegner hatte neue Truppen ins Gefecht geworfen. Die Bayern und Württemberger konnten zwar die Stellung an der Straße nach Becelaere noch eine Weile halten, mussten dann aber zurückweichen. Dankbar vermerkt die Regimentsgeschichte, dass sich die Briten der bayerischen Verwundeten angenommen hätten.[69] Es gelang den vereinigten Resten noch, das Städtchen Gheluvelt einzunehmen, woran Hitler jedoch nicht beteiligt war. Dessen Bataillon lag, befehlsgemäß, in den Gräben und sollte als Reserve später in den Kampf geführt werden. Dauerbeschuss der britischen Artillerie machte jedoch jedes Auftauchen unmöglich: »Man lag an die vorderen Grabenwände geschmiegt und ließ den Eisenhagel darüber hinwegbrausen.«[70] In Gheluvelt endete der Sturm des 16. Reserve-Infanterieregiments unter großen Verlusten. Nach vier Tagen Kampf wurde den Überlebenden der Rückzug befohlen.
Es ist Thomas WebersWeber, Thomas Verdienst, den deutschen Sturm auf Gheluvelt von seinem Heldenmythos entkleidet zu haben, den Hitler und andere später verbreiteten. Bei korrekter Zählung kam WeberWeber, Thomas auf Verluste von etwa 75 Prozent, von mehr als 3000 Mann waren noch 725 einsatzfähig. Genauso viele hatten ihr Leben verloren. Nicht alle Frontkämpfer berichteten so euphorisch wie Hitler. Ein Kamerad, der wie dieser den Krieg überleben sollte, schrieb, dass er »vier furchtbare Tage« ertragen habe: »Was ich erlebt, wäre genug.«[71] Für die Briten waren es die drei »glorreichen Tage«, denn das deutsche Ziel, die Eroberung Yperns, war nicht erreicht worden und wurde auch im weiteren Kriegsverlauf nie erreicht. Sie feierten die Erstarrung der Front als Sieg, was sie de facto auch war.[72]
Im Winter 1914/15 war die Front in Flandern erstarrt. Die Entscheidung wurde woanders gesucht. Die großen Abnutzungsschlachten in Verdun und an der Somme erlebte Hitler nicht aus nächster Nähe.
(Copyright ©: Hermann Stegemann, Geschichte des Krieges, Stuttgart 1917–1921)
In seinem Feldpostbrief an den Bekannten beschrieb Hitler auch die Verleihung des Eisernen Kreuzes II. Klasse an ihn. Vor dem Einreichen des Antrags hätten sie im Zelt des Regimentskommandeurs antreten müssen, um noch einmal persönlich Auskunft zu geben. Weil die Kompanieführer auch gehört werden sollten, mussten die Kandidaten das Zelt verlassen, in das dann eine Granate einschlug. Hitler: »Es war der furchtbarste Anblick meines Lebens.« Er habe Oberstleutnant EngelhardtEngelhardt, Philipp, der dabei schwer verwundet wurde, »vergöttert«.[73]
Am 3. November wurde Hitler zum Gefreiten befördert und am 9. zum Regimentsstab versetzt. Ein Regimentsstab wie beim RIR16 bestand aus vier Offizieren – Kommandeur, Regimentsadjutant, Arzt und Quartiermeister. Diesen waren rund fünfzig Unteroffiziere und Soldaten unterstellt. Hitler zählte zu den Ordonnanzen, also Hilfskräften, und erhielt die Funktion eines Meldegängers, was bedeutete, dass er Befehle oder Informationen vom Stab zu den Bataillonskommandeuren bringen musste. In unmittelbaren Kontakt zu den vordersten Linien kam Hitler fortan nur noch selten.[74] Der Umgang der Vorgesetzten mit ihren Untergebenen war üblicherweise korrekt, obwohl sich Hitlers Meldegängerkollege Balthasar BrandmayerBrandmayer, Balthasar an »Schikanen« durch einen bestimmten Offizier erinnerte. Seine Versetzung sei für alle ein »Freudentag« gewesen.[75]
Das Erstarren der Front empfand Hitler als unangenehm, wie ein Brief zeigt, den er am 26. Januar 1915 seinem Vermieter schrieb. Seit zwei Monaten liege das Regiment nun schon ununterbrochen an der Front, der Stab befinde sich in Messines. Die deutsche Artillerie habe den Ort unter »Strömen von Blut« erobert, aber erst nachdem er von ihr sturmreif geschossen worden sei. Die 21-Zentimeter-Mörser hätten »gespielt«, jeder Trichter sei so groß gewesen, dass ein Heuwagen hineingepasst hätte. »Schaurig« aber sei das feindliche Feuer in der Nacht. Trotzdem blieb Hitler optimistisch: »Aus dem Ort bringt uns kein Tod und kein Teufel mehr heraus.«[76] Und hinter Messines wimmle es von jungen, frischen Regimentern. Seine Kameraden und er würden ausharren, bis diese fertig ausgebildet seien, dann könne »der Tanz losgehen«. Die alten Freiwilligenregimenter seien »freilich jetzt sehr schwach«. Der Kampf koste Blutopfer, nicht gerechnet Kälte und Nässe. Denn der »ewige Regen« habe die Landschaft in einen einzigen grundlosen Sumpf verwandelt. Das Grabensystem sei inzwischen zu einem Gewirr von Wolfsfallen, Schießscharten und Drahtverhauen – einer uneinnehmbaren Stellung, wie Hitler glaubte – ausgebaut worden. Vom Ort selbst sei nicht mehr vorhanden als ein Schutt- und Brandhaufen. Unter ungeheuren Verlusten und »Strömen von Blut« hätten sie die Franzosen zurückgeworfen. Hier werde man aushalten, bis HindenburgHindenburg, Paul von Russland mürbe gemacht habe. Übrigens bitte er um Verzeihung, dass er so selten schreibe, aber er komme nur alle 14 Tage einmal aus dem Dreck, um sich zu waschen. Ebenso werde man auch »ganz stumpf« durch den »ewigen Kampf«, und es fehle der geordnete Schlaf. Häufig stünden die Soldaten bis zu den Knien im Wasser, dazu komme »sehr schweres Artilleriefeuer«. Er freue sich auf die Ablösung, trotzdem erhoffe er sich »bald auf der ganzen Front« den »Generalsturm«, denn: »Ewig kann es so nicht gehen.«[77] Die frischen Regimenter gab es freilich nicht, und »der Tanz« ging nicht los, weil die Oberste Heeresleitung die Entscheidung an anderer Stelle suchte.
Aufschlussreich ist auch ein anderer Brief, den Hitler kurz darauf an einen Bekannten in München schrieb. Ihm teilte er mit, er sei »jetzt sehr nervös« geworden. Sie lägen Tag für Tag von acht Uhr früh bis fünf Uhr nachmittags unter heftigem Artilleriebeschuss, das mache mit der Zeit auch die stärksten Nerven kaputt. Bemerkenswert sind die politischen Äußerungen, die Hitler an den Schluss seines Briefes stellte. Er habe nur einen Wunsch, nämlich »dass es bald zur endgültigen Abrechnung mit der Bande« kommen möge. Und jene, die das Glück besitzen würden, die Heimat wiederzusehen, sollten diese von der »Fremdländerei« gereinigt vorfinden. Er hoffe, dass der »Strom von Blut, der hier jeden Tag fließt gegen eine internationale Welt von Feinden« nicht nur Deutschlands Widersacher im Äußeren zerschmettere, sondern dass auch »unser innerer Internationalismus zerbricht«. Das wäre mehr wert als aller Ländergewinn. Mit Österreich werde es so kommen, »wie ich es immer sagte«.[78]
Der Zusammenbruch Österreichs an der Ostfront ließ jedoch dank der deutschen Waffenhilfe auf sich warten. An der Westfront lag die Initiative bei den Engländern, die am 10. März zur Eroberung des Städtchens Neuve Chapelle ansetzten. Nach starker Artillerievorbereitung gelang es indischen Truppen, in die Gräben und die Stadt einzubrechen und diese zu besetzen. Die Fortsetzung des britischen Angriffs am nächsten Morgen kam allerdings im Feuer der Infanterie zum Erliegen, und auch ein am Abend vorgetragener Angriff blieb vor der zweiten Verteidigungslinie der Deutschen stecken. Der Gegenangriff der bayerischen Truppen, unterstützt von Westfalen und Sachsen, fand am 12. März statt. Infolge der Schwäche der eigenen Artillerievorbereitung erlitten sie jedoch so schwere Verluste, dass sie durch den Ansturm am Mittag in die eigene Stellung zurückgedrückt wurden. Zwei Tage später wurden die Reste der Regimenter abgelöst. Die insgesamt zehntägige Schlacht kostete mehr als 22000 Menschen das Leben.[79] Hitlers Regiment wurde nach Fromelles verlegt, fünf Kilometer nördlich von Neuve Chapelle.
Die Postkarte aus Fromelles zeigt Ruinen, in denen sich aber akzeptable Quartiere herrichten ließen.
(Copyright ©: Sammlung Eberle)
Vier Jahre lagen die bayerischen Soldaten an diesem Frontabschnitt, in dem sie Straßen deutsche Namen gaben und ihre heimatlichen Feste feierten.
(Copyright ©: Sammlung Eberle)
Die nächsten zwei Jahre waren von Stellungskämpfen geprägt, deren Intensität jedoch gering war. Die deutsche Heeresleitung suchte die Entscheidung vor Verdun, die Festung im Süden der Westfront wurde zur »Blutmühle« für Deutsche und Franzosen.
Im Frontabschnitt der Bayern gab es nur wenige Verluste. Zwar lieferten sich die Gegner täglich Schießereien, aber Munition war knapp. Die Mannschaften wurden daher zum Ausbau der Stellungen herangezogen, deren Stärke einen englischen Angriff an dieser Stelle noch unwahrscheinlicher machte. Die Arbeit war schwer und eintönig, die Moral wurde schlechter, und die vielen hinzugekommenen älteren Soldaten, meist Landsturmmänner, neigten zu disziplinwidrigem Verhalten. Die Offiziere beklagten zunehmend Alkoholmissbrauch und die Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten.[80] Auch Hitler soll sich einem hartnäckigen Gerücht zufolge eine flämische Geliebte zugelegt haben, der Historiker Werner MaserMaser, Werner glaubte sogar an einen gemeinsamen Sohn.[81] Obwohl die Legende inzwischen mit Hilfe von DNS-Proben widerlegt worden ist[82], geisterte sie im Jahr 2012, diesmal in Gestalt eines angeblichen Hitler-Enkels, wieder einmal durch den britischen Blätterwald.[83]
Sicher ist jedoch, dass der Gefreite in diesen ruhigen Monaten viel Zeit mit Malen verbrachte, was die gründlich ausgeführten Zeichnungen und sorgfältig durchkomponierten Aquarelle belegen. Hitlers Skizzen sind detailliert ausgearbeitet und erwecken den Eindruck, dass er sein Berufsziel Kunstmaler nicht aus den Augen verloren hatte. Dass er bewusst für einen massenkompatiblen Geschmack produzieren wollte, zeigen die Aquarelle, die er im Städtchen Haubourdin anfertigte. Ihre frohe Farbigkeit kann zugleich als Indiz gelten, dass er im Gegensatz zum Winter 1914/15 wohl nicht unter den Verhältnissen litt. Den »Hohlweg bei Wytschaete«, den er und seine Meldegängerkollegen häufig unter Beschuss passieren mussten, malte er jedoch in düsteren, bedrohlichen Farben und mit einer expressionistischen unruhigen Bildsprache.[84] Wenn die Bilder etwas über den Menschen Hitler aussagen, stehen sie für das zielstrebige Arbeiten am Handwerk und eine Person, die offenbar Stimmungsschwankungen unterworfen war. Er selbst ging auf den Charakter seiner Bilder später nicht ein und leugnete, dass er nach wie vor an seiner künstlerischen Karriere festhielt. Stattdessen stilisierte er sich in der Rückschau zum noch ziellosen Grübler, der sich viel mit Politik und Philosophie befasste.[85]
Die wichtigste Tornisterlektüre Hitlers war in dieser Zeit eine sechsbändige Schopenhauer-Ausgabe. Hitler hielt den Philosophen für einen der größten deutschen Denker; er habe »viel von ihm gelernt«.[86] Dazu gehörte sicher die Verachtung für die breite Masse, die er mit SchopenhauerSchopenhauer, Arthur teilte: »Der große Haufe nämlich hat Augen und Ohren, aber nicht viel mehr, zumal blutwenig Urteilskraft und selbst wenig Gedächtnis.« Auch der Zynismus, mit dem SchopenhauerSchopenhauer, Arthur bei Betrachtungen über den Wert des Menschen über dessen Rang spottete, weil der lediglich ein »simulierter Wert« sei und deshalb nur »simulierte Hochachtung« erzeuge, wird bei ihm einen Nerv getroffen haben. Wie der Philosoph verachtete Hitler überlieferte Ränge und Strukturen, spielte aber zynisch mit der Eitelkeit und Ruhmsucht anderer, die SchopenhauerSchopenhauer, Arthur als wesentliche Triebkräfte des Menschen ansah.[87]
1916: die erste Verwundung
Die relativ beschauliche Zeit ging zu Ende, als die Engländer beschlossen, den Frontabschnitt bei Lille auf seine Standfestigkeit zu prüfen. Im Juli 1916 stürmten englische und australische Truppen die gut ausgebaute Grabenstellung bei Fromelles. Hitlers Regiment fügte den Briten mit Schrapnellgranaten und Maschinengewehren schwerste Verluste zu. Die erfolgreicher vorgestoßenen Australier saßen wenig später fest, weil die Deutschen die Gräben fluteten. Die folgenden Nahkämpfe wurden mit äußerster Erbitterung geführt, sogar Soldaten, die sich gefangen gegeben hatten, wurden misshandelt oder erschossen. Hitlers Regiment verlor in diesem ergebnislos geführten Gefecht 340 Mann, davon 107 Gefallene. Engländer und Australier opferten 6000 Mann, davon kamen 2000 ums Leben.[88] Der Sieg, der keiner war, hob die Stimmung nicht merklich. Verstöße gegen die Disziplin häuften sich, und auch die Angst, einen sinnlosen und grausamen Tod zu sterben, wuchs. Die Zahl der Desertionen stieg an, als bekannt wurde, dass das Regiment in die soeben begonnene Sommeschlacht verlegt werden sollte. Die Soldaten wussten, was auf sie zukam, sie kannten die Opfer der »Blutmühle« von Verdun.
Thomas WeberWeber, Thomas hat die disziplinarischen Vorfälle des Regiments ausgezählt und kam zu dem Ergebnis, dass sich Desertionen, unerlaubtes Entfernen und Feigheit vor dem Feind im zweiten Halbjahr 1916 häuften, mehr noch als 1918. Der Umgang mit den Soldaten, die nicht mehr kämpfen konnten oder wollten, die im Gaskrieg die Nerven verloren oder durch Verschüttungen zu nervös zitternden Pflegebedürftigen wurden, war human – rückschauend betrachtet vor der Folie des Zweiten Weltkriegs. Viele wurden als tatsächlich Kranke in die Heimat zurückgeschickt, wo sie allerdings nicht immer als solche behandelt wurden.[89] Die anderen erhielten Arreststrafen oder wurden in Strafkompanien versetzt, in denen schwere Arbeit zu leisten war. Es gab dort jedoch keine »Vernichtung durch Arbeit«, und Todesurteile wurden außerordentlich selten verhängt. Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten waren sich einig, dass auch die Entkräfteten und Dienstmüden Kameraden waren. Für diese Ansicht sprach auch, dass sich die meisten der Bestraften vorher tadellos geführt hatten, wie WeberWeber, Thomas herausfand.[90]
Hitler sah das anders, auch deshalb, weil er schon am Beginn der Sommeschlacht verwundet wurde. Er erlebte nicht mit, wie sein Regiment an nur einem Tag von 4000 Granaten eingedeckt wurde. Er sah nicht mit an, wie Dutzende Kameraden verschüttet und wieder ausgegraben wurden. Tag für Tag wurde das Regiment von Gasangriffen heimgesucht, von denen eine ungeheure psychologische Wirkung ausging. Die in einem ausgebauten Höhenzug liegenden Bayern, für die es kein Vorwärts und kein Zurück gab, sahen die Gasnebel auf sich zutreiben und konnten nur beten, verschont zu werden. Kamen sie trotz Schutzausrüstung zu lange in Kontakt mit dem Gas, waren schwerste Schäden die Folge.[91] Hitler überstand die blutigste Schlacht des Ersten Weltkriegs glücklich. Mehr als eine Million Menschen starben, er wurde bereits am vierten Tag seines Einsatzes verwundet. Am 5. Oktober 1916 schlug eine Granate in den Gang vor dem Unterstand der Meldegänger ein, wobei Hitler, Ernst SchmidtSchmidt, Ernst und Anton BachmannBachmann, Anton durch Splitter verwundet wurden. Todesopfer waren nicht zu beklagen, auch wenn Hitler das später behauptete.[92]
Ein Granatsplitter traf seinen linken Oberschenkel, wobei er sicher Blut verlor und gehunfähig wurde. Einen Hoden büßte er hingegen nicht ein, obwohl Spiegel, Bild und zahllose andere Medien das für die Wahrheit hielten oder zumindest glaubten, die Sache, ob wahr oder nicht, sei eine Meldung wert. Weil Hitler 1936 unter nicht genau deutbaren Symptomen litt, etwa an einem unangenehmen Jucken am Unterschenkel und ungewöhnlicher Mattigkeit, untersuchte ihn sein späterer Leibarzt Theodor MorellMorell, Theodor gründlich. Dabei prüfte er auch den Cremasterreflex, indem er einen Muskel an der Innenseite des Oberschenkels reizte. Die Hoden zogen sich wie erwartet nach oben. Bei dieser Untersuchung kontrollierte MorellMorell, Theodor auch die Möglichkeit eines schlecht verheilten Leistenbruchs, wofür er Hitlers Intimbereich ebenfalls abtasten musste. ErMorell, Theodor entdeckte keinerlei Normabweichung.[93]
Hitlers Verletzung war also tatsächlich »leicht«, wie die Verlustliste belegt.[94] Im Krankenbuch des Lazaretts Beelitz bei Berlin ist er als Zugang Nummer 4199 mit der Diagnose »Granatsplitterverletzung linker Oberschenkel« eingetragen.[95] Die hier untergebrachten Soldaten sollten ausheilen und wieder frontverwendungsfähig werden. Hitler machte jedoch, wie er in Mein Kampf schrieb, Bekanntschaft mit einer für ihn neuen Erfahrung, dem »Rühmen der eigenen Feigheit«. So begegnete er einem Soldaten, der sich am Drahtverhau selbst verstümmelt hatte. Seine Verletzung der Hand war kompliziert und langwierig. Im Lazarett berichtete dieser Soldat von der »Tapferkeit«, die dazu notwendig gewesen sei. Hitler erinnerte sich: »Viele hörten schweigend zu, andere gingen, einige aber stimmten bei.« Ihm erschien ein solches Verhalten als »Feigheit«, aber offenbar war er erstaunt und sprachlos, sodass er zu jenen gehörte, die schweigend zuhörten.[96]
Von Beelitz aus besuchte Hitler Berlin. In der Rückschau äußerte er sich recht zurückhaltend über seinen Eindruck von der Reichshauptstadt des Jahres 1916. Die Menschen hätten Hunger gelitten, schrieb er in Mein Kampf, die »Unzufriedenheit« sei durchaus »groß« gewesen.[97] Diese Charakterisierung der Lage ist eine Untertreibung. Die zum Überleben notwendige Nahrungsmenge wurde in den Großstädten um bis zu 40 Prozent unterschritten. Infolge der britischen Blockade, aber auch aufgrund logistischer Mängel starben in ganz Deutschland mehr als 800000 Menschen.[98] Es ist möglich, dass Hitler aus diesem Grund bereits am dritten Tag des Zweiten Weltkriegs einem System von Lebensmittelmarken für praktisch alle Grundnahrungsmittel zustimmte. Im Ersten Weltkrieg existierte es noch nicht. Die kaiserliche Regierung betrachtete jede Form von Zwangsbewirtschaftung als Schwäche. Erst 1915 wurde nach langem Zögern die Brotkarte eingeführt, dann im Herbst 1916 die Zuckerkarte. Es war der »Kohlrübenwinter«, der dem Gedanken der umfassenden Zwangsbewirtschaftung zum Durchbruch verhalf.[99]
Mitten in dieser Ernährungskrise wurde der genesene Hitler am 1. Dezember 1916 zur Truppe zurückversetzt. Stationierungsort war zunächst München, das er nicht wiedererkannte: »Ärger, Missmut und Geschimpfe, wohin man nur kam!« Zudem seien die alten Offiziere nicht in der Lage, »ein anständiges Verhältnis« zu den Soldaten herzustellen.[100] Es ist nicht bekannt, welcher Offizier den Gefreiten Hitler demütigte oder schikanierte. Es war ihm aber künftig offenbar unangenehm, daran erinnert zu werden, dass er sich nicht »oben« in einer Institution befand, die Befehle gab, sondern zu denen »da unten« gehörte, die sie ausführten.
Stadt, Truppenteil und Stimmung missfielen ihm, weshalb er im Januar 1917 um Versetzung bat. Er schrieb einen Brief an Fritz WiedemannWiedemann, Fritz, den Adjutanten im Stab des 16. Reserve-Infanterieregiments. Er sei nun wieder felddienstfähig und habe den »dringenden« Wunsch, zu seinen alten Kameraden zurückzukehren. Er bat WiedemannWiedemann, Fritz, der dem Kanzler Hitler später als persönlicher Adjutant dienen sollte, ihn wieder für das Regiment anzufordern. WiedemannWiedemann, Fritz entsprach der Bitte, sodass Hitler seine Stellung als Meldegänger im Stab zurückerhielt.[101]
Hitler (sitzend, links) und seine Meldegängerkollegen mit dem Terrier Foxl, den sie zur Rattenjagd abrichteten.
(Copyright ©: Bayerische Staatsbibliothek München | Bildarchiv)
Das Regiment war in die ruhige Gegend des La-Basse-Kanals verlegt worden, wurde aber im Mai 1917 erneut in die Schlacht geworfen. Diesmal bei Arras, wo in fünf Tagen 149 Männer starben und Hunderte verwundet wurden.[102] Das Regiment musste nach Flandern abgezogen und »aufgefrischt« werden. In dem Gebiet, das den Bayern inzwischen zur zweiten Heimat geworden war, nahmen die Fälle von Disziplinlosigkeit wieder zu. Offiziere beklagten auch die Fraternisierung mit den Belgiern, unternahmen aber wenig gegen die unzureichende Lebensmittelversorgung der Mannschaften.[103] Der Stab dürfte davon nicht betroffen gewesen sein.
Im vierten Kriegsjahr wurde das Regiment ein weiteres Mal bei Gheluvelt eingesetzt, und erneut erlitt es schwere Verluste. Doch im Gegensatz zum Sturmangriff von 1914 sollten die Soldaten jetzt verteidigen, was ihnen nicht gelang. Es war ein inzwischen typischer Angriff im Stellungskrieg. Bevor der Sturm losbrechen sollte, wurde mit schwerer Artillerie vorbereitet und immer wieder Gas geschossen. Am achten Tag musste Hitlers Regiment abgezogen werden, ohne dass es einen einzigen Feind zu Gesicht bekommen hatte. Das Regiment verlor 800 Mann, die übrigen waren extrem demoralisiert. Sehr »niederdrückend« sei der Anblick der »arg zerstümmelten Leichen«, vor allem der Gastoten, die, so Kommandeur Anton von TubeufTubeuf, Anton von in seinem Wochenbericht, »besonders angreifende Begleiterscheinungen zeigten«. Angesichts des körperlichen und seelischen Zustands und wegen der geringen »Gewehrstärke« könne er dem Regiment gegenwärtig einen »Kampfwert nicht zusprechen«.[104] Das Regiment wurde zwar verlegt, aber in eine Stellung, die ebenfalls im Artilleriehagel lag. Zwei Bataillone – bzw. deren Überreste – wurden vollständig abgezogen. Die Maschinengewehrkompanie und der Stab blieben, gerieten im Sturm der Engländer unter heftiges Feuer und wurden nach 24 Stunden zurückgenommen. Die Überlebenden waren »mehr Gespenstern als Menschen ähnlich«, beschrieb Hitler die Geschlagenen in Mein Kampf anschaulich.[105]
Nach den schweren Verlusten wurde das Regiment ins Elsass verlegt, in einen überaus ruhigen Frontabschnitt. Hitler suchte gemeinsam mit Ernst SchmidtSchmidt, Ernst um Heimaturlaub nach. Im Oktober 1917 reisten die beiden Meldegängerkollegen über Köln nach Dresden und Leipzig. Hitler fuhr dann allein nach Berlin weiter, wo er bei der Familie eines anderen Angehörigen des Stabs übernachtete, die sich liebevoll um ihn kümmerte.[106] Er hätte es sich nicht besser wünschen können, schrieb er an SchmidtSchmidt, Ernst. Von Berlin war er jetzt begeistert. Die Stadt sei »großartig«, so richtig eine »Weltstadt«, der Verkehr immer noch enorm. Endlich habe er Gelegenheit »die Museen etwas besser zu studieren«. Die schnell hingeschriebene Postkarte vom 6. Oktober 1917 zeigt immer noch Hitlers Wunsch, Kunstmaler zu werden, denn die Reise führte in Städte mit ausgezeichneten Gemäldegalerien. In Berlin hielt er sich, wie er schrieb, »fast den ganzen Tag« in den Museen auf.[107] Auf die politische Lage ging er nicht ein.
Kriegswende 1918
Anfang 1918 war die Stimmung bei dem wieder nach Norden verlegten Regiment recht zuversichtlich. Mehrere Wochen trainierten die Soldaten für die bevorstehende Frühjahrsoffensive, so etwas hatte es in den letzten vier Jahren nicht gegeben. Die Soldaten freuten sich auch angesichts der militärischen Gesamtlage. Italien war 1917 zusammengebrochen, auf dem Balkan verzeichnete das Heer überragende Erfolge. Im Osten bahnte sich ein echter Siegfrieden an, verbunden mit der Aussicht, den Zweifrontenkrieg zu beenden. Der Oberkommandierende Erich LudendorffLudendorff, Erich errichtete auf polnischem und litauischem Gebiet ein Protektorat und schuf einen Cordon sanitaire aus Satellitenstaaten um das bolschewistische Sowjetrussland. Die neuen Entwicklungen sorgten auch an der Front für Gesprächsstoff, zum ersten Mal wurde, wie Hitler feststellte, wirklich »politisiert«.[108] Mit dem Frieden von Brest-Litowsk befasste er sich später ausführlich.
Sein Regiment wurde am 28. März 1918 aus dem Bereitstellungsraum heraus südlich von Saint Quentin stationiert, wo es ab dem 7. April in die Operation Georgette eingreifen sollte. Es war damit Teil der deutschen Frühjahrsoffensive, deren erste Welle, die Operation Michael, sich gerade vor Amiens festzulaufen drohte. Das Regiment kämpfte dabei nach der neuen Heeresdienstvorschrift, welche die Offensive im Stellungskrieg regelte. Die dabei eingesetzte Taktik war riskant, aber erfolgversprechend. Die Artillerie legte vor die eigene Linie eine permanente Feuerwalze, hinter der einzelne mit Maschinengewehren und Flammenwerfern ausgerüstete Stoßtrupps vorrückten, ohne Rücksicht auf offene Flanken und liegen gebliebene Feinde zu nehmen. Die den Stoßtrupps folgenden Kampfgruppen schalteten später solche Widerstandsnester aus.[109] Diese Taktik sollte sich im Zweiten Weltkrieg bewähren, obwohl sie – gerade bei den Panzertruppen – zunächst umstritten war.
Der Erfolg der Stoßtrupps hing von einer exakten Koordinierung der Feuerwalze mit den Stoßtrupps ab, was nicht gut genug geübt worden war, wie die hohen Verluste durch eigenes Feuer zeigten. Zum Misserfolg wurde die Offensive aber auch, weil Franzosen und Engländer nicht mehr bereit waren, ihre Mannschaften in der ersten Grabenlinie verbluten zu lassen. Sie gestalteten ihre Verteidigung flexibler und opferten Stellungen in dem inzwischen tief gestaffelten Grabensystem. Hitlers Einheit verlor bei den Vorstößen, die etwa 35 Kilometer Raumgewinn einbrachten, 23 Offiziere und 1123 Mann.[110] Mit nur noch halber Gefechtsstärke führte das Regiment Ende Mai einen fünftägigen Angriff im Rahmen der Operation Blücher-Yorck durch, bei dem bedeutende Geländegewinne gelangen. Nach kurzer Auffrischung wurde es dann in die letzte Phase der Offensive geworfen (Operation Gneisenau).[111] Dieser Vorstoß mündete in die Marneschlacht, in der Franzosen, Briten und Amerikaner eine Gegenoffensive begannen. Die Entscheidung brachten mehrere hundert Renault-FT-17-Panzer, mit denen die noch nicht befestigten Linien der Deutschen rasch durchbrochen wurden. Erst einen Monat später konnten sie wieder stabilisiert werden.
Während dieser Rückzugsgefechte erhielt Hitler am 8. August 1918 das Eiserne Kreuz I. Klasse. Der Stellvertreter des Regimentskommandeurs begründete die Verleihung nicht mit einer einzelnen tapferen Tat, sondern führte die »unermüdliche und opferbereite« Tätigkeit als Meldegänger an. Wichtige Meldungen seien so »trotz aller Schwierigkeiten« und dem »Abreißen der Verbindungen« zu anderen Stellen gelangt. Seit dem Ausmarsch des Regiments habe Hitler sich »glänzend bewährt« und »Vorbildliches« geleistet.[112]