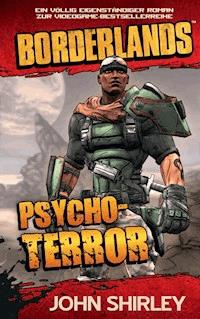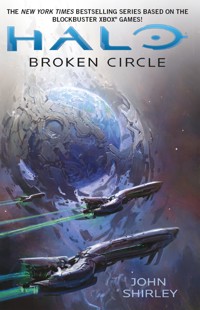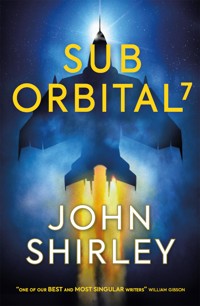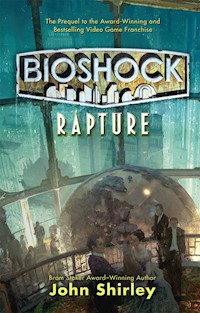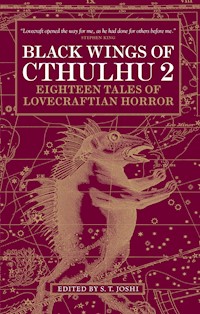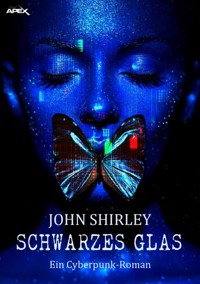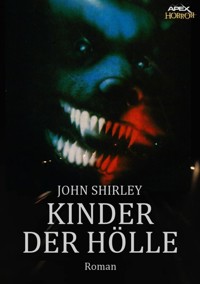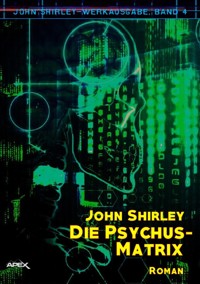7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Hitzefühler Redux - eine Neu-Ausgabe der erstmals im Jahre 1991 auf Deutsch erschienenen Kollektion Hitzefühler - versammelt 19 Science-Fiction-Erzählungen plus drei weitere, nicht in der Original-Zusammenstellung enthaltene Texte aus der Feder von Cyberpunk-Legende John Shirley, meisterhaft illustriert von Christian Dörge. Entstanden in den Jahren von 1975 bis 1989 reicht das Spektrum des Autors von geradezu klassischer Science Fiction (Zwei Fremde) über vom literarischen Surrealismus beeinflusste Texte (Die fast leeren Räume, Quill Tripstickler entkommt einer Braut) bis hin zu Texten, die den Cyberpunk – jene post-moderne SF-Literatur der (19)80er Jahre - nicht nur lesenswert machten sondern darüber hinaus mit Unsterblichkeit versahen (Der Schamane, Wölfe des Plateaus). Science-Fiction-Erzählungen, zwischen deren Zeilen man die düsteren Klänge der Proto-Punk-Musik erklingen hört; Science-Fiction-Erzählungen, geschrieben von einem wahren Meister seines Fachs. Abgerundet und ergänzt durch ein Vorwort von Stephen P. Brown und durch eine Einleitung von William Gibson.
»Die Stories in HITZEFÜHLER sind eine Offenbarung: Surrealismus mit der Waffe – und einem Lächeln...«
Richard Kadrey (Autor von Metrophage)
»John Shirleys Werk ist visuell, voll Energie und voller Esprit – diese Stories zu lesen, ist wie plötzlich in überraschender Gesellschaft zu sein: wie's ausgeh'n wird, kann man unmöglich voraussagen, aber es ist auf jeden Fall den Trip wert.«
Pat Cadigan (Autorin von Synder)
»John Shirleys Stimme ist die eines Propheten in der Cyberpunk-Wildnis. Er ist einer der Besten. An ihn wird man sich erinnern.«
Roger Zelazny (Autor von Straße der Verdammnis)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
JOHN SHIRLEY
Hitzefühler Redux
Erzählungen
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Der Autor
Vorwort von Stephen P. Brown
Einleitung von William Gibson
Was Cindy sah
Unter dem Generator
Unter dem Sternenbanner - 2076
Schlafwandler
Tahiti zum Quadrat
Zwei Fremde
Stumme Grillen
Ich lebe in Elizabeth
Die fast leeren Räume
Der Schamane
Der Schuss
Gleichgewicht
Lästige Schmetterlingspuppen, unsre Gedanken
Quill Tripstickler entkommt einer Braut
Wiederkehrende Träume vom Atomkrieg stürzen B. T. Quizenbaum in geistige Verwirrung
Wie es sich anfühlt, einen Menschen zu töten
Der Knoten
Sechs Arten Dunkelheit
Die Erscheinung
Das sonderbare Glück des Professor Cort
Fahrkarte zum Himmel
Wölfe des Plateaus
Ersterscheinungsdaten
Das Buch
Hitzefühler Redux - eine Neu-Ausgabe der erstmals im Jahre 1991 auf Deutsch erschienenen Kollektion Hitzefühler - versammelt 19 Science-Fiction-Erzählungen plus drei weitere, nicht in der Original-Zusammenstellung enthaltene Texte aus der Feder von Cyberpunk-Legende John Shirley, meisterhaft illustriert von Christian Dörge. Entstanden in den Jahren von 1975 bis 1989 reicht das Spektrum des Autors von geradezu klassischer Science Fiction (Zwei Fremde) über vom literarischen Surrealismus beeinflusste Texte (Die fast leeren Räume, Quill Tripstickler entkommt einer Braut) bis hin zu Texten, die den Cyberpunk – jene post-moderne SF-Literatur der (19)80er Jahre - nicht nur lesenswert machten sondern darüber hinaus mit Unsterblichkeit versahen (Der Schamane, Wölfe des Plateaus). Science-Fiction-Erzählungen, zwischen deren Zeilen man die düsteren Klänge der Proto-Punk-Musik erklingen hört; Science-Fiction-Erzählungen, geschrieben von einem wahren Meister seines Fachs. Abgerundet und ergänzt durch ein Vorwort von Stephen P. Brown und durch eine Einleitung von William Gibson.
»Die Stories in HITZEFÜHLER sind eine Offenbarung: Surrealismus mit der Waffe – und einem Lächeln...«
Richard Kadrey (Autor von Metrophage)
»John Shirleys Werk ist visuell, voll Energie und voller Esprit – diese Stories zu lesen, ist wie plötzlich in überraschender Gesellschaft zu sein: wie's ausgeh'n wird, kann man unmöglich voraussagen, aber es ist auf jeden Fall den Trip wert.«
Pat Cadigan (Autorin von Synder)
»John Shirleys Stimme ist die eines Propheten in der Cyberpunk-Wildnis. Er ist einer der Besten. An ihn wird man sich erinnern.«
Roger Zelazny (Autor von Straße der Verdammnis)
Frühe Ausgaben von Hitzefühler / Heatseeker:
Der Autor
John Shirley, Jahrgang 1953.
John Shirley ist ein vielfach mit Literatur-Preisen ausgezeichneter US-amerikanischer Schriftsteller, Drehbuch-Autor und Musiker. Er gilt neben William Gibson als der stilprägendste Cyberpunk-Autor.
Erste Veröffentlichungen 1979 und 1980: Transmaniacon (Roman), Dracula In Love (Roman), City Come A Walkin' (dt. Stadt geht los, Roman) und Three-Ring Psychus (dt. Die Psi-Armee, Roman).
1982 folgt Cellars (dt. Kinder der Hölle, Roman), der zum wichtigsten modernen Horror-Roman der (19)80er/90er Jahre gezählt wird.
John Shirley war Lead-Sänger der 1978 gegründeten Punk-Band Sado-Nation sowie - in den (19)80er Jahren - der Post-Punk- und ProgRock-Bands Obsession und Panther Moderns.
Von 1985 bis 1990 Veröffentlichung der dystopischen Song Called Youth-Trilogie: Eclipse (dt. Eclipse, Roman), Eclipse Penumbra (dt. Eclipse Penumbra, Roman) und Eclipse Corona (dt. Eclipse Corona, Roman). 2012 erscheint die Trilogie als überarbeitetes und ergänztes Signature-Omnibus unter dem Titel A Song Called Youth.
Weitere bedeutende Romane/Werke: A Splendid Chaos (dt. Ein herrliches Chaos, 1988), Wetbones (1991), ...And The Angel With Television Eyes (2001), Gurdjieff - An Introduction To His Life And Ideas (non-fiction, 2004), The Other End (2007), Everything Is Broken (2011), Black Glass (2012), Doyle After Death (2013), Wyatt In Wichita (2014).
John Shirley gilt überdies als Meister im Verfassen von Kurzgeschichten und Erzählungen und hat dementsprechend herausragende Text-Sammlungen veröffentlicht: Heatseeker (dt. Hitzefühler, 1989), New Noir (1993), The Exploded Heart (1996), Black Butterflies (1998), Really, Really, Really, Really Weird Stories (1999), Darkness Divided (2001), Living Shadows (2007) sowie In Extremis: THe Most Extreme Short Stories Of John Shirley (2011). Gemeinsam mit William Gibson verfaßte John Shirley die Kurzgeschichte The Belonging Kind (dt. Zubehör, 1981), welche Bestandteil von Gibsons Textsammlung Burning Chrome (dt. Cyberspace, 1986) ist.
Darüber hinaus schreibt John Shirley zahlreiche Film-Tie-Ins, u.a. Doom (2005), Constantine (2005), Batman: Dead White (2006), Resident Evil: Retribution (2012) und Grimm: The Icy Touch (dt. Grimm: Der eisige Hauch, 2013).
Im Jahr 2012 veröffentlicht Black October-Records John Shirleys musikalischen Back-Katalog: das Mini-Album Mountain Of Skullz und das Doppel-Album Broken Mirror Glass. 2015/16 veröffentlichte Black October-Records beide Tonträger zusätzlich in digitaler Form.
Der Apex-Verlag widmet John Shirley eine umfangreiche Werkausgabe.
John Shirley lebt und arbeitet in Vancouver, Washington/USA.
Vorwort
von Stephen P. Brown
Es war im Spätherbst 1970. Ich war nach einem vierjährigen Aufenthalt in Kalifornien gerade eben nach Portland, Oregon zurückgekehrt. Ich war einsam und gelangweilt und kannte niemanden in der Stadt. Ich bekam ein lokales Untergrundblatt in die Hände und entdeckte eine Kleinanzeige: »Treffen der Vereinigung der Fremden jeden Mittwochabend, Café 91th Street Exit.« Ich war ein Fremder, es klang interessant, also ging ich am nächsten Mittwoch rüber, um mich dort umzusehen.
Das 91th Street Exit war ein kleines Kaffeehaus im Kellergeschoss einer liberalen (und sehr toleranten) Kirche. Ich wanderte den Korridor entlang und streckte meinen Kopf durch die Tür. Der Raum war hell erleuchtet und leer, abgesehen von einem mageren blonden Typ so um die achtzehn, der gerade die Theke schrubbte.
»Ist das hier, wo sich die Vereinigung der Fremden trifft?« fragte ich.
Der Typ sah mit einem wahnsinnigen, elektrischen Grinsen auf: »Das bin ich!«
Das war meine erste Begegnung mit John Shirley und der Anfang einer langen, turbulenten und absolut unglaublichen Freundschaft. Ich könnte jetzt hier mit Stories weitermachen, mit den Salem-Parties; TERRA; der langen Fahrt nach Seattle wegen Clarion; der Reihe der riesigen verfallenen Häuser, die wir uns in Portland mit einer absonderlichen Zusammenstellung von Leuten teilten; GUTZ: Das Magazin des Ekelhaften; der Dada-Nacht im Exit; dem Wasserturm; ich muss aufhören, ich würde sonst dieses Buch füllen. Fragt mich einmal danach. Aber vor allem waren da die Geschichten. Der nicht abreißende Strom von Geschichten, der aus ihm hervorquoll.
Typischerweise sah Johns Schlafzimmer aus wie die Hölle eines Ordnungsfanatikers. Kleidungsstücke, schmutzige Wäsche, Bücher, Schallplatten, Nahrungsmittel, kleine Krabbeltierchen und benutzte Papiertaschentücher bedeckten zufällig durchmischt den Fußboden in einer dicken Schicht - gleichmäßig über den Boden verteilt. Aber in einer Ecke stand ein Tisch mit einer Schreibmaschine und einem exakt ausgerichteten, ordentlichen Manuskriptstapel daneben. Egal wie chaotisch es zuging (und es ging ziemlich chaotisch zu), dieser wachsende Papierstapel war immer da.
So gut ich ihn auch kannte und noch kenne, habe ich doch nie aufgehört, mich über die herrlich verrückten Ideen zu wundern, die er aus dem Ärmel schüttelte bis heute. Sein Roman Ein herrliches Chaos von 1980 ist reinster John Shirley, und dieses Buch hat mich nach achtzehn Jahren noch überrascht.
John Shirley ist eins der hervorragendsten Talente, die ich jemals kennengelernt habe. Seine Literatur widersetzt sich der Beschreibung. In den ersten Jahren hatte nur Ted White den Mut, sie in Amazing und Fantastic zu veröffentlichen. Die Zeit war noch nicht reif. Nun, die Zeit hat ihn inzwischen eingeholt, und seine Literatur ist (auf eine seltsame Weise) in Mode gekommen, und er hat seine Geschichten so gut wie überallhin verkauft.
Vielleicht kennt ihr seine Romane, aber dann seid ihr immer noch nicht auf seine Stories vorbereitet. Die hier vorliegende Zusammenstellung umfasst anderthalb Jahrzehnte, und zwischen den Buchdeckeln brodelt es. Das Buch platzt aus dem Bund vor Geschichten, die merkwürdiger sind, als man sich je hätte träumen können.
STEPHEN BROWN
Portland, Oregon
April 1988
Einleitung
von William Gibson
Die Legende besagt, dass John F. Seitz, Billy Wilders Kameramann, während der Dreharbeiten zu Sunset Boulevard fragte, wie er das Begräbnis von Norma Desmonds Schimpansen filmen solle. »Oh, nimm einfach die Einstellung, die du immer bei toten Affen nimmst, Johnny«, antwortete Wilder.
Seit man mich gebeten hat, eine Einleitung zu diesem Buch zu schreiben, kann ich nachempfinden, wie sich Mr. Seitz gefühlt hat. Es ist nicht gerade viel, was an John Shirleys Stories normal zu nennen wäre.
Willkommen in Shirleyland.
Bevor es also plötzlich und ernstlich unheimlich wird - das heißt, bevor ihr in den psychischen Ölschlick von Shirleys Imagination eintaucht -, will ich eine Einstellung versuchen...
Zum Zeitpunkt, wo ich dies hier schreibe, ist Mr. Shirley fünfunddreißig und ähnelt abwechselnd dem Schauspieler William Hurt und einer Karikatur von William Hurt, wie sie Dr. Seuss gezeichnet haben könnte. Als wir uns vor fast einem Jahrzehnt kennenlernten, trug er für seine Auftritte in Portlands Punk-Clubs, wo er mit einem wirklich wilden Haufen, genannt Sado-Nation, spielte, einen Patronengürtel um den Hals.
Tagsüber schrieb er Science Fiction.
Transmaniacon (gewidmet Blue Oyster Cult, Patti Smith, Leslie Fiedler und Aleister Crowley) wurde 1979 veröffentlicht und bald gefolgt von Dracula in Love und Three Ring Psychus. Shirley hatte den größten Teil von Transmaniacon 1974 geschrieben, als er neunzehn war.
»Als ich es bei den Verlagen rumreichte, hörte ich öfters das Wort geschmacklos«, erzählte er mir kürzlich. Das Buch stellt einen für Shirley-typischen Protagonisten vor, einen Mann, dessen Tätigkeit als Berufsnervensäge angegeben wird.
Dracula in Love ist eine liebevoll verwickelte Fußnote zu Bram Stoker, während
Three Ring Psychus von Levitation und anarchistischer Ekstase handelt. (Das aus der gleichen Periode stammende Manuskript eines unvollendeten Romans, The Exploded Heart, wurde kürzlich wieder aufgefunden und wird möglicherweise noch fertiggestellt werden.)
City Come A-Walkin' (dt. Stadt geht los) mit seinem unverhohlenen Bekenntnis zum Punk und seiner düster-ekstatischen Darstellung eines Stadt-Organismus mit Muskeln aus Asphalt und Stahl, erschien 1980. Nachdem er The Brigade in Portland beendet hatte, verzog sich Shirley nach New York, genauer gesagt: ins Literatenviertel, bevor es schick dort wurde, wo er den Horrorroman Cellars (dt. Kinder der Hölle) schrieb. The Brigade, vorgeblich ein Mainstream-Thriller über den Terror einer Bürgerwehr in einer Kleinstadt in Oregon, nimmt Cellars mit der rüden Erbarmungslosigkeit seiner Schlussfolgerungen bereits vorweg.
Heute erinnert einen der erbarmungslose, auf die Spitze getriebene Horror-Barock von Cellars an Clive Barker. Er liest sich wie Lovecraft auf PCP. 1982 war das ziemlich einzigartig.
Nachdem er New York für einen Arbeitsaufenthalt in Paris verlassen hatte, schuf Shirley die Traveler-Serie für den Dell-Verlag, schrieb unter dem Pseudonym D. B. Drumm die Traveler-Romane Band 1 bis 5 und nahm sein Album Obsessions auf. (Seams, ein auf Obsessions enthaltener Spoken-Word-Song, ist eine meiner Lieblingsgeschichten von Shirley.) Dort verschaffte er sich auch den nötigen europäischen Hintergrund für die Eclipse-Trilogie, A Song Called Youth, die seine surreale Intensität mit einem neuen Realismus verbindet, die Vision einer weltumspannenden Herrschaft von Neofaschisten in der nahen Zukunft.
In der Zwischenzeit zog er wieder um, diesmal nach Los Angeles. 1988 werden gleich drei neue Shirley-Romane veröffentlicht: A Splendid Chaos (dt. Ein herrliches Chaos), In Darkness Waiting und Eclipse Penumbra (dt. Eclipse Penumbra).
Es wird manchmal behauptet, die Kurzgeschichte sei die der Science Fiction angemessenste Form, wie man ebenso gut behaupten kann, der Findling sei die optimale Erscheinungsform von Felsen. In Shirleys Fall könnte man sagen, dass es ihm anfänglich bei kürzeren Texten leichter fiel, eine gewisse apokalyptische Intensität durchzuhalten - den für Shirley charakteristischen Drive. Die unvergessliche Story Tahiti zum Quadrat (Tahiti in Terms of Squares, 1978) ist mit ihren nicht-linearen Anspielungen auf eine neue (oder vielleicht übergeordnete) Ordnung des Lebens der reinste Trip. Die fast leeren Räume (The Almost Empty Rooms) von 1977 endet mit der Vision der Stunde Null nach einem Atomschlag, die sich vollkommen unterscheidet von allem, was ihr je gelesen habt. In Unter dem Generator (Under the Generator) aus dem Jahre 1976 kehrt eine energiehungrige Menschheit die Entropie um, um sich die Energie des Todes selbst nutzbar zu machen...
Mit City Come A-Walkin' bekamen Shirleys Romane die Hochspannung seiner Kurzgeschichten. Aber die Kurzgeschichten brachten es immer noch - und zwar voll. Ich denke an Der Knoten (Triggering) und Der Schuss (The Gunshot), die einer zweiten Periode angehören: New York-Stories. Vielleicht stammt die humorvolle Geschichte Quill Tripstickler entkommt einer Braut (Quill Tripstickler Eludes an Bride) aus dieser Periode und reflektiert eine gänzlich unerwartete Vorliebe für die Prosa P. G. Wodehouses.
Was Cindy sah (What Cindy Saw) und Die Erscheinung (The Unfolding, mit Bruce Sterling) scheinen mir gleichermaßen Stories einer Übergangsperiode zu sein; sie bewegen sich auf ein neues Gleichgewicht von Idee und Intention zu, die in der Eclipse-Trilogie wie in Wie es sich anfühlt, einen Menschen zu töten (What It's Like to Kill a Man), Wölfe des Plateaus (Wolfes of the Plateau) und Sechs Arten Dunkelheit (Six Kinds of Darkness) zu Tage tretende Reife.
Okay, das hört sich alles ganz nett an, etwa so, wie man's mir auf der Universität beigebracht hat. Und ich stehe dazu. Aber ich muss ebenfalls zugeben, dass mir Shirleys Prosa, auf irgendeine seltsame Art und Weise, immer wie Musik vorgekommen ist. Ich glaube nicht, dass sich die größte Stärke von Johns Literatur am besten mit dem Vokabular der Literaturkritik beschreiben lässt. Manchmal, wenn ich Shirley lese, kann ich die Gitarren hören, so als nagte an den Rändern des Textes eine monströse, subliminale Klangwoge. Das ist eine Wirkung, welche die Literatur über den Rock meines Wissens erst noch erreichen muss; ich glaube, Shirley schafft es, weil seine Stories, auf irgendeine ursprüngliche Weise, Rock sind. Sie steigen aus dem gleichen dunklen See des Rhythmus und des Adrenalinrausches auf, und das, was immer es ist, ist das, was sie zu etwas so Besonderem macht.
Wie ihr gleich herausfinden werdet.
Aber es gibt nichts Besonderes, ich meine, nichts wirklich Besonderes, ohne dass es eigenartig ist. Aber das ist schon in Ordnung: genießt es.
Etwas ausgesprochen Eigenartiges.
WILLIAM GIBSON
Vancouver, B. C.
März 1988
Für meine Frau
Kathleen Woods-Shirley
...in Liebe
Was Cindy sah
Die Leute in der Klinik waren sehr nett. Natürlich lebten sie oben, und Leute, die oben lebten, verhielten sich häufig freundlich und uniform, wie die kleinen magnetisch bewegten Spielzeugfiguren in einem elektrischen Footballspiel. Sie wirkten sehr ernsthaft, und siehatten eine Reihe von schrulligen Eigenschaften, die sie noch realistischer machten. Die Art und Weise, wie sich Doktor Gainsborough andauernd etwas aus dem Augenwinkel klaubte, zum Beispiel. Und die Art und Weise, wie Schwester Rebeck immer ihre schorfige rote Nase rieb und über Allergien klagte.
Doktor Gainsborough räumte mit allen Anzeichen von Ernsthaftigkeit ein, ja, das Leben sei voller Geheimnisse, und Cindy könne letzten Endes durchaus Recht haben mit den Dingen, die sich, wie sie es nannte, unten befanden. Doktor Gainsborough konnte sich nicht sicher sein, dass sie sich irrte - aber Cindy, sagten sie, wir haben unsere Zweifel, ernsthafte Zweifel, und wir möchten, dass du über unsere Zweifel und unsere Argumente nachdenkst und unserem Standpunkt eine Chance gibst. Doktor Gainsborough hatte gewusst, dass Cindy auf seinen Vorschlag, seine Vorstellungen höflicherweise zu überdenken, eingehen würde. Cindy war schließ-
lich ein fair gesonnener Mensch.
Sie weigerte sich bloß einfach, darauf zu reagieren, wenn Leute ihr sagten, sie sei verrückt und sehe Dinge, die gar nicht da waren.
Ja, Cindy, sagte Doktor Gainsborough, du könntest Recht haben. Aber wir haben immer noch starke Zweifel, und deshalb ist es wohl am besten, die Behandlung fortzuführen. In Ordnung?
Einverstanden, Doktor Gainsborough.
Also hatten sie ihr das Stelasin gegeben und ihr beigebracht, wie man Schmuck herstellte. Und sie hörte auf, über das Unten zu reden, eine Zeitlang jedenfalls. Sie wurde der Liebling der ganzen Klinik. Doktor Gainsborough brachte sie persönlich nach Hause, nach nur drei Monaten dieses Mal, und ohne Schockbehandlung. Er
setzte sie vor dem Haus ihrer Eltern ab, und sie griff durch das Wagenfenster hinein, um ihm die Hand zu schütteln. Sie lächelte sogar. Er lächelte zurück und bekam Lachfältchen um seine blauen Augen, und sie richtete sich auf, zog ihre Hand zurück und trat auf den Bordstein. Er wurde über die Straße fortgerissen; fortgerissen von dem Wagen, den er fuhr. Sie blieb mit dem Haus zurück. Sie wusste, dass sie sich zum Haus umdrehte. Sie wusste, dass sie darauf zuging. Sie wusste, dass sie die Treppe hinaufstieg. Aber die ganze Zeit über spürte sie das Ziehen. Der Zug des Unten war so sanft, dass man denken konnte: Ich weiß, ich drehe mich um und gehe und steige, während es in Wirklichkeit gar nicht so war. Man wurde durch all diese Bewegungen hindurch geführt, deshalb war man es gar nicht, der das alles tat.
Aber am besten dachte man, man täte es.
Sie hatte es geübt, dieses sich durch den Hinderniskurs der freien Assoziationen Hindurchmanövrieren. Sie tat es jetzt wieder, und sie schaffte es, die Empfindung des Gezogenwerdens zu unterdrücken.
Sie fühlte sich gut. Sie fühlte sich gut, weil sie nichts fühlte. Nicht sonderlich viel. Nur... nur Normales. Das Haus sah wie ein Haus aus, die Bäume sahen wie Bäume aus. Bilderbuchhäuser, Bilderbuchbäume. Das Haus machte höchstens einen ungewöhnlich ruhigen Eindruck. Niemand zu Hause? Und wo war Doobie? Der Hund war diesmal nicht vor dem Haus angeleint. Sie hatte sich vor dem Dobermann immer gefürchtet. Sie war erleichtert darüber, dass er weg war. Vielleicht mit der Familie zusammen weg gegangen.
Sie öffnete die Tür - komisch, dass sie fort waren und die Tür offen gelassen hatten. Es passte nicht zu Dad. Dad war paranoid. Er gab es sogar selbst zu. Ich rauche ein Wahnsinnskraut, sagte er. Er und Mom rauchten Pot und hörten sich alte Jimi Hendrix-Platten an und vögelten, wenn sie glaubten, Cindy sei eingeschlafen, lustlos auf dem Sofa.
»Hallo? Dad? Mom?«, rief Cindy jetzt. Keine Antwort.
Gut. Sie hatte Lust, allein im Haus zu sein. Eine Platte zu spielen, fernzusehen. Nichts, womit man fertig werden musste. Keine Zufallsfaktoren, jedenfalls kaum welche. Und keiner, der nicht harmlos gewesen wäre. Fernsehen war wie in ein Kaleidoskop zu blicken: es veränderte sich andauernd und produzierte seine Bewegungen auf seine verworrene Art, aber niemals geschah dabei etwas wirklich Unerwartetes. Oder fast nie. Einmal hatte Cindy es angeschaltet und sich einen japanischen Horrorfilm angesehen. Und der japanische Horrorfilm hatte viel zu sehr einer Karikatur des Unten geähnelt. Als hätten sie sich über sie lustig machen wollen, indem sie ihr zeigten, was sie wussten. Was sie von dem wussten, was sie wusste.
Jetzt, sagte sie sich. Denk ans Jetzt! Sie wandte sich von der Diele zu dem Türbogen, der zum Wohnzimmer führte.
Im Wohnzimmer war etwas, das stark einem Sofa ähnlich sah. Wenn es sich im Erholungsraum der Klinik befunden hätte, wäre sie ziemlich sicher gewesen, dass es ein Sofa war. Hier jedoch hockte es fett und blau-grau verstaubt im Dämmerlicht des Wohnzimmers, die verschnörkelten Armlehnen ein wenig allzu verschlungen;
es räkelte sich drohend genau im Mittelpunkt des Zimmers. Seine Maserung hatte etwas Unnatürliches. Es war auf eine Art gekörnt, die ihr noch nie aufgefallen war. Wie einer dieser ekligen, unförmigen Quallenhaufen an der Küste, ein hautiges Ding, dessen Klebrigkeit es mit einem Überzug aus Sand versehen hatte.
Eher noch befremdlicher war die eindeutig vertraute Form des Sofa-Dings. Aber es hatte etwas Aufgedunsenes, Angeschwollenes. Als wäre es aufgebläht vom Essen.
Das ist also ihr Geheimnis, dachte sie. Ihr Sofa ist es. Normalerweise fällt mir nichts Ungewöhnliches daran auf - weil ich es normalerweise nicht erwische, gleich nachdem es gegessen hat.
Sie fragte sich, wen es verschlungen hatte. Eine ihrer Schwestern? Im Haus war es ruhig. Vielleicht hatte es die ganze Familie gegessen. Aber dann hätte ihre Mutter nicht gesagt, dass sie bei ihrer Ankunft nicht zu Hause wären: jetzt fiel es ihr wieder ein. Eine der Krankenschwestern hatte es Doktor Gainsborough gesagt. Manchmal machte das Stelasin Cindy vergesslich.
Sie waren zum Mittagessen aus. Sie wollten wahrscheinlich ein letztes Mal auswärts essen, bevor Cindy zurückkam. Es war peinlich, mit Cindy ins Restaurant zu gehen. Cindy hatte eine Art an sich, an den Dingen herum zu kritteln. »Immerzu machst du alles mies, Cindy«, sagte Dad. »Du solltest lockerer werden. Du gehst mir auf den Keks, wenn du diese Scheiße abspulst.« Cindy würde erst die Serviererin heruntermachen und dann vielleicht die Tische, das Tischtuch, die Falten im Tischtuch. »Es ist die Symmetrie des Karomusters auf dem Tisch, die die Täuschung beweist«, würde sie ernsthaft sagen wie ein Fernsehkommentator, der über Terrorismus sprach. »Diese andauernde Häufung symmetrischer Muster ist ein Versuch, uns in einem Gefühl der Harmonie mit unserer Umwelt zu wiegen, die gar nicht vorhanden ist.«
»Ich weiß, dass du frühreif bist, Cindy«, würde ihr Dad sagen und sich Baguette-Krümel aus dem Bart wischen oder vielleicht an einem seiner Ohrringe ziehen, »aber du gehst mir echt auf den Keks.«
»Es könnte sein«, sagte Cindy laut zu dem Sofa, »dass du eine meiner Schwestern gegessen hast. Das ist mir ziemlich egal. Aber ich muss dir gleich eindringlich versichern, dass du mich nicht essen wirst.«
Dennoch wollte sie mehr über das Sofa-Ding herausbekommen. Vorsichtig.
Sie ging in die Küche, nahm einen Büchsenöffner und eine Taschenlampe und kehrte ins Wohnzimmer zurück.
Sie schwenkte das Licht über das Ding, das auf dem polierten Parkettboden saß.
Die Beine des Sofa-Dings, das sah sie jetzt, waren eindeutig mit dem Boden verschmolzen: sie schienen aus ihm herauszuwachsen. Cindy nickte und fühlte sich bestätigt. Was sie sah, war eine Art von Blüte. Sie musste weit unter der Erde Wurzeln haben.
Das Sofa-Ding zuckte selbstbewusst im Strahl ihrer Taschenlampe.
Mit der Taschenlampe in der linken Hand - sie hätte die Deckenbeleuchtung einschalten können, aber sie wusste, dass sie die Taschenlampe für die Höhlen unten brauchen würde - näherte sie sich dem ausgestreckten, blaugrauen Ding, wobei sie darauf achtete, dass sie ihm nicht zu nahe kam. In ihrer rechten Hand hatte sie den Büchsenöffner.
Die ganze Zeit über schien sie einen Besserwisser zu hören, der sagte: Das geht dich nichts an. Du solltest raufgehen und fernsehen und dich mit gefahrlosen Gedanken von einem Moment zum nächsten bewegen, die Hindernisse umschiffen und die gefährlichen Assoziationsballungen abwenden, indem du vorgibst, nicht zu wissen, was du weißt.
Doch es war schon zu spät. Ihr Stelasin war fast abgebaut, und das Sofa hatte sie in eine falsche Richtung geschubst, und jetzt befand sie sich auf der Nebenstraße eines fremden Vororts, und den Weg zurück zu der vertrauten Hauptstraße wusste sie nicht. Und es waren keine Polizisten da, bei denen sie sich hätte erkundigen können, keine Psychobullen wie Doktor Gainsborough.
Also kroch Cindy auf das Sofa-Ding zu. Sie war zu dem Schluss gekommen, dass das Sofa ihr nur dann wehtun konnte, wenn sie sich darauf setzte. Wenn man darauf saß, würde es sich um einen zusammenrollen, einen in sich einschließen. Wie eine Venus-Fliegenfalle.
Sie kniete vor seinen Beinen hin. Ihre Absicht spürend, bockte es ein wenig, und aus seinen Kissen quoll Staub. Es zog sich zusammen, die Kissen hoben sich. Es machte ein grässliches Geräusch.
Sie begann an seinen Beinen zu arbeiten, dort, wo sie in den Fußboden übergingen. Achtunddreißig Minuten lang arbeitete sie eifrig mit ihrem Büchsenöffner.
Das Sofa-Ding gab eine Reihe gedehnter, mitleiderregender Laute von sich. Ihr Arm schmerzte, aber der Büchsenöffner war überraschend scharf. Bald hatte sie die Höhle unter dem Sofa teilweise freigelegt; man konnte sie unterhalb der lose herabhängenden Umhüllung erkennen. Cindy holte tief Luft und riss das lose Stück hoch, um die Öffnung zu erweitern. Innendrin war es dunkel. Ein Geruch nach Moschus; nach Moschus und ein wenig nach Metall, wie Schmiermittel für einen Motor. Und ein kleiner Beigeruch von Verwesung.
Schwer arbeitend rollte sie die Haut des Fußbodens rund um das Sofa zurück. Die Natur war erfinderisch; bis jetzt hatte die Haut wie ein Parkettboden aus Hartholz ausgesehen. Sie war hart gewesen, massiv und auf die richtige Art gemustert. Eine wunderbare Verstellung. Die Haut war hart - aber nicht so hart, wie sie aussah. Man konnte sie abpellen wie Baumrinde, wenn man nur Geduld hatte und nichts auf schmerzende Finger gab. Cindy gab nichts darauf.
Das Wehklagen des Sofa-Dings steigerte sich zu einem Crescendo, so laut und schrill, dass Cindy zurückweichen und die Ohren mit den Händen bedecken musste.
Und dann faltete sich das Sofa in sich zusammen. Auch sein sirenenhaftes Geheul faltete sich zusammen und wurde gedämpft wie ein Schrei, der einer Hand zu entfliehen suchte, die den Mund eines kleinen Kindes verschloss.
Das Sofa glich einer sich schließenden Seeanemone; es schrumpfte zusammen, verschwand, wurde von der dunklen Wunde in der Mitte des Wohnzimmerbodens eingesaugt. Im Haus war es wieder still.
Cindy leuchtete mit der Taschenlampe in die Wunde hinein. Sie war feucht, schleimig, rot, gelb gesprenkelt. Das Blut des Hauses sprudelte nicht, es blutete in Tropfen, wie Schweiß. Das dicke, glasige Unterfleisch erzitterte und zog sich zurück, als sie es mit ihrem Büchsenöffner piekste.
Sie steckte den Büchsenöffner in ihren Stiefel und kniete sich neben die Wunde hin, um besser sehen zu können. Sie leuchtete mit der Taschenlampe in die Tiefe, in das Geheimnis, in das Unten hinein...
Das Haus hatte angeblich keinen Keller. Trotzdem war unter dem Wohnzimmerboden ein Raum. Er hatte ungefähr die gleiche Größe wie das Wohnzimmer. Seine Wände waren ein wenig konkav und glitschig-feucht, jedoch nicht organisch. Die Feuchtigkeit war eine Art von Maschinenschmiere. In der Mitte des Raums war eine Säule, die Stütze des Wesens, das sich als ihr Haus ausgegeben hatte. Die Säule, überlegte sie, war eigentlich mehr ein Stiel; ein dicker Stiel, der aus Seilen bestand, die sich umeinander wanden wie die Adern eines Stromkabels. Das Sofa musste in sein natürliches Versteck hineingezogen worden sein und sich jetzt zusammengepresst im Innern des Stiels befinden.
Sie fragte sich, warum das Haus bis heute noch nicht zugeschlagen hatte... Warum hatte es sie nicht alle zur Strecke gebracht, während sie geschlafen hatten? Aber die Leute dort unten, die Programmierer, hatten es wahrscheinlich nicht als gieriges, unwählerisches Raubtier erschaffen. Es war zur Vernichtung ausgewählter Menschen da - das musste die Erklärung für das Verschwinden ihrer Hausgäste sein, erkannte sie. Mom hatte in den letzten beiden Jahren vier solcher Leute mit nach Hause gebracht, jeden von ihnen auf dem Sofa untergebracht, und als es Morgen wurde, war keiner mehr da. Jetzt wusste Cindy, dass sie das Haus gar nicht verlassen hatten. Sie waren ein Teil von ihm geworden. Wahrscheinlich war Doobie das Gleiche passiert - Mom wollte ihn für gewöhnlich nicht im Haus schlafen lassen und hatte ihn nie auf das Sofa gelassen. Aber ihre Schwester Belinda ließ Doobie manchmal herein, wenn
Mom sich hingelegt hatte; der Hund musste es sich für ein Nickerchen auf dem Sofa bequem gemacht haben, die genetisch programmierte Essensstunde war gekommen, und es hatte mit Doobie das gemacht, was eine Seeanemone mit einer Elritze macht. Ihn eingeschlossen, gelähmt und dann verdaut.
Cindy war es egal. Sie hatte Doobie immer schon gehasst.
Sie lag flach auf dem Bauch und spähte durch den Riss in der Haut des Hauses. Der Unterboden lag etwa vier Meter unter ihr. Sie überlegte, ob sie sich in die Unterwelt hinabfallenlassen und sie erkunden sollte. Cindy schüttelte den Kopf. Besser Hilfe holen. Ihnen zeigen, was sie entdeckt hatte.
Ein merkwürdiges Gefühl im Magen ließ sie aufblicken.
Der Türbogen zum Wohnzimmer war verschwunden. Er hatte sich verschlossen. Die Fenster waren verschwunden. Eine Art von Narbengewebe war über sie gewachsen. Sie hatte das Wesen aufgeweckt, indem sie in es hinein geschnitten hatte. Deshalb hatte es sie gefangen.
Cindy erzeugte in ihrer Kehle ein kleines, hohes Huh! Sie stand auf und ging zur nächsten Wand, presste ihre Hände flach dagegen. Es hätte sich wie harter Putz anfühlen sollen, aber es gab unter ihren Fingern nach, nahm ihren Handabdruck an wie nasser Lehm. Es weichte auf. Das Haus würde um sie herum quellen, über ihr zusammenfließen wie ein Hügel aus Schlamm bei einem Erdrutsch, und es würde sie verschlingen und die Säfte aus ihr herauspressen und sie trinken.
Sie drehte sich zu dem Loch um, das sie in den Boden gemacht hatte. Seine Ränder rollten sich auf wie Papier, das sich in Asche verwandelte. Aber es war ebenfalls dabei, sich zu schließen. Sie packte fest die Taschenlampe, kniete sich hin, wand sich durch die Öffnung und fiel auf den Boden der Öffnung hinunter. Der Aufprall versetzte ihren Fußballen einen Schlag.
Cindy richtete sich heftig atmend auf und blickte umher.
Zu beiden Seiten der Kammer öffneten sich Tunnel, die sich so weit erstreckten, wie sie sehen konnte. Sie betrat den Tunnel zu ihrer Rechten. Die Decke war nur knapp einen Meter hoch; sie war gebogen und weich. Cindy ging langsam weiter, indem sie mit einer Hand nach dem Weg tastete, den Strahl der Taschenlampe auf den Boden gerichtet. Die Dunkelheit war voller Andeutungen, und Cindy fühlte ihren Mut schwinden. Sie hatte das Gefühl, ihre Schläfen wären in einem Schraubstock eingespannt und in ihrer Zunge befände sich eine Art schmieriger Elektrizität. Sie versuchte, sich das Licht der Taschenlampe als den Laserstrahl einer Waffe vorzustellen, schnurgerade und blendend stark, das Dunkel hinwegbrennend - aber das Licht war schwach und verschlang nur einen kleinen Ausschnitt der Dunkelheit. Allmählich passten sich ihre Augen jedoch an, und die Dunkelheit war nicht mehr so dicht und bedrohlich lastend, und der Strahl der Taschenlampe war nicht länger wichtig. In Abständen zeigte sich in dem leuchtenden Rechteck etwas, das wie durchsichtige Angelschnüre aussah, die sich vom Boden zur Decke erstreckten. Die Plastikdrähte tauchten in Bündeln zu acht oder neun auf und hatten unterschiedliche Abstände zueinander. Manchmal blieb kaum genug Platz, um sich zwischen ihnen hindurch zu quetschen. Dann drehte und wandte sie sich und schlängelte sich hindurch. Wenn sie einen der Drähte streifte, geriet er in Schwingung wie eine Gitarrensaite, jedoch mit einem Unterton in seinem Summen, der wie der Ruf eines Wüsteninsekts war. Irgendwie fühlte sie, dass die Drähte etwas mit dem Geschehen in der Oberwelt zu tun hatten. Mit Sicherheit wurden sie nicht von den Stadtwerken installiert, sagte sie sich.
Sie gelangte an eine Stelle, wo die Wand transparent war, zu einem durchsichtigen Fleck von der zweifachen Größe ihrer Hand. Er war ein wenig wolkig, doch Cindy konnte durch ihn hindurch in eine andere Kammer sehen; zwei Männer saßen dort an einem Metalltisch. Sie spielten Karten, die kleinen weißen Rechtecke in ihren Händen waren mit Irrgärten und Mandalas gekennzeichnet anstatt mit den üblichen Königen und Damen und Buben und Piks. Beide Männer waren über ihre Hände gebeugt, in tiefer Konzentration. Einer saß mit dem Rücken zu ihr. Er war der kleinere Mann; er hatte graues Haar. Der andere hatte ein rundes Gesicht: er war untersetzt, ein wenig übergewichtig, sein brauner Bart weißgesträhnt. Der größere Mann trug ein zerknittertes Jackett und Hosen von aktuellem Schnitt; der andere Mann trug einen fadenscheinigen Anzug, der schon seit vielen Jahrzehnten aus der Mode war. Der Raum sah aus wie eine Gefängniszelle. Es gab darin zwei Pritschen, eine Toilette, Tabletts mit halbverzehrter Nahrung, unter dem Tisch lagen leere Bierdosen.
»Sie bieten, Mister Fort«, sagte der Bärtige mit amüsierter Förmlichkeit.
»Recht haben Sie, Mister Dick«, sagte der andere leichthin. Er knallte eine Karte mit dem Bild nach oben auf den Tisch und sagte: »M. C. Escher gegen Maze den Azteken.«
Der andere Mann seufzte. »Ah, Sie haben wieder geblockt. Sie gewinnen. Das ist nicht fair: Sie hatten Jahre zum Üben, als sie gegen Bierce gespielt haben... Verdammt, wenn sie uns wenigstens rauchen ließen...«
Cindy schlug auf das Glas und rief, aber sie konnte sie nicht auf sich aufmerksam machen. Oder vielleicht taten sie auch nur so. Sie hob die Schultern und ging weiter.
Zehn Schritte weiter glitzerte etwas an der linken Seite, reflektierte den Strahl der Taschenlampe. Es war ein langer, vertikaler, rechteckiger Spiegel, der bündig in die Wand eingelassen war. Der Spiegel verzerrte Cindys Spiegelbild und ließ sie grotesk verlängert erscheinen. Sie griff danach und berührte versehentlich einen der Drähte; der transparente Draht klimperte, und ihr Bild im Spiegel schimmerte auf. Sie schlug den Draht erneut an, stärker diesmal, um zu sehen, was er mit dem Bild im Spiegel anfangen würde. Ihr Spiegelbild erzitterte und verschwand, und an seiner Stelle trat ein flimmerndes Bild der Oberwelt. Eine nüchterne Straßenszene, Kinder auf dem Heimweg von der Schule, Autos, die hinter einem langsam fahrenden VW Golf hupten, der von einer älteren Dame gesteuert wurde...
Aus einem Gefühl heraus, das zum Impuls wurde, schlug Cindy wiederholt die Tunneldrähte an, so hart sie konnte.
Der Spiegel - eigentlich eine Art Fernsehbildschirm - zeigte, wie der Verkehr außer Kontrolle geriet, wie der VW Golf mit großer Geschwindigkeit zurückstieß und in die anderen Wagen krachte, wie die Kinder die Kontrolle über ihre Gliedmaßen verloren und wahllos aufeinander einzuschlagen begannen.
Cindy kicherte.
Sie holte den Büchsenöffner aus ihrem Stiefel und zerrte damit an den Drähten, während sie die ganze Zeit über den Spiegel beobachtete. Die Drähte rissen mit einem protestierenden Knallen. Und in der Oberwelt: Kinder explodierten, Autos schlangen sich umeinander, plötzlich weich und formbar geworden, schlangen sich um Telefonzellen... eine riesige unsichtbare Woge schwemmte über die Straße und wusch die Gebäude hinweg...
Cindy lächelte und setzte ihren Weg durch den Tunnel fort, indem sie aufs Geratewohl an den Drähten zupfte.
Alle paar hundert Meter kam sie an eine Tunnelkreuzung; drei, die sich nach rechts und drei, die sich nach links öffneten, während ihrer weiter geradeaus führte. Manchmal änderte Cindy an diesen unterirdischen Straßenkreuzungen die Richtung, wobei sie ihrem Gefühl folgte und sich verschwommen der Tatsache bewusst war, dass sie ein bestimmtes Ziel hatte.
Schließlich mündete der Tunnel in einen kreisförmigen Raum, in dessen Mitte sich ein weiterer dicker, rotgelber Stängel befand; ein gerippter, mannsdicker Stängel, der beim Wachsen mit der Decke verschmolzen war. Doch hier wimmelten die Wände von etwas, das wie übergroße Blattläuse aussah. Wie mechanische Blattläuse, jede so groß wie ihre Hand und von der Farbe einer metallisch-blauen Rasierklinge. Sie klammerten sich in Gruppen zu zwanzig oder dreißig an die Wände, nur eine Handbreit von der nächsten Gruppe entfernt; die Blattläuse krochen methodisch auf kleinen dünnen metallenen Beinen, so dünn und zahlreich wie die Borsten einer Haarbürste; auf der Wand zur Rechten wimmelten sie zwischen Reihen von Bildschirmen. Sie schaltete ihre Taschenlampe aus; es kam genug Licht von den Fernsehmonitoren. Vor den Monitoren, die mehr oder minder den gleichen Abstand voneinander hatten, stand eine Reihe von entfernt menschenähnlichen gelben Gestalten, die Overalls aus Zeitungspapier trugen. Beim näheren Hinsehen erkannte Cindy, dass die Zeitungen in einer Art unergründlicher Geheimschrift bedruckt waren, ziemlich unleserlich. Und die Fotos zeigten nur halb erkennbare Silhouetten.
Zum ersten Mal regte sich in ihr wirkliches Unbehagen, und Bruchstücke, Fetzen von Angst, unregelmäßigen Hagelkörnern gleich, durchklapperten das frostige Herz ihrer Empfindungen.
Angst deshalb: die Männer vor den Bildschirmen hatten überhaupt keine Münder, keine Nasen, keine Ohren. Alle hatten nur riesig zwinkernde, wassergraue Augen. Und auch deshalb Angst: mit Cindys Eintreten begannen die Blattläuse, wenn es wirklich welche waren, sich fieberhaft - aber irgendwie zielbewusst - in Mandala-Mustern über die Wände zu bewegen und raschelten durch einen Überzug dicker, zotteliger Wimpern: die Wimpern, erkannte sie jetzt, bedeckten vollständig die Wände. Sie hatten die Farbe eines schlimm erkälteten Schlunds.
Die mundlosen Männer benutzten dreifingrige Hände, um Knöpfe auf den Monitoreinfassungen zu bedienen. Ab und zu reichte einer von ihnen hinauf und streifte eine Blattlaus; die Berührung hatte etwas an sich, was das Wesen elektrisierte, so dass es aufgebracht die Wand hinaufhuschte, wobei es die Wimpern zerteilte und die durch die kollektive Bewegung der anderen Blattläuse hervorgerufenen symmetrischen Muster veränderte.
Die Fernsehbilder waren schwarzweiß. Der Boden war aus Alabaster, mit eingelegten silbernen Drähten; die Drähte waren geheimnisvoll angeordnet und sprühten bei der Berührung der Metallschuhe der Fast-Menschen Funken.
Cindy hatte sich entschlossen, sie Fast-Menschen zu nennen.
Ihre Augen passten sich an das trübe Licht an, und sie sah, dass im Kreuz eines jeden Fast-Menschen ein Nabel saß. Der lange, sich verjüngende schwarze Nabel hing schlaff herab, dann hob er sich, um sich mit der Basis des dicken rotgelben Stängels in der Mitte der Kammer zu verbinden, ähnlich wie sich das Band eines Ersten-Mai-Feiernden um einen Maibaum legt. Cindy vermutete, dass die Nabel Münder und Nasen für die Fast-Menschen entbehrlich machten.
Cindy fürchtete sich, aber das ließ sie immer zur Offensive übergehen. Übernimm die Kontrolle, sagte sie sich.
Nur um zu sehen, was passieren würde, ging sie im Raum umher, schnitt mit ihrem Büchsenöffner die Nabelschnüre durch und trennte die Fast-Menschen von dem Stängel.
Die Fast-Menschen unterbrachen ihre Beschäftigung; sie drehten sich um und sahen sie an.
Cindy fragte sich, was sie empfanden. Waren sie entsetzt oder überrascht oder empört oder verletzt? Sie konnte es nicht sagen.
Einer nach dem andern griff sich an die spindeldürre Kehle und fiel um. Sie krümmten sich und zuckten und ließen das Drähtemuster auf dem Boden blaue Funken sprühen, und Cindy vermutete, dass sie dabei waren zu ersticken.
Diesmal empfand sie ein wenig Bedauern. Sie sagte es sogar. »Oh, tut mir leid.«
Nach einigen Minuten hörten sie auf, sich zu bewegen. Ihre großen Augen schlossen sich. Heftig atmend trat Cindy über die Leichen und ging zu einem der Fernsehschirme. Sie achtete darauf, nicht auf die silbernen Drähte im Boden zu treten; sie war sicher, sie würde einen tödlichen Stromschlag bekommen, wenn sie es täte.
Die Bildschirme gaben das Leben der Oberwelt wieder. Sich verästelnde Kohle-und-Kreide-Videobilder von Häusern und Motels und Verkehr und Hunden. Müllabladeplätzen. Umspringenden Ampeln. Farmen. Seebädern. Kanadischen Wanderern. Einem Teenagerjungen mit strähnigem blonden Haar und einer schmalen Brust, der zittrig eine Spritze aus einem rostigen Löffel zu füllen versuchte. Jazzmusikern. Masturbierenden Kindern. Masturbierenden Männern und Frauen. Masturbierenden Affen. Sie schaute eine Weile auf einen Monitor, der ein in einem Hotelzimmer kopulierendes Paar zeigte. Sie waren beide mittleren Alters und ziemlich käsig. Der Mann hatte schütteres Haar, und sein Bauch wabbelte im Rhythmus seines Stoßens; die Frisur der Frau war so scharf umrissen und dauerhaft wie ein Hut. Wie ein glockenförmiger Hut.
Impulsiv griff Cindy nach vorn und spielte an dem unbeschrifteten schwarzen Plastik-Knopf des Monitors. Das Bild flimmerte, veränderte sich: der Kopf der Frau verzerrte sich, verlor seine Form, manifestierte sich neu - er war zum Kopf eines Schimpansen geworden. Der Mann kreischte und löste sich aus ihr und wich zurück.
Die Frau begann sich zu zerkratzen.
Cindy zog eine Flunsch und legte den Kopf schräg. Sie griff hoch und stieß mehrere der metallischen Blattläuse mit ihrem Büchsenöffner an. Sie stoben, verängstigt durch die ungewohnte Berührung, auseinander und ließen die anderen umso heftiger aufschrecken, bis die Tausenden von Blattläusen, die sich an die runde Decke klammerten, sich inmitten der Wimpern in wimmelnder Hysterie neu sammelten und ihr symmetrisches Muster zerstört war.
Cindy blickte auf die Fernsehbildschirme. Jetzt zeigten sie nur noch Massenszenen. Zuschauer bei Footballspielen mit verwirrten und gequälten Gesichtern, als ob sie alle blind und taub geworden wären; sie stolperten mit fuchtelnden Armen ineinander oder strauchelten, taumelten die Tribünen hinunter und warfen dabei andere Leute um - während Cindy jedoch weiter zusah, begannen sich die Menschen geschlossen zum Spielfeld hinunterzubewegen. Sie strömten auf das Feld, besetzten es und begannen sich nach dem Diktat einer spontan neugebildeten psychischen Vorstellung zu formieren: Leute mit weißen oder gelben Hemden bewegten sich zueinander, Leute mit dunklen Hemden sammelten sich, bis das aus der Vogelperspektive aufgenommene Bild erkennen ließ, dass die Menge mit ihrem frisch gebildeten Farbmuster Worte buchstabierte. Sie lauteten:
ZEITGEIST
und dann
LIEBE MAL TOD GLEICH AKTION
und dann
REBELLION DER SPITZENMUSTER
Cindy wandte sich ab. Sie näherte sich dem Stängel in der Mitte des Raums. Den Büchsenöffner zwischen den Zähnen, begann sie daran hochzuklettern. Er war glitschig, aber sie war fest entschlossen und erreichte bald die Decke. Mit schmerzenden Armen und Beinen hing sie dort und begann mit einer Hand eine Öffnung zu schneiden.
Die Haut zerteilte sich von unten leichter. Zehn Minuten schmerzhafter Plackerei, und der Schlitz war breit genug, um hindurch zu klettern. Cindy ließ den Büchsenöffner fallen und schlängelte sich nach oben, durch die Wunde in der Decke.
Sie durchbrach eine zweite Schicht, indem sie mit den Zähnen daran nagte, und tauchte durch die Haut eines weiteren Pseudofußbodens auf.
Sie befand sich unter etwas, das wie ein gewöhnlicher vierbeiniger Holztisch aussah. Um sie herum waren vier leere Holzstühle und ein weißes, bodenlanges Tischtuch.
Sie stemmte sich aus dem feuchten, zitternden Schlitz und auf den Boden. Nach Luft schnappend presste sie sich neben das Tischtuch, das sie bis jetzt von dem, was draußen war, abgeschirmt hatte, und kroch in die Oberwelt hinaus, wieder einmal im Oben Angelongt.
Sie befand sich in einem Restaurant. Mom und Dad und Belinda und Barbara saßen am nächsten Tisch.
Sie starrten sie mit offenem Mund an. »Womit, zum Teufel, hast du dich da bekleckert, Cindy?«, fragte ihr Vater. Die Mädchen sahen aus, als ob ihnen übel wäre.
Cindy war mit der Feuchtigkeit, der Klebrigkeit, dem blutähnlichen Lebenssaft des unterirdischen Dings bedeckt.
Immer noch schwer atmend und mit hämmerndem Kopf griff Cindy nach unten, schob das Tischtuch beiseite und offenbarte die zerrissene, triefende Wunde, aus der sie herausgekrochen war. Dieses Mal sah sie auch ihre Familie.
Ihr Vater erhob sich ziemlich abrupt vorn Tisch, so dass er ihn beinahe umstieß und sich sein Weinglas in das Kleid seiner Frau ergoss. Er wandte sich ab und stolperte, in der Tasche nach seinem Pot-Beutel suchend, in Richtung Ausgang. Ihre Schwestern hielten sich die Augen zu. Sie schluchzten. Ihre Mutter starrte sie an. Moms Gesicht veränderte sich; die Augen wurden größer, die Lippen verschwanden, ihre Haut wurde staubig-grau. So war das also. Ihre Mutter war diejenige, die sie in ihre Familie eingeschleust hatten. »Sie sind nicht unter jedem Haus«, erklärte Cindy ihren Schwestern. »Man kann sie nicht überall finden. Ihr könntet unter eurem Haus graben und sie nicht finden - ihr müsst wissen, wie ihr zu gucken habt. Nicht wo zu gucken. Sie täuschen uns mit falschen Symmetrien.«
Ihre Schwestern folgten ihrem Vater nach draußen.
Cindy wandte sich ab. »Dann leckt mich eben im Arsch«, sagte sie. Sie fühlte die Unterweltaugen ihrer Mutter im Rücken. als sie sich wieder hinkniete und unter den Tisch zurückkroch. Mit den Füßen voran glitt sie durch die Wunde und fiel in den Raum darunter. Sie suchte auf den Monitoren und entdeckte einen Bildschirm, der ihren Dad und ihre Schwester dabei zeigte, wie sie gerade in den Wagen kletterten. Sie drehte an den Knöpfen und lachte, als sie sah, dass der Wagen wie ein Heliumballon mit durchtrennter Schnur in den Himmel stieg und sich dabei überschlug, wobei Belinda herausgeschleudert wurde und herabfiel und ihr Vater schrie, während der Wagen zerschmolz und zu einem riesigen Tropfen Quecksilber wurde, der in der Luft hing und dann in tausend glitzernde Tröpfchen zersprang, die herunterfielen und die Parkbucht mit silbrigem Gift übersprühten.
Unter dem Generator
In die Augen der Frau blickend, die ihm in der gut gefüllten Caféteria gegenüber saß, wurde er heftig an die Augen einer anderen Frau erinnert. Vielleicht waren in den Gesichtern der beiden Frauen geheime Spiegel verborgen. Die andere Frau, Alice, hatte gesagt: Ich halte es einfach nicht mehr bei dir aus, wenn du darauf bestehst, diesen verdammten Job zu behalten. Tut mir leid, Ronnie, ich kann einfach nicht.
Er überlegte, weiter in die Augen der zweiten Frau blickend, dass er für Alice den Job hätte aufgeben können. Aber er hatte es nicht getan. Vielleicht hatte er sie nicht wirklich gewollt. Und er war von Alice problemlos zu Donna gewechselt. Er war entschlossen, Donna wegen seiner Arbeit bei den Generatoren nicht ebenfalls zu verlieren.
»Ich war mal Schauspieler«, sagte Denton. Den Kaffee in seinem Becher schwenkend, rutschte er unbehaglich auf seinem Caféteria-Stuhl und fragte sich, ob das Plastik des Bechers sich langsam in den Kaffee hinein auflösen würde... Seit er im Krankenhaus arbeitete und jeden Morgen und Mittag Kaffee aus den gleichen Bechern trank, hatte er Visionen, in denen das Plastik sein Mageninneres langsam mit weißem Krokant überzog.
»Was ist aus der Schauspielerei geworden, und wie weit hast du's gebracht?«, fragte Donna Farber, wobei sie, wie es ihre Art war, so viel Fragen in einem Satz unterbrachte, wie sie konnte.
Denton runzelte die Stirn, und sein weit offener Mund zog einen kunstvollen Schnörkel über sein breites, blasses Gesicht. Seine Mimik war immer ein wenig übertrieben, als hätte er sich noch nicht an die Rolle des Ronald Denton gewöhnt.
»Ich habe off-Broadway gearbeitet, und ich hatte eine gute Rolle in einem von mir selbst verfassten Stück. Ein Schauspieler kann die Rolle immer besser spielen, wenn er sie geschrieben hat. Das Stück hieß All Men Are Created Sequels. Tigner hat es produziert.«
»Nie davon gehört.«
»Es wurde natürlich abgesetzt, nachdem ich ausgestiegen war.«
»Natürlich.« Ihre blauen Augen mit den Silberflecken lachten.
»Ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass die Schauspielerei viel zu viel von meiner Identität auffraß. Irgendwie. Eigentlich weiß ich nicht so recht, warum ich aufgehört hab. Vielleicht war es im Grunde auch Versagensangst.«
Seine unerwartete Offenheit veranlasste sie, ihm in die Augen zu blicken. Er dachte an Alice und fragte sich, wie er herausfinden könnte, welche Gefühle Donna eigentlich seinem Job entgegenbrachte, wenn sie überhaupt etwas fühlte.
Aber das Thema kam schon allein durch seine schwarze Uniform auf den Tisch. »Warum hast du die Schauspielerei aufgegeben, um bei den Generatoren zu arbeiten?«
»Ich weiß nicht. Es war etwas frei, und die Arbeitszeit lag günstig. Vier Stunden täglich, zweiundzwanzig Dollar die Stunde.«
»Yeah... aber es muss deprimierend sein, dort zu arbeiten. Ich meine, du hast die Schauspielerei wahrscheinlich immer noch nicht aufgeben können. Du musst vor Leuten, die bald sterben werden so tun, als ob alles in Ordnung wäre.« Es lag kein Vorwurf in ihrer Stimme.
Ihr Kopf neigte sich voller Mitgefühl.
Denton nickte nur, als erkenne er eine traurige Tapferkeit darin, dass er der Sündenbock war. »Jemand muss es schließlich tun«, sagte er. Im Grunde war er in Hochstimmung. Seit einer Woche versuchte er, Donna für sich zu interessieren. Er blickte sie freimütig an, bewunderte ihre schlanken Hände, die sie um die Kaffeetasse gelegt hatte, ihre ein wenig gespitzten Lippen, mit denen sie zum Abkühlen auf den Kaffee blies, das feste flachsfarbene Haar, das sie hinter den Ohren ausgeschnitten hatte.
»Ich verstehe nicht ganz«, sagte sie, in ihrem Kaffee nach einer Erleuchtung suchend, »warum man dafür nicht ehemalige Krankenschwestern nimmt, oder andere Leute, die an den Tod gewöhnt sind.«
»Einmal braucht man gewisse Elektronik-Kenntnisse, um die Generatoren zu überwachen. Deshalb bekam ich den Job. Ich habe Elektronik studiert, bevor ich Schauspieler wurde.«
»Das ist ein komischer Gegensatz. Elektronik und Schauspielerei.«
»Jedenfalls sind es nicht einmal erfahrene Krankenschwestern gewohnt, dazusitzen und Menschen vier Stunden an einem Stück beim Sterben zuzusehen. Sie lassen sie im Allgemeinen allein, außer wenn sie sie versorgen...«
»Aber ich dachte, du hättest gesagt, alles was du tun müsstest, wäre dazusitzen und alle Augenblicke die Anzeigen zu überprüfen. Du meinst, du musst dabei zusehen?«
»Nun... man kommt nicht dran vorbei. Man sitzt dem Patienten unmittelbar gegenüber. Da man nun mal da ist, sieht man auch hin. Ich bin mir irgendwie ihrer Gegenwart bewusst, weil ich dafür sorgen muss, dass sie nicht so schnell sterben, denn sonst könnte es passieren, dass das Gerät nicht mehr mit dem Abschöpfen mitkommt.«
Sie schwieg und sah sich in der belebten Kantine um, als suchte sie bei den umher hastenden Krankenhausangestellten mit den hölzernen Gesichtern Unterstützung. Eine Zeitlang schien sie auf das Geschirrgeklapper und den dumpfen Gesprächslärm zu lauschen.
Denton fürchtete, er habe sie verletzt und bei ihr den Eindruck erweckt, er sei eine Art Aasgeier. Er hoffte, dass sie sich nicht nach jemand anderem umsah, mit dem sie sich unterhalten konnte...
»Hier gefällt es mir nicht«, sagte sie.
»Dann lass uns rausgehen«, sagte Denton eine Spur zu ungeduldig.
Sie legten ihre Tabletts auf das Förderband und gingen zum Lift, fuhren zum Erdgeschoss des riesigen Krankenhauses hinunter und traten in die pastellfarbene geschwungene Lobby hinaus. Sie gingen zwischen künstlichen Topfpalmen und wartenden Menschen dahin, gekünstelten Gesichtern, hinter denen sich Sorgen verbargen. Sie traten durch die Drehtüren ins Freie und tauschten den Desinfektionsgeruch gegen das Junisonnenlicht und den warmen Hauch der Aerobile.
»Aerobile sind so leise«, sagte sie. »Der ganze Verkehrslärm hat mir immer Angst gemacht, als ich klein war.« Sie unterhielten sich ruhig über Autos und die Stadt und ihre Jobs, bis sie zu einem Park gelangten.
Unter einem Baum sitzend und gedankenlos am Gras zupfend, schwiegen sie eine Weile und ließen den Park auf sich wirken.
Bis Donna von sich aus zu sprechen begann: »Meine Eltern sind vor fünf Jahren gestorben und...« Dann brach sie ab und sah an ihm vorbei. Sie schüttelte den Kopf.
»Wolltest du etwas anderes sagen?«
Wieder schüttelte sie den Kopf, zu rasch. Er wollte sie fragen, ob man Generatoren über ihren Eltern angebracht hatte, bevor sie gestorben waren, doch dann sagte er sich, dass diese Frage ein schlechtes Licht auf ihn werfen könnte.
Sie saßen im Park und beobachteten auf den Plasphaltwegen vorbeikommende Radfahrer und Kinder. Nach einer Weile rollte ein Eisverkäufer eine schmierige weiße Karre vorbei, und Denton stand auf, um zwei Eis zu kaufen. Er war gerade auf dem Rückweg vom Verkäufer, etwa zehn Meter von der Stelle entfernt, wo Donna unter dem Baum wartete, als jemand eine Hand auf seinen rechten Arm legte.
»Kann ich mit Ihnen sprechen?« Beinahe ein Flüstern. »Nur für eine Minute?«
Es war ein Junge, sechzehn vielleicht, aber fast zehn Zentimeter größer als Denton. Der Junge öffnete und schloss nachdenklich den Mund, voller Ungeduld, seine Fragen loszuwerden. Er trug einen Jeansoverall. Seine Hände waren tief in den Seitentaschen versenkt, wie festgebunden. Denton nickte mit einem schnellen Blick auf das Eis, besorgt, es könnte in seinen Händen schmelzen. Wahrscheinlich warb der Junge für eine der Satanssekten.
»Sie sind ein Generator-Mann, stimmt's? Ein Kompensator.«
Wieder nickte Denton stumm.
»Mein Vater ist unter dem Generator; er stirbt. Und er ist noch nicht wirklich alt. Er wird noch... gebraucht.« Er machte eine Pause, um ruhiger zu werden. »Können
Sie... vielleicht könnten Sie ihm helfen, die Maschine für eine Weile abschalten?« Es war offensichtlich, dass es ungewohnt für den Jungen war, um einen Gefallen zu bitten. Er hasste es, Denton um irgendetwas zu bitten.
Denton wünschte, er wäre nicht in seiner Uniform aus dem Krankenhaus herausgegangen. »Ich kann für Ihren Vater überhaupt nichts tun. Ich bin kein Arzt. Und im Krankenhaus sind im Moment Dutzende von Generatoren in Betrieb. Ich habe Ihren Vater wahrscheinlich noch nie gesehen. Außerdem stimmt es gar nicht, dass die Generatoren den Patienten ihre Kräfte rauben. Das ist Altweibertratsch. Ihr Vater hätte überhaupt nichts davon, wenn ich ihn abschalten würde. Tut mir Leid.« Er ging weiter in Richtung Donna.
»Wie heißen Sie?«, fragte der Junge von hinten mit einer Stimme, aus der aller Respekt verschwunden war. Denton konnte den Blick des Jungen in seinem Rücken fühlen. Er wandte sich halb um, verärgert.
»Denton«, antwortete er und wünschte augenblicklich, er hätte einen falschen Namen genannt. Er ließ den Jungen stehen und ging zu Donna zurück. Er spürte schon eine Spur geschmolzenes Eis auf der Hand.
»Was wollte dieser Junge?«, fragte Donna, an ihrem Eis leckend.
»Nichts. Den Weg zu... zur Sporthalle. Er meinte, er wollte den Titelkampf der Satans/Jesus-Freaks sehen.«
»Tatsächlich? Er sah nicht so aus, als wäre er bewaffnet.« Sie zuckte die Achseln.
Der Junge beobachtete sie.
Etwas von dem Eis war auf Dentons Bein getropft.
Donna wischte den roten Flecken auf seiner schwarzen Uniform mit einem weißen Taschentuch ab.
Er wollte jetzt nicht an die Arbeit denken. Er hatte sich mit ihr für den Abend zu einem Besuch im Media Stew verabredet. Die erste Beziehung seit Alice.
Aber vielleicht wäre es besser, mit den Gedanken bei der Arbeit zu bleiben. Wenn er zu viel an sie dachte, würde er nervös und gekünstelt sein, wenn er mit ihr zusammen war. Vielleicht sogar alles verderben. Er stellte den Gürtel um seine einteilige tiefschwarze Uniform enger und ging ruhig zum Büro des Aufsehers hinüber. Der Vorgesetzte der Kompensatoren war klein, ungeduldig und ein zwanghafter Nörgler. Mr. Buxter lächelte, als sich Denton über den Arbeitsbogen beugte, der mit JUNIWOCHEN 19 BIS 26, 1996 überschrieben war.
»Warum so eilig, Denton? Ihr jungen Leute habt es immer eilig. Sie werden noch früh genug eingeteilt. Vielleicht zu früh für Ihren Geschmack. Ich habe Sie noch nicht in die Liste eingetragen.«
»Lassen Sie mich bei Mr. Hurzbaus Generator, Sir, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich komme mit Hurzbau gut aus.«
»Was soll denn dieser Mist, ich komme gut aus? Wir legen die Vorschrift weitherzig aus, die das Fraternisieren mit Patienten unter dem Generator verbietet... aber Vertraulichkeit ist streng verboten. Sie werden überschnappen, wenn Sie...«
Da er nicht wieder in eine von Buxters Lektionen verwickelt werden wollte, kapitulierte Denton sofort. »Es tut mir Leid, Sir. Ich wollte damit nicht sagen dass wir einander gut kennen würden. Was ich meinte, war, Hurzbau setzt mir nicht sonderlich zu oder geht mir mit den üblichen Vertraulichkeiten auf die Nerven. Könnte ich jetzt meine Zuweisung haben? Ich möchte nicht, dass sich der unbeobachtete Generator überlädt.«
»Selbstverständlich kümmert sich andauernd jemand um den Generator. Er kann sich nicht überladen. Sie sollten sich in Geduld üben. Besonders bei Ihrem Job.« Buxter hob seine breiten Schultern und legte eine dicke Hand auf seinen Bauch. Er sah auf die Liste, gähnte, strich sich den buschigen schwarzen Schnurrbart und begann seine Pfeife zu füllen.
Denton, der immer noch vor ihm stand, bewegte sich unbehaglich. Er wollte seine Schicht hinter sich bringen.
Buxter entzündete seine Pfeife und blies grauen Rauch auf Denton.
»Heute Durghemmer«, sagte Buxter.
Denton runzelte die Stirn. Durghemmer, die Klette. »Durghemmer.« Denton sprach den Namen in die Luft, auf dass er ihm nie wieder über die Lippen käme. »Nein. Also wirklich, Buxter, ich...«
»Noch so ein Schwächling. Nie finde ich einen, der bereit wäre, Durghemmers Generator zu übernehmen, aber ich will verdammt sein, wenn ich's am Ende selbst tue. Deshalb, Denton...«
»Ich kann nicht. Wirklich nicht. Ich habe heute Abend eine Verabredung. Da kommt es auf psychologisches Fingerspitzengefühl an. Durghemmer würde alles kaputtmachen.« Denton blickte seinem Vorgesetzten mit dem ganzen Pathos seiner Schauspielkunst in die Augen. Buxter starrte auf seine Hände, dann zündete er wieder seine Pfeife an.
»Okay. Dieses eine Mal lasse ich's Ihnen durchgehen«, sagte er. »Nehmen Sie Hurzbau. Aber reden Sie nicht mit ihm, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich sollte es nicht tun, aber ich werde Durghemmers Generator für heute Nacht auf Automatik stellen. Es ist gefährlich, aber was soll's? Allerdings - jeder muss früher oder später rotieren, Ron.«
»Natürlich«, sagte Denton erleichtert. »Später.« Er nahm seine Stempelkarte vom Regal an Buxters Bürowand.
Denton las pedantisch genau die Anzeigen ab, wobei er daran dachte, dass dieser Generator mindestens dreißigtausend Menschen mit Energie versorgte. Die Amplitude vergrößerte sich. Armer Hurzbau. Aber solche Gedanken, sagte er sich, waren genau die Sorge, die er nicht wollte. Viel Glück, Hurzbau!
Denton justierte die Haube über dem Bett. Die Haube des Generators war eine transparente Glocke, die Hurzbaus Bett umschloss. Sie bestand aus nichtleitendem Fiberglas und war von Drähten geädert, die in einem Kabelstrang an seiner Spitze zusammenliefen und sich wie eine dicke, gebündelte Kletterpflanze durch metallene Führungen in eine Öffnung in dem zylindrischen Kristall an der flachen Oberseite des Generators wanden.
Am rechteckigen Transformator lag an der dem Bett zugewandten Seite ein wabenförmiges Muster metallener Sechsecke offen. Auf der anderen Seite saß Denton in seiner schwarzen Uniform und in seiner beherrschten Haltung in einem Drehstuhl und regelte den Anstieg und Abfall der vorn Generator absorbierten Energie, so dass ein stetiger, kalkulierbarer Strom zu den elektrischen Transmittern floss. Wenn die Gewerkschaften nicht gewesen wären, hätten das alles die Computer erledigt.
Als er die Anzeigen überprüft hatte, versuchte Denton sich eine Weile zu entspannen. Er blickte zerstreut im Zimmer umher. Der Raum war klein, ganz in Weiß gehalten, und es gab nur die paar Bilder, die Hurzbaus Angehörige aufgehängt hatten, um ihn aufzumuntern. Die Bilder zeigten ländliche Szenen aus Gegenden, die inzwischen größtenteils mit Plasphalt versiegelt waren.
Denton wunderte sich, warum sich überhaupt jemand die Mühe mit den Bildern gemacht hatte. Hurzbau konnte sie durch die Plastikhaube nur verschwommen sehen. Nichts, was nicht zum Generator gehörte, wurde unter der Haube geduldet. Nicht einmal Bettwäsche. Hurzbaus nackter, krebszerfressener Körper wurde durch selbstregulierende Höhensonnen gewärmt.
Die Hälfte von Hurzbaus Gesicht hatte der Krebs weggefressen. Früher hatte er Übergewicht gehabt. Er hatte in vier Monaten von 100 Kilo auf 59 abgenommen. Die rechte Gesichtshälfte war zu einer dünnen Hautschicht eingefallen, die am Schädelknochen haftete; sein rechtes Auge war verschwunden, die Höhle mit Baumwolle ausgestopft. Er konnte nur mit Mühe sprechen. Sein rechter Arm war ausgetrocknet und nicht mehr zu benutzen, obwohl sein linker noch so stark war, dass er sich auf seinen Ellbogen aufstützen konnte.
»Kompensator.« krächzte er, kaum hörbar durch das Plastik. Denton schaltete die Sprechanlage ein.
»Was kann ich für Sie tun, Sir?«, fragte er ein wenig schroff. »Möchten Sie, dass ich die Krankenschwester rufe? Ich persönlich kann Ihnen keine medizinische Hilfe geben.«
»Nein. Keine Krankenschwester. Denton? Ihr Name?«,
»Ja. Ronald Denton. Ich sagte es Ihnen gestern, glaube ich. Wie geht...?« Er hatte es beinahe vergessen, aber es fiel ihm rechtzeitig wieder ein. Er wusste, wie es Hurzbau ging; er hatte andauernde Schmerzen und noch sechs Wochen zu leben - höchstens. »Möchten Sie etwas Metrazin einnehmen? Das kann ich holen.«
»Nein. Wissen Sie was, Denton?« Seine Stimme war das Gekrächze eines Raben.
»Hören Sie, mir wurde gesagt, ich würde mit den Patienten zu sehr fraternisieren. Das ist eigentlich nicht mein Job. Wir haben einen fähigen Psychiater und einen Priester und...«
»Wer sagt denn, dass Sie kein Priester sind, Denton? Die anderen Kompensatoren reden überhaupt nicht mit mir. Sie sind der einzige, der ein verdammtes Wort zu mir sagt.« Hurzbau schluckte, und seine ausgetrockneten Gesichtszüge verzerrten sich, so dass sich seine linke Gesichtshälfte für einen Moment der entstellten rechten Hälfte anpasste. »Wissen Sie, Denton, ich hätte mich gegen Krebs impfen lassen können, aber ich dachte, ich würde es nie brauchen. Ich nicht.« Er produzierte einige schmirgelpapierartige Geräusche, die ein Lachen sein mochten. »Und es ist eine sichere Angelegenheit, wenn man sich gegen Krebs impfen lässt, kann man keinen Krebs bekommen, und ich habe mir das durch die Lappen gehen lassen. Zum Kuckuck damit!«
Denton empfand dem sterbenden Mann gegenüber plötzliche Kälte. Er wich innerlich zurück, als wäre Hurzbau eine deformierte Sirene, die ihn unter die Haube locken wollte. In einer Beziehung stimmte es: Hurzbau wollte Mitgefühl. Und Mitgefühl hätte bedeutet, dass sich Denton in Hurzbaus Lage hätte versetzen müssen. Er musste damit Schluss machen, selbst wenn es auf Hurzbaus Kosten ging.
Doch ein Blick in die Augen des alten Mannes hielt ihn davon ab: ein rotes Licht vom ausbrennenden, erlöschenden Docht der Nervenenden Hurzbaus.
»Denton, sagen Sie mir eins.« Eine beinahe sichtbare Schmerzwelle jagte durch Hurzbaus geschrumpften Körper; die pergamentdünne Gesichtshaut verzerrte sich, als wollte sie reißen. »Denton, ich will Bescheid wissen. Die Generatoren, machen sie mich schwächer? Ich weiß, dass sie... Energie aufnehmen... von meinem Sterben... Stimmt es, dass sie... sich von mir ernähren? Lassen sie mich sterben, damit.«
»Nein!« Denton war von seiner eigenen Heftigkeit überrascht. »Nein, Sie sehen es genau verkehrt herum. Er nimmt Energie auf wegen Ihres Sterbens, aber sie kommt nicht direkt von Ihnen.«
»Könnten Sie.« begann Hurzbau, aber er fiel aufs Bett zurück, unfähig, sich länger aufzustützen. Denton erhob sich impulsiv von seinem Überwachungsstuhl und trat ans Bettende. Er blickte in die sich auflösenden Augen des Mannes hinab und schloss nach der fast sichtbar schwelenden Glut des Schmerzes auf den Fortschritt der Histolyse. Hurzbaus Mund arbeitete schweigend, heftig. Schließlich, an einer intravenösen Kanüle zerrend, die an seinem linken Arm befestigt war, brachte er heraus: »Denton... könnten Sie den Generator reparieren, wenn er ausfallen würde?«
»Nein. Ich weiß nicht genau, wie er funktioniert. Ich kompensiere nur die metrischen Oszillationen...«
»A-ha. Wie können Sie dann behaupten, dass er mir nicht das Leben aussaugt, wenn Sie nicht genau wissen, wie er funktioniert? Sie wissen, was man Ihnen erzählt. Aber woher wissen Sie, dass es die Wahrheit ist.«
Hurzbau begann zu würgen und spuckte gelbe Flüssigkeit. Ein Flüssigkeitsdetektor an der Seite des Bettes veranlasste einen Plastikarm dazu, sich von der Platte mit Automatikgeräten links von Hurzbaus Kopf zu erheben. Der Arm wischte das Kissen und Hurzbaus Lippen mit einem Schwamm ab. Die Augen des Sterbenden flackerten schwach auf, und er schlug mit seinem heilen Arm nach dem mechanischen Wischlappen.
»Verdammt, verdammt«, murmelte er, »ich bin doch keine Billardkugel.« Der Plastikarm floh zurück zu seiner Arretierung.