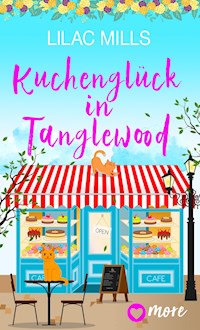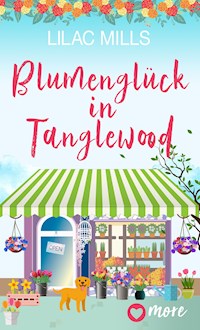Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tanglewood und Liebesglück
- Sprache: Deutsch
Liebe, Lügen, Hochzeitskleid.
Edie hat genug damit zu tun, ihre unberechenbare Chefin in Moira's Wedding Shop bei Laune zu halten. Und dann wird sie von Tia gebeten, ihr ein zweites Hochzeitskleid zu nähen, denn das Kleid, das deren alles bestimmende Oberschichten-Schwiegermutter ausgesucht hat, ist einfach nur schrecklich. Edie kann der Bitte nicht widerstehen, auch wenn es sie ihren Job kosten könnte und sie sich immer mehr in Notlügen verstrickt. Als wäre das nicht schon genug Aufregung, trifft sie immer wieder auf Tias Trauzeugen James, der keine Gelegenheit auslässt mit ihr zu flirten. Aber während Edie jeden Gehaltsscheck herbeisehnt, führt James ein High Society Leben ohne Sorgen und Nöte. Edie ist sich sicher: diese unterschiedlichen Welten passen einfach nicht zueinander …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Liebe Leserin, lieber Leser,
Danke, dass Sie sich für einen Titel von »more – Immer mit Liebe« entschieden haben.
Unsere Bücher suchen wir mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Begeisterung aus und hoffen, dass sie Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude im Herzen bringen.
Wir wünschen viel Vergnügen.
Ihr »more – Immer mit Liebe« –Team
Über das Buch
Edie hat genug damit zu tun, ihre unberechenbare Chefin in Moira's Wedding Shop bei Laune zu halten. Und dann wird sie von Tia gebeten, ihr ein zweites Hochzeitskleid zu nähen, denn das Kleid, das deren alles bestimmende Oberschichten-Schwiegermutter ausgesucht hat, ist einfach nur schrecklich. Edie kann der Bitte nicht widerstehen, auch wenn es sie ihren Job kosten könnte und sie sich immer mehr in Notlügen verstrickt. Als wäre das nicht schon genug Aufregung, trifft sie immer wieder auf Tias Trauzeugen James, der keine Gelegenheit auslässt mit ihr zu flirten. Aber während Edie jeden Gehaltsscheck herbeisehnt, führt James ein High Society Leben ohne Sorgen und Nöte.
Edie ist sich sicher: diese unterschiedlichen Welten passen einfach nicht zueinander …
Über Lilac Mills
Lilac Mills lebt mit ihrem sehr geduldigen Ehemann und ihrem unglaublich süßen Hund auf einem walisischen Berg, wo sie Gemüse anbaut (wenn die Schnecken sie nicht erwischen), backt (schlecht) und es liebt, Dinge aus Glitzer und Kleber zu basteln (meistens eine Sauerei). Sie ist eine begeisterte Leserin, seit sie mit fünf Jahren ein Exemplar von Noddy Goes to Toytown in die Hände bekam, und sie hat einmal versucht, alles in ihrer örtlichen Bibliothek zu lesen, angefangen bei A und sich durch das Alphabet gearbeitet. Sie liebt lange, heiße Sommer- und kalte Wintertage, an denen sie sich vor den Kamin kuschelt. Aber egal wie das Wetter ist, schreibt sie oder denkt über das Schreiben nach, wobei sie immer an herzerwärmende Romantik und Happy Ends denkt.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Lilac Mills
Hochzeitsglück in Tanglewood
Aus dem Englischen übersetzt von Julia Brinkkötter
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Impressum
Kapitel 1
»Darf ich einen Hund haben?« Danny saß auf dem Boden und spielte mit Lego. Er blickte hoffnungsvoll zu seiner Mutter hoch.
Edie nahm eine Stecknadel aus dem Mund und seufzte. »Danny, du weißt doch, dass der Vermieter keine Haustiere duldet. Außerdem habe ich keine Zeit, mich um einen Hund zu kümmern.«
»Ich habe Zeit«, sagte ihr Sohn ernsthaft.
»Selbst wenn die Hausverwaltung von Eastern Estates Haustiere erlauben würde, wärst du nicht alt genug, um allein mit einem Hund Gassi zu gehen.«
Edie schauderte bei der Vorstellung, dass ihr achtjähriger Sohn ohne Begleitung am Flussweg entlanglief. Erst letztes Jahr war der Fluss über die Ufer getreten und hatte die angrenzenden Cottages überschwemmt, so dass die Bewohner evakuiert werden mussten. Mit Flüssen war nicht zu spaßen.
»Und ein Kätzchen?«, schlug er vor. »Mit Katzen muss man nicht Gassi gehen.«
Hach, das musste man ihm lassen, er gab nicht auf. »Tut mir leid, Danny, aber ich darf einfach nicht riskieren, dass eine Katze mit ihren Krallen den Stoff zerkratzt.« Sie zeigte auf den Berg aus Spitze und Seide, der den kleinen Tisch im Wohnzimmer bedeckte. Edie arbeitete immer an mindestens drei teuren Braut- oder Brautjungfernkleidern gleichzeitig.
»Und wenn du sie in deinem Zimmer aufbewahrst und die Tür zulässt? Ich passe gut auf, dass die Katze nicht da reingeht.«
»Katzen kommen überall rein, Dan. Die kann man nicht aufhalten. Und ich lasse doch mein Schlafzimmerfenster gern einen Spaltbreit offen.«
»Ich kann sie aufhalten«, sagte er und nickte energisch mit dem Kopf. »Mary wäre eine Hauskatze, die nie rausgeht. Dann darfst du dein Fenster aufmachen, und sie könnte sich niemals reinschleichen.«
»Mary? Du hast der Katze schon einen Namen gegeben?«, fragte sie und sah zu ihrer Überraschung, dass Danny bis unter die Haarwurzeln seines sandblonden Schopfes errötete.
Er senkte den Kopf, konzentrierte sich auf sein Lego und murmelte: »Vielleicht.«
Edie lächelte. »Und wenn das Tier ein Junge ist?«
»Ist es nicht.« Ihr Sohn ließ sich nicht beirren. »Mary ist ein Mädchen.«
»Eine deiner Klassenkameradinnen heißt Mary, oder?«
Kurze Stille. »Ja …«, murmelte er weiter. Die Farbe seiner Wangen war nun in ein leuchtendes Rosa übergegangen.
Edie vermutete, ihr kleiner Junge könnte einen Schwarm haben. Sein erster, wie süß! Dem schwachen Strich der Schneiderkreide folgend, schob sie eine unglaublich scharfe, feine Nadel in die weiße Seide. Der plötzliche Anflug von Wehmut traf sie unvorbereitet. Ihr Sohn wurde viel zu schnell groß. Ehe sie sichs versah, würde er kein Kind mehr, sondern ein Teenager sein. Und was sollte dann aus ihr werden? Dann würde er ihrer Gesellschaft die von Mädchen und seinen Freunden vorziehen. Er würde sie ganz allein zurücklassen, bis nur noch ihre Arbeit und eine imaginäre Katze namens Mary ihr Gesellschaft leisteten.
»Hättest du auch deinen Hund Mary genannt, wenn wir Hunde halten dürften?«, fragte sie.
»Ja.«
»Und wenn es ein ganz anderes Tier wäre? Zum Beispiel …« – sie gab vor, angestrengt nachzudenken – »ein Hamster?«
Danny machte eine kurze Denkpause, dann nickte er mit gesenktem Kopf, den Blick weiter fest auf seine Steinchen gerichtet.
»Ein Kaninchen?«
Er nickte erneut.
»Ein Goldfisch?«
»Jupp.«
»Ein Huhn?«
»Hühner kann man nicht in der Wohnung halten«, sagte er und blickte kurz zu ihr hoch. »Die scharren im Garten und so herum, das weiß doch jeder.«
Edie war sich ziemlich sicher, dass dieses Detail nicht jeder wusste, denn im Gegensatz zu seinem besten Freund Jack hielten die meisten Menschen keine Hühner im Garten. Sie lächelte.
»Okay, und ein Papagei?«
»Ein Papagei, der Mary heißt? Jetzt wirst du aber albern«, widersprach er ihr. »Papageien heißen Polly.«
»Ach ja?«
Er nickte mit Nachdruck.
»Aber ein Schaf?«, schlug sie vor.
Er warf ihr einen vernichtenden Blick zu.
»Ein Esel?«
Noch ein böser Blick.
»Jetzt weiß ich’s!« Sie klatschte in die Hände. »Eine Ziege! Ich mag Ziegen.«
»Ich mag Hündchen und Kätzchen lieber«, entgegnete er ziemlich bestimmt. »Also, darf ich eins haben?«
Edies Lächeln verflog, und ihr Ton wurde ernster: »Tut mir leid, Dan, du weißt, dass das nicht geht. Wir hatten die Diskussion doch schon.«
»Miss Harding sagt, in eine Diskussion soll jeder sich einbringen können.« Danny schob das Kinn vor und strafte sie mit einem trotzigen Blick.
Edie wusste, dass seine Schulklasse eine »Diskussionsgruppe« ins Leben gerufen hatte, um den Schülerinnen und Schülern das logische Argumentieren näherzubringen. Jetzt war sie gespannt, wie sich dieses Gespräch noch entwickeln würde.
»Nein zu sagen, ist keine Diskussion«, ergänzte Danny.
Da hatte er nicht ganz unrecht, dachte Edie, die stolz auf ihren zunehmend redegewandten Sohn war. »Die Antwort lautet trotzdem Nein«, beharrte sie in einem sanften Ton und zuckte sogleich zusammen, als er mit seiner kleinen Faust die eben erst gebaute Figur zerschmetterte. War sein Verhalten wohl ein Überbleibsel kleinkindlicher Trotzanfälle oder ein Vorbote pubertärer Gereiztheit? Solch ein Wutausbruch sah ihrem sonst so lieben und sanften Sohn gar nicht ähnlich.
»Räum bitte die Lego-Steine weg, wenn du fertig gespielt hast«, trug sie in einem ganz ruhigen Ton auf, um sich nicht anmerken zu lassen, dass seine schroffe Reaktion sie beunruhigt hatte.
»Das ist nicht fair«, hörte sie ihn leise vor sich hin murmeln, und da musste sie ihm recht geben. Das war wirklich nicht fair. Ein Kind sollte ein Haustier haben dürfen, doch bei ihrer Arbeit und ihrem Vermieter war das nun einmal unmöglich.
»Du hast recht«, sagte sie, »aber vieles im Leben ist unfair, Danny.«
Er war alt genug, um der Wahrheit ins Auge zu blicken. Obwohl sie ihm am liebsten seine Unschuld und Naivität so weit wie möglich erhalten würde, täte sie ihm langfristig keinen Gefallen damit, ihn vor allem zu beschützen. Sie wollte, dass er eine gewisse Widerstandsfähigkeit entwickelte, um die Hindernisse bewältigen zu können, die ihm das Leben zwangsläufig noch in den Weg legen würde. Dazu gehörte auch, ihm verständlich zu machen, dass selbst eine berechtigte Bitte manchmal wegen widriger Umstände abgelehnt werden musste.
Edie sah sich das zur Hälfte fertig gesteckte Kleid an und seufzte. Sie liebte es, Brautkleider zu entwerfen und zu schneidern und die Freude in den Gesichtern der Bräute zu sehen, aber sie wünschte, diese Arbeit wäre etwas besser bezahlt. Wenigstens gut genug, um aus diesem kleinen Mietshaus ausziehen und ein eigenes Cottage kaufen zu können.
Allerdings würde auch ein Eigenheim nichts gegen ihr zweites Problem ausrichten – und das war die Zeit; beziehungsweise der Mangel daran. Edie Adams nutzte jede freie Minute, in der sie sich nicht um Danny kümmerte, für die Arbeit an ihren Hochzeitskleidern. Genau genommen waren es gar nicht ihre. Sie gehörten Mrs Carrington, der Besitzerin von Moira’s Wedding Shop; für Edie fühlte es sich jedoch so an, als wären es ihre. Sie war diejenige, die gemeinsam mit der Braut ein Kleid in all seiner Pracht zum Leben erweckte – die einen Stoffballen auf dem Regal in eine wunderschöne Robe verwandelte, die einer Prinzessin würdig war. Mit Edies Hilfe wurden Träume wahr, und sie liebte ihre Arbeit. Größtenteils.
Mrs Carrington zufriedenzustellen, konnte mitunter ziemlich schwierig sein. Eigentlich war es das fast immer. Die Frau war mürrisch und nicht gerade umgänglich, aber Edie arbeitete schon seit kurz nach Dannys Geburt für sie und hatte sich mittlerweile an sie gewöhnt. Diese Vertrautheit machte ihr den Umgang mit ihrer Chefin allerdings nicht unbedingt einfacher.
Doch in Bezug auf ihren Arbeitsplatz hatte sie nicht allzu viel Auswahl, und ihr aktueller lag – buchstäblich – direkt vor ihrer Haustür: Der Brautladen befand sich auf der anderen Seite des kleinen Platzes vor ihrem Cottage. Und so viele Stellen gab es sonst nicht, bei denen sie die Arbeit bequem von zu Hause aus erledigen konnte.
Der gute Danny hatte sich mittlerweile von seinem Wutausbruch über das Haustierverbot erholt und räumte jetzt brav seine Lego-Steine zurück in die Kiste.
»Gib mir eine halbe Stunde, um dieses Kleid fertig abzustecken«, sagte Edie. »Dann gehen wir die Hauptstraße runter und holen uns Kuchen zum Tee.«
»Juhu!« Danny klatschte in die Hände. »Darf ich eine Cremeschnitte haben?«
»Wenn sie noch welche dahaben«, versprach Edie. Es wurde schon etwas spät, und in der Bäckerei war spätnachmittags in der Regel nicht mehr viel übrig. Dafür verkaufte der Bäcker die letzten Stücke Kuchen dann oft günstiger, um sie noch loszuwerden, und das wiederum kam Edie zugute, denn sie musste wirklich jeden Penny umdrehen.
Mit gesenkter Stirn wagte Danny einen Blick hoch zu seiner Mutter. »Wenn du mir Geld gibst, kann ich jetzt schon hingehen.«
Edie erstarrte.
Das war das erste Mal, dass ihr Sohn vorschlug, allein zur Bäckerei zu gehen. Es musste ja früher oder später geschehen, dachte sie; der Drang nach Unabhängigkeit war unvermeidlich und unaufhaltsam, doch sie war noch nicht bereit dafür. Danny war erst acht Jahre alt (fast neun, wie er sie immer wieder erinnern musste). Er war noch viel zu jung, um allein die Hauptstraße entlangzulaufen, auch wenn es nur um die Ecke und ein paar Schritte weiter war. Dort waren zu viele Leute, zu viele Autos; für so einen großen Schritt war er noch lange nicht bereit. Sie war noch nicht bereit dafür. Vielleicht wenn er etwas älter ist, dachte sie; mit vierzehn oder so.
»Du bist noch nicht alt genug, um allein loszuziehen«, wandte sie ein.
»Wann bin ich denn alt genug?«, fragte er wissbegierig. Er klang nicht bockig oder frech, das konnte sie heraushören, sondern wollte es ernsthaft wissen.
»Das dauert noch ein wenig, mein Schatz«, sagte sie.
»Jack darf das aber, und er wohnt in der West Street.«
Hm. Edie runzelte die Stirn. Sie fand, dass Jacks Mutter ihrem Jungen viel zu viel erlaube. Er durfte sogar allein zur Schule gehen, so dass er zu bestimmten Tageszeiten eine mitunter stark befahrene Straße überquerte.
»Können wir jetzt los?«, fragte Danny. Man sah ihm an, dass er darauf brannte, endlich rauszugehen und etwas Spannenderes zu erleben, als mit seiner Mutter im kleinen Wohnzimmer eingepfercht zu sein.
»In einer halben Stunde«, wiederholte sie.
»Das hast du vor einer halben Stunde gesagt.« Danny seufzte. »Mir ist langweilig.«
»Das waren erst fünf Minuten. Wie wär’s, wenn du deine Malfarben holst?«, schlug sie vor.
Als er mit seiner Lehrerin und einem der Parkranger auf einem Wandertag zum Malen im Brecon-Beacons-Gebirge gewesen war, hatte er entdeckt, dass er recht talentiert war. Seither saß er gern an seinem kleinen Schreibtisch mit aufklappbarem Zeichenbrett. Der Kinderschreibtisch wurde ihm langsam etwas zu klein, und er wäre mittlerweile besser am Tisch im Wohnzimmer aufgehoben, aber der war meistens mit Meterware aus Seide, Satin und Tüll bedeckt. Und Edie wusste nur zu gut, dass Brautkleidstoffe und Kindermalfarben sich nicht miteinander vertrugen.
»Hier gibt’s nichts zum Malen«, entgegnete ihr Sohn.
»Wie wäre es mit den Äpfeln in der Schüssel? Die glänzen schön rot.«
»Ich will draußen malen«, sagte er.
»Okay, wie wäre es dann mit den Blumenkübeln im Hof?«
Sie hatten zwar keinen richtigen Garten, doch immerhin einen hübschen kleinen Hof, den Edie mit Blumentöpfen und ‑kübeln geschmückt hatte. Dort war gerade genug Platz für einen Holztisch und zwei Stühle.
»Keine Lust.« So langsam wurde Danny mürrisch.
Das geschah in letzter Zeit immer öfter, und zu ihrem großen Bedauern musste sie sich eingestehen, dass er sich langsam, aber sicher von ihr abnabelte.
Früher war sie einmal die Welt für ihn gewesen, doch jetzt nicht mehr. Seine Welt war seit seinem ersten Tag im Kindergarten unaufhörlich und unwiderruflich gewachsen. Es würde nicht mehr lange dauern, bis sie auf seinem rasanten Weg ins Erwachsenenalter nichts weiter als ein entfernter kleiner Fleck am Horizont sein würde.
Und was würde sie dann tun? Abgesehen von ihrer Mutter, zu der sie ein enges Verhältnis hatte und die sie fast täglich traf, gab es in Edies Leben niemanden außer ihrem Sohn.
Kapitel 2
»Du bist als Nächster dran, Kumpel.« William verpasste James einen Klaps auf den Arm.
»Das ist wohl eher unwahrscheinlich«, entgegnete er lachend. »Ich habe nicht einmal eine Freundin.«
»Du bist zu wählerisch.«
»Ich bin zu arm. Sie sehen, dass ich mich mit dir herumtreibe, und denken, mein Kontostand sei mit deinem vergleichbar. Sobald sie herausfinden, dass ich nicht in deiner Liga spiele, suchen sie schnell das Weite.«
»Ich bin nicht so reich, wie du denkst«, stellte William klar.
»Ach nein?« James sah sich demonstrativ in der großen Eingangshalle des Landguts um. Sie war doppelt so groß wie das Wohnzimmer seines kürzlich erworbenen halb verfallenen Bauernhauses. Ach, schlimmer noch: Sogar die Toilette hinter der Spülküche war hier größer als sein Wohnzimmer.
»Ich meine ja nur: Mein Bankkonto ist wahrscheinlich leerer als deins«, sagte William.
James warf ihm einen ungläubigen Blick zu. »Wenn du dich da mal nicht täuschst. Jetzt, da ich den Dachdecker bezahlt habe, kann ich noch etwa drei Pfund fünfzig vorweisen.«
Dieser Kleinbauernhof kostete ihn ein Vermögen, doch er fand immer noch, dass er seine bisher beste (und teuerste) Anschaffung überhaupt war.
»Schön, dass du wieder im Lande bist, James.« William verpasste ihm noch einen Schlag auf den Arm.
James verstand die Geste als Zeichen der Zuneigung. »Schön, wieder hier zu sein.«
»Hast du in deiner Abwesenheit auch etwas Nützliches gelernt, oder hast du bloß zwei Jahre lang Urlaub gemacht?«
»Na hör mal! Damit du’s weißt: Ich war verdammt beschäftigt.«
»Mit Herumstreunen in den USA, oder?«, triezte William, wurde dann aber ernster: »Und, was sagst du? Wie lief es?«
James hatte mit mehreren großen amerikanischen Nationalparks an der Wiederansiedlung von Wölfen gearbeitet. William führte gerade ein ähnliches Projekt in Großbritannien durch, allerdings mit Bibern statt mit Wölfen.
»Die Rückkehr so eines Spitzenprädators bewirkt jetzt schon Wunder bei der Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts«, erzählte James. »Der Einfluss auf das gesamte Ökosystem ist bemerkenswert. Wirklich schade, dass wir das nicht auch in Großbritannien machen können. Apropos, wie läuft’s mit der Wiederansiedlung von Bibern? Macht dein Projekt Fortschritte?« James hatte gehört, dass Williams Vater, Lord Tonbridge, vor einiger Zeit einen Teil seiner Ländereien den Bibern umgewidmet hatte.
»Gegen das Hochwasserproblem zeigt es schon Wirkung«, sagte William. »Die Fließgeschwindigkeit vom Bach in den Fluss nimmt bereits ab. Noch ein paar Biberdämme an den Zuflüssen, und der Fluss könnte tatsächlich zum letzten Mal übergelaufen sein.«
»Stimmt, ich habe davon gehört. Die Cottages an der Brücke wurden überschwemmt, oder?«
William nickte. »Am höchsten Punkt stand das Wasser bei neunzig Zentimetern.«
»Da bist du ja!«, rief jemand, und James drehte sich um. Es war eine bildhübsche junge Frau in einem Rollstuhl, die gerade in die Eingangshalle kam.
»Tia«, rief er. »Schön wie eh und je.«
»Ja, du bekommst deinen Zitronenkuchen«, erwiderte sie mit einem breiten Lächeln. »Dafür bist du doch hergekommen? Für Tee und Kuchen, stimmt’s?«
»Na ja, also wenn du so fragst …«, antwortete er. »William hat mir schon erzählt, dass eure Hochzeitsplanung gut vorangeht.«
Tia verzog das Gesicht und blickte kurz über ihre Schulter. »Wenn du einen Schlagabtausch im Fünfminutentakt mit deiner zukünftigen Schwiegermutter als ›gut‹ bezeichnen würdest, dann ja. Irgendwie können wir uns auf gar nichts einigen.«
»Wenn ich dir irgendwie helfen kann …«, bot James ihr an.
»Sorg dafür, dass William pünktlich auftaucht. Damit wäre mir schon geholfen«, scherzte sie. »Ah, und vergiss ja nicht den Ring.«
»Ganz sicher nicht«, versprach er ihr.
»Dürfte ich mir heute Nachmittag meinen Verlobten ausleihen?«, fragte sie. »Ich brauche ihn unbedingt beim Probeessen für die Hochzeitstorte.«
James horchte auf. »Das klingt toll. Darf ich mitkommen?«
»Nein. Iss du mal brav deinen Zitronenkuchen«, entgegnete William. »Du bist an der Reihe, wenn ich ausgestattet werde. Du wirst mir mit dem Anzug helfen müssen.«
»Das kommt ja wohl kaum an so eine Tortenprobe heran«, beschwerte sich James. Andererseits – wenn er noch öfter zum Nachmittagssnack aufs Landgut käme, würde er sich bald selbst auf Diät setzen müssen.
»James! Wie ich mich freue, dich zu sehen!«, trillerte Lady Tonbridge. Mit ausgestreckten Armen schwebte sie förmlich über den marmorgefliesten Flur auf ihn zu.
»Hallo, Julia«, sagte James, umfasste ihre Hände und gab ihr einen Kuss auf die Wange.
»Bist du jetzt endgültig zurück?«, fragte sie, und er nickte.
»Ja, er hat das alte Hopkins-Haus gekauft«, erzählte William ihr.
Julia erschauderte kurz. »Ich dachte, das sei unbewohnbar?«
»Fast. Seit ich ein neues Dach draufgesetzt habe, ist es nicht mehr so schlimm; wenigstens ist es nun dicht«, berichtete James.
»Und wie geht es deiner lieben Mutter?«, fragte Julia.
»Gut, danke. Sie freut sich, dass ich wieder zu Hause bin.« Eigentlich war er ja gerade in Tanglewood zu Hause und seine Eltern in Kent. Aber zumindest war er jetzt im selben Land wie sie und musste nicht mehr über den Atlantik fliegen, um sie zu besuchen.
»Davon gehe ich aus. Richte ihr doch liebe Grüße von mir aus, ja?« Julia wandte sich ihrem Sohn und seiner Zukünftigen zu. »So. William, Tia, die Frau mit den Tortenproben kommt bald. Seid bitte pünktlich. Ich habe eine Idee für die Füllung.«
Mit diesen Worten schwebte die anmutige Julia Ferris zurück durch die Eingangshalle und verschwand im Salon. Tia schüttelte den Kopf.
»Siehst du? Genau das meinte ich«, zischte sie. »Sie benimmt sich, als wäre es ihre Hochzeit und nicht unsere. Na gut, dann mache ich mich jetzt wohl besser fertig.« Sie hielt ihre schmuddeligen Finger hoch. »Ich habe vorhin Tomatenpflanzen im Gewächshaus pikiert. Mit schmutzigen Fingern ist nicht gut Kuchen essen.«
Ehrlicherweise sah James da gar kein Problem. Etwas Dreck schadete nicht. Im Gegenteil, der war sogar gut für das Immunsystem. Das war das eigentliche Problem: Die Gesellschaft war insgesamt einfach zu sauber und steril, so dass die Menschen nicht mehr genug mit Keimen in Kontakt kamen und –
»Willst du den ganzen Tag da stehen bleiben, oder kommst du mit auf eine Tasse Kaffee und ein Stück des versprochenen Zitronenkuchens?«, wollte William wissen. »Ich werde selbst aber besser verzichten – ich glaube, ich bekomme heute Nachmittag noch mehr als genug Kuchen …«
»Um ehrlich zu sein, muss ich jetzt los«, gestand James. »Ich muss in einer Stunde zur Gemeinderatssitzung. Wäre es okay für dich, wenn ich mir einfach ein Stückchen aus der Küche hole?«
»Na klar«, sagte William und gab ihm noch einen sanften Schlag auf den Arm. »Ich ruf dich an, ja? Dann treffen wir uns auf ein Bierchen.«
James überließ seinen Freund den umfangreichen und komplexen Hochzeitsvorbereitungen (Eine Tortenprobe – wer hätte das gedacht?) und freute sich sehr, dass er selbst damit gerade nichts am Hut hatte. Allein der Gedanke an all den Pomp und das Tamtam, ganz zu schweigen von den Kosten, machte ihm Angst.
Wenn er jemals heiraten sollte, und das war angesichts seines nicht vorhandenen Liebeslebens erst einmal ziemlich unwahrscheinlich, dann würde er sich eine einfache, ruhige Hochzeit wünschen. Natürlich war ihm klar, dass seine (noch unbekannte) Zukünftige das durchaus etwas anders sehen mochte. Doch bei der Vorstellung, dass alle Augen auf ihn gerichtet wären, während er vor versammelter Mannschaft in der Kirche stünde, wurde ihm flau im Magen.
Trauzeuge auf Williams und Tias Hochzeit zu sein, war schon schlimm genug. Wenn er nur daran dachte, was alles schiefgehen konnte, bekam er Herzklopfen: Er könnte zum Beispiel den Ring verlieren oder William beim Junggesellenabschied irgendeine Schnapsidee durchgehen lassen – so dass er mit einem peinlichen Tattoo und ohne Ring an den Traualtar treten müsste … Und an die Trauzeugenrede hatte er bisher noch nicht einmal einen Gedanken verschwendet.
Na gut, das stimmte nicht. In Wirklichkeit hatte er pausenlos über nichts anderes mehr nachgedacht, seit William ihn gefragt hatte. Und das trieb ihm den kalten Schweiß auf die Stirn. Eigentlich war es absurd. Immerhin fühlte er sich auch absolut wohl damit, in einem Raum voller Menschen zu stehen und eine Präsentation über die Vorteile seines Projekts Wilder Grünstreifen zu halten – denn genau das hatte er heute noch in der Gemeinderatssitzung vor: Er wollte die Ratsmitglieder davon überzeugen, auf allen geeigneten Grünstreifen Wildblumen aussäen zu lassen. Dennoch bekam er beim Gedanken daran, eine Rede auf der Hochzeit seines besten Freundes zu halten, Muffensausen.
James nahm sein Stück Kuchen mit ins Auto, um es unterwegs zu essen und sich gleichzeitig auf die bevorstehende Sitzung zu konzentrieren.
Wilde Grünstreifen anzulegen, war nicht so öffentlichkeitswirksam wie die Wiederansiedlung von Wölfen in Gegenden, in denen diese seit Jahrzehnten nicht mehr gesichtet worden waren, aber in den Augen mancher Menschen war das Projekt genauso brisant.
Seit er zurück war, setzte er sich dafür ein, an den kilometerlangen Straßenrändern und Kreisverkehren Wildblumen auszusäen. Diese sollten dann wild wachsen dürfen und nur jeweils Ende Oktober gestutzt werden, wenn die meisten Bienen, Schmetterlinge und anderen Insekten sich zum Winter zurückzogen.
Das wäre nicht nur für die rasch schwindenden Insektenpopulationen von Vorteil, sondern auch eine Zeit- und Geldersparnis für die Gemeinde. Zugegebenermaßen würden zunächst Kosten für den Kauf einiger Tonnen Saatgut entstehen, doch die würden später wieder dadurch ausgeglichen, dass man nicht mehr alle paar Wochen Arbeiter zum Mähen losschicken müsste und die damit verbundenen Kosten für Kraftstoff, Geräte und so weiter entfielen.
Er rechnete durchaus mit Widerstand, vor allem von der »Bloß nichts am Status quo ändern«-Fraktion, die grundsätzlich erst einmal jede Form von Veränderung ablehnte, aber wahrscheinlich auch aus der Gesundheits- und Sicherheitsecke, die eine unkontrollierte Grünstreifenbepflanzung als die Gefahr sondergleichen einstufen würde.
Gnade ihm Gott, wenn er erst seine nächste Idee umzusetzen versuchte, dachte James. Er hatte nämlich vor, die Wartehäuschen von Bushaltestellen zu begrünen. In anderen Ländern gab es so etwas schon, also war sein Vorschlag gar nicht so weit hergeholt. Er hatte die zur Verfügung stehende Fläche berechnet und die Auswirkungen auf die Tierwelt in der gesamten Grafschaft prognostiziert. Die Ergebnisse konnten sich sehenlassen – und das, obwohl dies eine ländliche Gegend mit nicht gerade der größten Bushaltestellendichte war.
Zugegeben, es ging hier nicht um Wölfe; allerdings war seiner Meinung nach selbst der kleinste Beitrag zur Schaffung von natürlichen Lebensräumen sehr viel wert. Nicht selten zeigten die kleinen Dinge am Ende die größte Wirkung.
Und James Preece hatte es sich zur Aufgabe gemacht, dort, wo er lebte, nicht nur für sich, sondern auch für Flora und Fauna die günstigsten Lebensbedingungen zu schaffen.
Kapitel 3
Edie war wie immer die Erste im Brautladen. Er war zwar offiziell ab zehn Uhr morgens geöffnet, doch Mrs Carrington stand fast nie vor elf Uhr auf der Matte, es sei denn, sie hatte einen frühen Termin mit einer Braut. Dass Kundinnen spontan zum Stöbern vorbeischauten, kam nur selten vor – und dann zu Mrs Carringtons großem Missfallen (denn sie wollte nach einem strikten Terminsystem arbeiten). Daher würde Edie aller Erwartung nach die nächste Stunde für sich allein haben.
Sie hängte das Kleid auf, das sie von zu Hause mitgebracht und an dem sie gestern gearbeitet hatte, als Danny sie gefragt hatte, ob er ein Haustier haben dürfe. Nun wollte sie sich eine schöne Tasse Tee machen, bevor sie sich ans Auspacken der Schleier begab, die gestern geliefert worden waren. Sie waren hauptsächlich aus spanischer und portugiesischer Spitze und kosteten mehr, als Edie in einer Woche verdiente – selbst wenn sie die gelegentlichen Änderungsarbeiten mitzählte, die sie zu Hause erledigte und pro Kleid bezahlt wurden.
Wie gewöhnlich hatte sie auch heute nicht gefrühstückt. Daher aß sie ein paar Kekse zu ihrem Tee und sah sich etwas im Laden um.
Das musste man Mrs Carrington schon lassen: Sie war vielleicht eine knauserige alte Tante, aber sie wusste, wie ein Brautladen auszusehen hatte. Ein Gefühl von zeitloser Eleganz und dezentem Luxus hing in der Luft wie das teure Parfum, das auf Geheiß ihrer Chefin mehrmals am Tag im Raum versprüht wurde. Kein Wunder, dass der Laden kein Geld abwarf, wenn Mrs Carrington (Edie würde sie niemals Moira nennen, und Mrs Carrington hatte es ihr auch nie angeboten) mit jedem Pumpstoß dafür sorgte, dass sich ihre Einnahmen buchstäblich in Luft auflösten.
Chanel N°5, so schön es duftete, war nicht gerade der günstigste Lufterfrischer. Wenn man Edie fragte, hätte sie Vasen mit frischen Schnittblumen überall aufgestellt (und nicht nur diesen einen Strauß auf dem Couchtisch), so dass sich das natürliche Aroma von Rosen und Päonien in der Luft ausbreitete. Das war viel besser als jeder künstliche Duft.
Aber Edie fragte ja niemand. Dabei, wie Moira’s geführt wurde, hatte Edie überhaupt kein Mitspracherecht, obwohl sie schon seit fast sieben Jahren und als einzige Angestellte in diesem Geschäft arbeitete. Jeder Versuch, Mrs Carrington irgendeine Art von Vorschlag zu unterbreiten, hatte sich schon vor langer Zeit als Fehler herausgestellt, weshalb Edie seither nur noch ihre Befehle ausführte.
Die nächste Stunde verbrachte sie damit, die Schleier auszupacken. Als Mrs C. (sie wirklich so anzusprechen, würde Edie im Traum nicht einfallen) dann zum ersten der einzigen beiden Termine an diesem Tag den Laden betrat, verbrachte sie eine geschlagene Stunde mit einer Kundin, die ein handgefertigtes, maßgeschneidertes Kleid zu einem Preis haben wollte, wie man ihn im nächsten Kaufhaus fände. Die Braut, ihre Mutter und ihre Schwester verließen den Laden wieder, ohne eine Anzahlung zu hinterlassen oder auch nur zu sagen, ob sie wiederkommen würden.
Noch so ein Problem mit Moira’s, dachte Edie bei sich, während sie die Kleider sorgfältig zurück an ihre jeweiligen Bestimmungsorte hängte: Der Laden war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Er konnte nicht mit den Preisen der Kaufhausketten mithalten, war aber auch nicht exklusiv genug, um viele Damen aus einer kaufkräftigeren Zielgruppe anzusprechen – solche, die kein Nullachtfünfzehn-Kleid von der Stange wollten. Und gerade darin war Edie besonders gut – im Entwerfen von Kleidern –, obwohl sie ohne Abschluss von der Modeschule abgegangen war. Doch eines Tages wollte sie die Ausbildung beenden, das hatte sie sich selbst versprochen.
Dieses Versprechen lag jetzt allerdings schon acht Jahre zurück, und mit der Arbeitsbelastung und ihrer Verantwortung für Danny sah es nicht so aus, als würde sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern. Zudem konnte sie es sich nicht leisten, auf ein regelmäßiges Monatsgehalt zu verzichten. Sie fand es ohnehin schon schwer genug, über die Runden zu kommen.
Gelegentlich gönnte sie sich so ein ausgiebiges Bad in Selbstmitleid. Als sie von ihrer Schwangerschaft erfahren hatte, war sie gerade erst achtzehn geworden. Das war, gelinde gesagt, ein Schock für sie gewesen; erst recht, als klargeworden war, dass der Kindsvater so gar nichts davon wissen wollte. Und da hatte Edie eine Entscheidung getroffen: Wenn er nicht am Leben seines Sohnes teilhaben wollte, dann wollte sie auch nichts von ihm. Sie würde das prima allein schaffen.
Prima war daran zwar nichts gewesen, aber sie hatte es geschafft, und jetzt war sie sehr glücklich mit ihrem Danny, sogar ohne Vater – ha, danke für nichts! Doch manchmal fragte sie sich schon, ob Danny ein männliches Vorbild im Leben fehlte. Ihre Mutter war selbst alleinerziehend gewesen, also gab es mütterlicherseits ebenfalls keinen Großvater, der diese Lücke füllte.
Vielleicht war das auch der Grund für sein aufsässiges Verhalten in letzter Zeit – hatte er das Gefühl, er müsse der Mann im Hause sein, weil niemand sonst diese Rolle übernehmen konnte?
Das würde jedenfalls erklären, dass –
»Edie! Fragst du die Damen bitte, ob sie Tee oder Kaffee möchten?« Mrs C. riss Edie mit ihrem schrillen Tonfall aus ihrem Tagtraum. Schnell ging sie sich erkundigen, was die Kundinnen wollten.
Eine von ihnen erkannte sie: Stevie war die Besitzerin von Peggy’s Tea Shoppe an der Hauptstraße. Ihr etwas zu trinken anzubieten, fühlte sich ein wenig so an, wie Eulen nach Athen zu tragen. Dennoch nahm sie wie befohlen die Bestellungen entgegen, kam kurz darauf mit einer Kanne Tee und zwei feinen Tassen und Untertassen zurück und stellte sie auf dem flachen Tisch vor dem cremefarbenen Plüschsofa ab.
»Könntest du uns bitte noch eine Tasse bringen?«, fragte Stevie. »Wir erwarten noch eine Brautjungfer. Sie dürfte bald da sein.«
Edie kam ihrer Bitte nach und ging rasch zurück in den nicht öffentlichen Bereich des Ladens, während die Frauen eine angeregte Unterhaltung über Brautkrönchen führten. Die vordere Ladenfläche war winzig, aber das Gebäude war dreistöckig und recht weiträumig. Das Erdgeschoss beherbergte den Sitzbereich, in dem die Bräute ihren Freundinnen und Verwandten die Kleider vorführten, die sie anprobierten. Dahinter lagen die Umkleide und ein Raum, der Platz für ein paar Dutzend Kleider bot. Noch weiter dahinter befanden sich das Büro von Mrs C. und eine kleine Küche.
Im ersten Stock waren die meisten Kleider untergebracht sowie all die anderen Dinge, auf die eine Braut einfach nicht verzichten konnte – von Reifröcken bis hin zu Satinschuhen, die sich beliebig einfärben ließen.
Edies Reich befand sich jedoch in der obersten Etage. Das war der Ort, an dem sie ihre Magie spielen ließ, indem sie eine grobe Skizze auf einem Stück Papier in ein wunderschönes Kleid wie für Aschenputtel verwandelte. Das geschah natürlich nicht über Nacht, sondern erforderte eine Menge Arbeit. Im Laufe dieses Schaffensprozesses nahm Edie so viel Arbeit wie möglich mit nach Hause, die sie immer erledigte, nachdem Danny ins Bett gegangen war. Aber das meiste fand hier oben in ihrem kleinen kreativen Ideenreich statt. Der Klang hatte ihr so gut gefallen, dass sie versucht war, ein Schild mit der Aufschrift Hier entstehen: Edies Ideen an die Tür zu hängen. Doch da sie wusste, dass die spaßbefreite Mrs C. es schnell wieder abnehmen würde, ließ sie es lieber gleich sein.
Sie hörte Mrs Carrington aus dem Vorführbereich (wie ihre Chefin ihn etwas übertrieben nannte) rufen: »Edie, hol mir mal das Buckingham-Kleid in Elfenbein und Nude.«
Das Buckingham-Kleid war eine Kreation von Edie (Mrs C. bestand darauf, jedes Modell nach einem Adelshaus zu benennen), und zu Anprobezwecken hatte sie es in verschiedenen Größen sowie drei Farbkombinationen geschneidert. Wenn sich eine Braut für das Kleid entschied, fertigte Edie ein neues nach Maß für sie an, so dass jedes Kleid perfekt auf die Braut, die es trug, zugeschnitten war.
Sie hatte Stevies Größe bereits grob abgeschätzt und lief nun schnell ins Obergeschoss, um das Kleid zu holen, von dem sie glaubte, dass es passen könnte. Sie lächelte, als sie Mrs C. sagen hörte: »Entschuldigen Sie, aber ich dulde hier keine Fotos. Das sind alles Einzelstücke. Ich will keine Imitate riskieren. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das Handy wegstecken würden.«
Da gab Edie ihrer Chefin ausnahmsweise recht. Sie steckte ihr Herzblut in ihre Kleider und wäre am Boden zerstört, wenn jemand ihre Kreationen einfach imitieren würde.
»Hierher, Kindchen«, befahl Mrs Carrington. Edie trat vor und hielt das Kleid so hoch wie möglich, um das Fallen und Fließen des Stoffes zu demonstrieren. Sie wünschte, Mrs C. würde endlich damit aufhören, sie »Kindchen« zu nennen – dann fühlte sie sich immer wie ein Dienstmädchen und nicht wie eine Angestellte.
»Das ist ein Trompetenkleid mit schulterfreiem Dekolleté, oben eng anliegend, unten ausgestellt«, sagte Mrs Carrington zur Braut. »Sehen Sie, wie die beigefarbene Seide unter der Spitze das Champagnergelb des Brautjungfernkleids aufgreift, das ich Ihnen gerade gezeigt habe? Mit Ihrer Figur können Sie das tragen.«
Das sah Edie ganz genauso. Für eine Frau mit spindeldürrer, kerzengerader Figur wäre dieses Kleid nichts gewesen. Sie hatte es für Frauen mit Kurven geschaffen, als Hommage an die Weiblichkeit. Und Mrs C. hatte recht: Elfenbein und Nude passten perfekt zu Stevies Haarfarbe und Hautton.
Manchmal fragte sich Edie ernsthaft, wie Mrs Carrington das bloß anstellte. Sie verlangte von den Bräuten nicht nur ein Beratungsgespräch vor dem eigentlichen Termin, sondern gestattete ihnen auch keinerlei Einsicht in ihre Kleiderbestände. Niemals. In Moira’s Wedding Shop wurde nicht gestöbert und nichts angefasst. Kein schweifender Blick über die Kleider, kein neugieriges Ertasten der Stoffe. Dass ein Kleid auf der Stange halb herausgezogen wurde, um es aus der Nähe zu betrachten, mochte in anderen Brautmodengeschäften vorkommen, aber niemals hier.
Bei Mrs Carrington hingegen lief das anders ab: Sie berücksichtigte alles, was die Kundin ihr gesagt hatte, und ließ Edie dann ein Kleid holen. Ein Kleid, mehr nicht. In neun von zehn Fällen verlangte die Braut nach keinem zweiten. Selbst wenn sie vor der Anprobe skeptisch war – sobald sie sah, wie wunderschön sie darin aussah, kam sie gar nicht mehr auf die Idee, ein weiteres Hochzeitskleid sehen zu wollen.
Auch mit den Brautjungfernkleidern für diese Hochzeit behielt Mrs C. recht. Das Champagnergelb stand beiden Frauen perfekt.
Moment mal, war das nicht …?
Die Nachzüglerin war Leanne Green, die in der Schule eine Stufe über ihr gewesen war. Sie hatte sie seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, obwohl Leanne ihren Blumenladen um die Ecke hatte. Gab es da nicht so ein Gerücht, dass Leanne an einem Fernsehwettbewerb für Floristen teilnahm?
»Es ist wunderschön.« Beim Anblick des Kleides bekam Stevie feuchte Augen, und Leanne reichte ihrer Freundin ein Taschentuch aus der Schachtel, die strategisch auf dem Couchtisch platziert lag.
»Probier’s an«, forderte die andere Brautjungfer. »Ich wette, es sieht phantastisch aus.«
Darauf würde Edie auch wetten. Die Anproben hatten immer etwas Märchenhaftes – als besäße so ein Kleid die Macht, selbst die gewöhnlichste Frau in eine Prinzessin zu verwandeln.
Mrs C. schickte Edie mit einem Fingerzeig wieder weg und befahl ihr: »Edie, bring Miss Taylor in die Umkleide. Ich komme gleich nach.«
»Edie? Edie Adams? Bist du’s?« Leanne hatte sie erkannt. »Kennen wir uns nicht aus der Schule?«
»Du warst eine Stufe über mir«, erwiderte Edie. Sie warf ihrer Chefin einen wachsamen Blick zu. Mrs C. hasste es, wenn sie mit ihren Kundinnen Small Talk machte.
»Dachte ich’s mir doch. Wie geht es dir?« Leanne schenkte ihr ein breites Lächeln, und Edie lächelte zurück. Sie hatte Leanne nie richtig kennengelernt, sie machte allerdings einen ganz netten Eindruck.
»Sehr gut, danke«, antwortete sie. »Entschuldige, ich muss Miss Taylor in das Kleid helfen.«
»Nenn mich ruhig Stevie«, sagte Stevie. »Alle duzen mich.«
»Nicht alle, Miss Taylor«, sagte Mrs Carrington. »Und wenn es Ihnen nichts ausmacht … In einer Stunde erwarte ich die nächste Braut.«
»Entschuldigung«, flüsterte Leanne Edie zu. Edie drehte sich weg und verkniff sich ein Lächeln.
Mrs C. erwartete in einer Stunde keine weitere Braut; der nächste Termin war sogar erst morgen. Doch alle Zeit der Welt zu haben, machte in diesem Fall wohl keinen so guten Eindruck, vermutete Edie. Es war traurig, aber wahr: Je stärker etwas gefragt zu sein schien, desto mehr wollten die Leute es haben. Zumindest nahm Edie an, dass das dahintersteckte, wenn Mrs Carrington einen Eindruck von Exklusivität im Laden zu vermitteln versuchte.
Um Stevie einzukleiden, brauchte es sowohl Edie als auch Mrs Carrington (denn das war eine sehr heikle Angelegenheit), und als sie in dem Kleid steckte, war Edie weitere fünfzehn Minuten damit beschäftigt, es anzupassen. Das sogenannte Probemodell ließ sich an verschiedenen Stellen abklemmen und abstecken, um zu zeigen, wie das maßgefertigte Kleid aussehen würde. Dieses Modell sah an der Braut zwar nicht perfekt aus (konnte es auch nicht, da es nicht speziell für sie gemacht war), es vermittelte Stevie und den beiden Freundinnen jedoch einen ausreichenden Eindruck davon, wie schön sie am Tag der Hochzeit darin aussehen würde.
In der großen Umkleidekabine hatte Mrs C. absichtlich keine Spiegel angebracht. Der Gedanke dahinter war, dass die Bräute kein Zwischending, sondern nur das Endprodukt zu Gesicht bekommen sollten. Unter dieser Prämisse führte Edie ihre Kundin in den Vorführbereich und half ihr auf das runde Podest.
Wenn sie eine Braut dort oben sah, zauberte ihr das immer ein Lächeln aufs Gesicht – es erinnerte sie an die Spieluhr, die sie als Kind gehabt hatte. Wenn man den Deckel anhob, richtete sich eine Ballerina auf und drehte sich auf der Stelle. Auch das Podest im Vorführbereich drehte sich, so dass die Begleiterinnen der Braut das Kleid aus allen Blickwinkeln betrachten konnten. Unwillkürlich erwartete Edie dann, das Klimpern der Melodie von Schwanensee zu hören.
»Oh. Mein. Gott.« Leanne schlug sich eine Hand vor den Mund und machte große Augen. Die andere Brautjungfer, die Edie nicht kannte (was für ein kleines Dorf wie Tanglewood ungewöhnlich war), sah genauso verblüfft aus.
»Ist das jetzt ein gutes OMG oder ein schlechtes?«, fragte Stevie mit besorgter Miene.
Mrs Carrington trat vor einen weißen Samtvorhang und griff nach einer Schnur. »Sind Sie bereit?«
Stevie nickte.
Mrs C. öffnete den Vorhang.
Als Stevie sich im Spiegel sah, kamen ihr die Tränen.
Und Edie auch.
Hach, deshalb liebte sie ihre Arbeit!
Kapitel 4
Edie hatte sich schon lange nicht mehr so auf etwas gefreut. Sie war auf das Landgut eingeladen worden und konnte es kaum erwarten.
Um genau zu sein, war nicht sie eingeladen worden, sondern Mrs Carrington. Aber Mrs C. hatte sie wissen lassen, dass Edie bei dem Beratungsgespräch dabei sein sollte. An sich war das nicht ungewöhnlich, wenngleich die meisten Beratungen, denen sie bisher beigewohnt hatte, im Laden stattgefunden hatten. Doch was Julia Ferris wollte, das bekam sie auch.
Jeder im Dorf kannte Lord und Lady Tonbridge. Natürlich nicht persönlich, aber da auf dem Landgut jeden Sommer ein Ball ausgerichtet wurde, zu dem alle Dorfbewohner eingeladen waren, gab es nur sehr wenige, die von sich behaupten konnten, noch keinem von beiden begegnet zu sein. Julia Ferris alias Lady Tonbridge achtete darauf, wann immer möglich, vor Ort einzukaufen, weshalb sie oft auf der Hauptstraße gesichtet wurde. Bis vor Kurzem hatte sie noch keinen Anlass gehabt, den kleinen Brautladen am Platz aufzusuchen; doch nun, da ihr einziger Sohn bald heiraten würde, hatte sie ein persönliches Interesse an allem, was mit Hochzeit zu tun hatte. Ihre Tochter, Miranda, hatte sich ebenfalls im letzten Sommer verlobt, sich allerdings noch nicht zu einem Hochzeitstermin geäußert, und so galt Julia Ferris’ Aufmerksamkeit einzig und allein der Trauung ihres Sohnes. Gerüchten zufolge war sie ein ziemliches Brautmonster – und das, obwohl sie selbst nicht die Braut war.
Edie war trotz der Sommerbälle noch nie auf dem Landgut gewesen. Die Veranstaltungen waren nur für Erwachsene, und sie hatte sich noch nie wohl damit gefühlt, Danny bei ihrer Mutter zu lassen, nur um die halbe Nacht lang durchzufeiern. Nicht beim Gesundheitszustand ihrer Mutter. Pauline ging es wirklich nicht gut, und sie tat bereits dadurch ihren Teil, dass sie sich während der Schulferien um Danny kümmerte. Edie konnte nicht von ihr erwarten, dass sie auch noch abends als Babysitterin einsprang.
Beim ersten richtigen Anblick des Gutshauses und seiner weitläufigen Anlage stockte Edie der Atem. Das Anwesen lag an einem der Hänge über dem Dorf, und auf dem Weg die imposante Einfahrt hinauf bot sich eine atemberaubende Aussicht über das Tal. Dem Panorama widmete Edie jedoch nur einen flüchtigen Blick, denn am meisten zog das Gebäude selbst sie in seinen Bann. Aus der Nähe sah es sogar noch größer aus als von der Straße, und sie verstand sofort, warum die Familie Ferris es für eine schöne Hochzeitslocation hielt. Mit der Heiratsfeier von William Ferris und Tia Saunders sollte wohl gleichzeitig der Veranstaltungsort beworben werden, und Julia wollte, dass alles perfekt war.
Edie konnte sich bildlich vorstellen, wie eine Braut auf den breiten, flachen Stufen stand, die zu den beeindruckenden Eingangstüren führten, und sich umrahmt von zwei Marmorsäulen links und rechts fotografieren ließ. Jetzt wollte sie unbedingt den Rest des Hauses sehen. Danach zu urteilen, was sie bisher gesehen hatte, war es der perfekte Ort für eine Hochzeit, fand sie.
Man führte sie in einen Flur mit einer imposanten Treppe (hier war wirklich vieles imposant, dachte sie). Darüber baumelte ein gewaltiger Kronleuchter, der wunderbar glitzerte und funkelte von all dem Sonnenlicht, das durch das Glasfenster hoch oben in der Kuppeldecke hereinströmte. Dunkle und düstere Gemälde von allerlei biederen und streng dreinschauenden Vorfahren (so Edies Vermutung) zierten die Wände, von deren Augen sie sich bei jedem Schritt beobachtet fühlte. Im Salon stand bereits ein Tablett mit Tee und Kaffee bereit.
Lady Tonbridge, die gemeinsam mit der Braut dort wartete, stand auf, um sie zu begrüßen. »Soll ich jemanden anweisen, Ihre Probemodelle hereinzubringen?«, fragte sie.
Mrs Carrington lächelte höflich. »Heute gibt es noch keine Kleider. Das ist nur das Beratungsgespräch. Ich komme mit den Modellen zurück, die ich für geeignet halte, nachdem ich mir ein Bild von Miss Saunders’ Anforderungen verschafft habe.«
Lady Tonbridge blinzelte. »Aha, verstehe. Ich nahm an, Tia könne heute ein paar Kleider anprobieren.«
»So weit sind wir noch nicht«, sagte Mrs C. »Zunächst müssen wir herausfinden, welcher Stil ihr am besten steht und gefällt.«
Edie hörte den beiden mit einem Ohr zu, ihre Aufmerksamkeit wurde jedoch auf Tia Saunders gelenkt, die mit ausdrucksloser Miene danebensaß. Nur ihr Blick und ihre roten Wangen verrieten Edie, dass die Braut vermutlich nicht allzu froh darüber war, dass man gerade über sie sprach, als wäre sie gar nicht anwesend.
Mittlerweile hatten sie sich hingesetzt und balancierten ihre Tassen auf den Knien (Edie hatte große Mühe, still zu halten und das Klappern der Untertasse auf ein Minimum zu reduzieren). Mrs C. kam sofort zur Sache.
»Können Sie nur schwer oder überhaupt nicht laufen, Miss Saunders?«, lautete ihre erste Frage.
Mit der Tasse vor dem geöffneten Mund erstarrte Edie. Lady Tonbridge schnappte kurz nach Luft.
Miss Saunders schien sich an der Frage überhaupt nicht zu stören. »Nein«, antwortete sie in einem ganz ruhigen Ton.
»Wenn das so ist, konzentrieren wir uns voll und ganz auf das Oberteil«, sagte Mrs C. »Der Rock des Kleides wird zweitrangig sein. Was wir gar nicht wollen, ist meterlanger Stoff, der sich in den Rädern verfängt. Die Rückenpartie lassen wir auch außen vor«, fügte sie hinzu. »Edie, machst du dir Notizen?«
Edie nickte und stellte ihre Tasse und Untertasse wieder auf dem Tisch ab. Dann kramte sie in ihrer Tasche nach einem Notizblock. So unvorbereitet zu sein, sah ihr eigentlich nicht ähnlich. Das prachtvolle alte Gebäude und die Anwesenheit von Lady Tonbridge hatten sie etwas aus dem Konzept gebracht.
»Ich denke da an Charmeuse. Was meinst du, Edie?«, schoss Mrs C. ihr entgegen, sobald Edie den Stift gezückt hatte.
»Zu schlicht. Der Stoff lässt sich nicht allzu aufwendig verzieren«, widersprach sie ihrer Chefin, ohne nachzudenken.
Mrs Carrington sah sie mit zusammengekniffenen Augen an. »Genau darum geht es ja. Dezent, elegant, unaufdringlich. Davon sprachen Sie doch, nicht wahr?« Sie sah zu Lady Tonbridge hinüber.
»Was ist Charmeuse?«, fragte Miss Saunders.
»Das ist ein leichter Stoff mit einem satinähnlichen Glanz, nur weicher und nicht so steif«, erklärte Edie und wurde sogleich von Mrs C. mit einem bösen Blick abgestraft, aus dem Edie recht deutlich herauslas, sie solle den Mund halten.
Sie senkte den Kopf und konzentrierte sich stattdessen auf das leere Blatt Papier.
»Das wäre perfekt für Sie«, betonte Mrs C. »Und ich würde Elfenbein statt Weiß vorschlagen.«
»Nein, ich denke, wir bleiben beim Weiß«, sagte Lady Tonbridge.
Bildete sie sich das nur ein, oder hatten Miss Saunders’ Augen gerade kurz aufgeblitzt? Hatte die Braut bei ihrem Kleid denn gar kein Mitspracherecht?
Mrs C. senkte ergeben den Kopf. »Aber natürlich, wie Sie wünschen. Und hätten Sie gern eine oder beide Schultern frei, mit oder ohne Ärmel …?«
»Wir dachten an ein gekreuztes Dekolleté mit breiten Trägern. Nicht wahr, Liebes?«, meinte Lady Tonbridge. »Oder vielleicht etwas, das von hier bis hier« – sie machte eine erklärende Geste mit den Händen – »drapiert ist. Schulterfrei ist meiner Meinung nach etwas vulgär.«
Miss Saunders schwieg, machte jedoch auf Edie den Eindruck, als läge ihr gerade so einiges auf der Zunge.