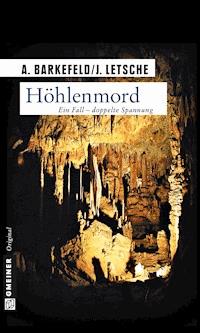
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Ein Fall, zwei Geschichten. Vor der Eröffnung einer einmaligen prähistorischen Ausstellung im Osterei-Museum in Sonnenbühl-Erpfingen wird zwischen den Exponaten aus der Bärenhöhle ein menschlicher Knochen entdeckt: Kommissar Andreas Clemenz macht Urlaub. Weil er sich ausgerechnet auf dem Bauernhof seiner Verwandtschaft einquartiert, landet er ungewollt mitten im Geschehen. Hauptkommissarin Magdalena Mertens setzt auf ungewöhnliche Ermittlungsmethoden als feststeht, dass es sich um Mord handelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AnnA Barkefeld / Julian Letsche
Höhlenmord
Ein Fall – doppelte Spannung
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten mit Lebenden und Verstorbenen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die beiden Geschichten spielen an realen Orten: in Sonnenbühl (www.sonnenbuehl.de), Tübingen, Reutlingen und Stuttgart.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © hraska – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4498-2
Danksagung
Mit gerne abgestattetem Dank an Familie und Freunde, die Adler Apotheke Tübingen und die geduldige Tübinger Polizei. Ermittlungstechnische, örtliche und sonstige Umstrukturierungen, die ich im Rahmen der Geschichte vorgenommen habe, liegen in meiner Verantwortung.
AnnA Barkefeld
Ich danke meiner Frau Antjek, die mich wie bei meinen Werken zuvor mit ihrem Sprachgefühl unterstützt und mir den Rücken freigehalten hat. Des Weiteren möchte ich Uwe Morgenstern danken, der die Idee zu diesem ungewöhnlichen Projekt gehabt hat, sowie Claudia Senghaas, die sofort einverstanden war, es zu realisieren.
Julian Letsche
AnnA Barkefeld
Kapitel 1
Erpfingen
»Was zum Teufel ist das?«
Leise und gewohnt stakkatoartig durchschnitt die scharfe Stimme die arbeitsame Stille in dem Museum. Der ruppige Satz ließ die wenigen Menschen aufschrecken. Der Sprecher wirbelte zu der verblüfften Museumsleiterin herum. Elisabeth Holtzmann starrte unversehens in empört aufblitzende bebrillte Augen. Sie gehörten Tim Weber, Filmemacher, Autor und seit zwei Jahren die männliche Hauptrolle in Elisabeths Privatleben. Der schmal wirkende, elegant gekleidete Mann hatte es organisiert, einen Einspieler zum Saisonauftakt des Hauses für den Stuttgarter Fernsehsender zu drehen. Neben ihm standen seine beiden Kollegen, Kameramann und Tonfrau, die hochschreckten, sich einen Blick zuwarfen und mit hektischen routinierten Bewegungen Kamera und Mikrofon ausschalteten. Sie arbeiteten lange genug mit Weber, um aufs Höchste alarmiert zu sein. Wenn der Chef wütend wurde und für diesen emotionalen Ausbruch mit Formel-1-Geschwindigkeit Schuldige suchte, erstarrte man klugerweise zu einer möglichst unsichtbaren und unhörbaren Salzsäule, bis die heiße Lava des Vulkans erkaltet war.
Elisabeth Holtzmann, der Tims hitzige Arbeitsweise bislang nicht in Fleisch und Blut übergegangen war, war sich der drohenden Gefahr nicht bewusst und drehte sich, gleichmütig mit der Schulter zuckend, zu der Glasvitrine um, deren Inhalt er so rüde beanstandete. Die Vitrine war Teil des Ostereimuseums in Sonnenbühl und Teil der erstmaligen, voraussichtlich einmaligen und ungewöhnlichen prähistorischen Sonderausstellung, die in wenigen Tagen für das Publikum öffnete. Elisabeth strich sich die dunklen Haare aus der Stirn und sah zufrieden und erfreut auf exakt arrangierte Objekte, die auf zwei einwandfrei geputzten und staubfreien Glasböden lagen. Die fehlerlosen Beschriftungen waren akkurat aufgestellt und ergänzende Fotos gut erkennbar. Die Beleuchtung war intakt und die restlichen Fingerabdrücke einer intensiven Endreinigung zum Opfer gefallen. Die Präsentation schien in ihren forschend-zufriedenen Augen tipptopp und gelungen.
Morgen würden die Künstler für den österlichen Kunstmarkt kommen und ihre Tische mit den wunderschön verzierten Ostereiern dekorieren. Die Dauerausstellung im ersten Stock war startklar.
Die beiden Tage vor der Ausstellungseröffnung waren für die Presse reserviert. Während sich am Tag zuvor die Dame von der Tageszeitung ›Reutlinger Generalanzeiger‹ sowie der ›Albbote‹ und andere regionale Berichterstatter informiert hatten, war heute das SWR-Fernsehen vor Ort.
Als zusätzliches, nicht selbstverständliches Bonbon für Elisabeth hatte der Wetterbericht kaltes, ruhiges Winterwetter ohne Neuschnee prognostiziert. Alle Zufahrtswege und die Albaufstiege waren picobello von Schnee und Eis geräumt. Besser ging es Ende März auf der Schwäbischen Alb mit über 700 Höhenmetern kaum, in einem Winter, der zu den kältesten und schneereichsten zählte. In den langen Monaten seit November hatten Schneemassen sich auf das Land und die Laune der Alb-Menschen gelegt.
Die Wintersportler hingegen genossen Skiabfahrten, Langlauf und sonnige Spaziergänge, und die Kinder formten die 1000ste Schneekugel mit demselben Glücksgefühl wie die allererste.
Bis zu diesem Moment war Elisabeths kleine und feine Museumswelt vollkommen in Ordnung. Kein Makel ließ sich erkennen. Sie lächelte erleichtert und verschränkte selbstbewusst die Arme vor ihrem Oberkörper.
»Soweit ich sehe, ist alles wunderbar«, sagte sie, sich zur Ruhe zwingend.
»Elli, willst du mich verarsch…«, explodierte Tim erneut. Elisabeth wurde heiß und rot im Gesicht und kalt und ablehnend im Ton. »Mäßige dich, wenn du mit mir redest, Weber. Ansonsten kennst du den Weg zur und durch die Tür.«
Wenn sie sauer auf ihren Liebsten war, benutzte sie seinen Nachnamen.
»Stopp. Nicht weitersprechen«, schrie Daniel gleichzeitig, »das kostet dich sonst 20 Cent in die Schimpfwörterkasse, Tim.« Der schlaksige 13-Jährige verbrachte seine freien Minuten im Museum und pflegte nach einem umfangreichen Fernsehdreh vor zwei Jahren im Ostereimuseum mit Tim Weber eine normale Männerfreundschaft. 24 Monate lang hatten sie sich weder gesehen noch telefoniert oder E-Mails ausgetauscht. Kaum sahen sie sich, knüpften sie nahtlos am letzten ›Tschüss‹ an, begrüßten sich kumpelhaft mit ›Alles klar?‹ und ›Jep, Mann, klar‹, und hatten damit die Geschehnisse der letzten Jahre vollständig und ausreichend besprochen.
Daniel schüttelte energisch seinen Kopf mit den blonden Haaren. Schmal und hoch aufgeschossen war er. Erster leichter Flaum bildete sich über seiner Oberlippe. Er hatte für die Absolvierung der Grundschule länger benötigt, nicht, weil es ihm an geistigen Kapazitäten mangelte, sondern aus persönlicher Überzeugung. Für die diversen Aktivitäten jenseits der Schule benötigte er seine komplette Aufmerksamkeit und Fitness, sodass er die Schulstunden dringend für Pausen und Ruhezeiten nutzte.
»Leute«, sprach er zu seinen aufgebrachten Eltern, »ihr wollt immer, dass ich sorgfältig lerne. Jetzt tue ich euch den Gefallen, indem ich die Klasse wiederhole, und es ist wieder nicht recht.« Sein Vater zwang sich, seine zuckende Hand schnell in die Hosentasche zu schieben.
Vor zwei Jahren drohte Daniel eine weitere Ehrenrunde für die 4. Klasse, da geschah in den Augen seiner gequälten Mutter ein sagenhaftes Wunder. Daniel legte einen lernintensiven Endspurt hin, der für die Versetzung knapp reichte. Der tiefere Grund lag nicht darin, seiner Mutter, deren Liebling er nach einer komplizierten Geburt und als Jüngster von drei Brüdern war, eine eher seltene Freude zu bereiten, sondern, weil Daniel sich verliebt hatte. Seine Angebetete, Kati Geiselhardt, ging in Genkingen auf die Hauptschule, und um ihr im Bus und auf dem Schulhof nahe zu sein, hatte Daniel Vollgas gegeben. Seine Mutter ließ er in dem Glauben, er habe sich für sie angestrengt. Das hatte rein pragmatische Gründe, weil sie ihm zusätzlich zum Taschengeld knisternde Scheine gab.
»Ach, mein lieber Goldjunge, du hast es geschafft. Ich weiß, dass du klug bist.«
Daniel hätte es grausam gefunden, seine arme Mama von dieser Illusion zu befreien, und wenn er daran dachte und nichts zu tun hatte, war er wahrhaftig ihr lieber Goldjunge und räumte die Geschirrspülmaschine aus oder reinigte den Hasenstall, in dem Pummel, der weiße Hase, ein trostloses und vernachlässigtes Gefangenendasein fristete. Seitdem Kati regelmäßig zu Besuch kam, ging es ihm besser. Daniels Liebe zu Kati erwies sich als konstant und treu, den Stürmen trotzend, die seine ADHS, die angeborene Hyperaktivität, im Alltag häufig und unplanbar heranrasen ließ.
Tim Weber lachte Daniel an, fuhr von 100 auf 50 runter und atmete aus. »Okay. Was sind das für Worte, für die man bezahlen muss?«
Daniel grinste verschmitzt, zuckte die Schultern und warf einen vorsichtigen Blick zu Elisabeth. »Erinnerst du dich nicht? Hatten wir schon vor zwei Jahren. Kann ich nämlich nicht aufzählen, sonst müsste ich blechen. Die Liste hängt in Frau Holtzmanns Büro.«
Tim nickte. »Schaue ich mir an. Was machst du mit dem Geld aus der Schimpfwörterkasse?«
»Im Sommer gehen wir ein dickes Eis essen mit vier Kugeln und bunten Smarties, Schokoladensoße, Sahne …«, begeisterte sich Daniel. Tim verzog angewidert sein ausdrucksstarkes Gesicht, fischte ein silbernes Geldstück aus seiner Hosentasche und reichte es dem Jungen.
»Stimmt so. Schließlich habe ich das Schimpfwort fast gesagt. Und das, die Sache noch verschärfend, zu einer Lady. Strafe muss sein.« Daniel nickte glücklich. »Gerne mehr Strafe. Sag ruhig weitere Schimpfworte.«
Weber gab ihm eine Kopfnuss und schickte sein erleichtertes Team in eine Zigarettenpause nach draußen, bat Daniel um eine alleinige Unterredung mit Elisabeth und schubste seine Freundin grob zu der alten Schulbank, an der Kinder malen durften. Elisabeth protestierte, und Tim küsste sie leicht auf die Wange. Beide drückten sich auf die stabilen Holzstühle. Tim strich Elisabeth leicht über ihren Unterarm und begann mit einer umständlichen, langatmigen Erklärung, in der er sich für mehrere Dinge gleichzeitig entschuldigte, die er für dringend erwähnenswert hielt.
Diesen ausführlichen Kommentar seiner Tat und der Taten der letzten Tage würzte er mit frei kombinierten Redewendungen, zigmaligem Räuspern und Hinundherschieben der schwarzen Brille entlang seines Nasenrückens.
Elisabeth fasste sich in Geduld. Sie machte sich nicht die Mühe, in diesem bunten Potpourri aus beruflichem und privatem Durcheinander einen roten Faden zu suchen und sich an ihm entlangzuhangeln. Zumeist fasste Tim die Essenz in einem Abschlusssatz zusammen. Bis es so weit war, ließ Elisabeth ihre Gedanken schweifen.
Kapitel 2
Erpfingen
Sie hatte Tim Weber kennengelernt, als er im Ostereimuseum eine Reportage und im Jahr davor einen Beitrag für eine Kindersendung drehte. Stets schwarz nach der neuesten Mode gekleidet sowie mit einigen farbigen Brillen ausgestattet, einem erstklassigen Haarschnitt von einem Stuttgarter Topp-Friseur, der seine roggenfarbenen glatten Strähnen in perfekter Form hielt, und einem dezenten Parfüm, das bei ihr Fantasien deutlich jenseits beruflicher Zusammenarbeit weckte, hatte er ihre Aufmerksamkeit von Anfang an unbewusst gebündelt, gleichzeitig ihre Distanziertheit geweckt, weil seine schmeichelnde, erregende Stimmmodulation nicht zu seinen oft verwendeten Kurzbefehlen zu passen schien. Dass er beständig und stets bereit war, in allen Situationen nach dem Komischen, Schrägen, Eigenartigen zu suchen und sich zu amüsieren, als wäre das Leben ein einziger heiterer Tanz, machte sie, die Ernsthafte, nervös und unsicher. Tim lachte lieber einmal zu viel, zog Parallelen, wo sie keine sah, und zitierte munter in Variationen allen und jedes. ›Nicht heiterer Tanz, ma chère, heiliger Tanz. Wie bei den Derwischen.‹
Entsprechend lange hatte es gedauert, bis beide ihre Gefühle aufrichtig akzeptierten und miteinander darüber sprachen. Die ersten Monate wurden von der Euphorie des Neuanfangs getragen mit der leichtfüßigen Bereitschaft für Offenheit, Entdeckungen und Begeisterung.
Seit Kurzem musste sich Elisabeth eingestehen, dass die gemeinsamen Schritte als Paar über die Verliebtheit hinaus weniger einfach waren, als in ihrem stillen Einpersonenkämmerlein erträumt. Tim hatte seine edle Wohnung in einer teuren Stuttgarter Halbhöhenlage, und sie lebte in Tübingen in einem Mehrfamilienhaus in einer Art Wohngemeinschaft. Mit ihrer pferdebegeisterten Schwester Greta, der gemeinsamen Freundin Nicola, Katze Bonnie und überfallartig mit Bruder Christian, der aus Hamburg zu Besuch kam, wenn ihm einfiel, dass Nicola seine Freundin war, ein paar Tage blieb und verschwand. Nicola nahm es gelassen, nannte es ›den Hamburgmonsun‹ und fuhr weitaus häufiger in den Norden. Wegen des gesunden Meeresklimas, wie sie das erläuterte, was bei ihren Freundinnen keiner Erklärung bedurfte.
Elisabeth und Tim trafen sich deutlich häufiger als Nikki und Christian, aber das Jonglieren mit Abendterminen und Organisieren von freien Wochenenden hatte seinen Preis. Mit jeder Absage oder Verschiebung wuchs uneingestanden eine leichte Mattigkeit. Immer häufiger wurden Dates mit einem charmanten Lächeln und einem lässigen ›Aufgeschoben ist nicht aufgehoben‹ abgesagt. Klärende Gespräche wurden auf die lange Bank geschoben, und die Bereitschaft, Nischen im Alltag zu zweit zu schaffen, ermüdete beide. Sie waren bekennende Workaholics und arbeiteten leidenschaftlich gerne in ihren jeweiligen Berufen. Tim stürzte sich am liebsten in mehrere Filmprojekte gleichzeitig, und Elisabeth in Sonderausstellungen und Veranstaltungen für das Museum.
Am letzten Sonntag, als Elisabeth in Tims kuscheligem breitem Bett in seinen Armen lag, murmelte sie: »Wenn die Hauptsaison beginnt, werde ich sechs Wochen in Sonnenbühl-Erpfingen sein.« Der eigentliche Inhalt, der drängende Wunsch nach einer konkreten Planung mit zementierten Treffen, ging am morgendlich entspannten Tim vollständig vorbei. »Warum schläfst du nicht dort?«, murmelte er in ihr Ohr. »Ist Luftkurort. Gibt genügend Zimmer und erspart dir eine Menge unnützer Fahrerei nach Tübingen und zu mir.«
Tim räkelte sich, streckte seine Arme in die Luft und spannte seinen hellen, unbehaarten Oberkörper an. Er war sichtlich stolz auf die pragmatische Lösung, die sämtliche Punkte bedachte. Es schien ihm nichts auszumachen, dass Elisabeth über eine Stunde Autofahrt von Stuttgart entfernt wäre und gemeinsame Verabredungen sich in nebulöser Unklarheit verloren.
»Na ja«, sagte Elisabeth lustlos, »es gibt ein Ferienhäuschen in derselben Straße wie das Museum.«
»Geht doch«, raunte Tim und strich ihr eine lange dunkelbraune Ponysträhne aus der Stirn. »Das kannst du gut machen.« Er griff nach ihrer Hand und legte sie auf den empfindlichen Köperteil zwischen seinen Beinen. »Noch bist du nicht weg. Mach weiter. Das Wichtigste zuerst, Süße.« Er küsste sie herzhaft heftig auf den Mund und ließ sie die nächste Stunde zwecks gemeinsamer Aktivitäten nicht aus seinen Armen.
Elisabeth träumte und verpasste, worum es ging. »… und beim Jupiter entschuldige ich mich«, endete Tim schwungvoll. Sie schwieg unbehaglich. Daniel erlöste sie, als er polternd die Treppen hinunterstürzte. »Na, Besprechung beendet?«, rief er und warf munter zwei kalte Dosen Cola, die er aus dem Kühlschrank im zweiten Stock genommen hatte, durch den Raum. Elisabeth und Tim fingen die Behälter ungeschickt auf, und Daniel lachte. »Dann kann’s weitergehen.«
Das erinnerte Tim an den ursprünglichen Grund seiner Aufregung. Er baute sich breitbeinig vor Elisabeth und Daniel auf und schob seine Brille auf der Nase nach oben. Seinen Arm weit nach hinten ausgestreckt und auf eine der Vitrinen deutend, rief er etwas, das Elisabeth und Daniel einen kalten Schauer über den Rücken jagte. Während sich ihre Augen vor Entsetzen weit öffneten, würgte der Junge und rang lautstark nach Luft. Gleichzeitig kamen Tims Kollegen dazu und bekamen die sofortige Gelegenheit, erneut zu erstarren. Der Vulkan brodelte über und spuckte kochende Lava aus.
»In der Vitrine liegt ein Menschenknochen.«
Kapitel 3
Tübingen
Andreas Clemenz drehte seine Hände um und starrte widerwillig auf seine Handflächen. Seitdem er vor einigen Jahren 40 geworden war, konnte er freudlos beobachten, wie seine Finger in die Breite wuchsen. Jeder einzelne. Langsam, kontinuierlich, zuverlässig wie Baumstämme. Aus den ehemals feingliedrigen Greifapparaten mit gerade gefeilten Nägeln waren derbe Funktionsmaschinen geworden. Mit dieser Größe konnte er inzwischen problemlos einen schmalen Frauenhals umfassen und zudrücken. Er nahm eine Limette und presste sie probehalber. Die grüne Zitrusfrucht verschwand vollständig in seiner Hand. Als ihm der Schweiß vor Anstrengung und krankheitsbedingt auf die Stirn trat, vermutete er, dass seine Hände, falls sie als Mordwerkzeuge Dienste leisten sollten, Übung bräuchten. Da er auf der anderen Seite, auf der Seite der Guten oder zumindest auf der des Gesetzes, an seinem Schreibtisch in der Polizeidienststelle saß, hatte diese Überlegung eher theoretischen Charakter. Als Kriminalkommissar hatte er in langen Jahren genug gesehen, um sich bewusst zu entscheiden, seine Taten im Rahmen des gesetzlich Erlaubten zu belassen.
Er gestand sich allerdings ein, dass er öfters die Grenzen seiner eigenen moralischen Einstellungen überschritt, und dass dem ein ruheloses Gewissen fast zwanghaft folgte.
Andreas Clemenz stand auf, lockerte seine Schultern und ging zur gegenüberliegenden Tischseite, wo ein bewusst unbequemer Stuhl stand, auf dem er sich vorsichtig niederließ. Nicht nur aus diesem Grund nahm niemand länger als unbedingt nötig Platz. Der Stuhl stand im Tübinger Polizeibüro, Dezernat für Kriminalverbrechen. Es war der Platz für Menschen, die verdächtigt wurden, schwere Straftaten begangen zu haben. Oder für Zeugen, Informanten, Wichtigtuer, Einfältige und sonstige Schattierungen menschlicher Selbstinszenierung. Ein offizieller Platz für polizeiliche Ermittlungen, der seine Vorteile hatte. Wie beim Zahnarzt konnten während einer laufenden Untersuchung tagelang Menschen einbestellt und ihnen auf den Zahn, sprich auf Verdachtsmomente, gefühlt werden. Sich widersprechende Aussagen konnten zügig erkannt und der Befragte damit konfrontiert werden. Ohne das gewohnte und sichere Umfeld der eigenen Wohnung und der Familie reagierten Menschen auf drängende und andauernde Fragen, Feststellungen und Beweisvorlagen verunsichert, machten winzige Fehler, die sich in einem Fall-Puzzle als entscheidend herausstellten. Körperhaltung, Gesichtsausdruck und Wortwahl gehörten mit zu dem, woraus sich Andreas das Bild über einen Fall akribisch und sorgfältig zusammensetzte.
Andreas schätzte diesen Teil seiner Arbeit, weil die Gespräche so vielfältig waren wie die menschenverachtenden Gründe, Verbrechen zu begehen. Ihm ging es darum, einen Fall inklusive des Verstehens der Hintergründe, Abhängigkeiten und gegenseitigen Verstrickungen zu lösen. Zu einem hohen Prozentsatz waren Mord, Totschlag oder Unfall mit Todesfolge Beziehungstaten zwischen Menschen, die sich kannten. Andreas forschte, bis er das persönliche Muster einer Straftat erkannte.
Andreas hatte den Stuhl mit Bedacht ausgewählt. Kaltes Metall ohne Armlehnen, eine schwarze, ungepolsterte Lederfläche und eine schmale, unbequem gebogene Rückenlehne machten aus der Sitzgelegenheit ein feines Folterinstrument. Schnell, wenn man es im Rücken und der Wirbelsäule hatte, und langsamer, wenn die harte Lehne unterhalb der Schulterblätter in den Körper einschnitt und zu schmerzen begann, sobald man sich anlehnte.
Der gleiche Stuhl stand vor seiner Tür und gab Andreas die Möglichkeit, die einbestellten Zeugen ungemütlich und psychologisch wirksam warten zu lassen, wenn er es für nötig erachtete.
Andreas schätzte den Stuhl und dessen Flurkollegen, wobei seine Kollegen ihn bei Rücksprachen geflissentlich mieden. »Lass mal, ich habe nur eine kurze Info für dich. Bin auf dem Sprung.«
Andreas setzte sich bewusst darauf, wenn er nicht vorankam. Ein Stuhlwechsel inklusive eines Einpersonenrollenspiels sollte Hilfe bringen. Er versuchte, Zugang zu den Gedanken des Verdächtigen zu finden und die Fragen aus dessen Sicht zu beantworten, die der aktuelle Bösewicht ihm nicht zu geben bereit war.
»Der Clemenz sitzt länger auf dem Verhörstuhl als auf seinem eigenen. Was sagt uns das?« Diese und andere seiner Marotten wurden von seinen Kollegen offen kommentiert, unabhängig davon, dass sie seine soliden Arbeitsergebnisse schätzten.
Clemenz atmete schwer aus, ging zurück, begann erneut, die Tastatur zu bearbeiten, und schniefte. Vom Aussehen und Charakter war er ein anderer Typ als der großstädtisch smarte Tim Weber, der souverän und elegant um sämtliche harte Kanten des Lebens segelte.
Andreas Clemenz rannte lautstark gegen die feste Mauer, wenn sich ihm eine entgegenstellte. Nicht weil er masochistisch veranlagt war, sondern weil er glaubte, der entstehende Lärm könne das tagscheue Gesindel hervorlocken, dem sein berufliches Interesse galt.
Insgesamt größer und breiter als der Filmemacher, trug der Kommissar seine dunkelbraunen glatten Haare schulterlang. Sie wirkten stets zipfelig, was kein Wunder war, denn er schnitt sie sich selbst. Friseurbesuche zählten für ihn zu den sinnfreien Unternehmungen des Lebens. Seine markante Nase mit dem Höcker war schmal und seine weit auseinanderstehenden großen braunen Augen mit den schwarzen dichten Wimpernkränzen wirkten fälschlicherweise so weich, tief und freundlich, dass Frauen reihenweise auf ihn flogen. Die bartlose, weiche Lippenform tat ihr Übriges. Es gab wenig, was mehr täuschen konnte. Wenn’s sein musste, war er ein gefährlicher Wolf, der sich an einem Fall verbiss, bis er gelöst war.
Beziehungsmäßig war er seit drei Jahren trotz des breiten Angebotes solo und widmete den verträumten Augenaufschlag ausschließlich seinem Teenager-Sohn Finn, wenn er ihn zu Gesicht bekam, einem spannenden Fußballspiel im Fernsehen und einem kühlen Blonden, wenn es direkt aus der Flasche in seine Kehle strömte, in völliger Unkenntnis, welchen Aufruhr dieses leichte Augenlidzucken bei der Damenwelt verursachte.
Affären waren dem lässig und qualitätvoll Gekleideten zu anstrengend, und da die auf ihn attraktiv wirkende Kollegin Sanja Müller-Seipert mit ihren langen braunen Haaren, die sie gerne altmodisch als Hochsteckfrisur trug, die ihr ausnehmend gut stand, glücklich per Doppelnachnamen und breitem weißgoldenen Ehering stets sichtbar verheiratet war, verschwendete er keine Zeit mit Flirten.
»Wenn du je wieder solo bist, Sanja, sag’s mir als Erstem. Dann werde ich dich für mich in Windeseile erobern.«
»Du wirst es vor Markus erfahren, versprochen«, grinste Sanja gut gelaunt in dem angenehmen Wissen, von zwei Männern gleichzeitig begehrt zu werden.
Es kam vor, dass Frauen, die im Zusammenhang mit einer seiner Ermittlungen standen, gegen Abend im Büro anriefen und baten, Clemenz möge sie dringend für ihre erneute Aussage treffen.
»Eben ist mir etwas Wichtiges und Unaufschiebbares eingefallen. Wir könnten im Restaurant um 20 Uhr eine Kleinigkeit essen.«
Diese Versuche, Andreas Clemenz an Treffpunkte zu locken, die leicht mit höchst privaten Domizilen getauscht werden konnten, wurden routiniert von Sanja abgewimmelt, die die jeweilige Anruferin betont sorgfältig auf die Öffnungszeiten der Polizeidienststelle hinwies, das Gespräch ruppig beendete und Andreas energisch das pinkfarbene, runde Sparschwein über den Tisch schob, in das sie sich ihre Samariterinnendienste mit klingender Münze bezahlen ließ. Wenn das Porzellanschweinchen gefüllt war, ging sie mit ihrem Mann Markus fröhlich essen, was Andreas aus nicht eingestandenen Gründen doppelt nervte.
»Du gehst auf meine Kosten ganz schön häufig mit ihm aus«, maulte er regelmäßig.
»Ich gehe genauso gerne auf deine Kosten mir dir weg.« Sanja genoss die Plänkeleien, weil Andreas gleichzeitig bestimmte persönliche Grenzen nicht überschreiten würde.
Wenn seine alte und geliebte Tante Rose, Zeit ihres Lebens auf der Schwäbischen Alb in Erpfingen wohnend und mit den Tübinger Geschehnissen zur Gänze unvertraut, gelegentlich seufzte: »Ich verstehe die heutigen Frauen nicht, sie müssten dir reihenweise nachlaufen, ach, und eine Nutte wäre bestimmt dabei«, drückte Clemenz ihr sacht einen Kuss auf die faltige Wange. »Ich möchte nicht, Röschen, dass eine Frau mir hinterherrennt. Wenn, soll sie neben mir gehen.« Tante Adele, die robustere der Schwestern, brummelte regelmäßig: »Besonders erfolgreich ist diese Einstellung nicht, mein Freund. Die letzte Frau, die neben dir schritt, läuft seit Jahren vor dir weg. Und, Rose, merk’s dir endlich«, ihre Stimme erreichte die Zone des ewigen Frostes, und ihre Augen schossen beängstigende Blitze auf das zerknirschte Tante Röschen, »es heißt Nette.«
Kapitel 4
Tübingen
Andreas Clemenz fühlte sich, als wäre sein Körper ein mit Wasser gefüllter Plastiksack, der ohne jede Muskelanspannung schlaff im Stuhl hing. Die unbequeme Stuhlfläche tat ein Übriges. So schnell, wie seine Nase lief, konnte er kaum ein Taschentuch hinhalten. Er stöhnte erneut zum Gotterbarmen. Seine Kollegin erhörte ihn beim dritten Mal, um genüsslich über seine allseits bekannte Hypochondrie zu lästern. »Du bist schwer mehrfach deprimiert«, analysierte Sanja leidenschaftslos und kicherte anhaltend. »Deine Hände, Körper, Nase, der ganze Mann und der Fall Heinrichs.« Sie räumte ihren Schreibtisch wie jeden Freitag akribisch wochenendfein auf.
»Willst du einen frischen Tee?«, machte sie ihm ein versöhnliches Angebot.
Andreas Clemenz schluckte beleidigt. Der Fall Heinrichs hatte sich für seine Verhältnisse hingezogen. Vielleicht, weil er unspektakulär aussah und gut und gerne zu der Kategorie unglückselige, nicht vermeidbare Unfälle mit Todesfolge gezählt werden konnte. Das wollte Clemenz aus kryptischen Gründen nicht wahrhaben. Beweise für ein Tötungsdelikt hatte er keine, nicht einmal einen Verdächtigen im engeren Sinn. Nur seine verquollene Nase sagte ihm, da stinke was zum Himmel. Das war Wasser auf die nimmermüde sprudelnden kollegialen Mühlenräder. »Du bist die erste Spürnase, die nichts riecht. Respekt. Weiter so.«
Andreas’ Kiefer fühlten sich verspannt an und schmerzten, weil er sie seit Tagen fest aufeinanderpresste. Wahrscheinlich malmte er mit den Beißerchen im Schlaf. Weil er alleine schlief, konnte das niemand bestätigen. Vorsichtig fuhr er mit dem Zeigefinger über die beiden Zahnreihen in seinem Mund. Wieder kicherte es, und ein sprudelndes Geräusch kam aus dem Wasserkocher.
Andreas klopfte mit dem Kugelschreiber rhythmisch auf den Schreibtisch. Er fühlte sich ungeduldig und krank. Es hätte durchaus ein Unfall sein können vor zwei Wochen in dem nächtlichen Garten des pieksauberen Einfamilienhauses der Familie Heinrichs in einem nahe gelegenen Dorf. Am Abend des 50. Hochzeitstages war die Ehefrau aus unbekannten Gründen in den Garten gegangen, auf einer vereisten Waschbetonplatte ausgerutscht, wurde vermutlich ohnmächtig und erfror oder verstarb infolge eines Herzinfarkts. Der Mann hatte auf sie gewartet, dann war er nach dem ungewohnten Alkoholgenuss eingeschlafen. Er wachte erst am nächsten Morgen wieder auf.
Der Ablauf ihres Ehrentages war als ein festliches Familienzusammentreffen inklusive alter Freunde organisiert gewesen, mit feinem Essen, schwerem Wein, Unterhaltung, Tanz. Dem Jubiläumspaar zu Ehren reisten die Kinder, Schwiegerkinder und Enkel an, die im Hotel übernachteten. Ein Taxi fuhr die Brautleute nach der Feier heim. Was dann passiert war, wirkte normal, verdachtsfrei und wie ein tragischer Unfall. Ein trauriger Abschluss eines schönen Festes.
Selbst die langwierigsten Befragungen der Nachbarn, der Familie und Freunde hatten nichts zutage gefördert, was auf eine Tat aus niederen Beweggründen hindeutete. Jedes Mal, wenn Andreas mit einer vorgeschobenen Frage zu dem Witwer ging, standen frische Blumen vor dem Foto der Ehefrau.
Ästhetisch und optisch gesehen wusste Clemenz, was ihn störte. »Dunkelbraun. Hilfe. Liebe Göttin der Schönheit, sieh nicht hin. Kleine braune Fliesen als Hausfassade. Und dazu dunkelbraune Fensterrahmen.«
Beige gemusterte Gardinen verwehrten neugierigen Blicken die Einsicht in die Zimmer. Ein seitlicher Spalt zwischen den Stoffbahnen ließ Andreas vermuten, dass die Hausbewohner ihre eigenen Augen gerne unbeobachtet die Straße entlangschweifen ließen. Vermutlich wussten sie mehr über das Privatleben der Leute, als diese in Gesprächen mit Familie Heinrichs zu offenbaren wünschten.
Im unkrautfreien Vorgarten standen farbige Kunststoffzwerge zwischen exakt geschnittenen immergrünen Lebensbäumen, kugeligem Buchs und Rhododendren. Die Erde zwischen den Pflanzen war mit braunem Rindenmulch bedeckt. Die Jägerzauntür war exakt geschlossen und der Briefkasten nebst dem Klingelbereich sauber geputzt.
»Da wagen es nicht mal irgendwelche Rotzlöffel, ihre Kaugummipapierchen hin zu schnipsen«, grummelte Andreas zu Sanja.
Am Tag zuvor war Andreas erneut zu Peter Heinrichs gegangen, ohne einen konkreten Verdacht und ohne Anlass. Das würde er Peter Heinrichs nicht auf die Nase binden. Freunde und Familie waren lange wieder fort, nur eine Tochter, Tanja, wohnte bei ihrem Vater. Sie hatte das Einverständnis der Polizei, demnächst abreisen zu können.
Andreas hatte noch nicht geklingelt, da riss sie die Haustür auf. Eine stets perfekt gekleidete Frau im mittleren Alter. Andreas kam sie unkonzentriert und verschroben vor. Ständig hingen ihre Augen an seiner rechten Hand und verfolgten atemlos jede seiner Bewegungen. Selten schaffte sie es, vollständige und inhaltlich stimmige Sätze zu sprechen. Sie zerfaserte die Worte wie Orangen, deren Fruchtfleisch die Obstpresse zerkleinert.
»Guten …, ah, Herr Clemenz, ich wollte gerade …, mein Vater ist …, erneut die Polizei …, möchten Sie Kaffee …, das Frühstücksgeschirr …, wollen Sie sich im Wohnzimmer …, ich dachte, wir hätten alle Fragen …, meine Güte, grauenhaft, kann ich die Blumen in eine Vase …?«
Trotz ihres Benehmens und ständiger Widersprüchlichkeiten, zählte sie für Andreas nicht zum exklusiven Kreis seiner Verdächtigen. Als Zeugin war sie keine Hilfe, obwohl sie sich anstrengte. Jedoch ihr aufgeregter Habitus und eine natürliche Nervosität, die einen kometenhaften Anstieg erfahren hatten, hatten zur Folge, dass alle ihre Bemühungen umsonst waren. Andreas baute auf seine eigene innere Gelassenheit während der Gespräche, aber hier reichte es nicht. Jedes Mal, wenn sie anfing, sich im Mikrobereich zu entspannen, fiel ihr Blick auf die rechte Seite seiner Jacke in Hüfthöhe, und es war aus mit hilfreichen Informationen. Ihre Angst vor dem, was sich unter dem Stoff kaum sichtbar wölbte, war irrational und ständig auf Hochtouren. Einmal hatte Andreas sie eingeladen, ein paar Schritte die Straße entlangzugehen, und ihr wie unabsichtlich und überdeutlich gezeigt, dass er seine Waffe nicht trug, aber sie konnte nicht umschalten. Bei ihr kapitulierte Andreas. Es musste einen anderen Zugang zur Lösung als Tanja Heinrichs geben.
»Träumerchen«, sagte eine Stimme und legte eine Portion Theatralik in die nächsten Worte. »Du bist bei der anderen und nicht bei mir.« Andreas blickte auf, und Sanja stellte ihm eine dampfende Teetasse vor die Nase. Er schaffte es, dankend und verärgert zu nicken. Verflixt, was hatte er aus dem Leben der Eheleute Heinrichs nicht beachtet, gesehen, gefunden?
»Bei meinen Händen weiß ich die Lösung«, murrte Andreas undeutlich. »Es ist die Arbeit auf dem Bauernhof meiner Tanten, die seit Jahren zunimmt. Den maroden Hof schaffen die alten Leutchen nicht allein. Es ist höchste Zeit zu verkaufen, aber verpflanz mal alte Bäume.«
Sanja unterbrach ihr Kichern, wandte den Kopf und sah nachdenklich zum Fenster hinaus.
»Bei dem Fall bin ich mir sicher. Irgendwo ist das Türchen. Ich rieche es.«
Andreas tippte vorsichtig an den linken Nasenflügel. Das Kichern ertönte erneut und wuchs sich zu einem lauten Lachen aus. »Aber sicher, bei diesem sensiblen Näschen, das auf jede Erkältung reagiert, die durchs Haus schwirrt. Und was ist, bitte schön, eine riechende Tür? Fahr übers Wochenende weg. Bodensee, Schwarzwald, Schweiz. Auswahl ist da. Kurier dich aus«, erteilte Sanja einen Ratschlag und griff nach ihrer Jacke.
»Lass sein. Auskurieren kann ich mich in meinem Bett besser als im fremden«, maulte Andreas trotzig. Sanja änderte ihre Laute zu einem albernen, wissenden Mädchengekichere. In der täglichen Zusammenarbeit mit Andreas Clemenz hatte sie es verinnerlicht, Situationen mit einem Grinsen zu entspannen, ihnen eine andere Richtung zu geben und insgesamt die Stimmung zu ändern. Oft genug ließen die Inhalte ihrer gemeinsamen Arbeit dies kaum zu. So war sie froh, dass auf Clemenz’ hypochondrische Verlangung in jeder Situation Verlass war und mit ihr oft eine Pause erreicht werden konnte – und sei sie kurz. Sie schickte einen tief empfundenen Dank ins Universum. Mit Andreas arbeitete sie gerne, schätzte ihn als Kollegen, Menschen und Mann, weil er deutlich seltener auf seinen egozentrischen Leitungen stand als manch anderer im Haus und sich Mühe gab, weibliche Sichtweisen zu respektieren, selbst wenn er sie nicht im Einzelnen verstand.
»Musst nicht zwangsläufig in beiden Fällen allein sein.« Sanja schickte ihm eine Kusshand.
Andreas nahm sie zur Kenntnis und schüttelte den Kopf. »Wenn ich was im Fall Heinrichs erreichen will, dann übers Wochenende.«
Sanja schloss die Jacke und schlang einen langen Schal mehrfach um ihren Hals. »Mach, was du willst, Sherlock. Am Montagmorgen wird der Chef dir den Aktendeckel vor der Nase zuknallen. Ich wünsch dir was.«
Als sie gerade die Hand auf den Türgriff legte, kam ein Kollege herein.
»Leute, der Tübinger Hauptbahnhof ist nördlich von hier.« Clemenz tat seine nörgelige Anmerkung, die auf seine Kollegen allerdings keinerlei sichtbare Wirkung hatte, gut. Sanja wedelte ungerührt mit der Hand zum Abschied und verschwand.
Kapitel 5
Erpfingen
Die entsetzte Stille im Ostereimuseum, die auf Webers Satz folgte, wurde einen Sekundenbruchteil später von den unterschiedlichsten Reaktionen abgelöst. Der Kameramann schnaufte: »Quatsch, Tim, Blödsinn«, die Tontechnikerin lief wortlos zu der Vitrine, Elisabeth schrie förmlich: »Was, um alles in der Welt, meinst du?«, Daniel würgte erneut und Tim zuckte gleichmütig die Schultern. Sie umringten die Glasvitrine.
Als hätte sich das beanstandete Knöchelchen versteckt, lugte es unter anderen nur halb hervor. Man musste genau hinsehen, um einen Unterschied zu seinen Artgenossen zu entdecken. Alle Augen starrten auf Tim und spiegelten überdeutlich das allgemeine Entsetzen.
»Na ja, es war in einem anderen Zusammenhang. Ich habe einen Film über Handprothesen und ihre Einsatzmöglichkeiten gedreht, und es ging um die komplizierte Anordnung der Knochen, Knorpel, Blutbahnen, was weiß ich. Spannend, was unter unserer Haut dauernd und ohne Pause los ist.«
Elisabeth schüttelte sich. »So genau möchte ich es nicht wissen. Ich bin froh, dass ich meine Haut habe.«
Daniel grinste, sein Forschergeist war geweckt und er presste seine Nase direkt an das saubere Vitrinenglas, was ihm von Elisabeth ein Rütteln an der Schulter einbrachte. »Jedenfalls ist kein Blut zu sehen. Kein Fleisch oder Hautfetzen. Und es stinkt nicht.« Daniel schnüffelte theatralisch.
»Igitt, hör auf!«, schimpfte Elisabeth.
»Blank gewienert, schön hell, freundlich und interessant anzusehen«, setzte Daniel begeistert eins obendrauf. Er war auf dem Weg, seine gern vor reichlich Publikum präsentierte Coolness wiederzuerlangen, und freute sich mehr darüber, als er es jemals laut zugegeben hätte.
»Keine Sorge. Bestimmt was Prähistorisches mit einer wissenschaftlich-sachlichen Erklärung und Lösung«, nickte Tim, ebenfalls in dem Bemühen, die Dramatik zu senken und die Lage zu entspannen.
»Hoffentlich hast du recht«, sagte Elisabeth zweifelnd und schob ihre Hand in Tims.
»Das ist wahrscheinlich«, ergänzte Tim. Sein Satz beruhigte Elisabeth und enttäuschte Daniel. Der Kameramann deutete auf seine Armbanduhr und machte mit seiner Rechten mehrere kreisende Handbewegungen, die besagen sollte, Eile und rasches Arbeiten wären deutlich angebracht.
»Ich muss meine Tochter vom Schwimmen abholen. Mach hin, Tim.«
»Ja«, sagte Tim, »wir sind zeitlich eng. Wir drehen an der anderen Vitrine, Elli, und du überlegst dir, was du tun willst.«
Elisabeth nickte, und Kamera und Mikrofon liefen professionell weiter, als wäre nichts geschehen.
Elisabeth ging in ihr Büro, um sich die Leihverträge anzusehen, in der vagen Hoffnung, einen konkreten Hinweis zu finden. Sie würde den Leihgeber anrufen, damit er den Knochen abholte. Sie wollte ihn aus dem Haus haben und damit ihre verstörenden Gedanken, dass zu dem Knochen ein Mensch gehörte, der mit hoher Wahrscheinlichkeit tot war. In das Thema mit mehreren Möglichkeiten, die ihr gleichsam gruselig erschienen, wollte sie sich nicht vertiefen. Sie notierte sich die Telefonnummer und knallte den Deckel auf den Ordner.
Am späten Nachmittag, als das Filmteam mit Tim gegangen war und Elisabeth einen Ablagekorb voll mit Blättern als ablenkende und zeitintensive Fleißarbeit in die Pappordner sortiert hatte, kam Johannes Zagst, der Leihgeber, ins Museum. Er wohnte nicht weit entfernt. Zu Fuß waren es ein paar Minuten. Zagst hatte sich nicht überreden lassen, sofort zu kommen, sondern sie auf den Abend vertröstet und etwas von »Muss ich vorher erledigen. Schließlich brennt das Museum nicht«, gebrummelt.
Elisabeth hatte ungeduldig auf ihn gewartet, insbesondere deshalb, weil er am Telefon einsilbig war und wiederholt »Komme bald«, gemurmelt hatte.
Der hohe wie breite Zagst brachte einen stattlichen und gelassen wirkenden Mann mit, den er als »Michael Herrmann, Polizist«, vorstellte. Obwohl der junge Mann keine Uniform trug, offensichtlich Feierabend hatte und rein äußerlich dem Geschehen im Vorfeld keine offizielle Bedeutung zumaß, konnte Elisabeth in seiner Anwesenheit keinen Frieden für ihre zermürbenden Gedanken finden. Sie zwang sich zur Ruhe, während Daniel begeistert schrie: »Hi, Michi, komm, ich zeige es dir. Das ist spannend.«
Elisabeth nahm sich zusammen. »Herr Zagst, die Leihgaben in der Vitrine sind von Ihnen und damit auch der Knochen, von dem wir denken, dass es sich um einen menschlichen handelt.« Diesen Satz hatte sie mehrfach geübt, um nicht erneut Übelkeit aus ihrem Magen aufsteigen zu fühlen, was die Panik und das schale Gefühl in ihrer Speiseröhre nicht hinderten, zu kommen. Sie schloss ihren Mund, um den Reiz des Erbrechens zu minimieren.
»Schau’n wir mal«, sagte Zagst und ging mit ihr zu Daniel und dem Polizisten. Zagst blickte sich um, nickte und sagte nichts. Elisabeth fühlte sich am Rande einer inneren Explosion. Der Knochen sollte aus dem Haus, und alles wäre gut. Die Sache musste ein schnelles Ende finden. Sie schloss die Vitrine auf, und ihre Stimme klang hysterisch. »Nehmen Sie ihn mit.«
Beherzt griff Zagst nach dem Knöchelchen. Michael Herrmann warf einen gelassenen Blick auf den Aufreger des Tages. »Pesttoter, schätze ich.«
Zagst widersprach energisch. »Ein Tierknochen wie die anderen.«
Elisabeth schüttelte den Kopf, als Zagst den Knochen seelenruhig in seiner Jackentasche verschwinden ließ. Von dem Dialog hatte sie nichts verstanden. »Was soll das heißen?«
»Hm«, brummte Zagst, »die Kiste mit dem kompletten Inhalt stand bei uns auf der Bühne unter einem Teppich. Völlig verstaubt. Wespennest, tote Wespen, Mäuseleichen, diese Dinge.«
Elisabeth drückte die Handflächen an ihre Schläfen. Heiliger Himmel, wo war der Weg aus diesem Gruselkabinett? Eine Bühne mit Teppich in einem Erpfinger Bauernhaus? Waren denn alle neben der Spur? Am Osterdienstag, nach der Hauptsaison, würde sie sich krankschreiben lassen, schwor sie sich. Spätestens dann war sie es wirklich. Daniel und Herrmann nickten synchron und wissend. Daniel schüttelte Elisabeth. »Bühne«, sagte er und blickte ihr in die Augen. »Das ist ein Dachboden. Und der Teppich ist eine Jacke. Ist Schwäbisch, und Sie als Schwäbin wissen das. Oder sind Sie betrunken?« Wenn Daniel mit Probeläufen dieser Art ihre Proteste normalerweise leicht herausfordern konnte und innerlich die Sekunden zählte, wie lange es dauerte, um sie auf der Palme zu haben, erntete er diesmal ein so schwaches Kopfschütteln, dass er meinte, sich zu täuschen.
Elisabeth verschränkte die Arme, um sich zumindest körperlich in der Unordnung nicht zu verlieren.
Zagst betrachtete die Vitrine und ließ einen flüchtigen Blick über die restliche Ausstellung schweifen. »Schön geworden. Als der Aufruf im Amtsblatt der Gemeinde kam, in dem Sie für die Ausstellung um Leihgaben baten, fiel es mir ein. Ich glaube, mein Vater hatte die Knochen und andere Dinge irgendwann aus der Bärenhöhle geholt. Hatte es vergessen.« Zagst verstummte.
Beifällig nickten Daniel und Michi Herrmann. Vergessen war eine feine Sache, die nicht unerheblich wenige Dinge auf unproblematische Weise klärte, solange es nicht um die Geburtstage ihrer aktuellen Freundinnen ging. Dann war Holland in Not und Land unter, und der Weg nach Canossa dringend angesagt.
»Sage ich ja, Pesttoter«, ergänzte Michi Herrmann. »Aus dem 30-jährigen Krieg. Kein Grund zur Aufregung. Zagst nimmt den Knochen mit. Fall gelöst.«
Danach schwiegen die drei Männer und blickten auf Elisabeth. Als von ihr keine sichtbare Reaktion kam, verabschiedeten sie sich mit einem schwachen Nicken und einer Handbewegung Richtung Tür. Michi Herrmann drehte sich zu Elisabeth um. Als hielte er sie für dringend professionell behandlungsbedürftig, sagte er übertrieben langsam bei der Verabschiedung: »Ich sehe morgen in unserer Datei nach, ob jemand aus Erpfingen aktuell vermisst wird. Ich rufe Sie an.«
»Tierknochen«, widersprach Zagst knapp, aber deutlich, »alles gut.«
Elisabeth verspürte das dringende Bedürfnis, laut zu schreien. Das ungewöhnliche Geschehen hatte ihre Hirnmasse in einen dysfunktionalen Brei verwandelt. Sie schloss die Tür hinter den Männern, ging in die Gästetoilette und ließ kaltes Wasser über ihre Unterarme laufen. Mit dem fließenden Nass kamen die rinnenden Bäche aus ihren Augen, die ebenfalls im Abfluss des Waschbeckens verschwanden. Mehr konnte sie nicht tun. Sie rieb das Waschbecken sauber und trocknete sich mit den Papierhandtüchern ab. Ihre Gedanken, die sich mit einem toten Menschen und seinem unbekannten Schicksal befassten und sich nicht abschalten ließen, machten sie wahnsinnig. Die Kopfschmerzen wurden zur hämmernden Migräne. Sie heulte aus dringend benötigtem Selbstmitleid.
Daniel polterte vor der Tür. »Kommen Sie raus, Wassergeist! Keine Sorge. In der Ausstellung sind nur die richtigen Knochen.« Elisabeth schluchzte laut auf. Richtige Knochen. Hilfe. Sie wollte eine schöne Osterei-Ausstellung haben, mit wundervollen ovalen verzierten Exponaten. Es war das Ostereimuseum und nicht ein Naturkundehaus, und sie keine Archäologin, Tierforscherin oder Ähnliches. Sie hatte Kunstgeschichte studiert und nicht das Innenleben von Geschöpfen.
Sollte sie nach den Vorstellungen esoterischer Lehren erneut auf die Welt kommen, schwor sich Elisabeth, ein unauffälliges Blümlein auf einer unerreichbaren Alpenwiese in klarer Luft zu werden. Irgendwo konnte man mit irgendwem darüber in freundlicher Atmosphäre bestimmt verhandeln.
Elisabeth nahm sich zusammen, warf das geballte Selbstmitleid symbolisch in ein Toilettenpapierchen und spülte es hinunter. Sie öffnete die Waschraumtür, bevor Daniel sie eintreten konnte, und lächelte ihn zum ersten Mal an diesem katastrophalen Tag mit einem winzigen Hoffnungslächeln an.
»Wird schon.« Daniel feixte, weil er ein ›Wird schon‹ mit einem deutlich anders gelagerten Schwerpunkt im Auge hatte als die Leiterin des Museums. Darüber schwieg er wohlweislich. Alles zur rechten Zeit.
Kapitel 6
Tübingen
Andreas Clemenz’ Kollege Matthias Koch knallte einen dünnen, verfärbten Pappordner mit der Aufschrift ›Lena Wiesinger, Vermisstensache Erpfingen, AZ 1955/3‹ auf Andreas’ Schreibtisch. »Du bist von da oben, oder?«, fragte er.
Unverbindlich zog Andreas die Schultern hoch. »Wenn du meinst, dass ich die Schwäbische Alb kenne und Verwandte habe, die …«
»Besser«, unterbrach ihn Matthias Koch, »hätte ich es nicht sagen können. Ich bringe dir eine uralte Vermisstensache. Der Seefeldt geht, und ich half ihm beim Aufräumen seines Aktenschrankes. Tagelang. Du willst nicht wissen, was dort alles lag.«
Clemenz grummelte. »Nimm das Ding mit. Geht mich nix an, und wahrscheinlich tummeln sich Bakterien und Stockflecken auf dem schimmeligen Papier.«
Matthias überhörte es und verkniff sich das süffisante Verziehen der Lippen nicht. »Wie der Flurfunk flüstert, hast du ab Montag keinen aktuellen Fall mehr.«
»Habe genügend andere Abschlussberichte zu schreiben die nächsten Wochen«, übertrieb Clemenz genervt. »Und einen Haufen Verwaltungskram. Dazu Fortbildungen und Co.«
»Dann bring eben die Ermittlungsakte ins Archiv. Mehr nicht.«
»Machs selber, Matthias«, rotzte Clemenz und fügte ein knappes »›tschuldige« an.
»Verlaufe mich ständig. Lange Gänge, wenig Ausschilderung.« Die Ausrede war so dürftig, dass sie als besonders fadenscheiniger Vorwand gewertet werden durfte. Clemenz ging zur Tür und öffnete sie. Seine Handbewegung war eindeutig.
»Sanja Müller-Seipert ist übrigens der Meinung …«, weiter kam Matthias Koch nicht.
»Daher der Wind und das plötzliche Verschwinden unserer hochgeschätzten, holden Kollegin. Raus mit dir«, sagte Andreas gelassen.
»Okay, okay«, der Mann griff die schmale Mappe und knallte die Tür hinter sich zu. »Schönes Wochenende!«, rief er im Gehen.
Clemenz goss das heiße Wasser aus dem Wasserkocher für einen weiteren Tee in einen von seinem Sohn handbemalten, überdimensionalen Becher und ließ einen Filterbeutel hineinsinken, den Tante Röschen mit Kräutern aller Art gefüllt hatte, überzeugt von der Nützlichkeit der Anwendung. Sie unterstützte Clemenz’ Hang, sich gerne krank und elend zu fühlen, weil sie so hemmungslos ihre Zuneigung zum Enkel ihrer verstorbenen Schwester Herta zeigen konnte. In ihren Augen konnte sie dies zu wenig tun, selbst wenn sie das Jahr über Marmelade für ihn einkochte, Früchtekompotte einweckte, kräftige Rindersuppen köchelte, nähte, strickte, stopfte, für Wehwehchen Kräuter sammelte, trocknete und zusammenstellte. Sie hatte Andreas seit seiner Geburt an den Wochenenden, wenn seine Mutter mit ihm aus Tübingen nach Erpfingen kam, umsorgt und verpflegt. In sämtlichen Schulferien hatte sie sein winziges Zimmer geputzt, das er bis zum heutigen Tag benutzte, das Bett gemacht und hinter ihm hergeräumt. Jede seiner Kinderkrankheiten wie Masern, Windpocken und Mumps hatte sie mit durchlitten und den Jungen, der unglücklicherweise überhaupt keinen Vater hatte, als verwöhnten Prinzen verzogen.
»Völliger Blödsinn, Rose«, sagte Adele, ihre ältere Schwester, ungeduldig. »Jedes Kind hat einen Vater. Ohne das geht es nicht. Andreas hat einen französischen.«
Weil Rose, bedingt durch den Zweiten Weltkrieg und die nie endende Arbeit auf dem Hof, die sie abhielt, in die Welt zu ziehen und ihre eigenen Erfahrungen zu sammeln, in den folgenden schweren Wiederaufbaujahren Männer nicht näher kennenlernte und durch die mangelnde sexuelle Aufklärung im Elternhaus eine nur undeutliche Vorstellung davon hatte, wie Menschenkinder entstanden, wobei sie es bei Hühnern und Kühen wusste, war sie sich nicht sicher, was ›französisch‹ in diesem Zusammenhang bedeutete. Das wagte sie Adele nicht zu fragen, und so blieb der ausländische Erzeuger, der niemals nach Erpfingen kam und vermutlich lange nicht mehr in Tübingen als Soldat stationiert war, ein unerklärliches Ereignis für Rose, das mit größter Sicherheit traumatisierend für den Jungen wurde, wenn sie nicht aufpasste. So hatte sie sich geschworen, Andreas auf das Äußerste mit allem, was in ihrer Macht stand, zu verwöhnen, zu beschützen und zu umsorgen.
Erstaunlicherweise war bei dieser Behandlung aus Andreas kein blasierter Kerl geworden, sondern ein freundlicher Mensch, der für Roses Taten und Geschenke dankbar war.
Adeles scharfe Augen, die mehr sahen, als ihrer Schwester meistens lieb war, und deren scharfe Zunge, die sie im Alter zunehmend fürchtete, machten es Rose schwer, Andreas bei den Abschieden unauffällig das Auto mit unabdingbar notwendigen Dingen vollzupacken. Sie glaubte ihm nicht, dass er sich in seiner Tübinger Singlewohnung zurechtfand und überdies wusste, wie Kühlschrank, Bügeleisen, Herd und Staubsauger funktionierten. Sie argwöhnte, dass die Räume in einem Zustand beständiger und tiefster Verwahrlosung seien, und die Fensterscheiben vom ewigen Nichtputzen blind waren. Sie dachte an zerschlissene Vorhänge und trostlos vertrocknete Topfpflanzen, deren braune Blätter beim geringsten Lufthauch zu Staub zerfielen. Im Kühlschrank wucherten mit Sicherheit grün-gelblich schimmernde Pilze, die mindestens tödliche Wirkung hatten. Graue, wabernde Schichten legten sich über das Parkett und schädigten Andreas’ Luftröhre und Lungen.
»Diese Läuse, Andreas, die sich da vermehren …«
»Süße, glaub mir, es sind harmlose Wollmäuse, Staubflusen eben …«
»Ich habe ein neues Mittel gekauft gegen Bakterien in der Toilette. Kam in der Fernsehwerbung.«
»Süße, glaub mir …«
Tante Röschens Fantasie, so konnte man sagen, war in Bezug auf Andreas völlig ungebremst, und wenn sie dachte, sie hätte sich bereits alles Gruselige und Grässliche überlegt, was ihrem Prinzen zustoßen konnte, hörte sie in den abendlichen Fernsehnachrichten neue Schreckensbotschaften, die sie auf Andreas eins zu eins übertrug und ihr laut klopfendes Herz mit einem Kräutertee mit Melissengeist besänftigen musste.
Es war gut, diese Gedanken sowohl vor Andreas als auch vor Adele zu verbergen. Einmal hatte sie von Adele einen ordentlichen Anpfiff bekommen. »Rose, wenn du dieses Kind nicht über 20 Jahre verpimpelt und es die nächsten 20 Jahre genauso gehalten hättest, wofür es keine Entschuldigung gibt, hätte aus dem Jungen was werden können.«
Adele war es ein besonders stacheliger Dorn im Auge, dass Andreas die Polizeilaufbahn eingeschlagen hatte. Kriminalkommissar in der Stadt. Als gäbe es keine anderen soliden und krisensicheren Berufe. Bäcker, Landwirt, Metzger oder ihretwegen Gastwirt. Andreas hatte damals mit einem selbst anspruchsvolle Mütter zufriedenstellenden Schulabschluss einige Möglichkeiten. Darüber hinaus war ihr Hätschelkind geschieden, und Exfrau Katja und sein Sohn lebten in Stuttgart. Finn verbrachte seine Sommer- und Herbstferien in Erpfingen, und so wiederholten sich die Geschehnisse der umfangreichen Verwöhnmaßnahmen wie ein Perpetuum mobile in der nächsten männlichen Clemenz-Generation.
Rose zitterte jedes Mal vor Empörung förmlich wie Espenlaub, wenn sie daran dachte, dass Adele sie für Andreas’ Berufswahl, seine instabile Gesundheit, sein privates Leben und Finns regelmäßige Landpartien verantwortlich machte.
»Ich weiß nicht, was das mit Andreas ist. Wir haben kräftige Rossnaturen. Punktum. Andreas soll sich mit kaltem Wasser waschen und mehr bei uns arbeiten. Dann vergisst er seine Zipperlein. Mann, Maus oder Memme«, krittelte Adele und rief übergangslos ihrem Bruder zu: »Hans, warum hast du für das Holzaufschichten so lange gebraucht? Für diesen Tag gibt es mehr Arbeit zu erledigen. Trödel also nicht.«
Kapitel 7
Tübingen
Andreas Clemenz schüttelte wegen seiner Kollegen und der Verschwörung, deren Grund er sich denken konnte, den Kopf und legte zum zigsten Mal geduldig die Hände auf die Tastatur. Es war ihm vergönnt, mehrere Stunden konzentriert zu arbeiten. Irgendwann sah Clemenz auf, blickte zum Fenster mit der grandiosen Sicht über die Stadt Tübingen und ihre begrenzenden Hügel hinaus, machte sich einige Ausdrucke und beschloss, es sei Feierabendzeit. Er hatte keinen Plan, wie er die nächsten Tage im Fall Heinrichs vorgehen sollte, und entschied sich, für eine leichtere Meinungsfindung ein paar Schritte in den Stadtkern zu machen, um auf der Neckarinsel spazieren zu gehen. Er fuhr den Rechner herunter, packte die bedruckten Papiere ein und öffnete die Tür. Er brauchte nicht erst über die Erpfinger-Akte zu stolpern, um zu sehen, dass Matthias Koch sie hatte fallen lassen. Aus Versehen natürlich. Und Bücken, Aufheben und Mitnehmen gingen nicht, man hatte es ja im Rücken. Bandscheibe und so. Andreas grunzte übellaunig. Er überlegte, ob er die Mappe mit einem wütenden Fußkick mitten ins Zimmer befördern sollte. Sie könnte bis Montag liegen bleiben, und er würde von Sanja eine Antwort fordern, während er ihr das zerfledderte Ding wirkungsvoll erbost unter die Nase hielt. Andreas blickte stumm auf den Boden und erwog die Sache, die einiges für sich hatte und zur Heilung seiner Gekränktheit immens beitragen würde.
Er kannte Sanja gut genug, um ihre Gründe für die Aktion nachzuvollziehen. Möglicherweise war die Akte im Schrank von Seefeldt zufällig aufgetaucht, und er glaubte Matthias Koch, dass dieser den Weg ins Archiv scheute. Nicht wegen der verwirrenden Anzahl der Gänge, da ein Aufzug direkt in die unterirdischen Räume führte, sondern wegen der Archivarin, die ihm bohrende Fragen stellen und es überdies seinem Vorgesetzten melden würde.
Andreas hätte ein Monatsgehalt gewettet, dass Sanja die schmuddeligen Seiten weder angefasst noch ihren Inhalt im Leisesten ahnte. Sie hatte vermutlich die Gunst der Stunde und des Zufalls genutzt, ihm eine Akte unterzujubeln, die ihm den kommenden Montag und dessen befürchtete Geschehnisse erträglich machen sollte. Und wie konnte sie einen neugierigen Spürhund besser locken als mit dem gut leserlichen Wort Erpfingen?
1:0 für Sanja. Clemenz akzeptierte, dass sie das Geplänkel gewonnen hatte, fasste die Mappe mit spitzen Fingern an und versenkte sie in seiner geräumigen Ledertasche. Er verließ die Polizeibehörde und ging zielstrebig den Weg durch die Stadt. Es war kalt, der Himmel von einem trostlosen Einheitsgrau, und die Häufchen alten Schnees entlang der Hauptstraße, inzwischen schwarz von den Abgasen der Autos, wirkten bizarr. Schwarzer Schnee. Eine Paradoxie, etwas, das es nicht gibt. So kam ihm der Fall Heinrichs vor. Von der ermittlungstechnischen Vorgehensweise betrachtet, hatte alles korrekt seinen Gang genommen. Die Kollegen hatten hervorragend gearbeitet, die Unterlagen waren vollständig und aktuell und dennoch kein Anknüpfungspunkt. Schwarzer Schnee.
Auf der Mitte der Eberhardsbrücke, die über den Neckar führte, blieb Andreas an einer Treppe, die auf die platanenbestandene Insel führte und den Neckar an dieser Stelle in zwei Flussarme teilte, stehen. Auf der einen Seite wuchs das Altstadtpanorama mit den schmalen, vier- bis fünfstöckigen Hausfassaden in die Höhe, die auf der alten Stadtmauer standen. Mit den verschiedenfarbigen Putzen und schiefen Fensterreihen, die mit Fensterläden versehen waren, wirkte es mittelalterlich. Dieser Charakter wurde durch sich neigende Giebel verstärkt.
Die mächtige Stiftskirche mit dem gewaltigen Turm bekrönte die steilen Hausdächer. Die Kirchturmuhr schmückte ein blau umrandetes Zifferblatt mit goldenen Zeigern und Zahlen und zog alle Blicke auf sich. Andreas war ein häufiger Besucher der Insel und fragte sich, wie oft diese Ansicht, eins der Wahrzeichen der Universitätsstadt, pro Jahr fotografiert werden mochte, und wie viele bewundernde Augenpaare sie entzückt anstaunten. Unter ihm floss der Neckar an der spitzen Seite der Insel wieder zusammen. Einmal im Jahr, an Fronleichnam, war sein Standort besonders begehrt. Durch das Nadelöhr zwischen Insel und Brückenpfeiler mussten beim bekannten Stocherkahnrennen die langen, flachen Boote aus Hartholz nach einer bestimmten Regel herumfahren. Gelenkt wurden die Boote von dem Stocherer, der am Bootsende auf einem schmalen Holzbrett stand und die sieben Meter lange Stange nutzte, um sich auf dem flachen Grund des Neckars abzustoßen, das Boot zu steuern und in Balance zu halten. Bei dem Wettkampf ging es bei den Teilnehmern in den Kähnen nicht ohne Gedrängel, Schreien und Stoßen, und man hatte von hier oben einen sicheren aktionsnahen Logenplatz. Es war sozusagen die erste Reihe, die nicht mitzuspielen brauchte, wie es oft im Zirkus oder bei anderen Veranstaltungen bedrohlich gefordert wurde. Heute war auf dem Wasser, von den eifrig hin- und herschwimmenden Enten abgesehen, alles ruhig. Als das Federvieh entschieden hatte, dass Andreas keine Papiertüte mit Leckereien hatte, schwamm es gemächlich davon. Im Unterschied dazu brauste der Verkehr in Andreas’ Rücken freitäglich aktiv und unaufhörlich die schmale Mühlstraße hinauf, die zum Zentrum führte.
Clemenz ging die breite Treppe auf die Insel hinunter, die eine Länge von über 800 Metern hatte. Eine gepflegte 200 Jahre alte Platanenallee lud zu allen Jahreszeiten zum Flanieren ein.
Andreas wählte die Kurzversion eines Spaziergangs und setzte sich auf die erste Bank am Ufer, die er erreichen konnte, mit Blick auf das Altstadtpanorama. Wenn schon gesundheitlich angeschlagen, konnte er versuchen, auf der kalten Bank vollständig krank zu werden. Irgendwas musste geschehen. Die Erkältung zog sich mit leichten Variationen seit Wochen hin. Mal blieb ihm die Stimme weg, dann hatte er Schluckbeschwerden, die Nase lief, Gliederschmerzen brachten sich in Erinnerung, ein Husten schüttelte ihn, Kopfschmerzen pochten hinter der Stirn, und eine allgemeine Energielosigkeit floss wie verklebender Sirup durch seine Blutbahnen. Seine Seufzer wurden lauter und länger, bis die Kollegen aus anderen Gründen mitseufzten, und ein vielstimmiger Chor durch die Gänge des Amtes erscholl. Als dieser Gesang die Ohren seines Chefs erreichte, empfahl er Clemenz rundweg, sich mit Rücksicht auf die Mitarbeiter krankzumelden, aber Clemenz wusste nicht, was er dem Arzt sagen sollte. Genauer gesagt wusste er nicht, bei welchen Beschwerden er aufhören sollte zu erzählen, weil die zulässige Sprechzeit beendet, ja bereits überschritten war. Andreas widerstrebte es ebenso, sich bei halbkrank krankzumelden, wie er es verwarf, für halbgesund Urlaub einzureichen. Eine Zwickmühle, die sein kollegiales Umfeld öfters nervte.
Andreas blickte auf. Der schmale, enge Platz gegenüber vor dem gelb gestrichenen Hölderlin-Haus mit dem runden Turm war im Gegensatz zu den Sommermonaten menschenleer. Andreas sah zum Himmel. Bevor die Dämmerung kam, konnte er die Akte studieren. Er wollte sie nicht länger als nötig behalten. Dünn war sie, ein paar Blätter nur, teils handgeschrieben, teils mit einer Schreibmaschine. Er brauchte Zeit, um sich mit der fremden Schrift vertraut zu machen. Klein, mit Unterlängen, in dunkelblauer Tinte, die ihn an seinen ersten Schulfüller erinnerte. Ohne Rechtschreibfehler und Tintenkleckse. Heinz Sauter, der zuständige Beamte, hatte die Dokumentation mit größtmöglicher Sorgfalt und zeitintensiv angelegt.
Der Ermittlungsverlauf war präzise und leicht nachvollziehbar aufgelistet. Eine junge Frau, Lena Wiesinger, verschwand am 3. Mai 1955 aus Erpfingen. Von heute auf morgen. Scheinbar spurlos. Die Vermisstenanzeige wurde von ihrer Freundin Hilde Geiselhardt aufgegeben. Eltern und Familie schien die junge Frau nicht zu haben. Wahrscheinlich eine entsetzliche Folge der grauenhaften Kriegswirren. Zehn Jahre zuvor war der Zweite Weltkrieg beendet worden. Längst nicht alles war wieder aufgebaut oder neu errichtet oder lief in normalen Bahnen. Deutsche Soldaten lebten nach wie vor in Kriegsgefangenschaften anderer Länder.





























