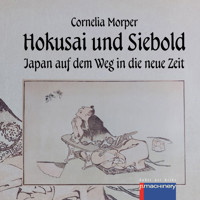
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Persönlichkeiten Hokusai und Siebold haben wesentlichen Anteil daran, Japan, das Jahrhunderte lang von der Außenwelt abgeschlossen war, in eine neue Zeit zu führen. Der Künstler Katsushika Hokusai war aufgeschlossen für alles Neue und experimentierte schon vor der Öffnung des Landes in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit westlich beeinflussten Maltechniken, Perspektiven, Farben und sogar mit holländischem Malpapier, das durch die kleine holländische Handelsniederlassung im Hafen von Nagasaki nach Japan gelangt war. Philipp Franz von Siebold kam 1823 als junger Arzt für die holländische Niederlassung nach Japan und hat japanische Ärzte in westlicher Medizin ausgebildet und darüber hinaus alles Wissenswerte über das bis dahin fast unbekannte Inselreich erforscht und für die westliche Welt erschlossen. Vielleicht sind sich die beiden Zeitgenossen 1826 sogar heimlich begegnet, als Siebold an der »Hofreise« der holländischen Delegation nach Edo, dem Sitz der Shogunatsregierung, teilnahm. Zur Illustration seines großen Werkes über Japan mit dem Titel »Nippon«, das Siebold nach seiner Rückkehr aus Japan verfasste, hat er viele Szenen aus den Skizzenbüchern von Hokusai verwendet, den sogenannten »Hokusai Manga«. Den Namen des Künstlers erwähnt er zwar nur sehr dezent an wenigen Stellen, aber das Werk ist unverkennbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 101
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
HOKUSAI UND SIEBOLD
Cornelia Morper
Hokusai und Siebold
Japan auf dem Weg in die neue Zeit
Außer der Reihe 74
Cornelia Morper
HOKUSAI UND SIEBOLD
Japan auf dem Weg in die neue Zeit
Außer der Reihe 74
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: Juli 2023
p.machinery Michael Haitel
Titelbild: »A Philosopher Watching a Pair of Butterflies. … This is a depiction of the Chinese philosopher Chuang Tsze who is known in Japan by the name of Sôshi … – Philipp Franz von Siebold (…) was so impressed with Pictures after Nature (Hokusai Shashin Gafu) that he returned to Europe with no less than six copies of it. In his efforts to make Hokusai's name known in the West he donated several copies to major libraries that included the Bibliothèque Nationale in Paris and, it appears, the Imperial Library in Vienna. Of the two copies he kept back, one fell into the hands of the collector Louis Gonse and is now in the Chester Beauty Library in Dublin.« [Matthi Forrer, »Hokusai, Prints and Drawings«, München 1991, S. 122/123]
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: Schaltungsdienst Lange oHG, Berlin
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 336 9
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 769 5
Cornelia Morper
Hokusai und Siebold
Japan auf dem Weg in die neue Zeit
Vorwort
Teil I
Katsushika Hokusai (1760–1849) und sein Werk
Ukiyo-e, »die Bilder der fließenden Welt« als neue Malschule
Die Herstellung eines japanischen Farbholzschnitts
Hokusai – Leben und ausgewählte Werke
1. Besuch des Shintō-Schreins Myojin in Kanda
2. Shinagawa
3. Schauer über der neuen Yanagi-Brücke
4. Der Kirschbaum
5. Der Hashirii-Brunnen in Ōtsu
6. Shamisen-Konzert im Freien
7. Musik und Tanz
8. »Klare Morgendämmerung bei Südwind«, Gaifū kaisei, der sog. »Rote Fuji«
9. Die Bogenbrücke von Okazaki
10. Die Brücke bei Fukui in Echizen
11. Ansicht des Fuji von Edo aus
12. Überfahrt über den Ōmigawa in einem schwimmenden Trog
13. Der Fuji in den Augen des Dichters
14. Blick auf den Fuji durch eine Schiebetür
15. Der Fuji durch ein Shintō-Torii gesehen
16. Der Fuji vom Strand aus gesehen
Ölgemälde aus Obuse
Teil II
Die Entdeckung des Hängerollbilds »Der Schmetterlingstraum des Zhuangzi«
Ein echter Hokusai? Gutachten über das Hängerollbild
Beschreibung des Hängerollbildes
Die Gerichtsverhandlung
Das British Museum in London übernimmt das Hängerollbild
Hokusai-Konferenz in Obuse
Teil III
Philipp Franz von Siebold (1796–1866)
Die Würzburger Familie Siebold
Siebolds erster Japanaufenthalt 1823–1829
Wissenschaftliche Bearbeitung seiner Sammlung
Der zweite Japanaufenthalt 1859–1862
Teil IV
Illustrationen aus den Skizzenbüchern Hokusai Manga in Siebolds Werk Nippon
Nippon Frontispiz
»Zinnebeeld des Vredes« – Sinnbild des Friedens
Teil V
Nippon und Hokusai Manga
Entdeckungsgeschichte von Japan
Japanische Kampfkünste
Die Pferde der Samurai
Pferd mit Pferdegeschirr und Zaumzeug
Bücherschrein Rinsō
Glockenturm Shōrō
Würdigung des Japanforschers Philipp Franz von Siebold
Literatur
Die Autorin
Bibliografie
Jörg Weigand
Hokusai – Cornelia Morper (*1940)
Vorwort
Katsushika Hokusai und Philipp Franz von Siebold – beide Persönlichkeiten haben wesentlichen Anteil, Japan, das Jahrhunderte lang von der Außenwelt abgeschottet war, in eine neue Zeit zu führen. Der Künstler Hokusai war aufgeschlossen für alles Neue und experimentierte schon vor der Öffnung des Landes in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit westlich beeinflussten Maltechniken, Perspektiven, Farben, und sogar mit holländischem Malpapier, das durch die kleine holländische Handelsniederlassung in Nagasaki nach Japan gelangt war. Siebold kam als junger Arzt für die holländische Niederlassung nach Japan und hat japanische Ärzte in westlicher Medizin ausgebildet und darüber hinaus alles Wissenswerte über das bis dahin fast unbekannte Inselreich erforscht und für die westliche Welt erschlossen.
Ich möchte mich in dieser Veröffentlichung diesen beiden Persönlichkeiten widmen, die in einer lockeren Verbindung standen und sich vielleicht sogar begegnet sind.
Bei meiner langjährigen Tätigkeit als »Sachverständige für Kunst und Antiquitäten Ostasiens« begegnete mir der japanische Künstler Katsushika Hokusai (1760–1849) immer wieder. Besonders hat mich ein Hängerollbild aus privatem Münchner Besitz beschäftigt, das sich nach eingehender Prüfung und nach einer aufsehenerregenden Verhandlung vor dem Amtsgericht München als ein originales Meisterwerk des Künstlers erwies, dem ich in meinem Gutachten den Titel »Der Schmetterlingstraum des Zhuangzi« gegeben habe. Es befindet sich inzwischen in der Japan-Sammlung des British Museum in London. Auch andere Werke des Künstlers Hokusai begegneten mir bei der Erfassung von Japan-Sammlungen und bei der Vorbereitung von Ausstellungen. Nur diese erarbeiteten Beispiele sollen hier die Darstellung bereichern.
Als Mitglied der Würzburger Siebold-Gesellschaft lag es nahe, dass der Würzburger Japanforscher Philipp Franz von Siebold (1769–1866) zu einem weiteren Forschungsschwerpunkt wurde. In seinem großen Werk über Japan mit dem Titel »Nippon«, das Siebold nach seiner Rückkehr aus Japan verfasste, verwendete er viele Illustrationen aus den Skizzenbüchern von Hokusai, den sogenannten Hokusai Manga.
Teil I
Katsushika Hokusai (1760–1849) und sein Werk
Hokusai gilt im Westen als der berühmteste Künstler Japans. Er war ein Meister des japanischen Farbholzschnitts Ukiyo-e, der »Bilder der fließenden Welt«, ein vielseitiger und überaus fleißiger Maler und Zeichner.
Sein bekanntestes Werk ist der Farbholzschnitt »Die große Woge vor Kanagawa«, Kanagawa oki nami ura, das Urbild eines Tsunami, aus der Serie »Die Sechsunddreißig Ansichten des Berges Fuji«, Fugaku sanjū-rokkei, von 1830/31, das unendlich oft reproduziert wurde und als Inbegriff der Kunst Japans gilt.1
Hokusai wird in einer Reihe neben Rembrandt, Leonardo da Vinci und Van Gogh zu den größten und genialsten Malern der Welt gezählt.
Die ersten japanischen Holzschnitte, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa bekannt wurden, waren einige Hefte von Hokusais Skizzenbüchern, den Hokusai Manga, die der Künstler Félix Bracquemond 1856 in Paris als Verpackungsmaterial für Porzellan entdeckte und die die Neugierde auf diese fremde, bunte Welt weckten.2 Die japanischen Farbholzschnitte vermittelten den staunenden Betrachtern im Westen ein buntes Bild von einem fast unbekannten Japan, das sich über zweihundert Jahre von der Außenwelt abgeschlossen hatte. Es war eine große Sensation, nicht nur für die Maler des Impressionismus, sondern für die ganze Kunstszene der damaligen Zeit.
Weniger bekannt ist, dass der Würzburger Japanforscher Philipp Franz von Siebold die ersten japanischen Holzschnitte, und zwar die bis dahin erschienenen Bände I bis VIII der Skizzenbücher Hokusai Manga, schon 1830 nach Europa brachte, als er nach seinem siebenjährigen Dienst als Arzt der holländischen Niederlassung Deshima in der Bucht von Nagasaki nach Holland zurückkehrte. Gleich nach seiner Rückkehr machte er sich an die Arbeit, das große umfassende Werk über Japan mit dem Titel »Nippon« zu verfassen. Er fand in den Hokusai Manga aufschlussreiche, bildliche Darstellungen, die Land und Leute des fernen Japan illustrierten. Die ersten Teile erschienen schon 1832 in Leiden in Holland, zweisprachig in Deutsch und Holländisch.
Abb. I, 1
Ukiyo-e, »die Bilder der fließenden Welt«, als neue Malschule
Da Hokusai diese Art der Darstellung von Themen des täglichen Lebens entscheidend mitprägte, sei hier eine kunsthistorische Einordnung von Ukiyo-e vorgenommen:
In Japan begann mit der Etablierung der Macht der Tokugawa-Militärmachthaber Shōgun zu Beginn des 17. Jahrhunderts eine neue politische und kulturelle Epoche, die durch Frieden und Wohlstand gekennzeichnet war, getragen von den unteren Gesellschaftsschichten der Handwerker und Händler. Das Machtzentrum hatte sich von der alten Kaiserstadt Kyōto nach Edo, dem heutigen Tōkyō, verlagert, das als Sitz der Shogunatsregierung einen enormen Bauboom erlebte. Die Fürsten Daimyō aus allen Teilen des Landes mussten regelmäßig am Hof des Shōgun erscheinen und eine würdige Residenz in Edo unterhalten. Mit ihnen kamen viele Samurai als Gefolgsleute in die Stadt. Sie bildeten die privilegierte und zunächst auch kulturtragende Gesellschaftsschicht. In Friedenszeiten wurden sie mit Verwaltungsaufgaben betraut und waren als Gehaltsempfänger von der Regierung abhängig. Da ihnen aber Handel und Gewerbe untersagt waren, verloren sie immer mehr an Einfluss.
Einen ungeahnten wirtschaftlichen Aufschwung erlebte die Bevölkerung in den Städten Chōnin. Sie wurde nun zum Träger einer neuen städtischen Kultur, was sich in der Literatur, im Theater und in der darstellenden Kunst spiegelte. Dank eines guten Schulwesens konnten jetzt auch die Kinder der einfachen Bürger lesen und schreiben lernen. Wegen der steigenden Nachfrage nach illustrierten Heften als Lesestoff nahm das Verlagswesen einen großen Aufschwung. Der Boden für die Entwicklung der Holzschnittkunst war bereitet, die anders als die traditionelle Malkunst immer als Handwerk betrachtet wurde.
Der neue Malstil der »Bilder der fließenden Welt« Ukiyo-e behandelte Themen aus dem täglichen Leben, was zur Unterhaltung der reichen Bürger beitragen konnte. Die bevorzugten Themen für die Farbholzschnitte waren das Kabuki- und Puppentheater, die Sumō-Ringkämpfe und vor allem das Leben in den Freudenvierteln der großen Städte mit ihren Teehäusern und Bordellen, wie Yoshiwara in Edo und Shimmachi in Ōsaka oder Shimabara in Kyōto. Hier fanden die Dichter, Schriftsteller und Künstler Anregungen und Motive für ihre Werke. Die Verleger befriedigten die Nachfrage ihrer Kundschaft nach den aktuellen Theaterprogrammen, nach den Bildern der Schauspieler der jeweiligen Saison, nach den Ansichten der hochrangigen Kurtisanen und der schönen Unterhaltungskünstlerinnen Geisha und Teemädchen, nach den sehr begehrten Bildern der neuesten Mode und Stoffmuster.
Durch die Politik des Sakoku, d. h. die Abschottung des Landes, waren den Japaner Reisen in fremde Länder untersagt. Umso mehr vergnügte man sich in der näheren und weiteren Umgebung im eigenen Land. In der Spätphase des Farbholzschnitts wird vor allem bei den Meistern Hokusai und Hiroshige die Landschaft zum bevorzugten Thema.
Die Herstellung eines japanischen Farbholzschnitts
Die Herstellung von japanischen Farbholzschnitten hatte sich in der Edo-Zeit ab 1630 zu einem florierenden Wirtschaftszweig entwickelt. Wichtige Voraussetzungen waren Papier mit fester Struktur und Saugfähigkeit und geeignete Farben. Für beides gab es in Japan eine lange Tradition und viele erfahrene Handwerker. Der Rohstoff für das Papier war die Rinde des Maulbeerbaumes, die unter Zusatz von Pflanzenextrakten und Leim zu einem festen Brei zerkocht und dann auf einer Matte aus Bambus getrocknet wurde. Damit später die Farben nicht ineinander laufen konnten, wurden die Bögen auf beiden Seiten mit einer Lösung aus Tierleim und Alaun bestrichen. Diese handgeschöpften Bögen hatten in der Regel eine Größe von ca. 50 x 37 Zentimeter. Durch Teilung und Zusammensetzen ergaben sich daraus die gängigen Formate für die Einzelblätter.
Um 1765 gelang nach einigen Vorstufen der Druck mit vielen Farben aus Mineral- und Pflanzenrohstoffen, Brokatdruck Nishiki-e genannt. Die ursprüngliche Farbkraft und das Zusammenspiel der Farben lassen sich oft nur noch erahnen, da nicht alle Farben lichtbeständig waren.
Der Herstellungsprozess war arbeitsteilig organisiert. Der Verleger trug das geschäftliche Risiko. Er beauftragte die Künstler, die man als Handwerker einstufte, mit einem Entwurf. Wenn dieser den Vorstellungen des Verlegers entsprach, wurde er an den Plattenschneider übergeben, dessen Arbeit sehr viel Geschick voraussetzte. Auf den Druckstock, der meistens aus Kirschholz bestand, wurde der Entwurf aufgelegt und so lange »gerubbelt«, bis sich die Tuschezeichnung auf den Holzstock übertragen hatte. Mit Messern, Sticheln und Meißeln umschnitt dann der Plattenschneider die Linien, bis die Vorzeichnung erhaben auf der Konturplatte stand. Für jede Farbe musste eine weitere Druckplatte angefertigt werden.
Den nächsten Arbeitsgang übernahm der Drucker, der die fertige Druckplatte einfärbte, das angefeuchtete Papier darauf legte und das Druckkissen Baren solange über die Druckplatte in kreisförmigen Bewegungen führte, bis die Farbpigmente ganz in die Struktur des Papiers eingedrungen waren. Damit die Platten genau übereinander druckten, waren an der rechten unteren Ecke und am rechten oberen Rand Passmarken Kentō angebracht. Bis zu zweihundert Abzüge waren in der Regel möglich.
Zu den Aufgaben des Druckers gehörte auch das Herstellen und Mischen der Farben. Als Neuerung wurde nach 1820 ein kräftiges Preußischblau auch Berliner-Blau Bero-ai genant, eingeführt, das von den Holzschnittmeistern wie Hokusai mit Begeisterung aufgenommen wurde.
In der Spätzeit des Ukiyo-e kam den Druckern von Landschaftsholzschnitten eine besondere Bedeutung zu. Ein besonderer Effekt war die Abstufung der Farbe zum Rand hin. Das wurde durch die Technik des Bokashi erzielt, indem vor dem Auftragen der Farben der Druckstock angefeuchtet wurde, sodass die Farben verlaufen konnten (Abb. I, 8–10).





























