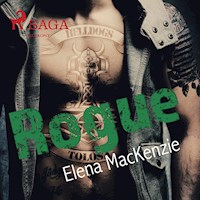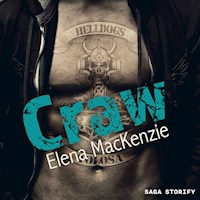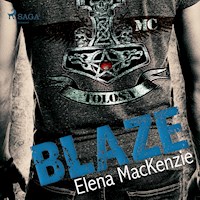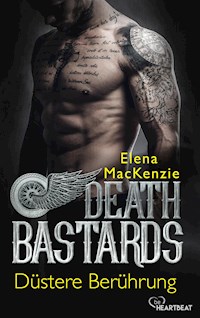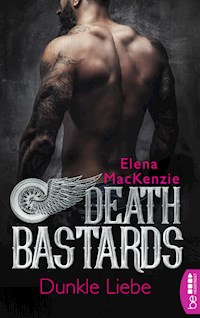5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für Holly scheint endlich alles gut zu werden: mit neuer Wohnung und neuem Job will sie für sich und ihre kleine Tochter Amy eine bessere Zukunft. Doch da hat sie die Rechnung ohne das Schicksal gemacht! Auf einmal klopft ein längst vergessenes Kapitel ihrer Vergangenheit an und reißt alte Wunden wieder auf: Tyler – und er ist fest entschlossen, Holly von seinen Gefühlen zu überzeugen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-98267-2
Überarbeitete Neuausgabe Juli 2016
© der Originalausgabe: Latos Verlag, Calbe/Saale 2014
© für diese Ausgabe: Piper Fahrenhein, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2016
© Piper Verlag GmbH, München 2016
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: © solominviktor/shutterstock.com
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Kapitel 1
Holly
»Wie gefällt dir dein neues Zimmer, Amy Miller?« Ich sah meine Tochter aufmunternd an, doch das beeindruckte sie kein bisschen.
»Ich mag mein altes lieber«, sagte sie und zupfte an dem braunen Bären herum, den sie von ihrer Cousine Rose zum Abschied bekommen hatte. Ich hockte mich neben sie und nahm ein Bilderbuch aus dem Umzugskarton, den sie begonnen hatte auszuräumen.
»Du kannst Rose doch noch immer besuchen. Und du wirst in der neuen Grundschulklasse viele Freunde finden.«
»Jetzt kann ich aber nicht mehr einfach nach nebenan gehen und mit Rose spielen.«
»Aber du kannst mit ihr telefonieren. Und gleich morgen kommt Rose mit ihrer Mum und dann helfen sie uns, die vielen Kisten auszuräumen.« Ich strich meiner fünfjährigen Tochter die hellblonden Strähnen aus dem Gesicht und legte eine Extraportion Fröhlichkeit in meine Stimme. »Ist dieser Holzboden nicht wunderschön? Kein löchriger Kunststoff mehr. Wir werden dir einen hübschen kuschelweichen Teppich kaufen.«
Amy sah mit leuchtenden tiefblauen Augen zu mir auf und lächelte. »Und hast du die Rutsche im Garten gesehen? Ob ich die wohl mal ausprobieren darf?«
»Ganz bestimmt darfst du das. In diesem Garten darfst du ab sofort spielen. Ist das nicht toll?«
»Jetzt gleich?« Amy sprang auf und drückte den zerschlissenen Teddy an ihre Brust.
Ich stand auch auf und ignorierte meine zitternden Muskeln, die müde und erschöpft von unserem anstrengenden Umzug waren.
»Jetzt. Aber lauf nicht weg. Ich muss noch ein paar Kartons aus dem Auto holen und dann komme ich und schau dir zu.«
Auch wenn Amy es noch nicht verstand, dass wir unser altes Zuhause verlassen mussten, ich war froh, dass ich ihr hier ein besseres und sichereres bieten konnte. Und das verdankte ich nur meiner Tante Amelia, die mir die Anstellung in der Universitätsbibliothek besorgt hatte, obwohl ich nicht einmal eine Ausbildung vorweisen konnte. Mit dem Geld, das ich als Aushilfe in der Bibliothek verdiente, konnte ich endlich die Miete für eine ordentliche Wohnung aufbringen. Eine Wohnung, in der der Boden nicht kaputt war, die Fenster dicht waren und es nicht schimmelte. Eine Wohnung weit weg von dem Horror, den Amy jeden Tag mitbekommen haben musste in den letzten sechs Monaten.
Ich lief die steinerne Treppe hinunter, zur Vordertür hinaus und lud mir den vorletzten Karton auf die Arme. Viel besaßen wir nicht, weswegen ich froh war, dass die Wohnung möbliert vermietet wurde. Ich warf einen Blick auf die beiden Fenster in der unteren Etage und lächelte zufrieden. Die Wohngegend hier war ruhiger, trotzdem nicht völlig abgelegen und bis zur Uni würde ich sogar zu Fuß gehen können. Ein Auto konnten wir uns nämlich nicht leisten. Der kleine grüne Suzuki Swift, mit dem ich unsere Habseligkeiten hergefahren hatte, gehörte Amelia. Ich weiß gar nicht, was ich in den letzten sechs Jahren ohne sie gemacht hätte.
Meine Tante hatte mir oft geholfen, seit meine Mutter mich auf die Straße gesetzt hatte. Aber ich nahm ihre Hilfe nur ungern an, denn ich versuchte mit aller Kraft, meiner Mutter, Amelias Schwester, zu entkommen. Und Amelia setzte alles daran, mich dazu zu bewegen, dieser Frau zu verzeihen. Ich wusste nicht einmal, warum sie sich diese Mühe machte, ich kannte meine Mutter gut genug, um zu wissen, dass sie keinerlei Interesse an mir oder Amy hatte. Und was sie mir angetan hatte, war nichts, was man verzeihen konnte.
Ein gut aussehender junger Mann kam aus dem Haus. Er grinste über etwas, dann entdeckte er mich. Seine Hand glitt durch sein ohnehin schon unordentliches dunkelblondes Haar und er musterte mich und den Karton in meinen Armen nachdenklich. Er sah sexy aus in seinen ausgewaschenen Jeans, dem eng anliegenden T-Shirt und mit den leuchtenden braunen Augen. »Soll ich dir helfen?«
Ich schluckte verlegen und war dankbar, dass mein Gesicht durch die Sommertemperaturen und die Schlepperei schon glühte, so konnte er nicht sehen, wie ich vor Verlegenheit rot anlief. Ich hatte nämlich so gut wie keine Erfahrungen im Umgang mit dem anderen Geschlecht. Bis auf die mit Amys Vater und meinen zwei Ex-Kurzzeit-Beziehungen. Und über die wollte ich nicht nachdenken.
Ich war fünfzehn, als ich mit Amy schwanger wurde. Für Männer war in meinem Leben kein Platz. Natürlich hatte ich auch nach Amys Vater noch kurze Beziehungen gehabt, aber beide Männer hatten recht schnell das Weite gesucht, als sie von Amy und meiner Mutter erfuhren. Danach hatte ich es Amy zuliebe aufgegeben, mir Hoffnungen auf eine liebevolle Beziehung zu machen. Ich wollte nicht, dass Amy so aufwachsen musste wie meine Schwester Tina und ich. Mit ständig neuen Vätern, die unser Leben für wenige Wochen kreuzten, um uns dann wieder zu verlassen. Obwohl die wechselnden Liebhaber unserer Mutter wohl noch unser kleinstes Problem gewesen waren.
Amy sollte ein geregeltes Leben haben. Ein Leben ohne eisige Kälte, Selbsthass, Alkohol und Gewalt. Auch das war ein Grund für diesen Umzug. Sosehr ich meine vier Jahre ältere Schwester Tina und ihre sechsjährige Tochter Rose liebte, konnte ich Amy nicht länger Tür an Tür mit ihnen wohnen lassen. Amy hatte schon zu viel von dem mitbekommen, was Tinas und Roses Leben bestimmte. Und solange Tina sich nicht helfen lassen wollte, musste ich versuchen, Amy davor zu schützen. Und vielleicht konnte ich durch diesen Umzug auch Rose manchmal aus ihrer Hölle befreien. Zumindest hoffte ich das.
Ohne meine Antwort abzuwarten, nahm der junge Mann mir die Kiste aus den Armen. »Ich bin übrigens Ryan. Und die Schönheit, die dort oben so eifersüchtig beobachtet, was wir beide hier unten treiben, das ist meine Freundin Lucy.«
»Hallo Lucy«, sagte ich und winkte zu dem Fenster in der mittleren Etage hoch, aus dem eine junge Frau schaute und zurückwinkte.
Plötzlich quiekte sie auf und schreckte zurück, dann verschwand sie vom Fenster. Ich folgte Ryan mit dem letzten Karton in den Armen und hörte in dem Augenblick, in dem ich das Treppenhaus betrat, wie oben jemand neugierig fragte, was es denn hier unten Interessantes zu sehen gab.
Ich folgte Ryan die elf Stufen zur unteren Etage und ignorierte dabei den wohlgeformten Hintern in den tief sitzenden Jeans. Natürlich hatte auch ich Bedürfnisse und war nicht immun gegen das andere Geschlecht. Und oft wünschte ich mir, es wäre da jemand, der mich in die Arme nahm und mir zeigte, dass ich nicht wertlos war. Aber ich musste an Amy und meine Schwester denken. In meinem Leben kamen immer sie an erster Stelle. Und Männer hatten mir zu oft ihre dunklen Seiten gezeigt, um ihnen noch genug zu vertrauen und sie in Amys oder auch nur in meine Nähe zu lassen.
»In welches Zimmer damit?«, wollte Ryan wissen, der im Flur stehen geblieben war und sich nach mir umwandte.
»In das Kinderzimmer«, sagte ich und wies auf die Tür am Ende des Gangs.
Ryan grinste. »Das ist oben bei uns mein Zimmer, aber zur Zeit wohnt meine Mutter da.«
»Ja, zusammen mit deinem Schlagzeug«, sagte jemand hinter mir.
Mit hochgezogenen Augenbrauen wandte ich mich zu zwei jungen Frauen um, die im Türrahmen standen und mich genauso neugierig musterten wie ich sie.
»Hallo! Das ist Lucy und ich bin Anne«, begrüßte mich eine von ihnen. Sie hatte einen blonden Bob, der sie nicht nur frech, sondern auch sehr attraktiv aussehen ließ. Beide waren schlank und nicht besonders groß. Aber das war ich mit 169 Zentimetern Körpergröße ja auch nicht. Lucy hatte braunes welliges Haar und einen Ausdruck um ihre Augen, der mir sehr bekannt vorkam und mir zeigte, dass auch sie schon Dinge mitgemacht hatte, die kein Mensch erleben sollte.
Ich gab erst Anne und dann Lucy die Hand. »Holly, schön euch kennenzulernen. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, dass ich mir Ryan ausgeborgt habe.«
»Das ist kein Problem. Ryan ist es gewohnt, für Frauen seine Muskeln spielen zu lassen«, sagte Anne und grinste mich vielsagend an.
»Das ist wahr. Es ist nicht leicht, wenn man seinen eigenen Hühnerstall voll gackernder Hennen hat«, gab Ryan mit blitzenden Augen zurück, als er aus dem Kinderzimmer kam.
»Gib es doch zu, du liebst es, mit drei Frauen zusammenzuwohnen«, meinte Lucy und knabberte aufreizend auf ihrer Unterlippe.
»Das würde ich, wenn eine von euch kochen könnte, meine Wäsche waschen würde …«
Anne hielt sich vor Lachen den Bauch und sah mich herausfordernd an. »Das Erste, was wir seiner Mutter beigebracht haben, als sie bei uns eingezogen ist, war: Auch wenn er dein Sohn ist, wir sind eine WG und in dieser macht jeder seinen eigenen Dreck weg. Es ist ihr nicht leichtgefallen, ihren Sohn nicht mehr zu bemuttern, aber mittlerweile macht es ihr sehr viel Freude, Ryan seine Sachen selbst waschen zu lassen.«
Ich warf Ryan einen flüchtigen Seitenblick zu und musste auch lachen, als ich seinen verkniffenen Gesichtsausdruck sah. Der arme Kerl weckte tatsächlich Mitleid in mir. Er wohnte schon in einer frauendominierten Umgebung und nun hatte ich auch noch vor, ihm vier weitere vor die Nase zu setzen.
»Wenn wir dir helfen können, musst du dich natürlich nicht zurückhalten. Du darfst jederzeit bei uns klingeln. Wir Mädchen müssen doch zusammenhalten«, meinte Lucy. Sie trat neben Ryan und schmiegte sich an seine Seite. »Und ich hab auch kein Problem damit, ihn dir auszuborgen. Um Löcher in die Wände zu bohren, natürlich.«
Ich musste lächeln, als Lucy noch einmal betonte, dass sie ihn mir nur für Männerarbeiten leihen würde.
»Dann frag lieber Danny – das ist einer unserer Freunde, den du sicher auch bald kennenlernen wirst –, der ist handwerklich nicht vollkommen unbegabt.« Anne kicherte.
»Ich kann Löcher in Wände bohren«, verteidigte sich Ryan.
»Ja, kannst du.« Lucy strich ihm tröstend über den Oberarm. Die kleine Gruppe war mir sofort sympathisch mit ihren Neckereien. Es fühlte sich angenehm an, mit ihnen hier zu stehen. Ich hatte noch nie richtige Freunde gehabt und schon lange keinen Kontakt mehr zu anderen Erwachsenen außer meiner Tante Amelia und meiner Schwester Tina. Nun hoffte ich, dass sich das bald ändern könnte. Vielleicht könnte ich genug Vertrauen aufbringen, um Lucy, Anne und Ryan in unser Leben zu lassen.
Wenn Amy sich hier wohlfühlen sollte, dann musste ich das sogar versuchen. Wie sollte sie lernen, anderen Menschen zu vertrauen, wenn ihre Mutter es nicht schaffte. Es wurde für uns beide Zeit, unser zurückgezogenes, einsames Leben hinter uns zu lassen. Mit einer freundschaftlichen Nachbarschaft könnten wir einen Anfang wagen. Ich erschauerte innerlich, denn es hatte in meinem Leben schon einmal jemanden gegeben, der versucht hatte, mich aus meinem Schattendasein zu holen. An diesen Jemand, so hatte ich mir auferlegt, wollte ich nicht mehr denken. Und trotzdem war er es, von dem ich träumte, wenn ich mich nach Berührungen sehnte.
Amy kam lachend zur Terrassentür im Wohnzimmer hereingelaufen und blieb verwundert neben mir stehen, als sie die drei Fremden in unserer neuen Wohnung sah. Sie schmiegte sich an meine Seite und sah mich fragend an.
»Amy, das sind Anne, Ryan und Lucy. Sie wohnen in der Wohnung über uns. Wie gefällt dir der Garten?«
»Der ist ganz super! Vor allem die Rutsche ist cool!« Amy entspannte sich neben mir. »Hallo«, sagte sie. »Ich bin Amy. Ich gehe jetzt in die Primary School. Ich kann schon meinen Namen schreiben.«
»Das ist toll«, sagte Anne. »Deine Mama ist bestimmt stolz auf dich.«
Ich presste die Lippen fest zusammen. Auch nach mehr als fünf Jahren rechnete ich noch immer damit, dass ich merkwürdige Blicke ernten würde, wenn fremde Menschen – besonders Menschen in meinem Alter – mitbekamen, wie jung ich gewesen sein musste, als ich mit Amy schwanger wurde. Bisher hatte ich meistens zumindest abschätzige Blicke geerntet. Doch unsere neuen Nachbarn schienen anders zu sein. Alle drei lächelten Amy freundlich an und gaben ihr die Hand.
»Wenn du Hilfe brauchst beim Auspacken, wir hätten Zeit«, schlug Lucy vor.
»Nein, danke. Ich bin völlig erledigt. Heute möchte ich mich nur noch auf dieses riesige Sofa fallen lassen und morgen kommt meine Schwester, um mir zu helfen.« Ich zeigte durch die Tür zum Wohnzimmer auf ein wirklich monströs großes dunkelbraunes Sofa im Kolonialstil. Die ganze Wohnung war in afrikanischem Stil eingerichtet. Vor dem Sofa lag ein künstliches Zebrafell, darauf stand ein rustikaler Couchtisch, die Schränke waren aus dunkelbraunem Echtholz. Meine Vermieterin stammte aus Uganda und hatte ein Stück ihrer Heimat in diese Wohnung einfließen lassen. Da alles miteinander harmonierte, konnte man sich hier wirklich wohlfühlen. Vielleicht lag es aber auch daran, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben in einer Wohnung leben würde, in der die Schranktüren nicht herausgebrochen waren, die Wände nicht abgewohnt und schmutzig und die Polstermöbel löchrig.
»Das mit dem Sofa verstehe ich«, sagte Lucy und rollte mit ihren dunklen Augen. »Wir wohnen auch erst knapp ein Jahr hier.«
»O ja! Und wir hatten damals keine Hilfe von gewissen Personen, die wir namentlich nicht erwähnen möchten«, ergänzte Anne.
Ryan grinste schief, schwieg aber.
»Aber wir könnten uns morgen wenigstens um Amy kümmern. Ryan und seine Kumpel haben ihren Spieleabend und wir könnten jede weibliche Unterstützung gut gebrauchen.«
Zweifelnd sah ich Lucy an. Ich hatte kein gutes Gefühl dabei, Amy fremden Menschen zu überlassen, doch Amy hüpfte glücklich vor mir herum. Für mich war es noch neu, meine Tochter aus meiner schützenden Umarmung zu lassen. Aber ich gab mir Mühe, es zu tun, weil sie nicht so zurückgezogen leben sollte wie ich in meiner Kindheit.
»Bitte, Mami! Bitte!« Sie sah mich flehend an. Hätte ich mir nicht eben erst selbst das Ziel gesetzt, zu unseren neuen Nachbarn Vertrauen zu fassen, dann hätte ich abgelehnt. Aber Amelia erwartete schon lange von mir, dass ich Amy mehr Freiraum lassen sollte, damit sie sich entfalten konnte. Und meine Tochter forderte genau diesen Freiraum in letzter Zeit immer öfter ein, wenn sie auch einmal etwas ohne mich unternehmen wollte. Außerdem konnte ich Amy nicht enttäuschen, vielmehr versuchte ich immer, sie glücklich zu machen. Und es wäre eine gute Übung für uns beide. Zumindest wäre sie nicht weit weg, denn uns würde nur eine Zwischendecke trennen.
»Also gut, du darfst Lucy und Anne morgen unterstützen.«
Lachend tanzte Amy um uns herum, während ich mich bei unseren neuen Nachbarn bedankte. Lucy zwinkerte Amy noch einmal verschwörerisch zu, bevor alle drei uns in der mit Kartons vollgestellten Wohnung allein ließen. Seufzend schloss ich die Tür und wandte mich meiner Tochter zu.
»Und jetzt nimmst du ein Bad«, sagte ich und begann Amy vor mich her in Richtung Badezimmer zu treiben. Ein Badezimmer, in dem es eine Dusche und eine Wanne gab. Auch das war neu für uns. Bisher mussten wir uns nur mit einer Dusche zufriedengeben, die dank alter kaputter Fliesen in Dunkelbraun alles andere als ein Wohlfühltempel war.
Während Amy im warmen Wasser planschte, räumte ich einen Karton mit Pflegeprodukten aus und schmiedete mit ihr Pläne für das Kinderzimmer und für ihren ersten Tag in der neuen Schule. Kaum im Bett, schloss Amy die Augen und schlief. Ich musste ihr nicht einmal eine Gutenachtgeschichte vorlesen. Dieser Tag war so aufregend für sie gewesen, dass er an ihren Kräften gezehrt hatte. Zuerst hatte sie viel geweint, als sie sich von Rose verabschieden musste, doch dann hatte sie Spaß beim Tragen der Kartons entwickelt.
Ich wollte nicht, dass sie in der Nacht aufwachte und sich fremd fühlte, also beschloss ich, neben ihr zu schlafen, und zog ihren warmen, zarten Körper an mich. In der Dunkelheit stahlen sich Zweifel in meine Gedanken: Was war mit Rose? Was mit meiner Schwester? War es richtig, zu gehen und beide schutzlos zurückzulassen? Ein wenig fühlte ich mich, als hätte ich sie im Stich gelassen, obwohl Tina meine Hilfe gar nicht wollte. Die Gewissensbisse und die Zweifel hielten mich umschlungen, bis ich endlich einschlief.
Damals
Als es endlich zum Unterrichtsende klingelte, warf ich eilig meine Hefte und Bücher in den schäbigen, abgenutzten Rucksack, den ich nun schon seit vier Schuljahren besaß. Normalerweise versuchte ich möglichst immer die Erste zu sein, die es aus dem Schulgebäude schaffte, damit ich nicht an den anderen vorbei oder mich durch das Gedränge im Korridor schieben musste. Ich hasste den Kontakt mit anderen Menschen. Nicht die Berührung, vielmehr die Wechselbeziehung mit anderen. Es war mir unangenehm. Ich wollte einfach meine Ruhe haben. Sie sollten nichts von meinen Problemen mitbekommen und ich wollte nichts von ihren wissen.
»Holland? Würdest du bitte einen Moment zu mir kommen?« Ich warf Ms Sanders einen frustrierten Blick zu und seufzte leise. Unsanft warf ich mir den Rucksack über die Schulter und ging schleichend die wenigen Schritte nach vorne zum Lehrerpult. Ich hielt den Blick gesenkt, denn ich ahnte schon, was gleich kommen würde. Meine viel zu feinen glatten Haare hingen wie ein schützender braun-blonder Vorhang vor meinem Gesicht. Der einzige Schutzschild, den ich besaß.
»Ja?« Ich hob langsam den Kopf, als das Klassenzimmer sich leerte. Ms Sanders sah mich mit zusammengepressten Lippen besorgt an.
»Hast du mit der Vertrauenslehrerin gesprochen?« Ihr Tonfall klang streng, obwohl sie das eigentlich nicht war. Sie war die freundlichste Lehrerin, die wir an der Schule hatten. Trotzdem konnte ich ihr nicht sagen, warum meine Noten nicht besser, warum meine Kleider geflickt und viel zu groß oder zu klein und meine Arbeitsmaterialien andauernd unvollständig waren. Aber ich wusste, dass sie es ahnte. Zumindest vermutete sie etwas.
»Ich habe keine Lust dazu, mit irgendwem zu reden«, sagte ich und schlug bewusst einen trotzigen Ton an. Angebotene Hilfe wies ich grundsätzlich zurück und tat so, als wäre ich einfach nur schwierig. Als Problemkind zu gelten war immer noch besser, als in eine Pflegefamilie zu kommen. Dann doch lieber meine Mutter. Nur noch dreieinhalb Jahre, dann wäre ich volljährig und könnte gehen, wohin auch immer ich wollte. »Ich verstehe gar nicht, warum niemand akzeptieren kann, dass ich bin, wie ich bin. Ich stehe auf meinen Look.«
»Das möchte ich dir auch gar nicht ausreden, wenn du wirklich so aussehen willst. Es gibt Schlimmeres als ein bisschen … punkig zu sein.« Sie zwinkerte mir aufmunternd zu und ich schob abwehrend die Hände in die Taschen der einzigen Schuluniformhose, die ich besaß. Ursprünglich gehörte diese Schuluniform mal Tina, also war sie sogar noch älter als der Rucksack. »Aber deine Schulsachen und deine schulischen Leistungen, die kann ich leider nicht ignorieren.«
Ich zuckte lässig mit den Schultern und musterte das Sonnenlicht, das im kupferroten Haar meiner Lehrerin tanzte. Sie war schön. Das fanden auch sämtliche Jungs der Klasse. Keiner Lehrerin hörten sie mit solcher Begeisterung zu wie ihr. Sie trug immer diese engen Bleistiftröcke, die sich an ihre Kurven schmiegten. Manchmal träumte ich heimlich davon, auch so toll auszusehen. Das würde wohl nie passieren. Selbst wenn ich irgendwann einmal einen solchen Rock besitzen würde, war ich viel zu dünn, um ihn so auszufüllen. Ich war eine hagere, schlaksige Vierzehnjährige. An mir war nichts attraktiv, aber das war eigentlich auch ganz okay. Das machte mich unauffällig und passte viel besser zu mir und meiner Vorliebe, als Außenseiterin zu gelten, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, von anderen Menschen wahrgenommen zu werden. »Die anderen Lehrer ignorieren es auch.«
»Ich weiß. Hör zu, ich möchte dir gerne helfen, nur musst du mir entgegenkommen.«
Wütend funkelte ich sie an. »Ich brauche keine Hilfe, mir geht es gut.« Ohne abzuwarten, wandte ich mich ab und verließ das Klassenzimmer. So freundlich sie auch war, ich musste ihr zuvorkommen. Ich hatte noch keine Ahnung, wie ich es anstellen sollte, aber ich musste mehr Geld für Schulsachen auftreiben. Keiner durfte das Gefühl bekommen, dass es mir zu Hause an irgendwas fehlte. Es war so schon schwer genug, die Alkoholsucht meiner Mutter vor den Jugendamtmitarbeitern herunterzuspielen und ihnen vorzumachen, dass es mir bei ihr gut ging.
Eilig lief ich den langen Korridor entlang. Meine Schritte hallten durch den leeren Flur. Ich stieß die Eingangstür auf und blinzelte gegen das Sonnenlicht an. Der Schulhof war leer, aber am unteren Ende der Stufen stand Lea mit ihren neuen Freundinnen. Ich stieß frustriert die Luft aus und spannte mich innerlich an. Sie war mal meine Freundin gewesen. Schon fast wie eine große Schwester. Die Einzige, die so ziemlich alles über mich wusste. Bis zu dem Tag, an dem meine Mutter nicht die Finger von ihrem Vater lassen konnte. Ich fühlte mich schuldig deswegen. Wahrscheinlich tat es deswegen mehr weh, weil ich mir einredete, dass ich es hätte verhindern müssen. Aber ich war damals erst zwölf gewesen, was hätte ich schon tun können? Jetzt ignorierten wir uns, so gut es ging. Es gab da nur ihre verstohlenen Blicke und geflüsterten Kommentare ihrer neuen Freunde.
»Holland, heute scheint dir nicht nur das Waschpulver ausgegangen zu sein.« Die Mädchen kicherten. Mit gestrafften Schultern ging ich an ihnen vorbei und hielt meine Fäuste fest an die Seiten gedrückt.
Ich lief um die Ecke der Sporthalle und damit aus dem Sichtfeld der Gruppe, die mir jeden verdammten Tag meines Lebens solche Sprüche an den Kopf warf. Schlimm waren nicht die Sprüche selbst, sondern die Wahrheit dahinter.
Bevor ich nach Hause gehen konnte, musste ich noch zum kleinen Kiosk an der Ecke und meiner Mutter ihre tägliche Flasche Whisky kaufen. Damit verstießen der Verkäufer und ich zwar gegen das Gesetz, aber wir waren beide übereingekommen, dass es so das Beste wäre. Für ihn war es unangenehm, wenn meine Mutter in seinem Laden randalierte oder Kunden wegen Geld anbettelte, und für mich war es peinlich, wenn sie das bei Müttern und Vätern meiner Mitschüler tat. Von der Secondary School bis nach Hause lief ich etwa zwanzig Minuten. Die reichten, um den Schultag aus meinem Kopf zu bekommen und zurück in mein noch beschisseneres Privatleben einzutauchen.
Jonathan, der Besitzer des kleinen Kiosks, begrüßte mich mit einem traurigen Lächeln. »Schule schon wieder aus?«
»Ja, gut so«, murmelte ich und kramte das Geld aus meinem Rucksack.
»Das kannst du heute stecken lassen, Kleine. Deine Mutter war schon hier und hat ihre Ration geholt.«
»Dann hat sie es wohl wieder mal nicht abwarten können«, knurrte ich wütend, weil ich wusste, dass sie gleich kaum ansprechbar sein würde. Und ich hatte noch immer das Problem mit den fehlenden Arbeitsmaterialien. Ich warf einen Blick auf das Geld in meiner Hand und lächelte matt. Sie würde sich bestimmt nicht daran erinnern können, dass ich das Geld für ihre heutige Flasche noch hatte. Zumindest würde es für die wichtigsten Sachen reichen.
So beschloss ich, nicht sofort nach Hause zu gehen, um das unvermeidliche Drama noch etwas hinauszuschieben und die Arbeitshefte für die Schule zu besorgen. Ich konnte es mir einfach nicht leisten, Ärger in der Schule zu haben. Mir hatte die kurze Gebärde der Jugendamtsleiterin von vor acht Monaten gereicht, als diese mir damit gedroht hatte, mich von zu Hause wegzuholen, wenn ich weiter so aggressiv wäre und die Schule nicht ernster nehmen würde. Und das durfte nicht passieren, weil das auch hieß, dass ich den einzigen Menschen verlieren würde, der mir noch was bedeutete. Meine Schwester Tina. Ich besuchte sie, sooft ich konnte, wenn ich zu Hause mal rausmusste. Und wer weiß, wo das Jugendamt mich hinstecken würde. Vielleicht an einen Ort, wo ich Tina nicht mehr sehen durfte.
Ich schaffte es, den Nachmittag im Supermarkt zu vertrödeln. Gegen Abend schlich ich mich die schäbigen Stufen zu unserer Wohnung hinauf. Das Haus sah von außen genauso beschissen aus wie von innen. Die Fenster der leer stehenden Etage unter uns hatte man mit Brettern zugenagelt, die Wände im Hausflur waren beschmiert und mit Graffiti besprüht. Von unserer Wohnungstür blätterte die dunkelgrüne Farbe ab, darunter kam ein Rostbraun zum Vorschein. Ich atmete tief ein und bereitete mich auf die Beschimpfungen vor, die mich zu Hause immer erwarteten, steckte den Schlüssel ins Schloss und stieß ein erschrockenes Keuchen aus, als mir die Tür aus der Hand gerissen wurde. Erstaunt sah ich meine auf Hochglanz polierte Mutter an. Geschminkt und in ihrem besten Blümchenkleid stand sie mit frisch gewaschenen, wallenden blonden Haaren vor mir und strahlte mich aus himmelblauen Augen an. Sie konnte so unschuldig aussehen wie ein Engel, aber das war sie nicht.
»Da bist du ja endlich. Ich warte seit Stunden. Du musst mir helfen!«
Ich blickte sie nur verständnislos an und musterte ihre schlanke, gepflegte Erscheinung. Zuletzt hatte ich sie so gesehen, als sie sich für meinen Vater hübsch gemacht hatte, um ihn an ihrem siebten Hochzeitstag zu überraschen. Das war der Tag, an dem er ihr eröffnet hatte, dass er eine andere Frau liebte. An diesem Tag hatte sie auch das letzte Mal so gestrahlt. Normalerweise begrüßte mich eine sturzbetrunkene, keifende, heruntergekommene Frau, die für ihre Tochter nichts weiter als Abscheu empfand, weil sie sie an ihre verlorene Liebe erinnerte – den Mann, der sich seit seinem Auszug nie wieder bei uns gemeldet hatte.
»Was ist los?«, wollte ich unwirsch wissen. Sie packte mich am Oberarm und zerrte mich in die Wohnung. Sie roch nach Alkohol, aber das tat sie immer. Trotzdem schien sie nicht betrunken zu sein. So erlebte ich sie eigentlich nur ganz frühmorgens und wenn sie eins ihrer Dates hatte, die meist damit endeten, dass sie und der Kerl besoffen im Bett landeten.
»Du musst mir beim Aufräumen helfen. Die Wohnung muss blitzblank sein.«
Ich sah mich mit hochgezogenen Augenbrauen um. »Diese Wohnung wäre ein Scheißhaufen, wenn ich sie nicht immer putzen würde«, sagte ich wütend. Bemängelte sie jetzt auch noch meine Haushaltsführung? Verdammt, ich war die Tochter. Das war eigentlich ihr Job. Nicht ich sollte sauber machen für den Fall, dass jemand vom Jugendamt mal nach dem Rechten sehen wollte, sondern sie. Aber in der Realität, in der ich lebte, war ich Mutter, Putzfrau, Köchin und Schülerin in einem.
»Kommt das Jugendamt, um sich von deinen Fähigkeiten als Mutter zu überzeugen?« Es war die Schule, die das Amt damals eingeschaltet hatte, deswegen war es mir so wichtig, mich in der Schule möglichst unauffällig zu verhalten. Eigentlich hätten dazu auch gute Noten gehört. Aber die kamen nicht von allein. Und solange ich mich um meine Mutter kümmern musste, blieb kaum Zeit zum Lernen.
Ich sammelte die Kleidung auf, die überall herumlag. Anscheinend hatte meine Mutter ihren gesamten Kleiderschrank anprobiert. Meine Mutter folgte mir.
»Nicht das Amt. Harry.«
»Muss ich wissen, wer das ist?« Ich warf eine braune Decke über den zerrissenen Stoff des terrakottafarbenen Sofas und räumte ein Whiskyglas und einen Teller mit einem angebissenen Sandwich in die Küche, die direkt an das Wohnzimmer grenzte. Unsere Küche war winzig, eigentlich nur eine Nische, in die gerade mal zwei Hängeschränke, ein Herd und eine Spüle passten. Ich spülte das Geschirr unter fließendem Wasser und räumte es abgetrocknet in einen der Hängeschränke.
Zurück im Wohnzimmer, wischte ich den kleinen Couchtisch ab und richtete ihn auf den alten zerfledderten Taschenbüchern aus, die eines der kurzen Beine ersetzten.
»Du musst noch das Zimmer von deiner Schwester herrichten. Sie braucht es ja nicht mehr. Die dumme Kuh hat uns ja verlassen.«
Ich funkelte meine Mutter hasserfüllt an. »Sie hat dich verlassen, nicht mich.«
Meine Mutter ignorierte meinen Kommentar und schob mich in Tinas ehemaliges Kinderzimmer. Ich beneidete meine vier Jahre ältere Schwester dafür, dass sie schon alt genug war, um dieses Leben hinter sich lassen zu können. Sie hatte ihre eigene Wohnung und bekam gerade ihr erstes Baby. Ihre Wohnung machte vielleicht nicht viel mehr her als diese, aber sie schien glücklich zu sein.
»Jetzt mach schon!«, kommandierte meine Mutter.
»Warum machst du es nicht selbst? Du wirst doch wohl noch einen Staubwedel in die Hand nehmen können!«, schrie ich sie an. In dem Moment klingelte es an der Tür.
Meine Mutter rannte los, um den Summer zu betätigen, und ich warf mies gelaunt einen Blick nach unten vor das Haus, wo ein klappriger Ford parkte. Hinter dem Ford stand ein weiß-grünes Motorrad und darauf saß ein Typ von etwa siebzehn Jahren, zu jung für ein Motorrad, und starrte unzufrieden auf das Haus. Ein Mann trat unten aus dem Eingang, öffnete den Kofferraum des Ford und förderte einen Karton zutage. Dann trat meine Mutter auf die Straße, sie hüpfte und klatschte in die Hände und führte sich auf wie ein kleines Mädchen. Flüchtig küsste der Kerl sie auf die Wange, sagte etwas zu dem Jungen auf dem Motorrad und verschwand mit meiner Mutter im Gebäude. Der Typ sah wieder zum Haus, dann entdeckte er mich hinter der Scheibe und sein Blick verharrte einen Moment. Erschrocken zuckte ich zurück und trat vom Fenster weg. Auch wenn mein Blick noch so flüchtig war und ich ihn nur von Weitem gesehen hatte, in meinem Magen hatte es sofort geflattert und so was hatte ich noch bei keinem anderen Jungen jemals empfunden. Mein Herz klopfte spürbar und ich biss mir auf die Unterlippe. Würde er hier bei uns einziehen?
Kapitel 2
Holly
Nachdem Amy ihr Regal mit ihren Plüschtieren und Brettspielen bestückt hatte, hielt sie am nächsten Morgen nichts mehr in der Wohnung. Sie riss aufgeregt die Terrassentür zum Garten auf und rannte auf die Rutsche zu. Ich räumte unser Frühstücksgeschirr in die Spülmaschine und schloss die Tür in dem Augenblick, als es klingelte. Noch einmal warf ich einen Blick auf Amy, die gerade quiekend wie ein Schweinchen die Rutsche heruntersauste und unten plumpsend auf ihrem Hintern landete. Am Himmel zogen leichte Wolken auf, aber ich hoffte, dass das Wetter durchhalten würde, dann wäre Amy beschäftigt, während ich mit Tina die letzten Kartons ausräumte. Und Rose würde sich bestimmt auch über ein paar Stunden im Garten freuen, bevor sie wieder zurückmusste in ihr einsames Kinderzimmer.
Ich ging, um die Tür zu öffnen, und rechnete fest damit, dass es Rose und Tina wären. Doch vor der Tür standen Anne und Lucy und grinsten mich fröhlich an. In ihren Händen hielten sie Kaffeebecher. »Guten Morgen, Nachbarin!«, begrüßten mich beide strahlend.
Ohne meine Einladung abzuwarten, betraten sie meine neue Wohnung und liefen zielstrebig ins Wohnzimmer. Ich zog die Augenbrauen hoch und fühlte mich etwas überrumpelt. Aber dann rief ich mir in Erinnerung, dass ich ab jetzt nicht mehr zurückgezogen leben, sondern Amy zuliebe mehr Normalität in unser Leben bringen wollte. Und Besuche von Nachbarn gehörten zu einem normalen Leben doch dazu. Ich zuckte mit den Schultern, warum auch nicht? Meine Kaffeemaschine steckte noch in irgendeinem Karton. Nervös folgte ich den beiden und setzte mich neben Lucy auf das Sofa.
»Ihr habt Kaffee mitgebracht. Wie nett«, sagte ich unsicher und Anne grinste breit.
»Kaffee ist eine Beleidigung für das, worum es sich in diesen Tassen handelt. Das ist feinster italienischer Latte macchiato. Sagt zumindest Lucy. Sie hat sich schon wieder eine neue Maschine gekauft.«
»Was heißt hier schon wieder, die alte war sechs Monate alt und diese kann sogar Pads, Kapseln und frisch gemahlenes Pulver verarbeiten. Nicht zu vergessen die Herstellung von schaumigem Milchschaum.«
Ich nahm lachend eine der Tassen entgegen, auf denen wirklich eine weiße Schaumkrone thronte, und schnupperte interessiert daran. »Ich werde euch leider nicht sagen können, ob das nun ein besonderer Kaffee ist oder nicht. Ich kenne nur Kaffee aus der Filtermaschine. Den billigsten gemahlenen Kaffee, den man für Geld bekommen kann.«
»Das ist wirklich traurig«, meinte Anne mit bedauerndem Gesichtsausdruck.
»Ach, das ist nicht traurig. Dann kommen wir eben öfter mit einer Tasse runter«, sagte Lucy und prostete mir mit ihrer Tasse zu. Ich schwankte zwischen Freude darüber, wie angenehm locker die beiden waren, und dem Gefühl, in einer neuen unbekannten Situation zu stecken. Nervös tippte ich mit meinem Zeigefinger gegen den Tassenrand und versuchte gleichzeitig, meine Unsicherheit zu überspielen.
»Sag bloß Ja, sonst wirst du es bereuen.«
»Es wäre mir ein Vergnügen«, murmelte ich höflich und löffelte etwas Schaum beiseite, um an den Kaffee zu kommen.
»Du musst den Schaum in den Mund schieben. Der ist doch das Beste!«, rief Lucy flehend.
»Oh, entschuldige. Ich dachte, der Kaffee wäre an Kaffee das Beste.«
Anne kicherte hinter vorgehaltener Hand. »Glaub mir, es ist der Schaum. Sie experimentiert ständig an der Konsistenz herum.«
»Ich mag ihn schön fest, aber nicht zu sehr. Die Bialetti-Kaffeemaschine macht das einfach super.« Lucy wies auf den Löffel in meiner Tasse. Ich nahm ihn und schaufelte mir einen Berg Schaum in den Mund, der sich sofort auflöste und seufzte genüsslich.
»Ja, perfekt«, bestätigte ich, obwohl ich keine Ahnung hatte, ob der Schaum das wirklich war, da ich keine Vergleichsmöglichkeiten besaß. Dann kostete ich von dem Kaffee und stöhnte erstaunt auf, als der nussige Geschmack sich auf meiner Zunge entfaltete. »Der ist wirklich gut«, murmelte ich und schnupperte noch einmal.
»Ja, gestern frisch vom Röster geholt, eben frisch gemahlen und dann in der Siebträgermaschine aufgebrüht. Frischer geht es nicht mehr.« Lucy sah wirklich zufrieden aus.
Anne lachte laut auf und verdrehte hinter Lucys Rücken die Augen. »Es gibt hier mehrere Starbucks. Sie könnte es so viel einfacher haben. Natürlich sollte noch erwähnt werden, dass sie in einem Café arbeitet, wo es auch eine wirklich tolle Maschine gibt.«
»Das stimmt nicht. Er ist frischer, wenn man ihn selbst macht«, sagte Lucy schmollend. Lucy hatte ein schmales Gesicht, wundervolle ausdrucksstarke Wangenknochen und eine kleine schmale Nase. Wie eine Elfe. Anne dagegen wirkte eher wie ein unschuldiger Engel mit ihrem runden Gesicht, das keinesfalls dick war. Es war einfach puppenhafter. Und ihre Nasenspitze war ein klein wenig knubbelig, passte aber perfekt zu ihr und ließ sie frech wirken.
»Und was treibt ihr beiden so, wenn ihr nicht über Kaffee debattiert?«, hakte ich amüsiert nach.
»Studieren.« Lucy warf Anne einen listigen Blick zu. »Und sie hat Dates, eine Menge davon.«
»Nur weil meine Mutter mich unbedingt an den Mann bringen will.«
»Ihr geht beide auf die Uni? Ich arbeite da ab Montag in der Bibliothek.«
»Im Swann Building?« Lucy sah mich interessiert an.
»Ja, genau.«
»Ich arbeite im Café im gleichen Gebäude.«
»Oh, das ist toll.«
»Ja, vielleicht kommst du mich ja mal besuchen.«
Ich presste die Lippen zusammen. »Ich werde kaum Zeit haben. Nach der Arbeit muss ich sofort los und Amy aus der Grundschule holen. Ich kann mir eine Nachmittagsbetreuung nicht leisten. Und am Abend ist sie sowieso immer hier.«
»Ich kann mir vorstellen, dass die Koordination von Kind und Job manchmal schwierig wird. Aber du kannst sie ja auch bei uns vorbeibringen, wenn es mal kneift«, schlug Lucy vor.
»Lucy ist ganz verrückt nach Kindern.«
Ich wich den abwartend fragenden Blicken meiner neuen Nachbarn aus. Obwohl ich zugestimmt hatte, dass Amy an diesem Abend zu ihnen gehen durfte, war ich mir nicht sicher, ob ich bereit war, daraus etwas Regelmäßiges zu machen. »Ja, mal schauen«, antwortete ich ausweichend.
»Also, wo können wir helfen?«, wollte Anne wissen und trank ihren Kaffee aus, bevor sie mich strahlend ansah und mir meine Tasse aus der Hand nahm.
»Eigentlich gibt es nicht viel zu tun. Meine Schwester Tina kommt gleich. Sie wird ihre Tochter mitbringen und daher ist auch Amy beschäftigt. Ihr helft mir doch schon, wenn ihr Amy heute Abend nehmt. Dann kann ich in aller Ruhe noch die letzten Überreste des Umzugs beseitigen«, warf ich versöhnlich ein, denn so sympathisch mir die beiden auch waren, ich nahm Hilfe von Außenstehenden nicht gerne an.
Ich wollte unbedingt immer auf eigenen Beinen stehen. Dann fühlte ich mich sicherer. Unabhängiger. Nie mehr wollte ich auf andere Menschen angewiesen sein. Dass ich damals, nachdem meine Mutter mich vor die Tür gesetzt hatte, bei Amelia gewohnt hatte, war mir noch heute unangenehm und es war ein Zugeständnis an mich selbst gewesen, das mich viel Überwindung gekostet hatte.
Durch die Alkoholsucht meiner Mutter war ich schon früh darauf angewiesen gewesen, mich selbst zu versorgen. Und mich dann in Amelias Obhut zu begeben war ein Schritt zurück gewesen, weg von der Unabhängigkeit, hin zu einer Frau, die sich um mich sorgte und ein Interesse an mir und Amy gezeigt hatte, das ich so nicht kannte. Es war schwierig für mich gewesen, das Ruder aus der Hand zu geben, aber Amelia war eine überfürsorgliche Glucke, die nicht zulassen wollte, dass ich zu früh erwachsen wurde. Was in Anbetracht der Tatsache, dass ich als Schwangere an ihre Tür geklopft hatte, fast ironisch wirkte. Aber hätte ich mich anders entschieden, hätte man mir das Baby nach der Geburt vielleicht sofort weggenommen. Und am Ende wäre ich trotz all meiner Vorsicht doch noch in irgendeiner Pflegefamilie weit weg von Tina gelandet. Das Jugendamt als Anlaufstelle war für mich nie eine Option gewesen. Es war der schlafende Riese, den ich immer gefürchtet hatte zu wecken. Das unbekannte Monster in meinen Albträumen.
»Okay, aber du musst nicht so schüchtern sein. In diesem Haus sind wir eine große nette Familie, damit das klar ist. Wenn du Hilfe brauchst, sind wir da«, belehrte Anne mich mit ernstem Gesichtsausdruck. Das Klingeln an der Tür rettete mich vorerst. Das Wort »Familie« rief bei mir eher unschöne Gefühle hervor, aber das konnten die beiden natürlich nicht wissen. Andererseits wäre es schön, endlich eine Art Familienleben für Amy zu haben. Meine Tochter brauchte etwas mehr Normalität, um die Schrecken der Vergangenheit beiseiteschieben zu können. Vielleicht war es bei ihr noch nicht zu spät. Bei mir schon. Ich würde den bitteren Geschmack von Familie – meiner Familie – nie mehr vergessen.
Lucy und Anne verabschiedeten sich von mir, nachdem sie mir das Versprechen abgerungen hatten, Amy am Abend auch wirklich zu ihnen hinaufzuschicken. Meine Schwester wirkte die ganze Zeit etwas verwirrt und ich hatte Mühe, ihr nicht mithilfe von Augenrollen klarzumachen, dass ich mit der Situation genauso überfordert war. Freundlichkeit waren wir beide nicht gewohnt. In unserem Leben gab es bisher nur einen Menschen, der uns Güte und Freundlichkeit hatte zukommen lassen, unsere Tante Amelia.
»Das war ja verrückt«, meinte Tina und wischte sich eine hellrote Strähne aus dem Gesicht, die sich in ihrem Mundwinkel verfangen hatte. Tina kam nach unserem Vater, zumindest soweit ich ihn in Erinnerung hatte: rotes Haar, Sommersprossen und grasgrüne Augen. Auch Rose hatte diese drei Merkmale geerbt. Sie hatte sich gar nicht erst lange bei uns Erwachsenen aufgehalten und war sofort zu Amy in den Garten gerannt.
»Da stimme ich dir zu. Heute Morgen standen sie mit Kaffee vor der Tür.«
Tina schlüpfte aus ihrer dünnen Strickjacke und hängte sie zusammen mit ihrer Handtasche auf einen Haken an der Garderobe. »Irre! Unsere alten Nachbarn waren rücksichtslose Nervensägen mit Dauerpartys. Übrigens, wir haben mit dem Bus nur zwanzig Minuten gebraucht.« Unsere alten Nachbarn waren drogenabhängige Punks, zu denen Rocco, Tinas Ehemann, trotz anfänglicher Distanz in den letzten Monaten Kontakte geknüpft hatte, um sich nicht alleine betrinken zu müssen.
»Ja, wir sind nicht aus der Welt«, bestätigte ich. Tina war zum ersten Mal in der Wohnung. Interessiert sah sie sich um. Ihre Augen wurden mit jedem Zimmer immer größer vor Überraschung. Diese Überwältigung empfand auch ich. Es war noch nicht richtig zu mir durchgedrungen, dass ich in so schönen Räumen jetzt wohnen würde. Aber diese Wohnung war der erste Schritt hin zu einem normalen Leben. Der Art Leben, das ich mir für Amy wünschte. So unbekannt und beängstigend diese Vorstellung für mich auch war. Ich wollte dieses Leben für uns beide. Es war an der Zeit, den Teufelskreis zu durchbrechen und die Erste in unserer verkorksten Familie zu sein, die Schluss machte mit Alkohol und Gewalt.
»Die Wohnung ist wirklich toll. Es wundert mich, dass du sie so günstig bekommen hast.«
»Ich denke, das ist Amelias Verdienst. Die Eigentümerin ist mit ihr befreundet.« Wenn Amelia sagte, sie seien befreundet, dann meinte sie für gewöhnlich, sie hatten etwas miteinander gehabt. Unsere Tante hatte trotz ihrer zweiundfünfzig Jahre ein recht reges Sexleben und das lebte sie mit Frauen aus. Als ich Amelia und Sanjana am Tag der Wohnungsbesichtigung zusammen gesehen hatte, war nicht zu übersehen gewesen, dass, was auch immer die beiden miteinander hatten, noch nicht ausgestanden war.
Ich beobachtete Tina, die dürrer und zerbrechlicher aussah als ich. Sie wirkte älter als vierundzwanzig. Vielleicht wie Anfang dreißig. In den letzten Monaten hatte sie auch deutlich mehr ertragen müssen als ich. Deswegen verstand ich nicht, warum sie diese Chance für Rose und sich nicht ergreifen wollte. In ihrem Gesicht konnte ich sehen, dass sie sich wünschte, einfach ihre Tochter und ihre Habseligkeiten packen und die letzten Monate hinter sich lassen zu können. Aber die Angst war größer und besiegte in ihr immer wieder den Wunsch nach Normalität. Und da war die Abhängigkeit, die sie ihrem Mann gegenüber entwickelt hatte. Tina war schon immer anders als ich gewesen. Weniger selbstständig. Den Auszug bei unserer Mutter hatte sie nur so früh gewagt, weil Rocco an ihrer Seite stand und ihr Leben in die Hand genommen hatte. Von dem Tag an, als sie mit seinem Kind schwanger bei ihm eingezogen war, hatte er ihr Leben bestimmt. Anfangs noch auf eine liebevollere Art, als er es jetzt tat.
Wir trugen die ersten Kartons mit der Aufschrift »Küche« aus dem derzeit noch leer stehenden Zimmer und begannen das wenige Geschirr, das ich besaß, in die Küchenschränke zu räumen. Es war recht warm und die Sonne knallte durch die großen Fenster direkt zu uns herein. Normalerweise achtete Tina peinlich genau darauf, dass man ihre Arme nie zu sehen bekam, aber sie hatte ihre Ärmel nach oben gestreift und ich konnte die Verbrennungsnarben darauf sehen. Spuren, die Tinas Ehemann hinterlassen hatte. Jedes Mal, wenn sie vergaß, diese Narben zu verstecken, und ich sie sah, dann war es, als müsste ich schreien vor Sorge und Wut.
Es gab eine Zeit, da hatte ich mich für Tina gefreut, weil sie eher aus der Hölle ausziehen konnte, in der unser Vater uns zurückgelassen hatte. Doch dann kam Rose, Rocco wurde arbeitslos und über das letzte Jahr hinweg hatte sich ein freundlicher fürsorglicher Mann in ein herrschsüchtiges Monster verwandelt. Plötzlich hatte er damit begonnen, Tina zu schlagen, zu demütigen und sie zu quälen. Er war zum Tyrannen geworden, der alles unter Kontrolle haben wollte. Und er schreckte auch nicht davor zurück, Rose und Amy seine alkoholgeschwängerten Ausbrüche miterleben zu lassen. Solange ich direkt nebenan gewohnt hatte, hatte ich versucht, dass Rose so häufig wie möglich bei uns übernachtete. Aber das Gebrüll und Tinas Wimmern waren auch durch die Wände hindurch zu hören gewesen. Und egal wie oft ich mich bemüht hatte einzugreifen oder Tina zu helfen, sie hatte Hilfe immer abgelehnt. Nicht einmal für Rose wollte sie sich von Rocco trennen. Die finanzielle und emotionale Abhängigkeit saß zu tief und sie fürchtete sich zu sehr vor Veränderung. Vor dem Unbekannten. Vor einem Leben ohne Unterstützung durch ihren Mann.