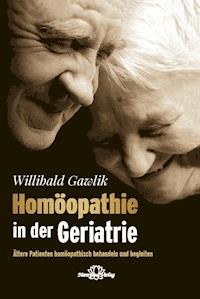
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Das erste Homöopathiebuch zum Thema Geriatrie. Der erfahrene homöopathische Arzt macht sein schier unerschöpfliches Wissen den interessierten Kollegen zugänglich. Er erläutert die Besonderheiten der geriatrischen ärztlichen Aufgaben sowie die Möglichkeiten und Grenzen der Homöopathie. Der Arzt Willibald Gawlik(1919-2003) war ein Urgestein unter den deutschen Homöopathen. Er arbeitete viele Jahrzehnte lang als Allgemeinarzt mit der Zusatzbezeichnung Homöopathie und Naturheilverfahren, wobei sein leidenschaftliches Wirken primär der Homöopathie gewidmet war. Diese große Liebe sowohl zur Homöopathie als auch zu seinen leidenden Patienten schlug sich in einer Vielzahl von Publikationen nieder, die einerseits der Kollegenschaft, andererseits aber auch den interessierten Laien zugedacht waren. Eines dieser Werke ist „Homöopathie in der Geriatrie“. Es behandelt die Homöotherapie des alternden Menschen und ist als praktischer Ratgeber konzipiert, der ein schnelles Nachschlagen und Auffinden geeigneter homöopathischer Arzneien ermöglicht. Dabei kommen allerdings auch philosophische Betrachtungen des Älterwerdens und Grundlegendes zur Anamnese, Arzneifindung und Dosierung homöopathischer Arzneien keineswegs zu kurz. Herzstück des Buches ist ein nach Organ- bzw. Körpersystemen geordnetes Therapiekompendium (u.a. Sinnesorgane, Herz-Kreislauf, Atmungsorgane, Verdauungsorgane, Haut, Bewegungsapparat und Nervensystem), das zu jedem Beschwerdebild die wichtigsten homöopathischen Arzneien mit relevanten Symptomen und Dosierung aufführt. Ein weiterer Teil befasst sich mit allgemeinen Gesundheitsproblemen, psychischen Symptomen und situationsgebundenen Beschwerden (z.B. Einsamkeit, Unheilbarkeit, Angst vor dem Tod). Eine kurze Zusammenfassung bewährter Indikationen von A-Z erlaubt eine rasche Orientierung und Mittelwahl. Bereichert wird das Werk zudem durch eine Materia Medica zu den Säuren und einer Vielzahl nach Reichen geordneten Konstitutionsmitteln. Zahlreiche Fallbeispiele geben Einblick in Gawliks Arbeit, bei der er sich auch nicht scheute, ergänzende Therapien einzubeziehen. Diesen ist ebenfalls ein Teil des Buches vorbehalten. Ein unverzichtbares Werk – aus der Praxis für die Praxis - für alle Therapeuten, die geriatrische Patienten behandeln! „Dieses Buch ist eine wahre Fundgrube an praktischen Tipps aus über 40 Jahren homöopathischer klinischer Erfahrung. Man muss erst einmal darauf kommen bei gereizten alten Menschen, die mit ihren dritten Zähnen Probleme haben, an Chamomilla zu denken und dann noch erfolgreich zu empfehlen, in den Altenheimen Schaukelstühle aufzustellen. Dies ist eine geniale Umsetzung der bekannten Situation bei zahnenden Säuglingen, die durch Herumtragen und Schaukeln beruhigt werden können. Alte Menschen ähneln in mancher Hinsicht kleinen Kindern. Man liest über Besonderheiten bei der Fallaufnahme bis hin zur Begleitung Sterbender. Es gibt Ratschläge bei Druckstellen von Prothesen bis hin zu Blutungen unter Blutverdünnern. Nahezu für alle Krankheiten und Symptome in der Geriatrie gibt es therapeutische Empfehlungen und treffenden Kurzcharakteristiken homöopathischer Arzneien. Das Buch ist voll von Goldkörnern und jeder, der alte Menschen in seiner Praxis betreuen darf, wird es mit viel Freude lesen.“ Markus Kuntosch, homöopathischer Arzt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Willibald Gawlik
Homöopathiein der Geriatrie
Ältere Patienten homöopathisch behandeln und begleiten
Impressum
Dr. med. Willibald Gawlik
Homöopathie in der Geriatrie
Ältere Patienten homöopathisch behandeln und begleiten
1. Auflage 2016
2. Auflage 2017
ISBN:978-3-95582-144-9
© 2016 Narayana Verlag GmbH, Kandern
Frühere Auflagen erschienen im Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart unter dem Titel: Homöopathie in der Geriatrie
Pathologisches Simillimum, turnusmäßiger Wechsel von Arzneien sowie weitere Verschreibungsstrategien und -techniken
Layout und Satz: Narayana Verlag, Kandern
Coverdesign: Arbëresh Dalipi
Coverabbildung: Siberia – Video and Photo, shutterstock.com
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Verlags darf kein Teil dieses Buches in irgendeiner Form – mechanisch, elektronisch, fotografisch – reproduziert, vervielfältigt, übersetzt oder gespeichert werden, mit Ausnahme kurzer Passagen für Buchbesprechungen.
Sofern eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet werden, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen (auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind).
Die Empfehlungen dieses Buches wurden von Autor und Verlag nach bestem Wissen erarbeitet und überprüft. Dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Weder der Autor noch der Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.
Inhalt
Vorwort des Autors
Vorwort des Verlags
Einführung
Gesundheit, Krankheit und Alter
Gerontologie und Geriatrie
Definitionen
Therapeutische Konsequenzen
Betreuung und Pflege
Bedeutung der Interaktion
Probleme in der organisierten Pflege
Homöotherapie
Die Anamnese beim alternden Menschen
Fragestellungen
Mittelfindung
Dosierung
Erkrankungen der Sinnesorgane
Augenerkrankungen
Blepharokonjunktivitis
Hordeolum
Ohrenerkrankungen
Tinnitus
Schwerhörigkeit
Geruchs- und Geschmacksverlust
Geruchsverlust
Geschmacksverlust
Erkrankungen der Zähne und der Mundhöhle
Zahnschmerzen
Gingivitis und Stomatitis
Verletzungen der Mundhöhle
Brech- oder Würgreiz bei zahnärztlicher Behandlung
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Funktionelle Herzbeschwerden
Angina pectoris
Herzinsuffizienz
Rhythmusstörungen
Bradykardie
Hypertonie
Hypotonie
Zerebrale Durchblutungsstörungen
Gefäßerkrankungen
Arterielle Durchblutungsstörungen
Apoplektischer Insult, TIA (Transitorische ischämische Attacke)
Chronisch-venöse Insuffizienz
Thrombophlebitis, akute Thrombose
Ulcus cruris
Hämorrhoiden
Erkrankungen der Atmungsorgane
Rhinitis
Sinusitis
Nasenbluten
Pharyngolaryngitis
Angina tonsillaris
Chronische Bronchitis
Emphysembronchitis, Altershusten
Pneumonie
Asthma bronchiale
Trockene Schleimhäute
Erkrankungen der Verdauungsorgane
Foetor ex ore
Appetitlosigkeit
Gastritis
Ulkuserkrankungen des Magens und des Zwölffingerdarmes
Akute Diarrhö
Chronische Diarrhö
Obstipation
Erkrankungen von Leber, Galle und Pankreas
Hepatopathie
Cholezystopathie
Erkrankungen des Pankreas
Stoffwechselerkrankungen
Hyperthyreose
Hypothyreose
Diabetes mellitus
Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane
Zystitis
Pyelitis
Harninkontinenz
Prostatitis
Erkrankungen der Haut und Hautanhangsgebilde
Furunkel und Phlegmone
Herpes zoster
Ekzemerkrankungen
Arzneimittelexanthem
Pilzerkrankungen
Analekzem, Afterfissur
Dekubitus
Benigne Tumoren
Warzen
Indurationen an Sehnen (traumatisch oder essenziell)
Indurationen der weiblichen Brust
Erkrankungen des Bewegungsapparates
Degenerative Gelenkerkrankungen
Erkrankungen der Wirbelsäule
Osteoporose
Erkrankungen des Nervensystems
Alterskopfschmerz
Schwindel
Alzheimer-Krankheit
Parkinson-Krankheit
Nasentröpfeln alter Männer
Allgemeine Gesundheitsprobleme
Altersschwäche
Immunschwäche
Verletzungen
Intubationsschäden
Blutungen
Psychische Symptome
Angstsymptome
Angst ohne Unruhe
Angst mit Unruhe
Angst, besonders groß, besonders früh
Gewissensangst
Gewissensangst mit Reue
Gewissensangst mit Unzufriedenheit über sich selbst
Angst, aber es ist nichts recht
Angst, will nicht angefasst werden
Angst, will nicht angesprochen werden
Angst vor dem Alter
Angst vor dem Alleinsein
Angst vor dem Tod
Angst, im Alter arm zu sein
Angst, lebendig begraben zu werden
Angst, vergiftet zu werden
Angst durch Musik
Angst vor sich Nähernden
Angst, die Straße zu überqueren
Angst vor dem Geräusch strömenden Wassers
Eigenartige Gebärden
Eigenartige Symptome des Ärgers
Ärgert sich, wenn er getröstet wird
Ärgert sich über die eigenen Fehler
Streit- und tadelsüchtig
Nächtliche Unruhe
Schlafstörungen
Affektschädigung
Depressionen
Reaktive Depressionen
Lebensüberdruss
Wahnideen
Situationsgebundene Symptomenkomplexe
Reiseempfehlungen
Erotik und Sexualität bei alternden Menschen
Kleine sexualmedizinische Apotheke
Alter und Einsamkeit
Über den Umgang mit chronisch und unheilbar Kranken
Angst vor dem Tod?
Hilfen in der Sterbestunde
Inkompatibilitäten homöopathischer Arzneimittel
Besonderheiten
Erkrankungen von A-Z
Schmerzen nach Verletzungen
Wichtige Modalitäten
Besondere Arzneimittel
Säuren
Arsen-Salze
Fluor-Salze
Konstitutionsmittel
Tierische Stoffe
Pflanzliche Stoffe
Mineralien
Metalle
Die Konstitutionsmittel in ihren Wandlungen
Fallbeispiele
Ergänzende Therapie
Praktische Hinweise zu häufigen Krankheitsbildern von A – Z
»Älterwerden«
Malum oder Bonum?
Philosophische Grundlagen der Homöopathie
Nachgesang
Anhang
Literatur
Über den Autor
Arzneimittelverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Vorwort des Autors
Die Industrieländer, zu denen auch Deutschland gehört, weisen den verhältnismäßig größten Anteil älterer Mitbürger auf. Gesundheitsexperten sagen aber auch den Entwicklungsländern eine entsprechende Entwicklung voraus, sodass im zweiten Viertel des dritten Jahrtausends sechzig Prozent der Weltbevölkerung über sechzig Jahre alt sein werden.
Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass auch in unserem Land dann mehr »Ruheständler« als arbeitende Bürger leben. Dieses Faktum einer immer älter werdenden Gesellschaft verweist auf Probleme im sozialen, politischen, gesundheitspolitischen und therapeutischen Bereich, die man schon heute aufzeigen kann. Trotz vieler Erkenntnisse finden die Geriatrie und alle ihre Erscheinungen in unserer modernen Medizin wenig Beachtung. Wir behandeln, versuchen Leben zu verlängern, Laborparameter zu verbessern, übersehen aber oft, dass für älter werdende Menschen weniger das kalibrierbare Messverfahren als vielmehr das Kriterium »Lebensqualität« von Bedeutung ist: Im Alter interessieren weniger die seit zwanzig Jahren erhöhten Leberwerte und die seit dreißig Jahren veränderte ST-Senkung im EKG. Wichtig ist in dieser Lebensphase beispielsweise, dass man jeden Tag atmen, essen und trinken kann, dass man spazierengehen und vielleicht auch noch Musik hören kann. Um alten Menschen zu helfen, muss man sie verstehen und begreifen: Es gilt zu erkennen, dass sie weiter sehen und tiefere Dimensionen erfassen; ihre Arme können nicht weiter greifen oder höher hinaufreichen und tasten dennoch schon an die Pforten des Himmels.
Im ersten Lehrbuch der Geriatrie, der 1796 entstandenen »Makrobiotik«, beschreibt Hufeland altersspezifische Entwicklungen mit folgenden Worten:
»Das Alter, ohnerachtet es an sich die natürliche Folge des Lebens und der Anfang des Todes ist, kann doch selbst wieder ein Mittel werden, unsere Tage zu verlängern. Es vermehrt zwar nicht die Kraft zu leben, aber es verzögert ihre Verschwendung, und so kann man behaupten, der Mensch würde in der letzten Periode seines Lebens, in dem Zeitraum der schon verminderten Kraft, seine Laufbahn eher beschließen, wenn er nicht alt wäre«.
Dieser etwas paradox erscheinende Satz wird durch folgende Erläuterungen seine Bestätigung erhalten. Der Mensch hat im Alter einen geringeren Vorrat von Lebenskraft und weniger Fähigkeit, sich zu restaurieren. Lebte er nun noch mit eben der Tätigkeit und Lebhaftigkeit fort als vorher, so würde dieser Vorrat weit schneller erschöpft sein und der Tod eher erfolgen. Nun vermindert aber der Charakter des Alters die natürliche Reizbarkeit und Empfindlichkeit, dadurch wird die Wirkung der inneren und äußeren Reize und folglich auch die Kraftäußerung und Kraftverschwendung auch vermindert, und so kann er bei geringerer Konsumption mit diesem Kraftvorrat weit länger auskommen. Die Abnahme der Intension des Lebensprozesses mit dem Alter verlängert also seine Dauer.« (aus Hufeland 1796, Kapitel VIII)
In Deutschland findet sich etwa ein halbes Hundert spezifischer medizinischer Fachgebiete. Sehr verwunderlich ist allerdings, dass es bei der immer größer werdenden Zahl alternder und alter Menschen keinen Facharzt für Geriatrie gibt1. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass es einem jüngeren Arzt schwerfallen kann, alte Menschen in ihren Beschwerden und Verhaltensweisen zu begreifen und dementsprechend zu behandeln. Auf diesem Hintergrund habe ich mir in meinem neunundsiebzigsten Lebensjahr die Aufgabe gestellt, die in einer Allgemeinpraxis über fünfundvierzig Jahre hindurch gesammelten diagnostischen und klinischen Erfahrungen in der Behandlung alternder Menschen niederzuschreiben. Die hierfür unabdingbare noetische Vigilanz konnte ich mir durch fortwährendes »zerebrales Jogging« bewahren. Es liegt mir viel daran, Denkanstöße zu geben und konkrete Vorschläge zu unterbreiten, um den Betroffenen zu helfen. Weiterhin möchte ich aufzeigen, welche Schwierigkeiten sich bei der ärztlichen Arbeit einstellen und wie man diese beseitigen kann.
Meine Ausführungen beruhen auf der Beobachtung, dass der Generationenwechsel in früherer Zeit durch eine vorgegebene Anzahl der Jahre bestimmt war, heute jedoch die sich in immer kürzeren Abständen modifizierende Mentalität und psychische Struktur die entscheidenden Kriterien darstellen. Das Verhältnis der jungen Kollegen zu älteren Menschen ist somit bestimmt durch eine geistig-seelische Distanz, die quasi über zwei Generationen hinweg entstanden ist. Der mentale und geistige Abstand ist deutlich größer als früher.
Immer wieder erlebe ich, dass junge Kollegen sehr deutlich den Standpunkt vertreten, das Leben und diese Welt gehörte der Jugend. Aufgrund ihres großen Wissens, das eher materiell als philosophisch-ethisch-religiös geprägt ist, glauben sie sich sehr überlegen. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass Ärzte nicht in erster Linie als Hüter der Gesundheit, sondern vor allem auch als »Sachwalter der Schöpfung« handeln sollten. Dieser Anspruch impliziert die Aufgabe, die älteren Menschen angemessen zu respektieren, zumal diese dies häufig nicht mehr einfordern können. Rufen Sie sich in Erinnerung, dass die alten Menschen einmal jung und gesund waren und oft sehr schwere Lebensphasen durchgemacht haben. Es ist mir ein Anliegen, die Kollegen zu warnen, die nach Worten meines Lehrers Weizsäcker »nur den Weg vor sich sehen, den sie gelernt haben, und nicht wissen, dass die Welt wesentlich größer ist und tausendmal mehr bietet als nur den Sektor Medizin.«
Auch dürfen wir nicht vergessen, dass die medizinische Fakultät letztlich aus der philosophischen bzw. theologischen Fakultät resultiert und die Behandlung von Kranken früher dem Priester und Arzt in die Hände gelegt war. Neben unserer geistigen Bereitschaft für Phänomene wie Video, Internet oder andere elektronische Einrichtungen sollten wir eine »seelische Antenne zum Himmel« ausrichten, durch die große Kraft empfangen werden kann.
Dies erlebte ich schon als Famulus bei dem berühmten Professor Bauer in Breslau. Wenn wir jungen Studenten uns vor der Operation die Hände wuschen und dabei fröhlich lachten, ermahnte er uns, daran zu denken, dass es bei unserer bevorstehenden Arbeit um Leben und Tod gehe. Im Hinblick darauf sollten wir uns besser darauf konzentrieren, keine Fehler zu machen, wobei auch ein kleines Gebet helfen könne. Dieser Rat hat mir so oft geholfen, dass ich ihn gerne weitergebe. Selbst wenn ich gar nicht mehr weiterwusste, erhielt ich eine Lösung meiner Probleme, oft durch zufällige Gegebenheiten oder auch einen Geistesblitz. Und hier schließt sich der Kreis: »Sachwalter der Schöpfung« heisst auch, die Schöpfung als solche anzuerkennen, um dann plötzlich zu spüren, dass der Schöpfer selber Hilfestellung leistet.
Eine weitere Erfahrung, die ich meinen lieben jungen Kollegen übermitteln möchte, besagt, dass die Homöopathie keine einfach nebenbei zu lernende Therapie ist. Meine Erfolge waren mit Sicherheit darauf zurückzuführen, dass ich sehr sorgfältige Anamnesen machte und immer wieder, auch aus den Fehlern, gelernt habe. Da das Erlernen der Homöopathie meiner Erfahrung nach schwieriger ist als das der konventionellen Schulmedizin, kann die anfängliche Begeisterung erlahmen. Misserfolge können zu Zweifeln führen. Der Epitaph am Beginn von Hahnemanns »Organon« kann hier den Weg weisen: »Sapere aude«, zu deutsch: »Habe den Mut, weise zu sein; wage es, viel zu lernen.« Horaz, von dem Hahnemann diese Worte in umgekehrter Reihenfolge übernommen hat, vervollständigt sie im zweiten Brief an Lollius Maximus mit dem Wort »incipe«, »fang an«. Wichtig ist, nicht lange zu warten, sondern sofort anzufangen und das Gelernte entsprechend anzuwenden.
Das ärztliche Handeln muss jeden Tag neu beginnen, indem man sich auf die Aufgabe konzentriert, dem kranken Menschen zu helfen. Gerade bei den oft multimorbiden alten Menschen sind wir gefordert, Polypharmaka zu vermeiden und die Homöopathie als einmalige Möglichkeit zu begreifen, mit einem, vielleicht zwei Medikamenten eingreifen zu können.
Von ganzem Herzen danke ich allen, die an diesem Werk mitgeholfen haben. Besonders danke ich dem Hippokrates-Verlag für seine Bemühungen um Ausstattung und Gestaltung des Buches sowie Cheflektorin Frau Dorothee Seiz für ihren immer nutzbringenden Einfluss und die ständig in Bewegung setzende Aktivität. Meiner Lektorin Frau Adelheid Trenz-Steinheil gebührt herzlicher Dank dafür, aus meinen sulfurischen Ausführungen mit größtem Einfühlungsvermögen in stilistische und sachliche Fragestellungen einen äußerst einprägsamen Text erstellt zu haben, anhand dessen der Leser meine Anliegen verstehen kann.
Greiling, 1998 Dr. Willibald Gawlik
1. Anmerkung des Verlags: Nach der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie (DGG) wird seit 2010 um die Einführung eines »Facharztes für Geriatrie« gerungen. Die Erlangung der Facharztbezeichnung Facharzt Innere Medizin und Geriatrie in einer neuen Musterweiterbildungsordnung (MWBO) ist bisher nur in drei Bundesländern möglich (Berlin, Brandenburg, und Sachsen-Anhalt). Die Weiterbildung umfasst 72 Monate. Die Einführung wird sich laut DGG bis 2016 verzögern. Eine 18-monatige Zusatzweiterbildung in Geriatrie (ohne Facharztbezeichnung) in Ergänzung zu einer Facharztkompetenz kann jedoch in allen Bundesländern absolviert werden.
Vorwort des Verlags
Das vorliegende Buch von Willibald Gawlik (1919–2003) ist 1998 im Hippokrates Verlag erschienen und war lange Zeit vergriffen. Es ist uns ein großes Anliegen, dieses Buch den Homöopathen wieder zugänglich zu machen. Zum einen war Willibald Gawlik ein begnadeter homöopathischer Arzt und Lehrer, nicht nur wegen seiner fachlich überragenden Kompetenz, sondern auch wegen seines Humors, seiner Harmonie und seiner Liebe, die aus ihm wirkten. Diese innere Ausrichtung ist in all seinen Ausführungen zu spüren und nachzuvollziehen.
Zum anderen zeigt die demografische Entwicklung, die Willibald Gawlik bereits in seinem Vorwort angesprochen hat, weltweit eine Zunahme der Anzahl älterer Menschen. Für das Jahr 2050 wird prognostiziert, dass zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte die Zahl der über 60-Jährigen die Zahl der Kinder (unter 14 Jahre) übersteigt. Laut Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) wird in Deutschland im Jahr 2060 fast jede dritte Person 65 Jahre oder älter sein.
Alle von uns vorgenommenen Änderungen sind durch Fußnoten angezeigt. Die homöopathischen Mittelnamen haben wir aus Gründen des schnelleren Verständnisses und der besseren Lesbarkeit geändert. Dr. Gawlik hat aufgrund seiner Tätigkeit in der »Homöopathischen Arzneibuchkommission« die Substanzen entsprechend der Bezeichnungen in den Monographien der Kommission D benannt und z. B. Nux vomica als Strychnos nux-vomica, Staphisagria als Delphinium staphisagria und Borax als Natrium tetraboracicum bezeichnet. Wir haben die den Homöopathen vertrauten Mittelbezeichnungen gewählt.
Wir sind sehr froh, einen aktualisierten Nachdruck der Homöopathie in der Geriatrie anbieten zu können und damit die wertvolle Arbeit von Willibald Gawlik zu würdigen. Das Werk bietet jedem Homöopathen eine fundierte Grundlage, um dem demografischen Wandel im Praxisalltag gerecht zu werden.
Kandern, im Winter 2016/17 Narayana Verlag
Einführung
Enkel bist du!
Siegen und Sorgen gestern Gewesener dankst du dein Dasein.
Hältst als Ahnherr Segen und Fluch fernster Geschlechter hütend in den Händen.
(aus der Edda)
Gesundheit, Krankheit und Alter
Gerontologie und Geriatrie
Definitionen
Therapeutische Konsequenzen
Betreuung und Pflege
Bedeutung der Interaktion
Probleme in der organisierten Pflege
Gesundheit, Krankheit und Alter
Als ich das erste Mal die Stufen zu einem Institut der Alma mater in Breslau hinaufstieg, war ich voller Erwartungen, Neugier, Sehnsucht und Wünschen, besonders was das Wissen über die Schöpfung anbelangt. Aus der Fülle interessanter Fragestellungen kristallisierte sich für mich dann bald der Mensch als ein besonders wunderbares und ohne Beispiel dastehendes Wesen in der gesamten Schöpfung heraus. Bacons »Historia vitae et mortis« veranlasste mich schließlich dazu, mich mit dem alternden Menschen und dem Alter zu beschäftigen. Ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu meinem heutigen Wissen war Hufelands »Makrobiotik oder die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern«. Dieses erste gerontologisch-geriatrische Lehrbuch erschien im Jahre 1796, in dem auch Hahnemann seine ersten Veröffentlichungen über die Homöopathie und die neue Heillehre in Hufelands Journal herausgegeben hat. Als drittes grundlegendes Werk las ich Hahnemanns »Kleine Medizinische Schriften«. Das erste Kapitel des zweiten Bandes, »Heilkunde der Erfahrung«, stellt quasi den Vorläufer des »Organon« dar und vermittelt umfassendes Wissen über den Menschen, dessen Leben, Wachsen, Gesundheit und Krankheit.
Angeregt durch diese drei Werke, beschäftigte ich mich immer intensiver mit älteren Menschen. Auf der Grundlage des von meinen akademischen Lehrern wie Viktor von Weizsäcker und Schipperges vermittelten Wissens lernte ich immer besser, ihr Wesen zu verstehen, mit ihnen umzugehen und ihre Weisheit sowie ihr Wissen zu schätzen. Dabei war mir klar, dass Altern im eigentlichen Sinne mit der Geburt, ja schon im Mutterleib beginnt und »Alter« somit einen Begriff darstellt, der nur im Vergleich anwendbar ist.
Schon Bacon bezeichnet das Leben als Flamme, die beständig von der umgebenden Luft konsumiert wird, und zieht den Schluss, es könne durch Verhütung dieser Konsumption und durch eine von Zeit zu Zeit durchgeführte Erneuerung unserer Säfte verlängert werden. Dazu empfiehlt er kühle Bäder und die Anwendung von Ölen und Salben nach dem Bade, weiterhin Gemütsruhe, eine »kühle Diät« und Mittel, wodurch die sehr lebhafte innere Bewegung und das damit verbundene Aufreiben des Menschen retardiert würde. Um bei zunehmenden Jahren die unvermeidliche Trocknung und Verderbnis der Säfte zu verbessern, hält er es für das Beste, alle zwei bis drei Jahre einen Renovationsprozess einzuleiten. Mittels magerer Diät und »ausleerender« Mittel ist zuerst der Körper von alten und verdorbenen Säften zu befreien, um ihn danach durch ausgesuchte, erfrischende und nahrhafte Diät und stärkende Bäder zu erneuern. Mit gewissen Einschränkungen gelten diese Ideen auch in der heutigen Zeit.
Hufeland beschreibt die Grundlagen der Lebensdauer, damit einhergehend Möglichkeiten der Verlängerung und der Verkürzung. Verkürzend wirken schwächliche Erziehung, Verzärtelung, moralische Verweichlichung, Ausschweifungen in der Liebe, Verschwendung von Zeugungskraft, Überanstrengung der Seelenkräfte, viele Krankheiten, Unmäßigkeit im Essen und Trinken, geistige Getränke, Angst vor dem Tod, üble Laune, Untätigkeit und Langeweile, überspannte Einbildungskraft und verschiedene Gifte. Verlängernd wirken vor allem Reinlichkeit, glücklicher Ehestand, physische Liebe, Ruhe der Seele, Zufriedenheit, Wahrheit des Charakters, mäßig genossene Sinnes- und Gefühlsreize. Hufeland verweist deutlich darauf, dass sich die Anwendung aller Regeln nach Temperament, Lebensart und Konstitution des einzelnen Menschen zu richten habe. Dies erinnert an Hahnemann, der in §208 der 6. Auflage des »Organon« dazu auffordert, auf das Alter des Patienten Rücksicht zu nehmen.
Das Titelbild der »Makrobiotik«, das die drei Parzen zeigt, beschreibt Hufelands Lebenskonzeption. Akzentuiert werden die Qualität der physischen Herkunft und Erzeugung, d. h. die Anlage des Lebensfadens, weiterhin dessen längeres oder kürzeres Fortspinnen, das Geschwind- oder Langsam-Leben, Lebenskonsumption und -restauration und schließlich das Abschneiden des Lebensfadens, welches früher oder später erfolgen kann. Gemeint ist die Todesursache, die das Ende des Lebens bisweilen völlig überraschend herbeiführt und den Lebensstrom so recht gewaltsam unterbrechen kann.
Zweifellos kann kein junger Mensch Genaues über das höhere Alter wissen. Lediglich ältere oder alte Menschen können fundiert vom »Abenteuer des Lebens« sprechen, wie dies Goethe in »Dichtung und Wahrheit« ausgedrückt hat. In der Rückschau werden viele Erlebnisse transparent, da sie wie die Zahnräder eines Uhrwerks ineinandergreifen: Man begreift endlich ihre Notwendigkeit.
Die saloppe Bezeichnung älterer Menschen als »Compostis« oder »Gruftis« verdeutlicht, wie sehr sich jungen Menschen beim Gedanken an das Alter der Vergleich mit etwas Dahinwelkendem, langsam Verwesendem, vielleicht sogar einem Absacken, einem Verschwinden aufdrängt. Ganz selten hören sie von Älteren, dass das Alter trotz vieler Molesten, Krankheiten, vielleicht sogar Schmerzen eine höhere Lebensqualität bietet.
Betrachtet man das Älterwerden als Thema mit vielen Variationen und einem Präludium der Jugend, ist festzuhalten, dass die Variationen durch eigenes Verhalten, äußere Ereignisse oder vielleicht auch durch das Schicksal bedingt sein können. Freilich wird uns mit dem Schicksal »salus«, das »Heil«, geschickt, das manchmal schmerzt und erst viel später als solches erkannt wird. Altern entgeht nur dann der Gefahr, zum bloßen Verfall unserer Zeitgestalt zu verkümmern, wenn wir uns den verbliebenen und immer neu gewährten Lebensmöglichkeiten zuwenden. Zu wirklicher Freiheit führt nur die entschlossene Annahme des Alters.
Ziel aller Freiheitsbemühungen ist auch im Alter die Findung der eigenen Identität, d. h. das anhaltende Bei-sich-selbst-Sein durch alle Wandlungen hindurch, die auferlegt werden.
Die Identität des alten Menschen ist von innen bedroht, wenn er sich selbst fremd wird in seiner sich verändernden und zerfallenden Leiblichkeit, von außen ist sie bedroht, wenn die Gesellschaft ihn als »Randexistenz« (Jean Améry) abschiebt. Der Alternde muss seine veränderte Identität erkennen, die ihm aus seinen Erfahrungen zuwächst und ihn seine Freiheit gegenüber jungen Menschen stärker erfahren lässt als den bloßen Unterschied der Jahre und der äußeren Gestalt. Für die innere Bejahung des Ruhestandes bedarf es neuer, tragfähiger Werte, um die Spannung zwischen dem Verhaftetsein an die Körperlichkeit und der Bewältigung leiblicher Schmerzen zu bewältigen.
Viktor von Weizsäcker betonte in seinen »Klinischen Vorlesungen«, dass die Straße unseres Lebens vorgezeichnet und gepflastert ist mit Verzichten: »… das Wenigste, was wir erwartet haben, ist verwirklicht worden. Die Meilensteine zu diesem mit Verzicht gepflasterten Wege mögen für den Pathologen Leichensteine unserer Wünsche sein: Die Krankheiten sind Zwischenlösungen, die Kompromisse unserer Konflikte gewesen und sie hinterlassen als Denksteine Narben, Sklerosen, Teiltode des Gewebes …«
In diesem Zusammenhang ist an das pädagogische Schlagwort »Bedürfnisbefriedigung« zu erinnern, das seit den 70er-Jahren geläufig ist. Eine kinderfreundliche Gesinnung zeichnet sich demnach dadurch aus, dass kindliche Bedürfnisse unmittelbar befriedigt werden müssen, wenn sie auftreten. Dagegen steht die Erfahrung, die schon Goethe in seinem Gedicht »Der Schatzgräber« beschreibt. Auf »saure Wochen« folgen »frohe Feste«, d. h. ein Erfolg ist umso kostbarer, je mehr wir uns bemühen mussten. Bemühen bedeutet aber nicht nur arbeiten oder sportliche Übungen durchführen, sondern auch unsere Vernunft einzusetzen. Hufeland beschreibt dies in der »Makrobiotik« folgendermaßen: »Der Mensch ist ohne Vernunft allen schädlichen Einflüssen preisgegeben und so das allervergänglichste und korruptibelste Geschöpf unter der Sonne. Der natürliche Mangel an Vernunft ist für die Dauer und Erhaltung des Lebens weit weniger nachteilig als der unterlassene Gebrauch derselben da, wo von Natur aus auf sie gerechnet ist.«
Das Streben nach einseitiger, unablässiger Bedürfnisbefriedigung führt langfristig zwangsläufig zu Unzufriedenheit, da niemals alle von der Werbeindustrie produzierten Wünsche sofort gestillt werden können. Unter dem Vorwand der Selbstverwirklichung werden normative Werte vermittelt, die den Aspekt der Individualität völlig außer Acht lassen, lediglich auf statistische Aussagen abheben und somit zu entsprechend fragwürdigen Schlussfolgerungen kommen.
Der durch Medien jeglicher Art ausgelöste innere Zwang, sich den äußeren Vorgaben anzupassen, kann lediglich durch die Erziehenden relativiert werden. Es gilt, sich immer wieder klarzumachen, dass das wichtigste, eigentliche Bedürfnis der Kinder nach Zeit, Kind-Sein-Dürfen und einem bestimmten Lebensrhythmus nicht übersehen werden darf. Wir sollten auch als Ältere jede Gelegenheit nutzen, diese Gedanken den heutigen Jugendlichen freundlich und vorsichtig zu vermitteln und klarzulegen, dass die Zufriedenheit im Alter, einer Lebensphase, die jedem Menschen vorgegeben ist, maßgeblich von einer in der Jugend erlernten Fähigkeit auf Verzicht abhängt.
Weizsäcker versuchte uns jungen Studenten zu vermitteln, dass Ältere auf ihrer Lebensreise zum Tod bewusst zu begleiten sind: »Schließlich ist das Ganze eine Reise zum Tode. Aber während dieser Reise nimmt die Summe des Irreversiblen fortwährend zu, die Biegsamkeit, die Elastizität nimmt ab, die Steifigkeit nimmt zu. Unterwegs kommt es immer wieder zum Aufflammen neuer, überraschender, kritischer Entscheidungen.« Weiterhin betonte er, das Leben ende seiner Meinung nach nicht mit dem Tod, sondern gehe in ein anderes Sein über, von dem wir nichts wissen. An dieser Stelle sei meine persönliche Erfahrung eingebracht: Die vorhandene Substanz zählt immer weniger, man wird überzählig, vielen auch lästig, vielleicht auch überflüssig. Man wird zurück-gebildet, innerlich und äußerlich eingeschränkt, Informationsfeld und Aktionsradius werden kleiner. In extremer Form ist dies in den Seniorenheimen zu beobachten, in die die alten Menschen quasi weggedrängt werden.
Es muss dem Nachdenkenden so unbegreiflich wie einleuchtend sein, dass die wahre Überwindung des Todes nur in der Auferstehung von den Toten liegen kann. Der christliche Glaube an die Auferstehung macht ein Angebot der Hoffnung. Immer wieder sollten wir deshalb danach streben, uns von der geradezu systematischen Verdrängung des Todes zu befreien. Auf der anderen Seite müssen wir gerade, weil wir in einer so aufgeklärten Welt leben, diese Verdrängung des Todes auch begreifen.
Bei Aischylos finden wir solche Gedanken wieder. Er spricht von einer großen Gabe, die darin besteht, dass der Vorausblick des Menschen seiner Zukunft den Charakter einer so greifbaren Gegenwart verleiht, dass er den Gedanken des Endes nicht zu fassen vermag. Er sieht sich einer Zukunft gegenüber, solange er nicht weiß, dass er keine Zukunft hat. Die Verdrängung des Todes ist gekoppelt mit dem Willen zum Leben. Im Zeitalter des sich sehr stark ausbreitenden Massenatheismus werden auch Ungläubige und gänzlich Säkularisierte gerade beim Sterben und bei der Beerdigung fortgesetzt Kultformen aufrechterhalten. Es besteht eine tiefe Scheu vor dem Mysterium und der Heiligkeit des Todes. Religiöser Glaube und reine Weltlichkeit, auch der Atheismus, stimmen überein, die Majestät des Todes zu ehren. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Wissen und wissenschaftliche Aufklärung eine unübersteigbare Grenze im Hinblick auf das Mysterium des Lebens und des Sterbens darstellen.
Gerontologie und Geriatrie
Definitionen
Statistische Erhebungen verweisen auf die Lebensalterspyramide bzw. den wachsenden »Altersberg« der westlichen Industriestaaten und berechtigen zu der Annahme, dass Gerontologie und Geriatrie zum Zeitpunkt der Jahrtausendwende und darüber hinaus eine sehr große Rolle spielen werden. Die folgenden Ausführungen wenden sich deshalb vor allem an den Allgemeinarzt oder Internisten, der für die Anwendung der Homöopathie gerade im Bereich der Geriatrie Anhaltspunkte sucht und entscheiden muss, welche Therapieform für den Patienten geeignet ist.
Gerontologie. Wir alle altern vom Augenblick der Geburt an und spüren dies erst im höheren Lebensalter, wenn die rein funktionellen Minderleistungen im somatischen, geistigen und seelischen Bereich eine strukturelle Involution anzeigen. Durch langsam nachlassende Bioverfügbarkeit und deutliche Retardierung körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit verändern sich die anatomischen, physiologischen, pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Reaktionen. Diese letztlich zum »Rentenabseits« oder zur »Pensionistenisolation« führenden Gegebenheiten sind Gegenstand der Gerontologie, der Alternsforschung und Lehre vom Altern. Sie befasst sich mit dem Menschen in seinen verschiedenen Lebensaltern, einschließlich der pathologischen Vorgänge, und fordert als multidisziplinäres Fachgebiet nicht nur die Philosophen und Historiker, sondern auch die Anatomen, Physiologen, Pharmakologen, Biologen, Politologen und Soziologen sowie die Psychologen und Theologen, schließlich auch die Politiker. Möglichst vielseitige Erfahrungen müssen eingebracht werden, aus denen Erkenntnisse über das Verhalten gegenüber alternden Menschen abgeleitet werden können, siehe Tabelle 1.
Jeder Mensch erlebt im höheren Alter eine physiologische Involution und eine psychologische Revolution. Freilich kann im Ruhestand bereits eine Beruhigung aller krankhaften Erscheinungen auftreten, weil die beruflich bedingten Belastungen und Erfordernisse wegfallen und ein völlig neuer Lebensabschnitt beginnt. Allerdings fehlen oft vor allem den Menschen, die sich beruflich in gehobener, verantwortlicher Position befanden, Erfolgserlebnisse und Motivation, gemeint sind Dankbarkeit oder einfach freundliche Worte, aber auch »Streicheleinheiten« wie Ehrungen und Auszeichnungen. Diese Alternden, denen die zeitgebundene, regelmäßige Arbeitszeit nicht mehr angemessen ist, weisen oft eine ausgezeichnete noetische Vigilanz auf und setzen dann ihre ganze geistige und körperliche Kraft in die Erfüllung selbstgestellter Aufgaben. Häufig strahlen sie große Lebensfreude aus und sind sehr gelassen, weil sie aufgrund großer Lebenserfahrung die innere Logik vieler vordergründig unverständlicher Gegebenheiten erfassen.
Ausgehend von einer multidisziplinären Betrachtung zeigt sich die individuelle Reaktion des alternden Menschen in besonderem Maße. Gerade dieser Gegebenheit entspricht die homöopathische Therapie, die das Individuum behandelt und nicht die Krankheit. Das alternde, vielleicht zerbrechliche oder verwelkende Individuum zeichnet sich, wie das kindliche, viel klarer und bunter gegen die Umgebung ab als das der mittleren Jahre und versetzt den Arzt in immer neues Erstaunen. Er erlebt verbitterte Menschen, die sich plötzlich isoliert vorkommen, aber auch Rentner, die es genießen, ihren Hobbys nachgehen zu können.
Altsein und Altwerden werden ganz unterschiedlich empfunden. Manche Menschen fühlen sich trotz aller Beschwerden gesund, andere empfinden jedes »Zipperlein« als gefährliche Krankheit und leiden darunter. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Gesundheit nicht nur als Freisein von Krankheit, sondern auch als Zustand des völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Gesundsein im Alter heißt, trotz kleinerer und größerer Defizite ein erfülltes Leben zu genießen. Anzustreben ist somit ein »gesundes und kreatives Altern«.
Körperliche und geistige Aktivitäten sowie vielfältige Interessen haben einen positiven Einfluss auf die körperliche und seelische Gesundheit und auf die Zufriedenheit im Alter. Doch Bewegung und gesundem Lebensstil sind Grenzen gesetzt. Etwa ab Mitte 80 zeigt sich nach Aussagen namhafter Gerontologen die Unausweichlichkeit körperlichen und geistigen Abbaus sowie chronischer Leiden.
Auf jeden Fall sollten die körperlichen Fähigkeiten, aber auch die zerebrale noetische Vigilanz rechtzeitig und intensiv trainiert werden, um sie so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Alle Bemühungen müssen jedoch dem individuellen Leistungsvermögen angepasst werden: Mit 75 Jahren noch die Sportart »Jogging« zu beginnen, ist mit Sicherheit falsch. Der alte Mensch ist nicht mehr das »wilde Pferd«, sondern eher der »alte Gaul«, der etwas träge einen Karren zieht, auf dem die mit dem Älterwerden verbundenen Beschwerden liegen.
Die häufig zitierte Weisheit »Man ist so alt, wie man sich fühlt« ist dem Jugendkult entgegenzusetzen, der schon Sechzigjährige zum »alten Eisen« zählt. Glücklicherweise zeigt sich gegenwärtig diesbezüglich insofern ein Wertewandel, als »die aktiven Alten« als spezifische Bevölkerungsgruppe entdeckt werden. Allerdings sind hierfür oft in erster Linie wirtschaftliche Faktoren maßgebend, zumal manche alte Menschen über beträchtliche finanzielle Mittel verfügen. Dennoch bleibt der unabdingbare Verlust an Aktivität im Alter mit Problemen behaftet. Das Altern vollzieht sich dann zwangsläufig im Verborgenen: Man versucht, die großen Schwächen des Körpers, ja auch des Geistes, zu verheimlichen. Aus Angst vor abwertenden Reaktionen wird das eigentliche Lebensalter häufig verschwiegen.
Der jugendliche, quasi jugendpflichtige Mensch schämt sich für sein Altern und begegnet der damit aufgeworfenen Problematik mit kosmetischen Präparaten, ohne sich der Tatsache zu stellen, dass auch bei ihm die biologische Uhr tickt. Diese Entwicklung löst eine eher statische Betrachtungsweise ab: In früheren Zeiten war der Erwachsene etwa zwischen 30 und 65 Jahre alt, und sein Selbst- und Fremdbild wurde vom Alterungsprozess kaum beeinflusst. Dies hatte gesellschaftliche Gründe: Die Dauerhaftigkeit sozialer Gegebenheiten ließ das Sozialalter relativ konstant erscheinen, während das biologische Alter voranschritt. Solche Biografiemuster wiesen der Jugend den Platz einer Art Vorschule an und sahen im Alter das »Danach«. In dem langsam zur Neige gehenden bürgerlichen Zeitalter hatte jeder Mensch seine Individualität, seine Identität, die aus seiner Biografie abzuleiten war. Der bürgerliche Lebensentwurf spannte sich wie ein riesiger Bogen über das Schicksal und apostrophierte Krisensituationen im allgemeinen Verlauf als Ausnahmen. In der Jugend wurde angelegt, was sich im Erwachsenenalter entfalten konnte. Das Alter erntete die Früchte des Lebens, wenn auch oft nur in Form von Reflektion und Erinnerung. Der Lebenslauf strebte einer Vollendung zu, und hier wurde Individualität, Identität schließlich zum Sinn des Lebens. Die Entwertung der alten, früheren Erfahrungen in einer sich immer rascher wandelnden Welt hat ältere Menschen zu funktionell jungen mit äußerst geringer Veränderungskapazität werden lassen, die oft unter Einsamkeit leiden, seit Jung-Sein das zu pflegende Image geworden ist, auf das man sowohl am Arbeitsmarkt als auch bei der Anbahnung zwischenmenschlicher Beziehungen achtet.
Geriatrie. Dieser Begriff beschreibt die Lehre von den spezifischen Erkrankungen des alten Menschen sowie deren Behandlung. Auch bei der Altersheilkunde sind verschiedene Disziplinen, vom Psychologen, Psychiater, Ophtalmologen, Otologen bis zum Internisten, Chirurgen oder Orthopäden gefordert. Der biologische Vorgang des Alterns erweist sich in dem uns bekannten morphologischen Substrat: Die primären Veränderungen betreffen häufig zentrales Nervensystem, Gefäßsystem und Bewegungsapparat. Problematisch ist hier vor allem die Tatsache, dass die Multimorbidität im Laufe des Alterns zunimmt. Schwerpunkte sind hier zerebrale Durchblutungsstörungen, Herzstörungen, Emphysem, Schwindel, Zittern sowie allgemeine Schwächezustände, nachlassende Elastizität der einzelnen Fasern, Stoffwechselstörungen von Diabetes bis zu Harnsäure-Kreatinin-Problemen. Weiterhin kommt es zu Störungen des Erinnerungsvermögens, Vergesslichkeit, Konzentrationsunfähigkeit sowie örtlicher und zeitlicher Desorientierung. Gerade bei Gedächtnisproblemen ist möglichst differenziert zu diagnostizieren, da ursächlich eine Depression, eine Überlastungssituation, eine Alzheimer-Erkrankung oder »normales Altern« gegeben sein kann. Die häufig auf Abnutzung beruhenden Störungen des Bewegungsapparates treten beispielsweise als Polyarthrose, Osteoporose oder Spondylose in Erscheinung, siehe Tabelle 1.
Die große Kompensationsfähigkeit des mehrfach gesicherten biologischen Systems Mensch, das im Falle fehlerhafter Arbeit einzelner Glieder ohne wesentliche Folgen für den Gesamtorganismus weiterarbeitet, wird immer geringer, je weiter das Alter fortschreitet. Dies zeigen die durchschnittlichen Regulations- und Funktionsparameter eines 75 Jahre alten Mannes im Vergleich zu denen eines Dreißigjährigen, siehe Tabelle 2. Der Organismus wird störanfälliger im Hinblick auf besondere Belastungen oder auch gegenüber Arzneimitteln, die im toxischen Bereich anzusiedeln sind. Damit geht eine vergleichsweise lange Rekonvaleszenz nach akuten Krankheiten einher, was Komplikationen begünstigt. Ältere Patienten stellen eine spezifische Gruppe dar, die mit besonderen Schwierigkeiten konfrontiert ist und äußerst sensibel auf ihr Umfeld reagiert. Die häufige Schwächung der Sinnesorgane, Rollen- und Funktionsverluste sowie physischer Abbau, aber auch mentale Störungen wie Vergesslichkeit und Entscheidungsunfähigkeit verschlimmern die Situation, die oberflächlich betrachtet durch körperliche Behinderungen bestimmt wird. Das Gefühl, ausgegrenzt und benachteiligt zu sein, dem Leistungsdenken unserer Gesellschaft nicht mehr entsprechen zu können, bewirkt in Verbindung mit den geringen Anforderungen unter Umständen eine Veränderung der Psyche mit Depressionen oder Verwirrtheit. Auch Schlafstörungen, Inkontinenz, Schmerzen und Pflegebedürftigkeit tragen zur mangelnden Körperintegrität und der damit zwangsläufig verbundenen Änderung des Selbstbildes bei. So leiden beispielsweise Patienten, die handwerklich beschäftigt waren, viel stärker unter einer Lähmung der Hand als unter Schwerhörigkeit, sind aber letztlich gezwungen, mit dieser Situation konstruktiv umzugehen.
Aus: Gawlik, W.: Der kurze Weg zum homöopathischen Arzneimittel. Sonntag, Stuttgart 1996)
Auf diesem Hintergrund besteht die Gefahr, dass den Patienten sehr viele Medikamente verordnet werden, wobei die Inkompatibilitätsgefahr sehr groß ist.
Hier ist der Hausarzt gefordert: Nur auf der Basis eines Informationsaustausches mit den Kollegen kann er fundiert darüber entscheiden, welche Mittel wirklich unumgänglich sind. Die tägliche Einnahme einer Unzahl von Medikamenten ist den Patienten in der Regel nicht zuträglich und beeinträchtigt das ärztliche Ziel, die Lebensqualität des Patienten zu erhalten bzw. zu steigern.
Therapeutische Konsequenzen
Der so schwierige Bereich der Geriatrie fordert den am Krankenbett und in der Praxis erfahrenen Arzt, seine Erkenntnisse weiterzugeben. Was sind nun Altersleiden? Wie empfindet man das Alter überhaupt und damit auch seine Leiden? Und wie kann man damit fertigwerden? Da ich weit über 70 Jahre alt bin, kann ich diese Fragen aus persönlicher Anschauung und nicht nur im theoretischen Sinn beantworten. Meine Einsichten gründen sich also nicht nur auf die Begleitung von Erkrankung bis zum Tod hin als Hausarzt, sondern auch auf das am eigenen Leib erfahrene Älterwerden.
Wie alle Homöopathie anwendenden Ärzte habe auch ich Schulmedizin studiert und wurde an der Universität zum kritisch denkenden Menschen erzogen. Die auf die Naturwissenschaft fixierte Vorstellung von Wissenschaftlichkeit ist jedoch zu einseitig, unbefriedigend und vielleicht letztlich sogar manchmal als Fehler zu betrachten. Eine Betrachtung des Wortes »Naturwissenschaft« legt dies nahe: Da Glauben nichts mit Wissen zu tun hat, kann Naturwissenschaft absolut unglaub-würdig sein.
Medizinische Wissenschaft ist am besten im Sinne einer Wissenschaft von der Krankheit zu definieren, die ihr zentrales Thema darstellt. Ausgehend von der großen Aufbruchstimmung der Naturwissenschaften im 18./19. Jahrhundert und im Zuge der rasant vorwärtsdrängenden technischen Entwicklung wurde auch auf die naturwissenschaftliche Medizin der Anspruch übertragen, alles sei messbar, wägbar und reproduzierbar; der Mensch stelle einen biologischen Parameter dar. Im Hinblick darauf wurden Standardwerte fixiert. Der vielschichtige Begriff »Maß« wurde in diesem Zusammenhang sehr bedeutsam, allerdings recht eindimensional verstanden – im Gegensatz zu Platon: Er beschreibt ein Maß, das von außen an einen Gegenstand angelegt wird, aber auch in der Sache selber liegt. Die innere Maßhaftigkeit eines sich lebendig erhaltenden Ganzen entspricht nach Vorstellung der alten Griechen als angemessener Zustand der Gesundheit.
Homöopathie. Schon in den Jahren 1942 und 1943 lernte ich während meines Studiums die Naturheilkunde und damit andere Therapiemöglichkeiten als die konventionelle Therapie kennen. Viel später konnte ich feststellen, dass gerade die Homöopathie unendlich viel, wenn auch nicht alle Krankheiten behandeln kann. Von Samuel Hahnemann im Jahre 1796 kreiert, basiert sie auf zwei großen Säulen:
• dem Ähnlichkeitsprinzip und
• der Arzneimittelprüfung am Gesunden.
Diese beiden Prinzipien waren nicht neu, wurden allerdings früher nur theoretisch vertreten und erst von Hahnemann praktisch umgesetzt. Das Ähnlichkeitsprinzip lautet »Similia similibus curentur« und wird von Hahnemann wie folgt definiert: »Wähle, um sanft, schnell, gewiß und dauerhaft zu heilen, in jedem Krankheitsfall eine Arznei, welche ein ähnliches Leiden erregen kann, als sie heilen soll.« Der Arzt hat demnach nach der Ähnlichkeit zwischen der Symptomatik des Patienten und dessen Modalitäten sowie dem Ergebnis der Arzneimittelprüfung und deren Symptomen zu suchen. Es geht darum, die Fähigkeiten jeder Arznei zu beobachten, um zu erkennen, welche krankhaften Symptome und Befindensveränderungen sie beim Gesunden erzeugt. Die Arzneimittelprüfung entspricht der modernen Erforschung der Pharmakodynamik eines Arzneimittels und gibt Auskunft über die sogenannten Modalitäten, die von Wetter, Zeit, Essen und anderen Umständen hervorgerufen werden. Fassen wir alle Arzneimittelprüfungssymptome zusammen, so erhalten wir das Arzneimittelbild eines bestimmten Mittels. Da wir nicht alle Arzneimittelsymptome und Modalitäten lernen können, sind diese in verschiedenen Nachschlagewerken, den sogenannten Repertorien, verzeichnet. Diese sind allerdings nicht vollständig, sondern stellen ein »Vokabularium der Homöopathie« dar, das dem behandelnden Arzt bei der Suche nach dem richtigen Arzneimittel den Weg weisen kann. Bieten sich mehrere Mittel an, muss er die Entscheidung selbst treffen.
Unsere modernen Arzneimittellehren enthalten nicht nur die Ergebnisse der Arzneimittelprüfung, sondern auch die Erkenntnisse der Pharmakologie, das Wissen um die Toxikologie, um die Gewerbe- und die Berufsmedizin und die Beobachtung am Krankenbett seit mehr als sieben Ärztegenerationen.
Die Herstellung homöopathischer Arzneimittel wird entsprechend der Hahnemannschen Vorschriften i. S. einer Potenzierung vorgenommen, da Hahnemann entdeckte, dass ein Kranker auf das ihm ähnliche Arzneimittel besser anspricht, wenn er es in rhythmischer Verdünnung, d. h. potenziert erhält. Dabei wird die Substanz in Dezimal- oder Zentesimal-Verdünnungen, aber auch in LM- oder Q-(Quinquagintamillesimal-)Potenzen gegeben. Die horizontale Motilität reicht bis 10-23.
Die Substanz eines Arzneimittels ist bestimmbar, messbar und berechenbar. Ihr stellte Hahnemann das Wesen des Arzneimittels gegenüber, das wie beim Menschen jenseits des Wägbaren, Fass- und Messbaren angesiedelt ist, auch als »Ekstase« bezeichnet wird und die Lebenskraft repräsentiert (Abb. 1). Als Beispiel sei der tief in der Erde wachsende Bergkristall angeführt: Sein Wesen ist dadurch charakterisiert, dass er sich immer nach der am Tag der Sommersonnenwende im Zenit stehenden Sommersonne ausrichtet. Unabhängig von der Verdünnungsstufe wird das Wesen bei der Potenzierung vertikal immer weiter verstärkt.
Mit der Potenzierbarkeit des Wesens geht die Gefahr der zu hohen Potenzierung des Arzneimittels einher, die den Patienten stark beeinträchtigen kann.
Die Homöopathie wird der spezifischen Reiztherapie zugeordnet. Sie greift histiotrop, organotrop, aber auch personotrop ein und kann damit nicht nur Organe oder Organsysteme beeinflussen, sondern auch das kranke Individuum. Dabei benötigt sie die Mithilfe des Organismus, um therapeutisch wirksam zu werden: Das Arzneimittel vermittelt dem Körper eine Information, worauf bei entsprechender Responsibilität des Organismus oder des Individuums eine Besserung eintreten kann.
Hat das homöopathische Mittel keinen Angriffspunkt mehr, ist also das Individuum nicht mehr in der Lage zu reagieren, wird auch die homöopathische Therapie keinen Erfolg haben. Dieser Ansatz widerspricht der allgemein vertretenen These, der Gegenstand medizinischer Behandlung sei die Krankheit, wobei hier vom Wortsinn auszugehen ist: Gegenstand ist das, was Widerstand leistet. Bei der homöopathischen Behandlung steht jedoch das Individuum, die Persona, die Persönlichkeit im Mittelpunkt aller Anstrengungen: Über die »Bezwingung« dessen, der krank geworden ist, muss man die Krankheit beherrschen.
Abbildung 1: Arzneimittelbild und potenziertes Arzneimittel (nach Hahnemann, Organon, §§ 105-291)
Zusammenfassend sei betont, dass weder naturwissenschaftliche Medizin noch Homöopathie einseitig ausgeübt werden sollten. Stößt die Homöopathie an ihre Grenzen, ist naturwissenschaftlich zu therapieren. Ein guter homöopathischer Arzt studiert sorgfältig die Entwicklungen der naturwissenschaftlichen Medizin, um die eigene Diagnose und Therapie kritisch hinterfragen zu können und behandelt auf der Basis einer klaren klinischen Diagnose im Sinne einer individuell ausgerichteten, optimalen Therapie. Unabdingbare Voraussetzungen hierfür sind
• neben den grundsätzlich erforderlichen medizinischen Kenntnissen ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Homöopathie,
• wiederholte Bearbeitung ihrer Quellen,
• Offenheit und Kritikfähigkeit,
• kritische Betrachtung der Erfolgsmöglichkeiten,
• die Beachtung des ganzen Menschen bei Anamnese und Diagnostik.
Geriatrie und Homöopathie. In über 40-jähriger praktischer Arbeit habe ich sehr viele Erfahrungen insbesondere bei der Behandlung alter Menschen gemacht, die ich weitergeben möchte. Weiterhin veranlasst mich die Tatsache, dass im erweiterten Sinn Nicht-Messbares und Unwägbares Gegenstand der Naturwissenschaft ist, dazu, das etwas eingeengte naturwissenschaftliche Wissen auch im geriatrischen Bereich zu erweitern: Es gilt, neben dem stofflichen Bereich das mit kalibrierbaren Messverfahren und Laborparametern nicht erfassbare Wesen des älteren Menschen verstärkt zu berücksichtigen. Dieses manifestiert sich als eingeschränkte Lebenskraft auf der Basis einer physiologischen Involution, die alle zerebralen Breiche betrifft und retardierte Reaktionen, Vergesslichkeit, verlangsamte Denkfähigkeit, geänderte Modalitäten und geänderten zirkadianen Rhythmus bedeutet. Von großer Bedeutung ist weiterhin die psychologische Revolution in Form einer Abschwächung aller Affekte, der Abschirmung gegen die Gesellschaft und deren Ablehnung. Auch Einsamkeit, Verschrobenheit und Mentalitätsprobleme sind hier wichtige Kriterien.
Das Kranksein alter Menschen sowie chronische Krankheiten sind für die moderne Medizin sowohl im medizinischen als auch im soziologischen und hygienischen Sinn von besonderer Bedeutung. Die Grenzen des technischen Könnens werden hier besonders schmerzhaft aufgezeigt. Bei der Behandlung dieser Kranken sollten wir uns ganz besonders daran erinnern, dass der Patient eine Person ist und nicht nur ein »Fall«. Der Patient muss merken, dass eine Hilfestellung nicht nur routinemäßig durchgeführt wird. Mit anderen Worten: Der Arzt muss handeln, nicht nur be-handeln.
Arzt und Patient sind Partner, wobei der Arzt verpflichtet ist, dem Patienten sein hochspezialisiertes Können zukommen zu lassen. Häufig geht der Arzt mit alten Patienten eher reserviert um, da sie ihm erhebliche narzistische Kränkungen zufügen, wenn sich die Krankheit allen therapeutischen Bemühungen verweigert. Ein ganz wichtiger Aspekt ist hier, den Patienten nicht nur abzuhören, sondern auch in sich hineinzulauschen und damit zu neuen persönlichen Quellen zu stoßen. Gerade im Hinblick auf die in der Homöopathie äußerst wichtige Anamnese, deren adäquate Durchführung essenzielle Voraussetzung für den richtigen therapeutischen Ansatz ist, ist dies von Bedeutung. Ein Hausarzt, der mehrere Generationen einer Familie behandelt, kann familiäre Anlagen erkennen und den älter werdenden Patienten hinsichtlich der Prävention beraten. Körperliche und geistige Aktivität und angemessene Ernährung, d. h. der Verzehr von viel Gemüse und wenig Fleisch, kalt gepressten Pflanzenölen, Milch und Milchprodukten zur Kalziumversorgung, die Aufnahme von viel Flüssigkeit stehen an erster Stelle. Auch der Umgang mit Genussgiften und die Lebensweise sind wichtige Parameter. Auf keinen Fall sollte man ältere Patienten bezüglich ihrer Essensgewohnheiten ausschließlich an Kalorientabellen messen. Ich persönlich habe mindestens sechs Jahre lang viel weniger als 1000 Kalorien pro Tag zu mir genommen und dies gut überlebt. Unsere Nahrung besteht nicht nur aus bestimmten Stoffen, sondern beinhaltet auch eine nicht nach Kalorien zu messende Wesenhaftigkeit. Wichtig ist, Elemente der freien Natur wie Vitamine, Spurenelemente, Mineralien nicht in Tablettenform, sondern durch die Nahrung zuzuführen. Mischkost in maßvollen Portionen bekommt dem alternden Menschen am besten.
Dass bestimmte Krankheiten Änderungen der Nahrungsgewohnheiten erfordern, ist selbstverständlich.
Die Sima-Studie »Selbständigkeit in höherem Lebensalter« weist nach, dass durch ein gezieltes körperliches und geistiges Übungsprogramm Fähigkeiten wie Gedächtnis und physiologische Kompetenz in einem Jahr erheblich gesteigert werden konnten. Als besonders effektiv erwies sich dabei die Kombination von körperlichen mit kognitiven Übungen. Selbst leichte Depressivität oder leichte Formen von Demenz konnten gebessert werden. Nach Beendigung des Trainings gingen diese Effekte wieder verloren.
Es geht darum, bei den älteren Patienten ein Gesundheitsbewusstsein anzubahnen, das die Entwicklung chronischer Krankheiten verzögern, wenn nicht gar verhindern kann. Das darf allerdings nicht dazu führen, dass die älteren Patienten aus Sorge um ihre Gesundheit krank werden. Sie sollten lediglich zum Nachdenken darüber angeregt werden, was zu ihrer Gesundheit beiträgt. Das frühe Erkennen von Risikofaktoren, zu denen Übergewicht, Bewegungsmangel, Alkohol- und Nikotinmissbrauch sowie seelische Probleme zählen, kann lebensrettend sein.
Viele alte Menschen leiden sehr unter dem Nachlassen ihrer Sinnesorgane: Sie riechen, schmecken, sehen und hören schlecht. Die Bedeutung des Tastsinns wird entsprechend größer, und mancher alte Mensch staunt darüber, welche Qualitäten dieser bislang vernachlässigte Sinn erschließen kann. Der Arzt kann darauf hinwirken, dass der Patient sich bemüht, den über die Fühlkörperchen der Haut vermittelten Empfindungen verstärkt nachzuspüren. Wer sein Leben lang mit Augen und Ohren lebte, muss erst lernen »umzufühlen«.
Sehr wichtig ist, Patienten nicht mit Diagnosen allein zu lassen. Ausführliche aufklärende Gespräche über notwendige Maßnahmen sind unabdingbar. Dabei stellt sich meist heraus, ob die somatischen Störungen auf Faktoren wie Einsamkeit, Einschränkung oder Nichtbeachtung beruhen. Es ist ein bedauerliches Phänomen unserer Zeit, dass der alte Mensch erst im Krankheitsfall ein legitimes Anrecht auf eine quasi interessante Umgebung, beispielsweise das Krankenhaus, hat, in der ihm Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet wird. Gesundheit bedeutet dagegen für viele verhasste Isolation in häuslicher Umgebung.
Im Interesse einer guten und angemessenen Behandlung alter Menschen ist nicht nur ein Umdenken in Bezug auf die Wertschätzung des Alters nötig, sondern auch eine Umwertung im Bewusstsein des Arztes, der Krankheit fälschlicherweise als seine ausschließliche Domäne versteht.
Aber auch der Patient muss sein Alter aus einer anderen Perspektive betrachten. Er sollte keine negative Bewertung des Seniums vornehmen, sondern auch diesen Lebensabschnitt als wertvoll erachten, d. h., als Phase der Sinnfindung bei keineswegs verkleinertem, wohl aber verändertem Erwartungshorizont. Dies bedeutet, dass er seine Rolle neu definieren und neu finden muss.
Für einen jungen Arzt oder Pfleger ist es sehr wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass das hohe Lebensalter in vielen Aspekten eine weitaus größere Bandbreite hat als alle anderen Lebensphasen. Deshalb müssen wir das Verhalten alter Menschen kategorisieren, um auf diese Weise eine Technik zu entwickeln, mittels derer man ihnen helfen kann, ihre Würde wiederzugewinnen oder zu erhalten.
Ein besonderes Problem für alte Menschen sowie für ihre Betreuer sind Verwirrtheitszustände, die in der Regel Symptome zerebraler Durchblutungsstörungen darstellen. Um Letztere richtig zu bewerten und damit angemessen therapieren zu können, ist die Überprüfung verschiedener Parameter und eine Zuordnung zu den in Tabelle 3 dargestellten Stadien erforderlich.
Wichtig ist auch, die Gefühle des Patienten anzuerkennen und ihm diese zu bestätigen. Um in die innere Erlebniswelt des alten Menschen einzudringen, braucht man ein gutes Einfühlungsvermögen. Man muss »in den Schuhen des alten Menschen gehen«. Ablehnung verunsichert sehr stark, Vertrauen dagegen schafft Stärke, die das Selbstwertgefühl wiederherstellt und somit Stress verringert.
Ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl ist die wesentliche Voraussetzung für Zufriedenheit und Gesundheit im fortgeschrittenen Lebensstadium, zumal Erfolgserlebnisse ausbleiben, wenn der Patient bereits pensioniert oder »in Rente« ist. Nur so kann man der sozialen Abschiebung im Alter begegnen bzw. ihr entgehen. Krankheit ist hier nur ein Tor, das man auf dem Weg zu einem sich anbahnenden neuen Prozess durchschreiten muss. Der Arzt muss – abseits verbreiteter Klischeevorstellungen – verstehen, dass kranke alte Menschen in ihre Lebensgeschichte eingebettet sind, und versuchen, sein Handeln in diese Individualität einzufädeln. Es geht um eine neue Art der Betrachtung, das amerikanische »Story-Konzept«, das die grobe, gängige Kategorisierung von »gesund«, »krank« oder »behindert« relativiert.
Viele der alten, vereinsamten Menschen ziehen sich nicht mehr in die Vergangenheit zurück, wenn sie in der Gegenwart erfahren, dass sie um ihrer selbst willen geliebt werden.
Die folgenden Hinweise sollen eine Hilfe darstellen für alle, die privat oder beruflich mit alten Menschen zu tun haben:
• Akzeptieren Sie jeden Patienten grundsätzlich, ohne ihn zu beurteilen. Jeder Mensch ist auf seine Weise wertvoll.
• Beachten Sie seine Individualität.
• Gefühle, die ausgedrückt und von einem vertrauten Zuhörer bestätigt werden, werden schwächer, geleugnete Gefühle stärker.
Laut C. G. Jung wird »eine nicht beachtete Katze … zum Tiger«.
• Wenn das Kurzzeitgedächtnis versagt, stellen alte Menschen das Gleichgewicht durch früher gefestigte Erinnerungen wieder her.
• Das Gehirn stellt nicht den einzigen Regulator menschlichen Verhaltens dar.
Schwer orientierungsgestörte alte Menschen zeigen bei der Sektion trotz ihrer funktionellen Störung kaum Veränderungen im Zerebrum.
• Jedes Stadium im Menschenleben hat eine bestimmte Aufgabe. Da der alte Mensch sie nicht mehr allein lösen kann, müssen wir ihm dabei helfen.
Grundsätzlich rate ich, beim Umgang mit alten Menschen übergeifende Zielsetzungen zu verfolgen, um so stringent und effektiv vorgehen zu können, siehe Tabelle 4.
Denken Sie im Übrigen gelegentlich auch daran, dass auch Sie selbst älter werden! In der Erinnerung an meine jungen Jahre wird mir klar, dass ich an meinem damaligen Verhalten gegenüber alten Menschen sehr viel zu korrigieren hätte, weil ich das Altwerden, trotz Studium und Staatsexamen, noch nicht begriffen hatte. Begriffen habe ich es erst, seit ich selbst alt bin und alles, was ich hier niedergeschrieben habe, für mich sichtbar und spürbar wird. Deshalb mein Versuch bei noch vorhandener noetischer Vigilanz der folgenden Generation zumindest einen Anstoß zu geben, sich Gedanken darüber zu machen. Denn, so scheint es mir manchmal, die Zukunftssicht von Huxley (»Schöne neue Welt«) kommt mit ungebremster, vitaler Kraft auf unsere »schöne alte Welt« zu.
In mancherlei Hinsicht ähnelt die Behandlung alter Menschen der von Kindern, was sich aus den Worten der »Lustigen Person« aus Goethes Faust I ableiten lässt:
»Der Jugend, guter Freund, bedarfst du allenfalls,
wenn dich in Schlachten Feinde drängen,
wenn mit Gewalt an deinen Hals
sich allerliebste Mädchen hängen,
wenn fern des schnellen Laufes Kranz
vom schwer erreichten Ziele winket,
wenn nach dem heftigen Wirbeltanz
die Nächte schmausend man vertrinket.
Doch ins bekannte Saitenspiel
mit Mut und Anmut anzugreifen,
nach einem selbstgesteckten Ziel
mit holdem Irren hinzuschweifen,
das, alte Herren, ist eure Pflicht,
und wir verehren euch darum nicht minder.
Das Alter macht nicht kindisch, wie man spricht,
es findet uns nur noch als Kinder.«
Langsame Wiederherstellung des Selbstwertgefühls. Die Umsetzung der in diesen beiden Ausschnitten aus dem »Vorspiel auf dem Theater« enthaltenen Gedanken wird den viel Geduld fordernden Umgang mit alten Menschen erleichtern. Aus der Erfahrung einer jahrzehntelangen Praxis sei hier betont, dass sie auch viel Freude schenken können.
Es gilt jene Kräfte wieder zu beleben, mit denen das Gleichgewicht, das mir und jedem Patienten angemessene, bewahrt und wiedergefunden wird. In meiner Jugend war das Faktum der Wissenschaft diesbezüglich ausschlaggebendes Kriterium und bildete die Basis der sogenannten Erkenntnistheorie. Heute ist klar, dass sich Welt und Dinge verändern und die methodische Wissenschaft sich durch Erkennen ihre Grenzen setzt, diese gleichzeitig aber immer wieder überwinden muss.
Zu detaillierteren Darstellungen der Homöopathie vgl. die Lehrbücher von Dorcsi, Eichelberger, Illing, Köhler, Leeser, Zimmermann.
Übersicht
• In manchen Fällen bessert sich der Zustand alter Menschen nach Absetzen oder Beschränken der Medikamente. Wichtig ist also festzustellen, welche Krankheiten überhaupt behandlungsbedürftig oder -fähig sind. Es geht darum, Nutzen und Risiko gegeneinander abzuwägen und die Inkompatibilitätsgefahr durch die Anwendung möglichst weniger Arneimittel zu verringern. Für die Bewertung einer Krankheit sind nicht nur Laborbefunde ausschlaggebend.
• Der homöopathische Arzt muss sich seiner Rolle als Bezugsperson bewusst sein und die Patienten als Kommunikationspartner ernst nehmen.
• Zuwendung und Interesse von Pflegepersonal, Angehörigen und Arzt helfen dem alternden Menschen, sein Altwerden als natürlichen biologischen Prozess zu akzeptieren.
• Es empfiehlt sich, die somatischen Fähigkeiten und die noetische Vigilanz rechtzeitig und regelmäßig zu trainieren.
• Der Patient ist nur dann zur Gesundung motiviert, wenn er das Gefühl hat, nicht nutzlos zu sein.
• Auch beim älteren Menschen können akute und chronische Erkrankungen mit Homöopathika effizient und risikoarm behandelt werden.
• Einfach nachzuvollziehende Dosierungsschemata begünstigen die Compliance. Am besten ist es, täglich nur ein Medikament zu geben. Keinesfalls sollten mehr als drei Medikamente pro Tag gegeben werden.
• Bestimmte Anwendungsformen fallen dem alternden Patienten schwer. Das Zählen von Tropfen beispielsweise kann schwierig sein.
• Hat ein anderer Arzt schon bestimmte Medikamente verordnet, muss dies bei der Behandlung berücksichtigt werden.
Betreuung und Pflege
Bedeutung der Interaktion
Wichtige Kriterien. Noch nie in der Geschichte sind so viele Menschen so alt geworden wie heute. Die Soziologen prognostizieren ein »Zeitalter der Hochbetagten«. Was muss geschehen, damit sich diese Entwicklung auf Dauer freiheitlich und würdevoll vollziehen kann? Mit technologischen und soziokulturellen Innovationen wird es nicht gehen. Es bedarf vielmehr einer Mobilisierung aller moralischen Potenzen, damit die Gesellschaft ihrer Alten nicht binnen Kurzem in bedrohlichem Ausmaß überdrüssig wird.
Ältere werden in zunehmendem Maße weniger zu Hause von den Angehörigen, sondern in Alten-, Senioren- oder Pflegeheimen oder Alterskrankenhäusern betreut. Der behandelnde Arzt muss die pflegenden Angehörigen sowie Alten- und Krankenpfleger dazu anhalten, die medizinischen Behandlungsmethoden richtig durchzuführen, ihnen vor allen Dingen aber immer wieder die Bedeutung einer – aller Gewohnheit zum Trotz – bleibenden persönlichen Zuwendung vermitteln.
Die positive Wertschätzung der oft abgelehnten alten Menschen, besonders derer, die psychisch gestört erscheinen, ist in den Vordergrund zu stellen. Vorurteil und Gleichgültigkeit müssen abgebaut werden. Das Primat gehört dem Grundsatz, diese alten Mitmenschen so zu behandeln, dass das Leben für sie erträglich und menschlich gestaltet wird.
Betreuung bedeutet nicht nur bewahrende medizinische Pflege, sondern auch menschliche Begegnung sowie Aktivierung und Ermutigung zur Selbsthilfe. Um ihr Leben sinnvoll gestalten zu können, benötigen alternde Menschen Motivation, Erfolgserlebnisse und »Streicheleinheiten«, beispielsweise in Form anerkennender Bemerkungen. Hinfällige alte Menschen sind beispielsweise hocherfreut, wenn man sie lobt, bei Tisch nichts verschüttet zu haben. In der Pflege Ausgebildete sind sich hierüber im Klaren und haben sich eigene Einstellungen bewusst gemacht. Im Laufe ihrer Arbeit lernen sie auch Fehler im Umgang mit alten Menschen erkennen. Hier sei betont, dass der Arzt bei der Arbeit in Senioren- und Pflegeheimen von den Pflegenden viel lernen kann, die mit ihren Fragen wertvolle Anregungen geben.





























