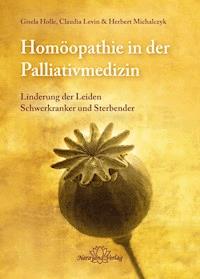
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Dieses Werk ist ein Meilenstein in der ergänzenden homöopathischen Behandlung von Schwerkranken und Sterbenden. Die Heilpraktikerin Gisela Holle und die beiden Ärzte Claudia Levin und Herbert Michalczyk verfügen über langjährige Erfahrung im Hospizdienst und der Palliativmedizin und vermitteln praxisnah und verständlich die wichtigsten Grundlagen dieses immer mehr an Bedeutung gewinnenden Gebiets. Schritt für Schritt werden die Besonderheiten der homöopathischen Therapie in der Palliativmedizin erklärt. So ist die Fallaufnahme oft mehr ein Beobachten als ein Befragen. Der Therapeut muss hier für auffällige Symptome geschult sein. Übersichtlich werden die häufigsten Beschwerden, die bei Sterbenden beobachtet werden, erläutert und die wichtigsten homöopathischen Mittel kurz und übersichtlich differenziert. Dies reicht von Kachexie, Depression und Schlafstörungen über Atemnot, Obstipation und Übelkeit bis zur plagenden Angst und Unruhe. Bewährt hat sich eine überschaubare Anzahl von knapp 20 homöopathischen Arzneimitteln, die in einer ausführlichen Materia medica dargestellt werden. Eindrückliche Fallbeispiele zeigen, wie segensreich der Einsatz der Homöopathie gerade in den letzten Lebensphasen sein kann, oft auch begleitend zur konventionellen Therapie. Hilfreich sind die Hinweise für Angehörige, wie man die Bedürfnisse Sterbender erkennt. Ungewöhnlich sind die mittelspezifischen Pflegetipps. So sollte man bei einem Carbo vegetabilis-Patienten für kühle Raumtemperatur sorgen und ihn mit einem Seidenschal abdecken, ein Tarentula-Patient kann durch rhythmische Musik beruhigt werden. Die Mitbetreuung der Angehörigen ist ebenfalls von großer Bedeutung. Hier werden die zwei wichtigsten Kummermittel besprochen. Abgerundet wird das Werk durch ein übersichtliches Palliativ-Repertorium, das sich auf bewährte Rubriken und die wesentlichsten Mittel beschränkt. Ein Werk für Therapeuten aber auch für Angehörige, die sich über die erstaunlichen Möglichkeiten der Homöopathie in der Palliativmedizin informieren möchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gisela Holle, Claudia Levin & Herbert Michalczyk
Homöopathie in der Palliativmedizin
Linderung der Leiden Schwerkranker und Sterbender
Impressum
Gisela Holle, Claudia Levin & Herbert Michalczyk
Homöopathie in der Palliativmedizin
Linderung der Leiden Schwerkranker und Sterbender
1. Auflage 2016
2. Auflage 2016
ISBN: 978-3-95582-163-0
© 2016 Narayana Verlag GmbH
Coverabbildung: Shutterstock – haraldmuc
Herausgeber: Narayana Verlag,
Blumenplatz 2, 79400 Kandern, Tel.: +49 7626 974970-0
E-Mail: [email protected], Homepage: www.narayana-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Verlags darf kein Teil dieses Buches in irgendeiner Form – mechanisch, elektronisch, fotografisch – reproduziert, vervielfältigt, übersetzt oder gespeichert werden, mit Ausnahme kurzer Passagen für Buchbesprechungen.
Sofern eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet werden, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen (auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind).
Die Empfehlungen dieses Buches wurden von Autor und Verlag nach bestem Wissen erarbeitet und überprüft. Dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Weder der Autor noch der Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.
Samuel Hahnemann (1755-1843) Begründer der Homöopathie, Hahnemanndenkmal 1851 in Leipzig
Inhalt
Geleitwort
Vorwort
1 Homöopathie in der Palliativmedizin
1.1 Hospiz – und Palliativversorgung, Palliativmedizin
1.1.1 Zielsetzung
1.1.2 Entwicklung
1.1.3 Schwerkranke und Sterbende homöopathisch begleiten
1.2 Grundlagen der Homöopathie
1.2.1 Konzept
1.2.2 Gesundheit und Krankheit
1.2.3 Herstellung der homöopathischen Arzneimittel
1.2.4. Homöopathische Fallaufnahme
1.2.5 Repertorisation
1.2.6 Heilungsverlauf
1.3 Besonderheiten der homöopathischen Therapie in der Palliativmedizin
1.3.1 Beobachten statt Befragen
1.3.2 Gemütssymptome
1.3.3 Allgemeinsymptome
1.3.4 Auffallende und sonderliche Symptome
2 Vom Leben und Sterben
2.1 Sterbephasen – Palliativ Care
2.1.1 Rehabilitationsphase
2.1.2 Terminalphase
2.1.3 Finalphase
2.2 Der Sterbeprozess aus der Sicht der Elemente
2.2.1 Äußere Auflösung
2.2.2 Innere Auflösung: Rückzug des Raum-Elements
3 Homöopathie in der letzten Lebensphase
3.1 Wann ist eine homöopathische Begleitung angezeigt?
3.2 Häufige Symptome und Indikationen
3.2.1 Anorexie/Kachexie
3.2.2 Depression
3.2.3 Dyspnoe
3.2.4 Fieber und Infektionen
3.2.5 Obstipation
3.2.6 Diarrhö
3.2.7 Rasselatmung/Husten
3.2.8 Schlafstörungen, Schlaflosigkeit
3.2.9 Schmerzen
3.2.10 Schwäche/Somnolenz
3.2.11 Übelkeit und Erbrechen
3.2.12 Unruhe und Angst
4 Arzneimittelbilder und Fallbeispiele
Aconitum
Antimonium tartaricum
Apis meliffica
Arsenicum album
Arsenicum jodatum
Borax
Cadmium sulfuricum
Carbo vegetabilis
Hyoscyamus niger
Ignatia
Lachesis
Natrium muriaticum
Nux vomica
Okoubaka aubrevillei
Opium
Phosphorus
Secale cornutum
Tarentula cubensis
5 Pflegehinweise und Angehörigenmittel
5.1 Praktische Tipps zur Pflege aus dem Verständnis der Arzneimittelbilder
5.2 Differenzialdiagnosen
5.3 Behandlung von Angehörigen
5.3.1 Homöopathische Mittel für Angehörige
5.3.2 Schockzustände
6 Das Palliativ-Repertorium
6.1 Entwicklung des Repertoriums
6.2 Anwendung des Repertoriums
6.3 Palliativ-Repertorium
7 Lebensqualität erhalten
7.1 Nahrung und Flüssigkeit am Lebensende
7.1.1 PEG: Für und Wider
7.1.2 Wie viel Flüssigkeit braucht der Mensch?
7.2 Wirkungen, Nebenwirkungen und Folgen von Tumortherapien
7.2.1 Übelkeit und Erbrechen
7.2.2 Haut- und Schleimhautveränderungen
7.2.3 Weitere Schädigungen
7.3 Beispiele für gängige Therapieschemata der häufigsten Tumoren
7.3.1 Kleinzelliges Lungenkarzinom
7.3.2 Kolorektales Karzinom
7.3.3 Mammakarzinom
7.3.4 Prostatakarzinom
7.4 Behandlungsziel: Verbesserung der Lebensqualität
7.4.1 Wie kann man erkennen, dass der Sterbende leidet?
7.4.2 Wie können Angehörige in der letzten Lebensphase helfen?
8 Hilfreiche Adressen und Links
8.1 Palliativersorgung
8.1.1 Hospiz- und Palliativversorgung
8.1.2 Patientenverfügung und Betreuungsvollmacht
8.2 Homöopathie
8.2.1 Homöopathische Weiterbildung
8.2.2 Homöopathische Taschenapotheken
8.3 Literatur
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Arzneimittelverzeichnis
Geleitwort
Homöopathie und Palliativmedizin – sind das nicht zwei Richtungen in der Medizin, die sich gegenseitig ausschließen?
Hahnemanns „Ähnliches soll durch Ähnliches geheilt werden“ (similia similibus curentur), scheint im Widerspruch zum Ansatz der Palliativmedizin zu stehen, geht es in der Palliativmedizin doch in erster Linie um die Linderung der für die Patienten meist quälenden Symptome. Von einer Heilung kann aufgrund des häufig weit fortgeschrittenen Erkrankungsstadiums kaum mehr gesprochen werden. Dennoch sehe ich aufgrund meiner Erfahrung für die Homöopathie eine wichtige, ergänzende Rolle zur Allopathie, wie Hahnemann die sogenannte Schulmedizin bezeichnete.
Als ich im Jahresprogramm des Hospizdienstes DaSein auf die Fortbildungsreihe Anwendungsmöglichkeiten der Homöopathie in der Palliativmedizin stieß, war ich eher skeptisch – denn bisher hatte ich die Homöopathie als Medizin der Konstitution gesehen und nicht als Möglichkeit, in akuten Krisen durch homöopathische Mittel Symptome zu behandeln und, wie es in der Palliativmedizin heißt, Symptomkontrolle durchzuführen und damit dem Palliativpatienten unangenehme Begleiterscheinungen seiner Erkrankung bzw. die Therapienebenwirkungen erträglicher zu machen. Diese Möglichkeit machte mich aber auch neugierig.
Schon nach dem ersten Tag der Fortbildung, gepaart mit meinen praktischen Erfahrungen als Palliativmediziner in der SAPV (= spezialisierte ambulante Palliativversorgung), stellte ich fest, dass eine Therapieergänzung mit wenigen, gezielt ausgewählten homöopathischen Mitteln manchmal zu einer sehr überraschenden Wendung in der Symptomatik führen kann. Ich habe auch erlebt, wie bei Menschen mit Skepsis gegenüber einem „Zuviel an chemischen Medikamenten“ die Homöopathie als „Türöffner“ fungiert und Offenheit für beide Ansätze bewirken kann.
Für mich als schulmedizinisch ausgebildeten Palliativ- und Notfallmediziner stellt die Homöopathie nicht nur bei der Symptomkontrolle, sondern auch in Krisensituationen mittlerweile eine zusätzliche Option dar. Vor diesem Hintergrund freue ich mich sehr, dass es jetzt ein Praxisbuch über die Homöopathie in der Palliativmedizin gibt.
Persönlich bin ich überaus dankbar für die Hilfestellungen, die uns die Autoren im Kurs angeboten haben. Während der einjährigen Ausbildung konnten die Teilnehmer die Begeisterung unserer Lehrer für die Homöopathie sehr gut nachvollziehen, und sicher ist dabei auch so mancher Funke übergesprungen. Anhand von konkreten Beispielen für die Leitsymptome wurden uns die Grundlagen der Homöopathie vermittelt und der langjährige Erfahrungsschatz im Einsatz bei Palliativpatienten deutlich gemacht.
Ich würde es als großen Gewinn für unsere Patienten betrachten, wenn die Homöopathie vermehrt und ergänzend in der Symptomkontrolle eingesetzt werden würde.
München, im Januar 2016 Dr. M. Braun
Vorwort
Eine der bemerkenswertesten Veränderungen in der Medizin in den letzten 30 Jahren hat sich wohl in der Begleitung und der Therapie des Menschen am Ende des Lebens vollzogen. Vor über zwanzig Jahren war mir der Umgang mit Schwerkranken und deren Angehörigen Motivation für die Mitwirkung beim Aufbau des ambulanten Hospizdienstes DaSein e.V. in München. Eine kleine Gruppe engagierter Ehrenamtlicher organisierte sich aus einem kleinen Büro heraus für dieses Projekt. Wir begaben uns auf den schmalen Grat, um zwischen schulmedizinischer Versorgung und der Hilfe in häuslichen Situationen, eine menschenwürdige Brücke zu bauen. Kontinuierlich stabilisierte ein Pfeiler nach dem anderen unsere Arbeit. Die homöopathische Begleitung gehörte von Anfang an dazu, wenn sie denn erwünscht oder indiziert war.
Unser Hospizverein, mittlerweile von über 60 ehrenamtlichen Hospizhelfern getragen, wird seit zwei Jahren zusätzlich von einem SAPV-Team gestützt.
Im Herbst 2010 wurde in Harlaching ein Seminar angeboten zum Thema „Homöopathie am Ende des Lebens“, zu dem sich über 200 Teilnehmer anmeldeten. Eine überraschende Resonanz. Aus diesem Seminar heraus entstand ein Arbeitskreis von Palliativmedizinern, Hospizbegleitern und Pflegekräften, die sich über Einsatz und Wirkung von homöopathischen Arzneien bei Schwerkranken und in der Sterbebegleitung austauschten. Die Nachfrage nach Kursen wurde deutlich, und so boten wir 2013 zum ersten Mal in München unter der Leitung von Frau Dr. Elisabeth Geigenberger eine Jahresfortbildung mit dem Thema „Homöopathie in der Palliativmedizin“ an. Leider ist Frau Dr. Geigenberger im August 2013 verstorben. Ihr Wunsch war es, die Essenz dieser Seminare als Buch zu veröffentlichen.
Die Fortbildung umfasste eine Auswahl der meistindizierten und bewährten homöopathischen Arzneimittel und deren Anwendung in Palliativsituationen, mit vielen Fallbeispielen aus unserer Praxis. Unter Supervision kam es schon während des Seminars zu positiven Rückmeldungen der Teilnehmer im Einsatz homöopathischer Mittel am Krankenbett. 2014 wurde dieser Kurs wiederholt.
Dieses Buch möchte den Einsatz der Homöopathie mit einer überschaubaren Auswahl an homöopathischen Mitteln den Therapeuten in der Palliativmedizin zugänglich machen. Es ist ein Leitfaden für die Verschreibung von bewährten Indikationen mit vielen Fallbeispielen, in denen die Homöopathie deutliche Wirkung zeigt. Für ein tieferes Verständnis ist es somit von Bedeutung, die Grundregeln der Homöopathie zu verstehen. Der erste Teil des Buches geht auf die Grundprinzipien wie z. B. das Ähnlichkeitsgesetz und die Anamnesetechnik mit Repertorisation ein.
Wie in der Hebammenpraxis, so gibt es auch beim Sterbeprozess ähnliche Abläufe und Durchgänge, also Akutsituationen, in denen sich bestimmte homöopathische Verschreibungen bewährt haben. Gerade wenn gut gewählte schulmedizinische Medikamente nicht das gewünschte Ergebnis bringen, bzw. sich paradoxe Reaktionen zeigen, kann die Homöopathie eine wunderbare Hilfe sein. Die Wirkung eines homöopathischen Mittels ist meist sehr deutlich und schnell erkennbar, wie in den vielen Fallbeispielen nachzulesen ist.
Die Auswahl der Mittel in der palliativen Situation am Lebensende beschränkt sich auf Arzneien,
• die häufig indiziert sind bei Symptomen in den verschiedenen Sterbephasen
• die als Begleittherapie bei Nebenwirkungen der Chemotherapie zur Anwendung kommen und
• auf Arzneien für die Betreuung von Angehörigen.
Das Buch erhebt nicht den Anspruch, alle Möglichkeiten der homöopathischen Behandlung erfassen zu können, die erfahrenen und geschulten Homöopathen zur Verfügung stehen, sondern soll eher eine Unterstützung sein in der Begleitung. Es kann nicht allen homöopathischen Arzneien gerecht werden, die in der Alltagspraxis und der konstitutionellen Verschreibung der klassischen Medizin angezeigt sind.
Vielleicht wird sich damit eine Tür öffnen zur homöopathischen Wahrnehmung und zur Erkennung des Ähnlichkeitsprinzips.
Frau Dr. Claudia Levin geht aus ihrer 40-jährigen Praxiserfahrung als Haus- und Palliativärztin auf die Nebenwirkungen der Chemotherapie und die begleitende Behandlung mit homöopathischen Mitteln ein. Außerdem gibt sie wertvolle Hinweise über die Nahrung und Flüssigkeitszufuhr am Lebensende.
Herbert Michalczyk arbeitet als leitender Arzt eines SAPV-Teams. Das von ihm erstellte Repertorium ist ein Auszug mit den nur in diesem Buch beschriebenen Arzneien. Dieses Palliativ-Repertorium ist ausschließlich auf der Basis positiv verlaufener Fälle erstellt worden.
Ich wünsche mir für die Sterbenden und ihre Angehörigen, dass jeder Tag Leben für sie einen Sinn erfüllt und es ihnen möglich wird, diesen zu erkennen. Manchmal können wir die Umstände dafür unterstützen. Und dabei werden wir Zeugen, dass alles Tun endlich ist und wir das Loslassen lernen.
München, im Januar 2016 Gisela Holle
1 Homöopathie in der Palliativmedizin
Gisela Holle
1.1 Hospiz – und Palliativversorgung, Palliativmedizin
Der Umgang mit Sterben und Tod ist in der modernen Gesellschaft schwierig geworden. Beides wird meist verdrängt und tabuisiert: Kranke und Sterbende werden häufig in Institutionen unter Ausschluss der Öffentlichkeit betreut. Nur die relativ kleine Gruppe der medizinischen Helfer übernimmt in dieser Phase die Verantwortung für ein humanes Sterben, an dem Familie, Seelsorger, Freunde und Nachbarn oft keinen Anteil mehr haben. Tatsächlich sind Krankenhäuser und Altenheime in unserer Gesellschaft die Orte, an denen die meisten Menschen (etwa 80 %) sterben.
Bei der Palliativpflege und Hospizversorgung handelt es sich entsprechend um die wirksame, ganzheitliche Pflege und Versorgung von Patienten, deren Krankheit nicht mehr kurativ behandelbar ist. An erster Stelle stehen die erfolgreiche Behandlung der Schmerzen und weiterer Symptome sowie die Hilfe bei psychischen, sozialen und seelsorgerischen Problemen. Das Ziel der Palliativpflege ist es, die bestmögliche Lebensqualität für Patienten und deren Familien zu erreichen (Definition der WHO).
Laut WHO 2002 handelt es sich bei der (Palliative Care) um einen Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren Familien, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung konfrontiert sind. Dies geschieht durch Vorbeugung und Linderung des Leidens mittels frühzeitiger Erkennung und korrekter Beurteilung der Behandlung von Schmerzen und anderen Beschwerden körperlicher, psychologischer und spiritueller Art. Das Angebot umfasst die Symptomkontrolle und Rehabilitation, die Betreuung in der Terminalphase, die Beratung und Unterstützung der Familie, die Betreuung zu Hause, im Tageshospiz oder im stationären Bereich sowie die Begleitung in der Trauerphase durch das multiprofessionelle Team.
1.1.1 Zielsetzung
Mit dem Grundsatz „Nicht dem Leben mehr Tage hinzufügen, sondern den Tagen mehr Leben geben.“ ist das Ziel der Palliativmedizin klar umrissen. Von der Begründerin der Palliativmedizin, Cicely Saunders, formuliert, geht es darum, für mehr Lebensqualität Sorge zu tragen, statt die Lebensquantität zu vermehren. Im Mittelpunkt steht der kranke Mensch, seine Angehörigen und Nahestehenden, um seine individuellen Wünsche und Bedürfnisse geht es. Um diesen umfassend Rechnung zu tragen, müssen in jedem Einzelfall die körperlichen, psychischen, sozialen und spirituellen Dimensionen gleichermaßen berücksichtigt werden. Das erfordert multiprofessionelles, sektorenübergreifendes Handeln, eine intensive Kommunikation aller an der Betreuung beteiligten Haupt- und Ehrenamtlichen sowie die partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Folgende Grundsätze kennzeichnen die Hospiz- und Palliativversorgung und die Palliativmedizin:
• Behandlung des Patienten in der Umgebung seiner Wahl (ambulant, stationär, zu Hause, Pflegeheim etc.)
• Beachtung der physischen, psychischen, sozialen und seelsorgerlichen Bedürfnisse von Patient, Angehörigen und Behandlungsteam
• Individuelle Behandlung jedes Patienten im multidisziplinären Team rund um die Uhr
• Offenheit und Wahrhaftigkeit als Grundlage des Vertrauensverhältnisses unter allen Beteiligten
• Symptomkontrolle (Schmerzen und andere Symptome) durch den Spezialisten (intensive medizinische Betreuung)
• Fachliche Pflege durch speziell geschulte Pflegekräfte
• Integration von Ehrenamtlichen
• Zentrale Koordination des Teams
• Kontinuierliche Betreuung (24-h-Bereitschaft) des Patienten und seiner Angehörigen bis zum Tod bzw. in der Trauerzeit
• Bejahung des Lebens. Akzeptanz von Sterben und Tod als Teil des Lebens. Der Tod wird weder beschleunigt noch hinausgezögert. Aktive Sterbehilfe wird strikt abgelehnt
• Forschung, Dokumentation und Auswertung der Behandlungsergebnisse
1.1.2 Entwicklung
Die Sorge für Kranke, Schwache und Alte ist ein Zeichen sozialer Strukturen in einer Gesellschaft. Erste Orte der Pflege finden sich in den byzantinischen und frühchristlichen „Xenodochien“ (Herbergen). Im Römischen Reich werden diese „Gasthäuser“ hospitium genannt. Im Mittelalter während der Kreuzzüge entstehen viele dieser Hospize als Gast- und Rasthäuser („Hotel“) entlang der Pilgerwege. Dort werden müde, kranke und alte Wandernde gepflegt, oft auch bis zum Tod. Erste Hospize speziell für die Pflege Schwerkranker und Sterbender („Hospital“) entstehen im 18. Jahrhundert in Dublin (Irland) und Lyon (Frankreich). Von dort verbreitet sich die Idee in mehrere europäische Länder.
Die Entwicklung der modernen Hospizarbeit und Palliativmedizin geht von England aus, wo Cicely Saunders 1967 mit dem St. Christophers Hospice das erste stationäre Hospiz gründete. Dort werden Schwerkranke und Sterbende bis zum Tod betreut. Die erste Palliativstation entstand 1975 am Royal Victoria Hospital in Montreal (Kanada). Die Idee wurde vom St. Christophers Hospice übernommen, aus sprachlichen Gründen (französisch) jedoch der neue Begriff „palliativ“ eingeführt.
Mit der Gründung des ersten Hospizes 1967 von Cicely Saunders in London, begann sich das Tabuthema „Sterben“ langsam als ein würdiger Bestandteil des Lebens in das öffentliche Bewusstsein einzugliedern. Die Hospizbewegung öffnete sich der Zuwendung von Sterbenden und deren Angehörigen gleichermaßen. Es veränderten sich abstrakte Therapiekonzepte oder Krankheitsvorstellungen. Sterben wird nicht ausschließlich als Krankheit definiert, eher als Lebenskrise mit Erkrankungen, die von unterschiedlichen Therapeuten begleitet wird. Der Einsatz der ehrenamtlichen Hospizbegleiter bis zur medizinischen Palliativversorgung bildet heute ein Netzwerk, interdisziplinäre Teams arbeiten ambulant und stationär Hand in Hand. Patient und Symptom stehen zwar im Mittelpunkt, die Unterstützung des sozialen Umfeldes wird jedoch ebenso in die Begleitung einbezogen: Insbesondere in der Form von Entlastung der Angehörigen mit Zuwendung, Gesprächen und ausreichend Zeit für die Anwesenheit am Krankenbett.
1.1.3 Schwerkranke und Sterbende homöopathisch begleiten
In der Endphase der meisten Erkrankungen fehlen spezifische, auf die Grundkrankheit gerichtete Therapiemaßnahmen oder sie sind ausgeschöpft. Entscheidend ist eine Symptomkontrolle entsprechend dem Ausmaß der Beschwerden mit einer möglichst hohen Lebensqualität bis zum Tod. Die klassischen Ziele der Palliativmedizin mit umfassender Sorge um die körperlichen, psychischen, sozialen und geistlichen Bedürfnisse der Patienten, unter Wahrung ihrer größtmöglichen Selbstbestimmung, sind daher am Ende fast aller Erkrankungen maßgebend. So können exemplarisch „terminale Syndrome“ häufiger Grunderkrankungen betrachtet werden, die jeweils den gleichen Palliativansatz und ähnliche Zielvorgaben aufweisen. Hierbei wird die palliativmedizinische Denkweise deutlich.
Diese Rückbesinnung zum ganzheitlichen Ansatz von Behandlung war in der Homöopathie von jeher ein selbstverständlicher Ansatz von Heilverständnis. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Homöopathie in der Palliativmedizin ihren festen Platz findet.
Wie auch in anderen Bereichen der Medizin geht es nicht um das Entweder-Oder, sondern um die Ergänzung der Möglichkeiten bei der Linderung von Leiden. Oft stoßen gut gewählte Palliativ- und Schmerztherapeutika an ihre Grenzen, Patienten reagieren gegenteilig, die Nebenwirkungen sind nicht mehr tragbar. Hier bietet die Homöopathie mit ihrem individualisierten Vorgehen eine ernstzunehmende Option in der Begleitung Schwerkranker und Sterbender.
1.2 Grundlagen der Homöopathie
Begründet wurde die Homöopathie von dem Arzt, Apotheker und Chemiker Samuel Hahnemann (1755-1843), der den damaligen Behandlungsmethoden – Aderlass, Schröpfen, Verabreichung toxischer Substanzen – äußerst kritisch gegenüberstand. Er gab zunächst seine praktische Tätigkeit auf, da er – wie er einem Freund mitteilte – nicht länger nach dieser oder jener Krankheitshypothese Substanzen verabreichen wollte, die ihren Platz in der Materia medica (Arzneimittellehre) einer willkürlichen Entscheidung verdankten. Samuel Hahnemann hatte bereits 13 Jahre als Arzt, Pharmazeut, Chemiker und Übersetzer medizinischer Literatur gearbeitet, als er während der Übersetzung von Cullens Arzneimittellehre seinen legendären Versuch mit der Chinarinde durchführte. Hahnemann entwickelte als gesunder Mensch Fiebersymptome, wie er sie von Malariakranken kannte, die eben durch die Chinarinde geheilt wurden. Zahlreiche andere Selbstversuche an sich, seinen Familienmitgliedern und Freunden folgten, und sechs Jahre später formulierte er das Ähnlichkeitsgesetz „Similia similibus curentur“ (Ähnliches werde durch Ähnliches geheilt). 1810 erschien sein Hauptwerk, das „Organon der rationellen Heilkunde“, in dem Hahnemann in 294 Paragraphen die Grundsätze und Gesetzmäßigkeiten der Homöopathie formulierte. Die letzte (6.) Auflage, das „Organon der Heilkunst“, in dem Hahnemann 1842 seine durch die praktische Tätigkeit veränderten Einsichten beschrieb, wurde erst 1921 veröffentlicht.
1.2.1 Konzept
Die klassische Homöopathie beruht auf drei Grundprinzipien: Dem Ähnlichkeitsgesetz, der Arzneimittelprüfung und der Potenzierung.
Ähnlichkeitsgesetz und Arzneimittelprüfung
Das Ähnlichkeitsprinzip „Similia similibus curentur“ („Ähnliches werde durch Ähnliches geheilt“) stellt fest, dass Krankheiten durch homöopathische Medikamente geheilt werden, die bei einem Gesunden ähnliche Symptome hervorrufen, wie sie bei dem Kranken auftreten.
„Jedes wirksame Arzneimittel erregt im menschlichen Körper eine Art von eigner Krankheit, eine desto eigenthümlichere, ausgezeichnetere und heftigere Krankheit, je wirksamer die Arznei ist. Man ahme der Natur nach, welche zuweilen eine chronische Krankheit durch eine andre hinzukommende heilt und wende in der zu heilenden (vorzüglich chronischen) Krankheit dasjenige Arzneimittel an, welches eine andre, möglichst ähnliche, künstliche Krankheit zu erregen im Stande ist und jene wird geheilet werden; Similia similibus.“
Entsprechend dem Ähnlichkeitsgesetz ist also nur derjenige Arzneistoff in der Lage, einen kranken Menschen zu heilen, dessen Arzneimittelbild dem Symptomenbild ähnlich ist, das ein erkrankter Mensch hervorbringt.
Das Ähnlichkeitsgesetz ist untrennbar mit der Arzneimittelprüfung am gesunden Menschen verbunden, denn nur so kann Wissen über die Wirkung eines Arzneistoffes gewonnen werden. Am Beispiel der Küchenzwiebel (Allium cepa) lässt sich das Ähnlichkeitsgesetz nachvollziehen: Es entstehen beim Gesunden durch das Schneiden der Küchenzwiebel folgende Symptome: Starke Flüssigkeitsabsonderung aus Augen und Nase, Augenjucken oder -brennen, Kitzeln der Nase, Niesreiz. Dementsprechend wird Allium cepa auch als Schnupfenmittel eingesetzt.
1790 unternahm Samuel Hahnemann seine erste dokumentierte Arzneimittelprüfung, den Chinarindenversuch, und erkannte die Ähnlichkeitsregel. Dies gilt als Geburtsstunde der Homöopathie. In der damaligen Zeit kannte man die heilende Wirkung der Chinarinde bei Wechselfieber und man nahm an, sie entfalte ihre Heilkraft durch Stärkung des Magens. Hahnemann nahm nun als gesunder Mensch Chinarinde ein und schildert seinen Selbstversuch wie folgt:
„Ich nahm des Versuchs halber etliche Tage zweimahl täglich jedesmahl vier Quentchen gute China ein; die Füße, die Fingerspitzen u.s.w. wurden mir erst kalt, ich ward matt und schläfrig, dann fing mir das Herz an zu klopfen, mein Puls ward hart und geschwind; eine unleidliche Aengstlichkeit, ein Zittern (aber ohne Schauder), eine Abgeschlagenheit durch alle Glieder; dann Klopfen im Kopfe, Röthe der Wangen, Durst, kurz alle mir sonst beim Wechselfieber gewöhnlichen Symptome erschienen nach einander; doch ohne eigentlichen Fieberschauder. Mit kurzem: auch die mir bei Wechselfiebern gewöhnlichen besonders charakteristischen Symptomen, die Stumpfheit der Sinne, die Art von Steifigkeit in allen Gelenken, besonders aber die taube widrige Empfindung, welche in dem Periostium über allen Knochen des ganzen Körpers ihren Sitz zu haben scheint, – alle erschienen. Dieser Paroxysm dauerte zwei bis drei Stunden jedes mahl, und erneuerte sich, wenn ich diese Gabe wiederholte, sonst nicht. Ich hörte auf, und ich war gesund.“
„Jedes wirksame Arzneimittel erregt im menschlichen Körper eine Art von eigner Krankheit, eine desto eigentümlichere, ausgezeichnetere und heftigere Krankheit, je wirksamer die Arznei ist. Man ahme der Natur nach, welche zuweilen eine chronische Krankheit durch eine andre hinzukommende heilt, und wende in der zu heilenden (vorzüglich chronischen) Krankheit dasjenige Arzneimittel an, welches eine andre, möglichst ähnliche, künstliche Krankheit zu erregen im Stande ist, und jene wird geheilt werden; Simila similibus curentur.“
Die auf dem Ähnlichkeitsgesetz basierende Heilkunst nannte Hahnemann Homöopathie, als Allopathie bezeichnete er die Therapieverfahren, die entsprechend dem Gegensatzprinzip (contraria contraris), Symptome mit Gegenmitteln, d. h. Fieber mit fiebersenkenden Mitteln, rheumatische Beschwerden mit Antirheumatika behandeln.
Am Beispiel des Arzneimittels Arsenicum album (weißes Arsenik) soll das Ähnlichkeitsgesetz dargestellt werden.
Arsen war im Altertum das klassische Gift der Giftmörder. Deshalb ist seine akut toxische Wirkung bestens bekannt. Es wurde der Nahrung untergemischt und führte über einen choleraähnlichen Zusammenbruch zum Tode. Symptome der Vergiftung sind Durst, Trockenheit und heftiges Brennen der Schleimhäute, starker Speichelfluss, Erbrechen von Galle und blutigem Schleim, heftige wässrig-blutige Durchfälle und Darmkrämpfe. Zudem bestehen folgende Symptome: Übergang in eine zyanotische Gesichtsfarbe und Eiseskälte der Extremitäten. Empfinden von Enge im Brustbereich mit brennenden, reißenden Schmerzen. Erschwerte Atmung löst Unruhe und panische Todesangst aus. Puls schwach und fadenförmig, tachykard bis zum Kreislaufkollaps. „Er ist kalt, friert und weint und glaubt verzweifelt, es könne ihm nichts helfen und er müsse doch sterben; hierauf allgemeine Mattigkeit“. (Samuel Hahnemann, Reine Arzneimittellehre)
Für eine Verschreibung bei Schwäche und Unruhe, die oft in terminalen Phasen auftreten, gibt es verschiedene homöopathische Mittel, die aber nur dann ihre Wirkung entfalten können, wenn sie exakt auf die Symptome des Erkrankten passen: Similia similibus curentur (Ähnliches werde mit Ähnlichem geheilt)
Arsenicum album ist eines der am häufigsten gebrauchten Finalmittel der Homöopathie. Viele Patienten zeigen exakt die Symptome dieser Vergiftungserscheinung. Besonders die starke Unruhe, die panischen Ängste, die Schwäche, die erschwerte Atmung und das Kälteempfinden sprechen für die Verschreibung von Arsenicum album.
Potenzierung
Neben dem Ähnlichkeitsgesetz und der Arzneimittelprüfung ist die Potenzierung die dritte Säule der Homöopathie. Hahnemann hatte beobachtet, dass sich bei den damals üblichen Arzneidosierungen die Symptome beträchtlich verschlimmerten oder sogar toxische Nebenwirkungen auftraten. Er begann die Arznei schrittweise zu verdünnen und verschüttelte sie auf jeder Verdünnungsstufe sehr stark. Diese dynamisierte oder „potenzierte“ Arznei hatte eine deutlich stärkere Wirkung. Gleichzeitig konnten durch den Prozess der Potenzierung Vergiftungserscheinungen verringert werden.
Die Potenzierung homöopathischer Arzneimittel erfolgt nach festgelegten Regeln, die durch folgende Nomenklatur gekennzeichnet wird: Der Buchstabe zeigt an, in welchem Verhältnis das Arzneimittel verdünnt wurde. So wird bei den D-Potenzen (Dezimalpotenzen) im Verhältnis 1:10, bei den C-Potenzen (Centesimal-Potenzen) im Verhältnis 1:100, bei den LM- bzw. Q-Potenzen (Quinquagiesmillesima-Potenzen) im Verhältnis 1:50.000 verdünnt. Die Anzahl der Potenzierungsschritte wird durch die hinter dem Buchstaben stehende Zahl angegeben. Dementsprechend wurde bei einer C 30-Potenz 30-mal hintereinander im Verhältnis 1:100 verdünnt und genauso häufig verschüttelt. Die für die Verdünnung notwendigen Schüttelschläge sollten am besten auf dem Handballen oder auf ein ledergebundenes Buch erfolgen. Im Homöopathischen Arzneibuch sind die Richtlinien zur Herstellung homöopathischer Arzneimittel genau festgelegt.
1.2.2 Gesundheit und Krankheit
Hahnemann führte den Begriff der Lebenskraft neu ein und definierte Gesundheit wie folgt:
„Im gesunden Zustande des Menschen waltet die geistartige, den materiellen Körper belebende Lebenskraft unumschränkt und hält alle seine Theile in bewundernswürdig harmonischem Lebensgange in Gefühlen und Thätigkeiten, sodass unser inwohnende, vernünftige Geist sich dieses lebendigen, gesunden Werkzeugs frei zu höheren Zwecke unseres Daseins bedienen kann.“
Somit wird jedes Organ und jede Zelle von der immateriellen, geistartigen Lebenskraft beeinflusst. Sie ist dem Organismus übergeordnet und steuert alle Lebensfunktionen. Sobald die Lebenskraft geschwächt oder z. B. durch Überbelastung, Stress, psychische Probleme ins Ungleichgewicht gebracht wird, ist der Organismus vor krankmachenden Einflüssen (z. B. Bakterien, Viren, Pilzen, Pollen) nicht mehr geschützt. Jeder Krankheit liegt nach Hahnemann eine Verstimmung der Lebenskraft zugrunde. Georgos Vithoulkas, an der weltweiten Verbreitung der klassischen Homöopathie maßgeblich beteiligt (alternativer Nobelpreis 1996), sieht die Kreativität des Menschen als wesentliches Kriterium für Gesundheit. Er definiert Gesundheit als Freiheit von Schmerz, Leidenschaft und Selbstsucht und bezieht in seine Definition die körperliche, emotionale und geistige Ebene des Menschen ein.
1.2.3 Herstellung der homöopathischen Arzneimittel
Nach dem Gesetz von Avogadro lassen sich bis zu einer Verdünnung von D 23 (Loschmidt-Zahl) noch Moleküle nachweisen. Somit sind in einer D 24 oder C 12 eines potenzierten Arzneimittels und insbesondere bei den als Konstitutionsmittel eingesetzten Potenzen (z. B. C 30 und C 200) keine Moleküle der Ausgangssubstanz mehr zu finden. Konstitutionelle Mittel wirken also nicht auf der stofflichen Ebene. Man geht davon aus, dass durch den Potenzierungsvorgang Informationen der Ausgangssubstanz auf die Trägersubstanz (Wasser, Alkohol, Milchzucker) übertragen werden. Durch die passende Information, die im richtig gewählten Arzneimittel enthalten ist, wird im Organismus des Patienten der Reiz zur Selbstheilung gesetzt.
Das Homöopathische Arzneibuch umfasst heutzutage über 2.000 pflanzliche, tierische und mineralische Substanzen, und es werden immer neue Stoffe (z. B. Schokolade, Diamant, Wasserstoff) geprüft. Wird das homöopathische Mittel aus Pflanzen (z. B. Bryonia – Wurzelstock der Zaunrübe, Pulsatilla – Blüten der Küchenschelle) oder Giftstoffen von Tieren (z. B. Lachesis – Gift der Buschmeisterschlange) gewonnen, wird eine Urtinktur hergestellt. Diese besteht zu gleichen Teilen aus der flüssigen Arzneisubstanz und hochprozentigem Alkohol. Ist die Ausgangssubstanz nicht in Alkohol löslich (z. B. Metalle, Säuren) wird sie bis zu ihrer Löslichkeit mit Milchzucker verrieben. Ab der Potenz C 3 bzw. D 6 ist jeder Stoff in Alkohol löslich.
Eingesetzt werden auch aus kranken Geweben und Körpersekreten homöopathisch aufbereitete Mittel, die als Nosoden bezeichnet werden. So wird z. B. Psorinum aus dem Inhalt eines Krätzebläschens hergestellt oder Tuberkulinum aus Auswurf aufbereitet, der Tuberkelbazillen enthält. Nosoden werden eingesetzt, um Therapieblockaden zu lösen, und erfordern genaue Kenntnisse der Miasmenlehre von Hahnemann und deren Weiterentwicklung. Mit Miasma (griech. Makel, Befleckung) bezeichnete Hahnemann drei Arten der Störung der Lebenskraft (Psora, Sykose und Syphilis). Ein Miasma kann erworben werden (z. B. allopathische Behandlung) oder anlagebedingt vorhanden sein.
1.2.4. Homöopathische Fallaufnahme
Die Homöopathie ist eine ganzheitliche Heilmethode, bei der sowohl die körperlichen als auch die emotionalen und geistigen Symptome des Patienten in die Behandlung miteinbezogen werden. Krankheit und Gesundheit sind individuelle Geschehen und bei jedem Menschen anders.
„Es gibt keine psychosomatischen Krankheiten, so wie es keine rein körperlichen Leiden gibt. Bei jedem menschlichen Leiden, vom Schnupfen bis zum Krebs, greifen Körperliches, Seelisches und Soziales auf unlösbare, oft auch unschaubare Weise ineinander.“ Thure von Uexküll
Der Homöopath behandelt nicht eine bestimmte Krankheit, sondern den Kranken mit seinem ganz individuellen Beschwerdebild. Der Mensch ist eine Einheit aus Körper, Geist und Seele. Die „Lebenskraft“ besitzt die Fähigkeit zur Eigenregulation und erhält das harmonische Gleichgewicht im Organismus, daher ist Krankheit eine akute oder chronische Verstimmung der „Lebenskraft“. Die Symptome sind nicht die Krankheit selbst, sondern, laut Hahnemann, Ausdruck der verstimmten „Lebenskraft“ und ihr Versuch, das Gleichgewicht wiederherzustellen.
Eine homöopathische Anamnese verlangt von dem behandelnden Homöopathen großes Einfühlungsvermögen und äußerste Sorgfalt, um entsprechend der Ähnlichkeitsregel das zur Symptomatik am besten passende Arzneimittel zu bestimmen. Die Erstanamnese kann bei chronischen Erkrankungen eins bis zwei Stunden dauern.
Jede gute Anamnese ist eine Kunst, ähnlich wie ein Portrait, das ein Künstler zeichnet. Je detaillierter das Portrait gelingt, desto mehr ähnelt es der dargestellten Person. Je besser die Anamnese gelingt, desto klarer wird das Bild, das wir vom Patienten erhalten und desto leichter kann ein geeignetes Arzneimittelbild gefunden werden.
Die Anamnese, das Herzstück der Behandlung, erfordert vorurteilslose Aufmerksamkeit, innere Ruhe und eine gute Beobachtungsgabe. Nach dem freien Spontanbericht des Patienten werden die Symptome, d. h. die Hauptbeschwerden, Allgemeinsymptome (z. B. Ernährung, Temperaturempfinden, Reaktion auf Wettereinflüsse, Schlaf, Tageszeiten) sowie Geistes- und Gemütssymptome (z. B. Gedächtnis, Konzentration, Ängste, Charaktereigenschaften) weiter aufgenommen und in die Auswertung des Falls und die Hierarchisierung der Symptome einbezogen. Die für eine Arznei besonders auffälligen und wichtigen Angaben, die das Mittel charakterisieren, werden als Leitsymptome bezeichnet.
In Akutsituationen, in denen sich auch meist die Palliativpatienten befinden, sind die geschulten Beobachtungen des Homöopathen und dessen Sinne besonders wichtig.
Spontanbericht
Zu Beginn des Gespräches lassen Sie den Patienten die augenblicklichen Probleme berichten. Falls das





























